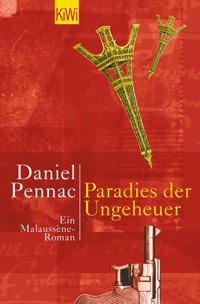9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Benjamin Malaussène Reihe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Als Verlagslektor und Sündenbock vom Dienst in den Editions Tallion hat Benjamin Malaussène schon immer gefährlich gelebt, wenn sich die Enttäuschung abgelehnter Möchtegern-Dichter bei ihm entlud. Doch nun kommt es noch schlimmer. Im Auftrag der strengen Verlegerin Reine Zabo muss er in die Rolle des unglaublich erfolgreichen Bestsellerautors J.L.B.schlüpfen, der inkognito bleiben möchte und öffentliche Auftritte scheut. So gibt Benjamin als Double professionell Interviews und erträgt sein Bild als J.L.B. auf Postern in der Stadt. Große Sorgen bereitet ihm zudem seine Lieblingsschwester Clara. Sie ist am Morgen ihrer Hochzeit mit einem Mann, der ihr Großvater hätte sein können, durch einen hinterhältigen Mord vorzeitig Witwe geworden. Und dann wird auch Benjamin während einer Lesung von einer Kugel getroffen. Zufall oder Zusammenhang? Bücher und Autoren, Korruption und Hass, Liebe und Tod, eine kräftige Prise Belleville und natürlich viel Aufregendes von den Malaussènes – Sündenbock im Bücherdschungel ist ein wunderbar spannender Roman von Daniel Pennac.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 431
Ähnliche
Daniel Pennac
Sündenbock im Bücherdschungel
Ein Malaussène-Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Inhaltsverzeichnis
Über Daniel Pennac
Über dieses Buch
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
Inhaltsverzeichnis
büßt hauptberuflich für nicht von ihm begangene Sünden, ist aber außerdem der umtriebige Vater eines ganzen Haufens nicht von ihm gezeugter Kinder
Julieseine löwenmähnige Schönste und Liebste, eine junge Journalistin, die es wissen will
Julius der HundBenjamins treuer Gefährte, von epileptischen Anfällen bedroht und eine Bedrohung für empfindliche Nasen
Lounadie außerhäusig verheiratete große Schwester
Thérèsedie nach den Sternen sehende Schwester, die Benjamins Zukunft bereits auf dem Lager hat
Jérémyder Tunichtgut im Hause Malaussène, dessen Treiben am Ende oftmals guttut
Le Petitder kleine Junge mit rosa Brille, der in Wahrheit albtraumsichtig ist
Verdundie jüngste Schwester, deren Seele kein Kurort ist, wovon sie lautstark Kunde gibt
C’est un Angeein Neuankömmling auf dieser Welt und Kind von
Clarader Lieblingsschwester von Benjamin, die auch das Schlimmste fotografiert und beinah die Frau wird von
Clarence de Saint-Hiverdem musisch-progressiven Gefängnisdirektor, der allzu früh als Ehemann ausfällt
Mamandie große, meist unsichtbare Mutter des Stamms der Malaussènes: in unaufschiebbaren Liebesdingen unterwegs
Van Thiandie franko-asiatische Ersatzmutter von Verdun und Kriminalinspektor mit großer Treffsicherheit
Carregawortkarger Inspektor mit Sympathien für Benjamin und präzisen Schrittlängen
Commissaire divisionaire Coudrierweiß als himmlischer Ordnungshüter mehr über Benjamin als dieser selbst
die Reine Zabodie Chefin Benjamins, eine Verlagsleiterin wie sie im Buche steht
Loussa de Casamanceder Senegalese mit den grünen Augen, großer Kenner chinesischer Literatur
Chabotteder Ex-Justizminister mit schriftstellerischen Neigungen
Mme Nazaré Quissapaolo Chabotteseine steinalte Mutter, die manches über ihn weiß
Alexandre Krämerder Schriftsteller mit mörderischen Neigungen
Amarder Inhaber eines Restaurants, wo alles zusammentrifft: Minztee und Couscous, Hammel am Spieß, der Stamm der Malaussènes
YasminaAmars Frau und Zweitmutter aller Malaussènes
Mo der Mossi Simon der Kabyle Hadouch Ben Tayeb Nourdinealle miteinander hilfreiche Freunde, die, wenn es drunter und drüber geht, erst so recht zum Leben erwachen
Inhaltsverzeichnis
Für Didier Lamaison
In Erinnerung an John Kennedy Toole,
der starb, weil er nicht gelesen wurde,
und an Wassili Grossman,
der starb, weil er gelesen wurde.
Inhaltsverzeichnis
Der Autor dankt Paul Germain, Béatrice Bouvier und Richard Villet, die ihn durch das Dickicht der Buchkunst, die Partitur des Pinyin-Chinesisc und die Abgründe der Chirurgie geleitet haben.
Inhaltsverzeichnis
»Ich ist ein Anderer, aber das ist nicht von mir.«
Christian Mounier
Inhaltsverzeichnis
IDer Stuhl des Sündenbocks
Sie haben ein seltenes Laster, Malaussène: Sie leiden mit dem anderen mit.
1
Alles fing an mit einem Satz, der mir durch den Kopf ging: »Der Tod ist ein geradliniger Prozess.« Diese Art von ätzender Feststellung, die man eher im Englischen erwartet: »Death is a straight on process …« oder so ähnlich.
Ich fragte mich gerade, wo ich diesen Satz gelesen hatte, als plötzlich der Riese in mein Büro stürmte. Noch ehe die Tür hinter ihm zudonnerte, beugte er sich zu mir herab:
»Malaussène, sind Sie das?«
Ein riesiges Gerippe, um das man ansatzweise einen Körper modelliert hatte. Knochen wie Keulen und die Haare ein Dickicht, das unmittelbar über der Nase zu wuchern begann.
»Sind Sie das, Benjamin Malaussène?«
Wie ein gespannter Bogen meinen Schreibtisch überwölbend, hielt er mich zwischen den Armlehnen meines Stuhls gefangen, die er mit eiserner Pranke umklammerte. Die verkörperte Urgeschichte. Ich zog den Kopf zwischen die Schultern, presste mich gegen die Rückenlehne und war außerstande zu sagen, ob ich ich war. Ich fragte mich nur eines: wo ich diesen Satz »Der Tod ist ein geradliniger Prozess« gelesen hatte, ob ich ihn aus dem Englischen oder dem Französischen hatte oder aus einer Übersetzung …
Da beschloss der Kerl, uns auf Augenhöhe zu bringen: Mit einem Hüftschwung riss er uns, meinen Bürostuhl und mich, vom Boden hoch und setzte uns vor sich auf meinem Schreibtisch ab. Aber selbst in dieser Position dominierte er die Lage um eine gute Kopfeslänge. Durchs Gestrüpp der Brauen hindurch sondierte ein Eberblick mein Gewissen, als habe er dort sein Latein verloren.
»Macht Ihnen wohl Spaß, Leute zu quälen?«
Er hatte eine sonderbar kindliche Stimme, mit einem Unterton von Schmerz, der Furcht einflößend sein wollte.
»Ja?«
Und ich da oben auf meinem Thron war unterdessen außerstande, an etwas anderes als an diesen verdammten Satz zu denken. Der nicht mal gut klang. Läppischer Schund. Vielleicht ein Franzose, der einen auf Ami machen will. Wo habe ich ihn bloß gelesen?
»Haben Sie nie Angst, dass Ihnen mal jemand die Fresse poliert?«
Seine Arme zitterten jetzt. Sie übertrugen eine tiefe Schwingung auf meinen Stuhl, die von seinem ganzen Körper ausging, Typus Erdbeben ankündigendes Trommelgrollen.
Es war das Telefon, das die Katastrophe auslöste. Es klingelte. Die hübschen plätschernden Modulationen der heutigen Telefone, Speichertelefone, Programmiertelefone, Distinktionstelefone, Direktionstelefone für jedermann …
Das Telefon zerbarst unter der Faust des Riesen:
»Schnauze!«
Ich hatte kurz meine Chefin vor Augen, die Reine Zabo, wie sie oben, am anderen Ende der Leitung, nach diesem Keulenschlag bis zur Hüfte im Teppich verschwunden war.
Worauf der Riese sich meine schöne semidirektoriale Lampe schnappte und ihr exotisches Holz auf seinem Knie zersplittern ließ, bevor er fragte:
»Dass mal jemand auftauchen und Ihr Büro in Klump hauen könnte, auf den Gedanken sind Sie wohl noch nie gekommen?«
Der Kerl gehörte zu diesen Zornmütigen, bei denen jeder Äußerung eine Handlung vorausgeht. Ehe ich antworten konnte, war der in seine ursprüngliche Funktion einer tropischen Keule zurückverwandelte Lampenfuß in meinem Computer gelandet, dessen Bildschirm zu bleichen Scherben zersplitterte. Ein Loch im Gedächtnis der Welt. Da dies nicht genügte, hämmerte mein Riese auch noch auf das Gehäuse ein, bis die Luft von Symbolen schwirrte, die den wüsten Urzustand der Dinge wiedergefunden hatten.
Himmel, wenn ich ihn weiter gewähren ließ, würden wir tatsächlich in die Vorgeschichte zurückfallen.
Mittlerweile kümmerte er sich nicht mehr um mich. Er hatte den Schreibtisch von Mâcon, der Sekretärin, umgekippt, und nach einem Fußtritt endete eine der Schubladen voller Büroklammern, Stempel und Nagellack an der Wand zwischen den beiden Fenstern. Dann rückte er, bewaffnet mit dem Aschenbecher, der seit den Fünfzigerjahren elegant auf einem halbkugelförmigen Bleifuß wippte, dem gegenüberstehenden Regal systematisch zu Leibe. Er hatte es auf die Bücher abgesehen. Der Bleifuß richtete entsetzliche Verheerungen an. Der Typ hatte einen Instinkt für archaische Waffen. Bei jedem Hieb stieß er einen kindlichen Seufzer aus, einen jener Laute der Ohnmacht, die vermutlich die normale Musik der Verbrechen aus Leidenschaft bilden: Ich klatsche meine Frau gegen die Wand und flenne dabei wie ein Schoßkind.
Die Bücher flogen durch die Luft und zerfledderten am Boden.
Es gab nur eine Methode, das Gemetzel zu beenden.
Ich stand auf. Ich ergriff mit beiden Händen das Tablett, auf dem Mâcon mir Kaffee gebracht hatte, um mich nach meinem jüngsten Anfall von Übellaunigkeit (eine Mannschaft von sechs Druckern, die meine heilige Patronin zu Arbeitslosen gemacht hatte, weil sie sechs Tage zu spät geliefert hatten) milder zu stimmen, und schleuderte es mit allem, was daraufstand, in das Glasregal, in dem die Königin die Bücher mit den schönsten Einbänden ausstellte. Die leeren Tassen, die halb volle Kaffeekanne, das Silbertablett und die splitternde Glasscheibe machten genug Krach, um meinen Riesen auszubremsen. Die Hand mit dem Aschenbecher fror hoch über seinem Kopf ein, schließlich drehte er sich zu mir um:
»Was machen Sie da?«
»Dasselbe wie Sie, ich kommuniziere.«
Dann ließ ich den Papierbeschwerer aus Kristall, den Clara mir zu meinem letzten Geburtstag geschenkt hatte – ein Hundekopf, der vage an Julius erinnerte (entschuldige, Clara, entschuldige, Julius) –, über seinen Kopf hinwegsausen. Der Papierbeschwerer zerschmetterte das Gesicht des alten Talleyrand-Périgord, jenes geheimen Vorgängers der Reine Zabo, der die Editions du Talion zu einer Zeit gegründet hatte, als jeder und alle wie heute Papier brauchte, um seine Rechnung mit jedem und allen zu begleichen.
»Sie haben recht«, sagte ich, »wenn man die Welt nicht verändern kann, muss man das Dekor verändern.«
Er ließ den Aschenbecher neben sich zu Boden fallen. Und was geschehen musste, geschah nun auch: Er brach in Schluchzen aus.
Das Schluchzen kugelte ihm sämtliche Gelenke aus. Er glich jetzt einer dieser Holzfiguren, die, wenn man gegen ihren Fuß drückt, wie ein Kartenhaus in sich zusammensacken.
»Kommen Sie her.«
Ich hatte mich wieder auf meinen Bürostuhl gesetzt, der noch immer auf dem Schreibtisch stand. Schwankend kam er auf mich zu. Sein Adamsapfel legte zwischen den Drahtseilen des Halses unglaubliche Strecken zurück, um den Schmerz zu verscheuchen. Ich kannte solchen Kummer gut. Es kam nicht das erste Mal vor.
»Kommen Sie, noch ein Stückchen.«
Er machte noch zwei, drei Schritte, bis er vor mir stand. Sein Gesicht troff. Sogar sein Haar schwamm in Tränen.
»Vergeben Sie mir«, sagte er.
Er rieb sich die Augen mit den Fäusten. Seine Finger waren behaart.
Ich legte ihm die Hand in den Nacken und zog seinen Kopf auf meine Schulter herab. Bruchteilssekundenlanger Widerstand, dann wurde alles weich und schlaff.
Mit einer Hand hielt ich seinen Kopf in der Kuhle meiner Schulter, mit der anderen streichelte ich ihm übers Haar. Meine Mutter konnte das sehr gut, es gab keinen Grund, weshalb ich es nicht können sollte.
Die Tür ging auf, und im Rahmen erschienen die Sekretärin Mâcon sowie mein Freund Loussa de Casamance, Senegalese, eins achtundsechzig groß, mit Augen wie ein Cockerspaniel und Beinen wie Fred Astaire, der mit Abstand der beste Kenner chinesischer Literatur in ganz Paris ist. Sie sahen, was zu sehen war: einen Verlagslektor, der auf seinem Schreibtisch sitzt und mitten in einem Trümmerfeld einen vor ihm stehenden Riesen tröstet. Mâcons Auge ermaß mit Entsetzen die Schäden, Loussas Blick fragte mich, ob ich Hilfe brauchte. Ich bedeutete ihnen mit fächelndem Handrücken, sich zurückzuziehen. Lautlos ging die Tür wieder zu.
Der Riese schluchzte noch immer. Seine Tränen liefen mir den Hals hinunter, ich war klatschnass bis zur Taille. Sollte er sich ruhig nach Herzenslust ausheulen, ich hatte es nicht eilig. Die Geduld des Trösters rührt von dem Schlamassel her, in dem er selber steckt. Wein nur, mein Kumpel, wir sitzen alle bis über beide Ohren in der Scheiße, von deinen Tränen steigt der Spiegel nicht weiter an.
Und während er sich in meinen Kragen verströmte, dachte ich an die Verlobung von Clara, meiner Lieblingsschwester. »Sei nicht traurig, Benjamin, Clarence ist ein Engel.« Clarence … wie kann man nur Clarence heißen? »Ein Engel, der sechzig ist, mein Liebling, dreimal so alt wie du.« Das samtene Lachen meiner kleinen Schwester: »Ich hab etwas entdeckt, Benjamin, Engel haben ein Geschlecht und sind alterslos.« – »Trotzdem, meine Clarinette, trotzdem, ein Engel und Gefängnisdirektor …« – »Der aber aus seinem Gefängnis ein Paradies gemacht hat, Benjamin, vergiss das nicht!«
Verliebte haben auf alles eine Antwort, und große Brüder bleiben mit ihren Sorgen allein: Meine Lieblingsschwester wird morgen eine Oberwachtel heiraten, so ist das. Nicht schlecht, oder? Wenn man noch erwähnt, dass meine Mutter vor ein paar Monaten mit einem Bullen durchgebrannt und dermaßen verliebt ist, dass sie bisher kein einziges Mal angerufen hat, so erhält man ein ziemlich hübsches Bild der Malaussène-Familie. Ganz zu schweigen von meinen anderen Brüdern und Schwestern: Thérèse, die in den Sternen liest, Jérémy, der seine Schule abgefackelt hat, le Petit mit der rosa Brille, dessen Albträume Wirklichkeit werden, und Verdun, die Letztgeborene, die seit dem ersten Augenblick tobt und brüllt wie die Schlacht desselben Namens …
Und du, heulender Riese, was für eine Familie hast du, hm? Vielleicht gar keine, und deshalb hast du alles aufs Schreiben gesetzt, ja? Er hatte sich ein bisschen beruhigt. Das nutzte ich, um ihm die Frage zu stellen, deren Antwort ich kannte:
»Ihnen ist ein Manuskript abgelehnt worden, richtig?«
»Zum sechsten Mal.«
»Immer dasselbe?«
Wieder nickt er und löst zuletzt seinen Kopf von meiner Schulter. Und während er ihn sehr langsam schüttelt:
»Ich habe es so oft überarbeitet, wenn Sie wüssten, ich kann es auswendig.«
»Wie heißen Sie?«
Er nannte seinen Namen, und ich sah sogleich die erheiterte Miene der Reine Zabo wieder, wie sie das betreffende Manuskript kommentiert: »Ein Typ, der Sätze schreiben kann wie ›Erbarmen!, wich er schluchzend zurück‹ oder der glaubt, einen Witz zu machen, wenn er die Galeries Lafayette Pfuifett nennt, und das gleich sechsmal hintereinander, unerschütterlich sechs Jahre lang – an welcher vorgeburtlichen Krankheit leidet so ein Typ, Malaussène, können Sie mir das sagen?« Sie schüttelte ihren riesigen Kopf, den das Leben auf einen magersüchtigen Körper gesetzt hatte, und wiederholte, als sei es eine persönliche Beleidigung: »›Erbarmen!, wich er schluchzend zurück‹ …Warum nicht: ›Guten Tag, trat er ein‹ oder ›Tschüs, verließ er den Raum‹?«, und mehr als zehn Minuten trug sie eine beeindruckende Palette von Varianten vor, denn Talent ist es nicht, was ihr fehlt …
Kurz, wir hatten das Manuskript abgelehnt, ohne es zu lesen, mit meiner Unterschrift, und der Junge wäre beinahe vor Kummer in meinen Armen gestorben, nachdem er mein Büro in ein Terrain vague verwandelt hatte.
»Sie haben es nicht einmal gelesen, stimmts? Die Seiten 36, 123 und 247 lagen noch auf dem Kopf, wie ich sie eingelegt hatte.«
Klassischer Fall … Unglaublich, dass wir Verlagsleute bei all unserer Cleverness immer wieder darauf reinfallen! Und was sagst du ihm jetzt, Benjamin? Was sagst du dem Typen jetzt? Dass er sich an ein gigantisch überholtes Modell von Infantilität klammert? Seit wann glaubst du denn an die Reife, Benjamin? Ich glaube an gar nichts, verdammt, ich weiß bloß, dass Kindereien auf der Schreibmaschine ein schlimmes Ende nehmen und das weiße Blatt Papier das Schweißtuch der Dummheit ist. Und dass er nicht einer derjenigen ist, denen die Reine Zabo ihren Krempel abkauft. Diese Frau ist ein Manuskript-Scanner, und es gibt nur eins auf der Welt, was sie wirklich zum Heulen bringt: ein malträtierter Konjunktiv I + II. Also, was schlägst du dem Riesen da jetzt vor, dass ers mit Aquarellmalerei versuchen soll? Gute Idee: dann wird er auch noch den Rest des Gebäudes in Kleinholz verwandeln … Mit seinen knapp fünfzig hat er sich der Literatur seit mindestens dreißig Jahren mit Haut und Haar verschrieben, solche Kerle sind zu allem fähig, wenn man ihnen ihre Feder stutzt!
Ich traf also die einzig mögliche Entscheidung. Ich sagte zu ihm:
»Kommen Sie.«
Ich sprang direkt aus meinem Stuhl auf den Boden. Ich wühlte in dem zertrümmerten Schreibtisch von Mâcon und fand schließlich den Schlüsselbund, den ich suchte. Ich durchquerte das Büro in der Diagonalen. Er folgte mir wie durch die Wüste. Die Wüste nach dem israelisch-syrischen Bruch. Ich kniete mich vor einen Metallschrank, drehte den Schlüssel einmal um, der Rollladen glitt sofort herab. Der Schrank war randvoll mit Manuskripten. Ich nahm das erstbeste, das mir unterkam, und sagte:
»Hier!«
Der Titel lautete: Ohne zu wissen, wohin ich ging, der Name des Autors: Benjamin Malaussène.
»Haben Sie das geschrieben?«, fragte er mich, nachdem ich den Rollschrank wieder verschlossen hatte.
»Ja, die anderen alle auch.«
Ich legte den Schlüsselbund genau an die Stelle von Mâcons Trümmern zurück, wo ich ihn gefunden hatte. Diesmal zockelte der Riese nicht hinter mir her.
Sprachlos betrachtete er das Manuskript.
»Ich verstehe nicht.«
»Dabei ist es ganz einfach«, sagte ich, »all meine Romane da sind viel häufiger abgelehnt worden als Ihrer. Ich gebe Ihnen den hier, weil er mein jüngstes Kind ist. Vielleicht können Sie mir ja sagen, woran es hapert. Mir gefällt er.«
Er betrachtete mich, als hätten die stiebenden Möbel bei mir eine Schraube gelockert.
»Aber warum ich?«
»Weil man die Bücher anderer besser beurteilen kann und Ihre eigene Arbeit zumindest beweist, dass Sie lesen können.«
Hier hustete ich, wendete mich einen Moment ab, und als sich mein Blick wieder auf ihn heftete, standen mir Tränen in den Augen.
»Bitte, machen Sie das für mich.«
Ich glaube, er wurde blass, er breitete die Arme aus, aber ich konnte vermeiden, dass er mich an die Brust drückte, ich begleitete ihn zur Tür, die ich weit öffnete.
Er zögerte einen Augenblick. Seine Lippen zitterten wieder. Er sagte:
»Es ist grauenvoll zu wissen, dass andere noch unglücklicher sind als man selber. Ich schreibe Ihnen, was ich von Ihrem Roman halte, Monsieur Malaussène. Versprochen, ich schreibe Ihnen!«
Er zeigte auf den angerichteten Schaden und sagte:
»Vergeben Sie mir, ich werde für alles aufkommen, ich …«
Aber ich schüttelte den Kopf und schob ihn sanft hinaus. Ich schloss die Tür hinter ihm. Das letzte Bild, das sich ihm von dieser kleinen Veranstaltung bot, war mein von Tränen überströmtes Gesicht.
Ich wischte sie mit dem Handrücken fort, und ich sagte:
»Danke, Julius!«
Da mein Hund nicht reagierte, ging ich zu ihm hin und wiederholte:
»Nein wirklich, danke! So was nenn ich einen Hund, der seinen Herrn verteidigt!«
Aber ich hätte mich genauso gut an einen ausgestopften Köter wenden können. Julius der Hund blieb vor dem Fenster sitzen und betrachtete weiter mit der Ausdauer eines japanischen Malers die vorbeifließende Seine. Um ihn herum waren die Möbel durch die Luft geflogen, sein kristallenes Abbild hatte Talleyrand auf dem Gewissen, aber Julius dem Hund war das herzlich egal; mit schiefem Kopf und hängender Zunge schaute er zu, wie die Seine, ihre Kähne, Kisten, Schuhe und Lieben vorüberzogen … So reglos, dass der gestörte Riese ihn für ein primitives Kunstwerk gehalten haben musste, aus einem Material, das selbst für eine schnaubende Wut zu schwer war.
Mich beschlich ein Verdacht. Ich kniete mich vor Julius hin. Ich rief ihn sanft:
»Julius?«
Keine Antwort. Nur sein Geruch.
»Du hast doch keinen Anfall?«
Die ganze Familie Malaussène lebte in beständiger Angst vor seinen epileptischen Anfällen. Meiner Schwester Thérèse zufolge kündigten sie stets eine Katastrophe an. Außerdem blieb immer etwas zurück: schiefer Kopf, hängende Zunge …
»Julius!«
Ich nahm ihn auf den Arm.
Nein, er fühlte sich lebendig an, ganz warm, mehliges Fell, Gestank aus allen Poren: Julius der Hund, wie er kerngesund ist.
»Gut«, sagte ich, »genug geträumt jetzt, beweg deinen Hintern, wir kündigen der Reine Zabo.«
War es das Wort »kündigen«? Er sprang jedenfalls auf und war vor mir an der Tür.
2
»In diesem Monat kündigen Sie schon zum dritten Mal, Malaussène, fünf Minuten will ich gern erübrigen, um Sie wieder in die Spur zu bringen, aber mehr nicht.«
»Keine Sekunde, Majestät, ich kündige: Da gibt es nichts zu verhandeln.«
Meine Hand lag bereits auf dem Türgriff.
»Wer spricht von Verhandeln? Ich bitte Sie nur um eine Erklärung.«
»Keine Erklärung; mir reichts, das ist alles.«
»Die andern Male hat es Ihnen auch gereicht, es reicht Ihnen chronisch, Malaussène, das ist Ihre Krankheit.«
Sie saß nicht auf ihrem Stuhl, sie stak darin. Ihr Oberkörper war so mager, dass ich immer damit rechnete, sie könnte sich durch die Kissen bohren. Auf diesem Körper schaukelte, wie aufgepflanzt auf einen Spieß, sanft ein außergewöhnlich dicker Kopf – ein Schildkrötenkopf auf der Heckablage eines PKW.
»Sie haben einem armen Teufel ein Manuskript zurückgeschickt, ohne es überhaupt gelesen zu haben, und ich habe gerade die Rechnung dafür bezahlt.«
»Ich weiß, Mâcon hat mich bereits unterrichtet. Sie ist ganz aus dem Häuschen, die arme Kleine. Er hat Sie mit der umgedrehten Seite drangekriegt?«
Sie amüsierte sich bestens zwischen ihren Hängebacken. Erklärungen – damit lockte sie mich jedes Mal auf den Leim.
»Genau, und es grenzt an ein Wunder, dass er nicht den ganzen Schuppen in Brand gesteckt hat.«
»Tja! Ich werde Mâcon entlassen müssen, die Seiten richtig herum einzulegen gehört zu ihren Aufgaben. Die Kosten für das zertrümmerte Büro bekommt sie von der Abfindung abgezogen.«
Auch ihre Hände am Ende der spindeldürren Arme wirkten wie mit Luft aufgepumpt. Als hätte man Schraubenziehern Babyhände aufmontiert. Vielleicht lag es daran, dass ich plötzlich angerührt war. Ich hatte so viele Babyhände gesehen! Le Petit hatte noch welche, Verdun natürlich auch, Verdun der Winzling, die Letztgeborene im Stamm der Malaussènes. Und selbst Clara, Clara, die morgen heiraten würde, auch sie hatte im Grunde noch Babyhände.
»Mâcon entlassen? Mehr fällt Ihnen wohl nicht ein? Sie haben heute schon sechs Drucker arbeitslos gemacht, reicht Ihnen das nicht?«
»Hören Sie, Malaussène …«
Die Geduld dessen, der meint, keine Erklärungen schuldig zu sein.
»Hören Sie: Ihre Drucker haben mir den Bildband nicht nur sechs Tage zu spät geliefert, sondern auch noch versucht, mich übers Ohr zu hauen. Riechen Sie mal!«
Unvermittelt schlug sie das Buch direkt vor meiner Nase auf – Typus hochluxuriöser Geburtstags-Vermeer van Delft, besser als das Original, unbezahlbar, nie gelesen, genau das richtige Objekt für jeden Zahnarztbücherschrank.
»Schönes Buch«, sage ich.
»Ich habe Sie nicht gebeten zu schauen, Malaussène, sondern zu riechen. Was riechen Sie?«
Es roch gut nach neuem Buch, dem ofenfrischen Croissant des Verlegers.
»Es riecht nach Leim und frischer Druckerfarbe.«
»Das ist es eben, nicht gar so frisch. Welche Druckerfarbe?«
»Pardon?«
»Um welche Druckerfarbe handelt es sich?«
»Lassen Sie den Unsinn, Majestät, woher soll ich das wissen?«
»Venelle 63, mein Junge. In sieben, acht Jahren entsteht um die Buchstaben herum ein hübscher roter Hof, und das Buch ist für den Müll. Eine chemisch instabile Sauerei. Wahrscheinlich hatten sie noch einen Vorrat auf Lager, sie haben versucht uns einzuwickeln. Aber sagen Sie mir lieber, wie Sie Ihren Irren wieder losgeworden sind? So unter Strom, wie der war, hätte er Sie eigentlich abmurksen müssen!«
Abrupter Themenwechsel war ihre Methode: eine Sache ad acta gelegt, die nächste in Angriff genommen.
»Ich habe ihn zum Literaturkritiker gemacht. Ich habe ihm eines der nicht zurückverlangten Manuskripte gegeben und ihm gesagt, es sei von mir. Ich habe ihn nach seiner Meinung gefragt, um Rat gebeten … Ich habe den Spieß umgekehrt.«
(In der Tat mein Lieblingstrick. Prompt schrieben die abgelehnten Autoren aufmunternde Briefe an mich: »Es sind Seiten voller Empfindsamkeit, Monsieur Malaussène! Sie werden es eines Tages schaffen, halten Sie es wie ich: machen Sie weiter; Schreiben verlangt einen langen Atem …« Ich antwortete jedes Mal postwendend, drückte meinen tiefen Dank aus.)
»Und das funktioniert?«
Sie betrachtete mich mit ungläubiger Bewunderung.
»Es funktioniert, Majestät, es funktioniert jedes Mal. Aber mir reicht es. Ich kündige.«
»Warum?«
Ja tatsächlich: Warum?
»Haben Sie Angst?«
Nicht wirklich. Da war zwar dieser Satz über den geradlinigen Tod, der mir ein bisschen zusetzte, aber der verrückte Riese hatte mich nicht wirklich geängstigt.
»Macht Ihnen die Unmenschlichkeit im Verlagswesen zu schaffen, Malaussène? Wollen Sies lieber im Immobiliengeschäft probieren oder in der Erdölindustrie, bei den Banken? Apropos, der Internationale Währungsfonds, kann ich nur empfehlen: Einem Entwicklungsland die Zuwendungen streichen mit dem Argument, dass es seine Schulden nicht zurückzahlen kann – die Rolle kann ich mir gut für Sie vorstellen: mit Millionen von Toten als Sahnehäubchen!«
Sie hatte sich immer in dieser mackerhaft-mütterlichen Art über mich lustig gemacht. Und immer hatte sie mich zu guter Letzt am Wickel gekriegt. Diesmal nicht, Majestät, diesmal mache ich mich aus dem Staub. Sie musste es in meinem Blick gelesen haben, denn sie richtete sich, die dicklichen Fäuste auf den Schreibtisch gestützt, halb auf, ihr Kopf drohte wie eine reife Frucht auf die Schreibunterlage zu fallen:
»Hören Sie, zum letzten Mal, Sie blöder Trottel …«
Sie arbeitete an einem schäbigen, kleinen Metallschreibtisch. Der Rest des Raumes glich eher einer Mönchszelle als dem Refugium eines Direktors. Nicht zu vergleichen mit dem Vorzimmer des Louvre, wo ich meinem Talent nachging, und auch nicht mit dem Glas-Alu-Design von Calignac, unserem Verkaufsdirektor. In puncto Büro war in diesem Hause jeder besser untergebracht als sie; auch in puncto Klamotten hätte sie als die Teilzeitsekretärin ihrer jüngsten Pressereferentin durchgehen können. Sie mochte es, wenn ihre Mitarbeiter luxusumhegt in Samt und Seide schwitzten; sie kultivierte ihr Image des kleinen Caporal in der grauen Uniform, der von Marschällen mit betresstem Hintern umgeben ist.
»Hören Sie, Malaussène, ich habe Sie als Sündenbock eingestellt, damit Sie sich an meiner Stelle anschnauzen lassen; damit Sie die Kohlen aus dem Feuer holen, indem Sie im richtigen Augenblick flennen; damit Sie die unlösbaren Probleme lösen, indem Sie Ihre Märtyrerarme ausbreiten – mit einem Wort, damit Sie einstecken. Und Sie stecken hervorragend ein! Sie sind ein Einstecker allererster Güte, niemand auf der Welt kann besser einstecken als Sie, und wissen Sie warum?«
Sie hatte es mir schon tausend Mal erklärt: Weil ich ihrer Meinung nach als Sündenbock geboren war, ich hätte das im Blut, hätte anstelle des Herzens einen Magneten, der die Pfeile anzieht. Doch an diesem Tag setzte sie noch eins drauf:
»Aber nicht nur das, Malaussène, da ist noch etwas anderes: Mitleid, mein Junge, Mitleid! Sie haben ein seltenes Laster: Sie leiden mit dem anderen mit. Vorhin haben Sie mit dem infantilen Riesen gelitten, der meine Möbel zertrümmert hat. Und Sie haben das Wesen seines Schmerzes so gut begriffen, dass Sie auf die geniale Idee kamen, aus dem Opfer einen Henker zu machen, aus dem abgewiesenen Schriftsteller einen allmächtigen Kritiker. Genau das brauchte er. Nur Sie konnten etwas derart Einfaches spüren.«
Ihre Stimme gleicht einer schrillen Rätsche, halb begeisterte Göre, halb illusionslose Hexe. Unmöglich, bei ihr zwischen Enthusiasmus und Zynismus zu unterscheiden. Nicht die Dinge selbst, sondern diese zu verstehen, lässt sie vor Freude ausrasten.
»Sie sind der zweifach Schmerzensreiche dieser niedrigen Welt, Malaussène!«
Ihre Hände flatterten vor meiner Nase herum wie fette Schmetterlinge.
»Selbst ich kann Sie anrühren, das sagt alles!«
Sie bohrte sich den drallen Zeigefinger in die flache Brust.
»Jedes Mal, wenn Ihr Blick auf mir ruht, kann ich Sie sich fragen hören, wie ein derart voluminöser Kopf auf einem solchen Rechen wachsen konnte!«
Irrtum, ich hatte diesbezüglich meine Idee: erfolgreiche Psychoanalyse. Der Kopf ist geheilt und der Körper aus dem Programm gestrichen. Der Kopf genießt uneingeschränkt seine Gesundheit, der Kopf profitiert allein von den schönen Dingen des Lebens.
»Ich kann mir lebhaft vorstellen, wie Sie meine private Leidensgeschichte zusammenfantasieren: Am Anfang eine unglückliche Liebe oder ein allzu ausgeprägtes Bewusstsein für die Absurdität dieser Welt, und als letztes Heilmittel dann die Psychoanalyse, wo Herz war, soll Hirn werden, das geheimnisvolle Sofa, nicht wahr? Die kostenintensive Ichisierung, oder?«
(Mist aber auch …!)
»Hören Sie, Majestät …«
»Sie sind der Einzige meiner Angestellten, der mich offen Majestät nennt – die andern tun das nur hinter den Kulissen: Und da soll ich mich von Ihnen trennen?«
»Hören Sie, mir reichts, ich gehe, und Schluss.«
»Und die Bücher, Malaussène?«
Es war ein Schrei, während sie aufsprang.
»Und die Bücher?«
Mit ausholender Geste wies sie auf die vier Wände ihrer Zelle. Die kahl waren. Kein einziges Buch. Dennoch war es, als stünden wir plötzlich mitten in der Bibliothèque Nationale.
»Haben Sie an die Bücher gedacht?«
Puterrote Wut. Die Augen traten ihr aus dem Kopf. Violett die Lippen, schneeweiß die dicken Fäuste. Statt in meinem Stuhl zu verschwinden, sprang ich meinerseits auf und brüllte:
»Die Bücher, die Bücher, mehr kommt Ihnen nicht über die Lippen! Nennen Sie mir eins!«
»Was?«
»Nennen Sie mir eins, einen Romantitel, irgendwas, einen Herzensschrei, los!«
Einen Augenblick lang schnappte sie perplex nach Luft, ein Zögern, das ihr zum Verhängnis wurde.
»Sehen Sie«, triumphierte ich, »Sie können mir nicht einmal einen einzigen Titel nennen! Hätten Sie Anna Karenina oder Bibi Fricotin gesagt, ich wäre geblieben.«
Dann:
»Komm, Julius, wir gehen.«
Der Hund, der vor der Tür gesessen hatte, hievte seinen dicken Hintern hoch.
»Malaussène!«
Aber ich drehte mich nicht um.
»Malaussène, nicht Sie kündigen – ich kündige Ihnen! Sie pesten mehr als Ihr Hund, Malaussène, Sie sprechen von Herz, wie man aus dem Maul stinkt! Sie sind ein menschlicher Dreck, ein falscher Hund, den das Leben ausradieren wird, ohne dass ich mich einmische, verpissen Sie sich, Gott verdammt, und freuen Sie sich auf die Rechnung für das verwüstete Büro!«
Inhaltsverzeichnis
IIClara heiratet
Ich will nicht, dass Clara heiratet.
3
Ich musste die tiefe Nacht abwarten. Dann erst begriff ich, warum ich bei der Königin Zabo den Sündenbockstuhl geräumt hatte.
Ich war in Julies Arme geflohen, mein Kopf hatte sich zwischen Julies Brüsten vergraben (»Julie, bitte, bitte, gib mir deine Nippel«), Julies Finger streunten träumend durch mein Haar, als ihre Stimme mir plötzlich ein Licht aufsteckte. Ihre schöne, fauchende Savannenstimme.
»Im Grunde«, sagte sie, »hast du gekündigt, weil Clara morgen heiratet.«
Das stimmte, verdammt. Ich hatte den ganzen Tag an nichts anderes gedacht. »Morgen wird Clara die Frau von Clarence.« Clara und Clarence … das Gesicht der Königin, wenn sie das in einem Manuskript fände! Clara und Clarence! Nicht einmal die Arztromane leisten sich derartige Klischees. Aber nicht nur das Lächerliche der ganzen Sache brachte mich um, sondern die Sache selbst. Clara heiratete. Clara verließ das Haus. Clara, mein kleiner Liebling, der schwebend leichte Flaum meiner Seele, machte sich davon. Keine Clara mehr, um sich zur Stunde des täglichen Zoffs zwischen Thérèse und Jérémy zu stellen, keine Clara mehr, um le Petit, wenn er aus seinen Albträumen erwachte, zu trösten, keine Clara mehr, um Julius den Hund im Lande der Epilepsie zu umhegen, auch kein Gratin dauphinois mehr und keine Lammschulter à la Montalban. Höchstens vielleicht noch sonntags beim hergebrachten Familienbesuch. Herrgott noch mal … Himmelherrgott verflucht noch mal … Ich hatte den ganzen Tag an nichts anderes gedacht, ja. Ich dachte an Clara, als dieser Lackaffe von Deluire rummoserte, weil seine Bücher nicht schnell genug in den Flughafenbuchhandlungen auflagen (weil die Buchhändler sie nämlich nicht mehr wollen, du Null, hast dich im Fernsehen aufgeplustert, statt brav an deinem Stil zu feilen, und schon sitzt du auf dem absteigenden Ast, das geht dir ab, was?). Ich greinte: »Es ist meine Schuld, Monsieur Deluire, allein meine Schuld, sagen Sie es nicht der Chefin, bitte«, unterdessen zu mir: »Morgen geht sie weg, heute Abend sehe ich sie wirklich zum allerletzten Mal …«; und ich dachte an die Trennung von Clara, als diese betrügerischen Drucker vor mir standen, um zu sechst ihre Sache zu verteidigen, die nicht zu verteidigen war; und noch als dieser Übergeschnappte aus der Steinzeit die Bude himmelte, war es Claras Weggang, der mir das Herz abschnürte. Das Leben von Benjamin Malaussène war plötzlich hierauf zusammengeschnurrt: Seine kleine Schwester Clara verließ das Haus um das Haus eines anderen willen. Das Leben von Benjamin Malaussène setzte aus. Und Benjamin Malaussène, plötzlich von grenzenlosem Überdruss ergriffen, von der hochgehenden Woge Kummer gepackt (oh, là là!), fortgespült von der Brücke des Lebens, Benjamin Malaussène präsentierte der Reine Zabo, seiner Chefin, die Kündigung, wobei er den Moralisten heraushängen ließ, der ihm so gut zu Gesicht stand wie das Messgewand dem Dieb, der den Opferstock klaut. Ein Selbstmord halt.
Als Julius und ich, törichte Trottel wir beiden, stolzgebläht über diesen Sieg mit eingebauter Niederlage, uns ab durch die Mitte machten, schob Loussa de Casamance, mein verlegerischer Freund, sich mit seinem roten Lieferwagen an uns heran, der bis zum Dach mit chinesischen Büchern für die Buchhandlung Herbes sauvages im neuen Belleville gefüllt war, und forderte uns auf einzusteigen. Er rückte mir als Erster den Kopf zurecht, er und sein nüchterner Sinn, dem er das Überleben als senegalesischer Schütze in der Schlacht von Montecassino verdankte. Ein paar Minuten lang steuerte er wortlos seine rollende Bibliothek, dann warf er mir mit seinen seltsam grünlich funkelnden Augen schräg einen Blick zu und sagte:
»Gewähre einem alten Afrikaner, der dich mag, die traurige Ehre, dir zu sagen, dass du ein kleiner Depp bist.«
Er hatte eine Stimme voll spöttischer Zärtlichkeit. Doch selbst da noch dachte ich an Clara – an ihre Stimme. Vielleicht war es letztendlich ihre Stimme, was mir am meisten fehlen würde. Vom ersten Tag an, seit ihrer Geburt, hatte Claras Stimme das Haus vor dem Gedröhn der Stadt geschützt. Eine warme, runde, ihrem Gesicht so ähnliche Stimme, dass, sieht man Clara, während sie nicht redet – zum Beispiel wenn sie unter ihrer roten Laborlampe Fotos entwickelt –, man sie weiterhin vernimmt, man sich einhüllen lässt in den köstlich weichwollenen Überwurf, der gegen die Frische des Abends schützt.
»Die Reine Zabo mit der Frage nach dem einen Buch in die Pfanne zu hauen«, sagte Loussa, »ist nicht sonderlich loyal, wenn du meine Meinung wissen willst.«
Loussa war ein so friedlicher wie bedingungsloser Anhänger der Königin Zabo. Und er wurde nie laut.
»›Nennen Sie mir eins … nur eins‹ – ein kleiner juristischer Winkelzug, der dir da eingefallen ist, Malaussène, mehr nicht.«
Er hatte recht. Einen andern in perplexe Sprachlosigkeit treiben und ihn dann niedermachen ist nicht gerade fein.
»So gewinnt man Prozesse, aber so bringt man auch die Wahrheit zur Strecke. Faˇn gõng zì xĭng, wie die Chinesen sagen: befrage dein Gewissen.«
Er fuhr außergewöhnlich schlecht. Aber nach dem Gemetzel von Montecassino war er überzeugt, dass der Straßenverkehr ihm nichts anhaben konnte. Plötzlich sagte ich zu ihm:
»Loussa, meine Schwester heiratet morgen.«
Er kannte meine Familie nicht. Er war noch nie bei uns gewesen.
»Gewiss ein Glück für ihren Mann«, sagte er.
»Sie heiratet einen Gefängnisdirektor.«
»Ach!«
Ja, genau das war seine Meinung: »Ach was!« Es folgte das Überfahren mehrerer roter Ampeln und einige heikle Begegnungen mit anderen Fahrzeugen, dann fragte er:
»Ist sie alt, deine Schwester?«
»Nein, sie wird demnächst neunzehn; aber er ist alt.«
»Ach!«
Der Gestank von Julius nutzte die Stille, um sich breitzumachen. Julius der Hund agierte von jeher mittels Ausdünstungen. Wie mit einer Hand leierten Loussa und ich unsere Fenster herunter. Dann sagte Loussa:
»Hör mal, vielleicht hast du Lust zu reden oder auch das Bedürfnis zu schweigen, jedenfalls spendier ich dir einen Schluck.«
Vielleicht musste ich letzten Endes die Sache jemandem erzählen, einem, der nicht im Bilde war. Loussas rechtes Ohr würde sich sehr gut dafür eignen.
»Seit mir im Krieg das linke Trommelfell gerissen ist«, pflegte er zu sagen, »verhält sich mein rechtes Ohr wesentlich objektiver.«
Erstes Kapitel: Im letzten Jahr, als in Belleville alten Damen die Kehle durchgeschnitten wurde, weil man an ihre Ersparnisse wollte, hatte sich mein Freund Stojilković, ein serbischer Quasi-Onkel unserer kleinen Familie, in den Kopf gesetzt, die alten Damen zu beschützen, weil die Bullen sie ins offene Messer laufen ließen.
Zweites Kapitel: Zu diesem Zweck bewaffnete Stojilković die alten Damen bis an die Zähne mit alten Knarren aus einem Lager, das er am Ende des letzten Krieges in den Katakomben von Montreuil angelegt und nun reaktiviert hatte. Nachdem er in einem eigens hierfür ausgestatteten Saal in den selbigen Katakomben den alten Damen beigebracht hatte, wie man aus allen Positionen feuert, entließ er sie – die fortan so unkontrollierbar waren wie Marschflugkörper mit zweifelhaften Köpfen – seelenruhig in die Straßen von Belleville.
Drittes Kapitel: Selbstverständlich verschlimmerte dies nur die Metzelei. Ein Inspektor in Zivil, der einem dieser Mädels beim Überqueren einer Kreuzung helfen wollte, endete auf dem Asphalt mit einer Kugel in der Stirn – ein Schnitzer: Großmutter hatte zu schnell gezogen.
Viertes Kapitel: Da kriegen die Bullen endlich den Dreh und schwören, den Märtyrer zu rächen. Zwei Inspektoren mit etwas mehr Grips als die anderen kommen hinter das Geheimnis und Stojilković: hinter Gitter.
Fünftes Kapitel (als Einschub, denn Einschübe sind das Inwendige des Lebens): Während der Ermittlungen werden die beiden Inspektoren zum häufig gesehenen Gast von Belleville im Allgemeinen und der Malaussène-Familie im Besonderen. Der jüngere von beiden, mit Namen Pastor, verliebt sich bis über beide Ohren in meine Mutter, die ein neues Leben anzufangen beschließt, zum achten Mal mit jungfräulich neuem Herzen. Abgang Maman, Abgang Pastor. Richtung Hotel Danieli, Venedig. Aber ja.
Was den zweiten Flic betrifft, Inspektor Van Thian, Frankovietnamese, kurz vor der Rente, so hat er sich bei der Jagd auf den Mörder drei Kugeln gefangen und genießt in unserem Kreis eine glückliche Genesungszeit. Allabendlich erzählt er den Kindern ein Kapitel des Abenteuers. Er ist ein irritierender Erzähler: mit dem Aussehen von Ho Chi Minh und der Stimme von Jean Gabin. Die Kinder sitzen auf ihren Doppelstockbetten und lauschen ihm, die Nüstern vom Dunst des Blutes und das Herz von den Versprechen der Liebe geweitet. Der alte Thian hat seiner Erzählung den Titel Wenn alte Damen schießen gegeben. Und er hat uns allen darin überaus schmeichelhafte Rollen zugewiesen, was den »Ohrenschmaus«, wie es im Radio heißt, erhöht.
Sechstes Kapitel: Nur, kein Stojilković mehr, kein serbischer Onkel mit bronzener Stimme mehr, kein Schachpartner mehr für mich. Aber da wir nicht zu jenen gehören, die einen alten Kumpel einfach so fallen lassen, beschließen Clara und ich, ihn in seinem Kerker zu besuchen. Er sitzt in der Strafanstalt von Champrond in der Essonne. Metro bis zur Gare d’Austerlitz, Zug bis Etampes, Taxi bis zum Gefängnis, und hier die Überraschung: Statt einer hermetisch verschlossenen Justizvollzugsanstalt mit felsenartigen Mauern empfängt uns ein Adelssitz aus dem 18. Jahrhundert, wenngleich hergerichtet als Knast, mit Zellen, Uniformierten, Besuchszeiten, aber auch mit französischem Garten, Aubusson-Teppichen an den Wänden, Schönheit, wohin das Auge schaut, und abgeschirmter Bibliothekenstille. Nicht das leiseste Klimpern und Klirren, Gänge ohne Widerhall, ein Hafen. Die zweite Überraschung: Nachdem ein alter Wärter, diskret wie eine Museumskatze, uns zu Stojilkovićs Zelle gebracht hat, weigert dieser sich, uns zu empfangen. Kurzer Blick durch den Türspalt: ein kleines rechteckiges Zimmerchen, der Boden übersät mit zerknülltem Papier, aus welchem ein Schreibtisch hervorragt, der sich unter der Last von Wörterbüchern biegt. Stojilković will während der Haft Vergil ins Serbokroatische übersetzen, aber die wenigen Monate, die er aufgebrummt bekommen hat, reichen dafür nicht aus. Deshalb, kehrt marsch, Kinder, bitte, und gebt die Direktive weiter: keine Besuche bei Onkel Stojil.
Siebtes Kapitel: Die Erscheinung vollzog sich auf dem Rückweg durch die Gänge. Denn, ja, die erste Begegnung von Clara und Clarence fällt in den Bereich der Erscheinungen. Es war ein Frühlingsabend. Die Sonne tauchte die Wände in Herbstlaubgold. Der alte Wärter geleitete uns zum Ausgang. Unsere Schritte wurden von einem langen Kardinalsteppich geschluckt. Es fehlten nur noch Walt Disneys Pailletten, um uns, Clara und mich, Hand in Hand ins azurblaue Paradies sämtlicher Versöhnungen entschweben zu lassen. Um ehrlich zu sein, ich hatte es eilig rauszukommen. Dass ein Gefängnis so wenig einem Gefängnis glich, erschütterte mein Wertesystem. Und es hätte mich nicht weiter verwundert, wenn das Dieseltaxi, das draußen auf uns wartete, sich in eine Kristallkutsche verwandelt hätte, gezogen von diesen geflügelten Pferden, die nie einen Apfel fallen lassen.
Da erschien uns der bezaubernde Prinz.
Hochgewachsen, gerade, stand er, ein Buch in Händen, am Ende des Ganges, und ein schräg einfallender Sonnenstrahl übergoss sein weißes Haupt mit Gold.
Der Erzengel in Person.
Die schneeweiße Haarsträhne, die ihm übers Auge fiel, vermochte im Übrigen ganz gut den gerade angelegten Flügel zu verkörpern.
Er sah zu uns herüber.
Himmelblau, die Augen, versteht sich.
Wir standen zu dritt vor ihm. Er sah nur Clara. Und auf Claras Gesicht erschien dieses Lächeln, dessen Aufkeimen ich von Anfang an gefürchtet hatte. Nur hatte ich geglaubt, sie würde das erste Exemplar einem Unfertigen mit Pickeln, Turnschuhen und Walkman schenken, der, wenn er dem Reiz der Schwester erläge, der Autorität des Bruders anheimfiele. Oder Clara würde, insofern sie nicht sonderlich gut in der Schule war, uns ein etwas steifes Ass in Deutsch und Mathe anschleppen, mit dem unsere Fantasie kurzen Prozess machen konnte. Oder einen Ökofreak, den ich mit Lammschulterhieben umgedreht hätte.
Aber nein.
Ein Erzengel.
Mit himmelblauen Augen.
58 Jahre alt. (Achtundfünfzig. Beinahe sechzig.)
Und Gefängnisdirektor.
Die Blicke flossen in eins, und von dieser Intensität im Himmel gehalten, hörte die Erde auf sich zu drehen. Irgendwo in der Stille der Gänge spielte schwermütig ein Cello auf. (Ich erinnere daran, dass all dies in einem Gefängnis vor sich ging.) Als wäre das ein Signal, schleuderte der Erzengel mit einer graziösen Kopfbewegung die weiße Strähne aus der Stirn und sagte:
»Wir haben Besuch, Francois?«
»Ja, Herr Direktor«, erwiderte der alte Wärter.
Von diesem Moment an hatte Clara unser Haus verlassen.
»Aber sag mal«, fragte Loussa und setzte sein Glas ab, »was genau machen deine Knackis da eigentlich in deinem Traumgefängnis?«
»Erstens sind das weder meine Knackis noch mein Gefängnis. Und zweitens machen sie alles, was irgend mit Kunst zu tun hat. Schreiben, Malen, Bildhauerei, es gibt ein Streichquartett, ein Kammerorchester und eine Theatertruppe …«
Jaaa … Saint-Hiver ist der Überzeugung, dass ein Mörder ein schöpferischer Mensch ist, der sein Fach noch nicht gefunden hat (die Kursivierung stammt von ihm), und so verfiel er in den Siebzigerjahren auf diese Gefängnis-Idee. Als Ermittlungs- und später als Strafvollstreckungsrichter hatte er genügend Gelegenheit zu sehen, was der normale Knast anrichtet, er sann auf ein Heilmittel und drückte es den übergeordneten Instanzen allmählich sanft aufs Auge, und siehe da: es funktioniert … es funktioniert seit zwanzig Jahren … Umwandlung der destruktiven Energie in schöpferischen Willen (die Kursivierung erneut von ihm) … an die sechzig Mörder, die er zum Kienstler konvertiert hat (die Aussprache stammt von meinem Bruder Jérémy).
»Ein ruhiges Fleckchen für mein Rentnerdasein, summa summarum.«
Loussa geriet ins Träumen.
»Ich könnte meinen Lebensabend der Übersetzung des Bürgerlichen Gesetzbuches ins Chinesische widmen. Wen muss ich umbringen?«
Unsere leeren Gläser füllten sich wieder. Meines kreiste zwischen den Fingern. Ich versuchte, in den purpurnen Tiefen des Sidi-Brahim die Zukunft meiner Clara zu lesen. Aber mir fehlten die Gaben von Thérèse.
»Clarence de Saint-Hiver, findest du das nicht unglaublich, dass jemand Clarence de Saint-Hiver heißt?«
Loussa fand das nicht unglaublich.
»Der Name stammt aus der Karibik, wahrscheinlich aus Martinique. Im Grunde«, fügte er hinzu, »frage ich mich, ob du nicht vor allem verschnupft bist, weil deine Schwester einen weißen Farbigen heiratet …«
»Mir wärs lieber, sie hätte dich geheiratet, Loussa, einen schwarzen Farbigen, mit deinem roten Lieferwagen voller chinesischer Literatur.«
»Oh, ich, ich taug nicht mehr viel! Mein linkes Ei ist zusammen mit meinem Ohr auf dem Beinacker von Montecassino geblieben …«
Plötzlich schlug der Wind um, und uns umschmeichelte das duftende Belleville. Merguez- und Minzgeruch. Unweit unseres Tisches drehte sich, bedächtig brutzelnd, ein Spieß. Ein Lammkopf steckte darauf, aufgespießt wie ein Hähnchen, und machte bei jeder neuen Umdrehung Julius dem Hund schöne Augen.
»Und Belleville?«, fragte Loussa unvermittelt.
»Wie, Belleville?«
»Deine Kumpel aus Belleville, was sagen die dazu?«
Gute Frage. Was sagte Hadouch Ben Tayeb, mein Freund aus Kinderjahren, zu dieser Heirat und was sein Vater Amar, Besitzer eines Restaurants, wohin der Malaussène-Stamm von jeher geht, was Yasmina, unser aller Mutter, und was Mo der Mossi und Simon der Kabyle, die beiden kleinen Könige des Kümmelblättchens zwischen Belleville und der Goutte d’Or, und Hadouchs roter beziehungsweise schwarzer Schatten, ja, was sagte diese eher ein wenig verschriene Gesellschaft dazu?
Antwort: Juxende Bestürzung.
»So was kann aber auch nur dir passiern, mein Bruder Benjamin …«
»Deine Mutter brennt mit dem Flic Pastor durch, und Saint-Hiver ehelicht dein Schwesterlein!«
»Stiefsohn von nem Bullen und Schwager von ner Wachtel, bistn feiner Kerl, Benjamin!«
»Und du, Benjamin, wen heiratest du demnächst?«
»Komm, nimm einen …«
Sie boten mir zu trinken an, die Freunde aus Belleville.
Aufrichtige Anteilnahme …
Bis zu dem Tag, an dem Clara mir die Möglichkeit zum Gegenangriff gab. Ich hatte sie zu Amar bestellt, es sei dringend, und sie saßen schon alle da, als ich kam. Beim Wangenkuss fragte mich Hadouch: »Gehts besser, mein Bruder Benjamin?« (seit der Ankündigung von Claras Hochzeit fragte mich Hadouch nicht mehr, ob es mir gut gehe, sondern ob es mir »besser« gehe, fand er witzig, der Blödmann …), und Simon grinste sein breitestes Grinsen:
»Was kündigst du uns diesmal an, haben deine Mutter und Pastor dir ein Brüderchen gemacht?«
Und Mo der Mossi, um nicht zurückzustehen:
»Oder hast du jetzt vielleicht bei der Polente angefangen?«
Aber ich, während ich mich mit Leichenbittermiene setzte:
»Viel schlimmer, Leute …«
Ich holte tief Luft, dann fragte ich:
»Hadouch, du hast Clara auf die Welt kommen gesehen, weißt du noch?«
Hadouch kapierte als Erster, dass es ans Eingemachte ging.
»Ja, wir waren zusammen, als sie zur Welt kam, doch.«
»Du hast sie trockengelegt, ihr den Hintern abgeputzt, als sie klein war …«
»Ja.«
»Und später hast du ihr Belleville beigebracht, du bist sozusagen ihr Straßenpate. Im Grunde ist es dir zu verdanken, wenn sie von dem Viertel so schöne Aufnahmen gemacht hat …«
»Wenn du meinst, ja …«
»Und du, Simon, als sie größer wurde und anfing, den kleinen Gaunern den Kopf zu verdrehen, da hast du sie wie ein Bruder beschützt, oder?«
»Hadouch hat mir gesagt, dass ich auf sie aufpassen soll, ja, aber auch auf Thérèse und auf Jérémy und jetzt auf le Petit, sind doch alle ein bisschen unsere Familie, Ben, wir wolln doch nicht, dass sie irgendeinen Blödsinn verzapfen.«
Hier legte ich ein Lächeln auf von der Art, wie nur schöne fette Andeutungen es gestalten können, und wiederholte langsam, ohne den Kabylen aus dem Auge zu lassen:
»Du sagst es, Simon: Clara gehört ein bisschen zu deiner Familie …«
Dann, an Mo den Mossi gewandt:
»Und als Ramon versuchte, sie anzufixen, da hast du ihm den Schädel gegen einen Brückenpfeiler gedonnert, Mo, oder täusche ich mich?«
»Was hättest du denn an meiner Stelle gemacht?«
Mein Lächeln wurde noch sonniger.
»Dasselbe, Mo, was heißt, dass du so gut wie ich ihr Bruder bist … oder beinah.«
Hier überließ ich es der Stille, zu wirken. Dann sagte ich:
»Es gibt ein Problem, Leute.«
Ich ließ sie noch ein paar Sekunden schmoren. Dann:
»Clara möchte euch auf ihrer Hochzeit haben.«
Stille.
»Alle drei.«
Stille.
»Sie möchte Mo und Simon als Trauzeugen.«
Stille.
»Sie möchte am Arm deines Vaters die Kapelle betreten, Hadouch, und mit Yasmina auf der anderen Seite, und Nourdine und Leila möchte sie als Brautkinder.«
Stille.
»Sie möchte, dass du und ich hinter ihr die Kapelle betreten. Direkt hinter ihr.«
Hier unternahm Hadouch einen Ausbruchsversuch.
»Aber was haben denn Moslems wie wir auf einer christlichen Hochzeit verloren?«
Ich hatte eine Antwort parat.
»Heutzutage kann man seine Religion wählen, Hadouch, aber seinen Stamm noch nicht. Und der Stamm von Clara, das seid ihr.«
Umzingelt. Hadouch gab den Befehl zur Kapitulation.
»Okay. Welche Kirche? Saint-Joseph in der Rue Saint-Maur?«
Und da gab ich ihnen mit sehr bedächtigen Worten den Rest.
»Nein, Hadouch, sie möchte in der Gefängniskapelle heiraten. Oder wenn dir das lieber ist, im Knast …«
4
Ja, weil mir nämlich zu allem Überfluss noch die große Glaubenskrise geboten wurde. Bis dahin war Clara in der Auffassung erzogen worden, dass man den Menschen zwar lieben müsse, doch eher gegen Gott und einige andere tödliche Überzeugungen. Tja, und plötzlich hatten Clarence und sie ihr Zusammentreffen dem Konto irgend so einer Allmacht gutgeschrieben. Und Clarence, dieser Guru der Kreativ-Kriminalität, hatte mir seine überschlanken Finger auf die Schultern gelegt und mit flüchtigem Lächeln (schließlich sind Engel nichts anderes als Nestflüchter) gemurmelt:
»Benjamin, warum weigern Sie sich anzuerkennen, dass unsere Begegnung in den Bereich der Gnade fällt?«
Kurz und gut, eine jahrelange Erziehung für die Katz, weiße Hochzeit in der Knastkapelle mit kirchlichem Segen durch die geistliche Höchstinstanz der französischen Knastologie, wie den Hochzeitsanzeigen zu entnehmen ist. Reliefdruck, die Hochzeitsanzeigen, Saint-Hiver versteht zu leben. Zweimal standesamtlich getraut, zweimal geschieden, überzeugter Positivist, bekennender Verhaltenstherapeut, und nun die Heirat mit einer Halbwüchsigen in Weiß vor dem Altar! Clarence de Saint-Hiver …
Ich drehe mich in meiner Koje um, ich suche Julies Brüste. Clarence de Saint-Hiver … »warum weigern Sie sich anzuerkennen, dass unsere Begegnung in den Bereich der Gnade fällt?« … Schwachkopf, aber feste.
»Reg dich ab, Benjamin, schlaf, sonst bist du morgen völlig erledigt.«
Habe nie etwas menschlich Wärmeres gefunden als Julies Brüste.
»Vielleicht hält es ja nicht lange, vielleicht versucht sich Clara gerade an einem ersten Entwurf von Liebe … hm, Julie … was denkst du?«
Man kann Paris schlafen hören. Julies Zeigefinger lockt verträumt eine meiner Haarsträhnen.
»Die Liebe macht keine Entwürfe, Benjamin, das weißt du genau, sie schreibt jedes Mal direkt ins Reine.«
(Zum Haareraufen, ja …)
»Und warum wünschst du ihr eigentlich, dass sie den Typen nicht liebt, den sie heiratet?«
(Weil er ein falscher Fuffziger ist mit seinen frommen sechzig Jahren, verdammt, weil er eine Oberwachtel ist und weil er schon andere gevögelt und fallen gelassen hat!) Da diese Antworten vor keinem Richter Bestand haben, behalte ich sie für mich.
»Weißt du, dass du mich noch eifersüchtig machst?«
Das ist keine wirkliche Drohung, Julie sagt das im Halbschlaf.
»Dich liebe ich bis ans Ende meiner Tage«, antworte ich.
Sie dreht sich zur Wand und sagt nur:
»Jeden Tag reicht mir.«
Julies Atem hat seinen Kreuzfahrtrhythmus gefunden. Ich bin der Einzige, der noch wach ist, in dem ehemaligen Haushaltswarenladen, der uns als Wohnung dient. Außer vielleicht noch Clara. Ich stehe auf. Ich gehe ins Erdgeschoss nachschauen … aber von wegen, sie schlummert wie eh und je in lebensgeschützten Tiefen. Auch die andern schnarchen in ihren Doppelstockbetten. Thian hat ihnen ein Kapitel aus seinen Alten Damen erzählt. Jérémy ist darüber offenen Mundes eingeschlafen, und le Petit hat vergessen, seine Brille abzusetzen. Thérèse liegt wie gewöhnlich brettsteif da, als ob sie im Stehen eingenickt und von jemandem ins Bett gepackt worden wäre, der darauf bedacht war, sie nicht zu knicken. Julius der Hund schläft mitten unter diesem Völkchen, und seine Lefzen schmatzen wie ein Wörterbuch, in dem geblättert wird.
Über Julius: Verduns Wiege. Verdun ist die Jüngste und zornmütig auf die Welt gekommen. Sie schläft wie eine entsicherte Granate. Nur der alte Thian kriegt sie dazu, das Leben zu schlucken. Deshalb neigt er, sobald sie aufwacht, sein Gesicht über die Wiege, damit die Granate einwilligt, nicht zu explodieren.
Über einem Stuhl liegt besagtes weißes Kleid, es schwebt in der Dunkelheit wie das Phantom des Glücks. Yasmina, die Mutter von Hadouch und Frau von Amar, war am Abend zu einer letzten Anprobe mit Clara hier. Noch so eine schöne Geschichte … Typisch Malaussène-Stamm! Ich hatte Maman angerufen, um ihr die Nachricht von der feinen Vermählung mitzuteilen. »Wirklich?«, sagte Maman drüben in Venedig, dem anderen Ende unserer Leitung, »Clara heiratet? Gib sie mir, mein Kleiner, sei so lieb!« – »Sie ist nicht zu Hause, Maman, sie kauft ein …« – »Na, dann sag Clara, ich wünsch ihr, dass sie so glücklich ist wie ich … Also, Küsschen, ich drück euch alle, meine Lieben … du bist ein guter Sohn, Benjamin.« Und klack, aufgelegt. Ernst, einfach so: »Ich wünsch ihr, dass sie so glücklich ist wie ich« … und aufgelegt. Seither kein Anruf, keine Mitteilung, komme nicht zur Hochzeit, nichts … Maman.
Folglich übernimmt Yasmina ihre Rolle. Solange ich denken kann, waren Yasminas Rockschöße immer unsere eigentliche Mutter.
Ich gehe mir einen Stuhl aus der Küche holen, ich stelle ihn zwischen meine Schläfer, diese lieben Erzeugnisse mütterlicher Lieben, ich hocke mich rücklings auf den Stuhl, und die Arme auf der Lehne verschränkt, den Kopf auf die Arme gebettet, tauche ich ab.
Na ja … Ich tauche zwar, aber statt in Traumgewässern zu