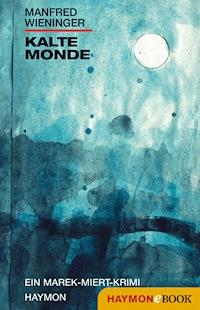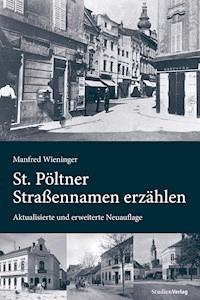Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Marek-Miert-Krimi
- Sprache: Deutsch
MAREK MIERT IST ZURÜCK: EIN NEUER FALL FÜR DEN KULTIGEN HINTERHOF-DETEKTIV. Marek Miert gehen die Aufträge nicht aus. Dubiose Gestalten stehen zu allen möglichen und unmöglichen Uhrzeiten vor der Tür des schwergewichtigen Hinterhof-Detektivs: Sei es eine ehemalige Liebschaft, die Miert als Babysitter engagieren will, sei es eine attraktive Studentin der Kriminalsoziologie, die eine Seminararbeit über ihn zu schreiben plant. Und dann schneit Marek Miert tatsächlich auch noch ein richtiger Ermittlungsauftrag bei der Tür herein: Ein eleganter Herr beauftragt ihn, das verwahrloste Grundstück seines eben verstorbenen Großvaters zu bewachen. Und schon ist der Ermittler mittendrin in der Suche nach der verschwundenen Beute eines Bankraubs. Zu seinem Schrecken muss er bald feststellen, dass sich neben ihm auch noch äußerst brutale Vertreter der Harlander Verbrecherszene daran beteiligen. Manfred Wieninger brilliert mit einer Detektivgeschichte zwischen amerikanischem Hard-Boiled-Stil und tiefschwarzem Humor. Sein sympathischer Ermittler Marek Miert beweist auch in seinem siebten Fall Sitzfleisch, einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, eine scharfe Zunge - und einen gesunden Appetit. - mit dem beliebten Harlander Diskontdetektiv Marek Miert - scharfsinnig, spannend, ironisch und abgründig - ein österreichischer Hinterhof-Krimi mit viel schwarzem Humor - in der Tradition amerikanischer Hard-Boiled Novels "Marek Miert ist schlagfertig und besitzt ein großes Herz. Wer den sympathischen Ermittler mit seinem ganz eigenen Charme noch nicht kennt, sollte das schleunigst ändern." "Schräg und ironisch, tiefschwarz und komisch, aber durchaus auch gesellschaftskritisch, ohne dabei bitter zu sein." Weitere Marek-Miert-Krimis: - Prinzessin Rauschkind - Rostige Flügel - Kalte Monde - Der Engel der letzten Stunde
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 246
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Manfred Wieninger
Der Mann mit dem
goldenen Revolver
Ein Hinterhof-Krimi
mit Marek Miert
Manfred Wieninger
Der Mann mit dem goldenen Revolver
»Wie hast du mich gefunden?«, fragte ich die Frau, die spätabends vor meiner Wohnungstür stand, leicht verblüfft.
»Mein Gott, Miert! Du stehst im Telefonbuch und dein Foto ist öfter in den Lokalzeitungen, als du denkst, wenn du wieder einmal mit einem deiner idiotischen Fälle in die Bredouille geraten bist«, antwortete die Frau, die – wie ich mich zu entsinnen glaubte – Adriana hieß, oder auch Daniela oder sonst wie, gereizt. Ihr Nachname war mir sowieso unbekannt, tutto completo.
Ihr blasses, ovales Gesicht mit der feingliedrigen Nase unter dem brünetten Pagenkopf war mir besser im Gedächtnis geblieben. Sie war kleiner, als ich sie in Erinnerung hatte, und steckte in ausgewaschenen Jeans und einem bis zum Hals zugeknöpften dunkelgrünen Parka. Erschöpft sah sie aus und irgendwie mitgenommen. Eigentlich konnte ich mich kaum an sie erinnern, nur an eine ziemlich desaströse Nacht in einem Lokal am Schießstattring vor vielleicht einem Jahr, in der ich an einem guten Dutzend Caipirinhas sozusagen zerschellt und am Morgen danach in ihrer Garçonnière bei der Hesserkaserne – genauer gesagt: in ihrem Bett – aufgewacht war. Schon damals hatte ich mich post festum an nichts mehr erinnern können, außer an den brasilianischen Zuckerrohrschnaps, den ich bei Gott nie wieder trinken werde. Frühmorgens, während sie noch unruhig wie eine arme Seele schlief, hatte ich die winzige Wohnung verlassen, um daheim meine heftigen Kopfschmerzen auszukurieren und meinen Brand mit Kamillentee und Ähnlichem zu löschen. Viel mehr als ihren Vornamen hatte ich in dem Lokal nicht mitbekommen, und eigentlich nicht einmal den.
Das Beunruhigende, das wirklich Beunruhigende an der Frau war das Baby, das sie in einem dunkelblauen Tragegeschirr über Bauch und Brust trug. Neben ihrem rechten Fuß stand eine übergroße, abgenutzte schwarze Reisetasche.
Heiliger Bimbam, dachte ich, solche Situationen kommen doch eigentlich nur in schlechten Kabarett-Programmen und in diesen verlogenen Herzschmerz-Filmchen im Fernsehen vor, aber doch nicht in der Wirklichkeit!
»Wie geht es dir?«, fragte ich einfallslos, um das Schweigen zu brechen.
»Seit wann interessierst du dich dafür, wie es mir geht?«, gab meine spätabendliche Besucherin schmallippig zurück.
Okay, dachte ich, 1:0 für sie.
»Willst du mich, nein uns, nicht wenigstens hereinbitten?!«, fragte die Frau in spitzem Tonfall.
Es war ein kühler, eintöniger Septemberabend, der sich wie Strudelteig bis in die Nacht gezogen hatte. Ich hatte mehrere Partien Schach gegen mich selbst gespielt und jedes Mal verloren. Dazu hatte ich eine Flasche eines unkomplizierten Röschitzer Zweigelt getrunken.
»Natürlich«, antwortete ich und machte die Tür frei.
Schon seit Tagen hatte niemand angerufen, hatte sich niemand für mich interessiert. Auch Kundschaft hatte sich keine blicken lassen. Nicht einmal ein paar Zeugen Jehovas hatten bei mir geklingelt. Eigentlich, dachte ich, war ich so gefragt wie der Tod.
Die Frau, die Adriana oder Daniela oder sonst wie hieß, ging ein wenig in die Knie, um die Reisetasche aufzuheben, und marschierte dann ganz langsam an mir vorbei. Das Baby im Tragegeschirr schlief. Es hatte eine helle Haut mit orangen Stellen und einen unwahrscheinlich großen, völlig kahlen Kopf.
Meine späte Besucherin ließ sich nach den wenigen Schritten in mein Wohnbüro hinein auf der nächstbesten Sitzgelegenheit nieder; auf einem der hohen, unlackierten Eichenstühle, die ich selbst irgendwie patschert fand und auf dem für gewöhnlich meine Klienten Platz nahmen. Also all die Gauner und Verbrecher, die Lügner und Betrüger, all die Dr. Seltsams und Geistesgestörten, die Mühseligen und Beladenen, die mich gelegentlich mit unmöglichen Dingen und seltsamen Erledigungen beauftragten. Damit verdiente ich mehr schlecht als recht meinen Lebensunterhalt. Meine moralische Grundlage bei diesen Aufträgen war meistens selbstgezimmert, und manchmal überschritt ich Grenzen, die man besser nicht überschreiten sollte. Aber die Entscheidung darüber lag immer bei mir – jedenfalls bildete ich mir das ein.
Die Reisetasche stellte die Frau mit dem Baby wieder neben ihrem rechten Fuß ab. Im Übrigen blieb sie sitzen, wo sie saß, und rührte sich nicht. Sie machte auch keinerlei Anstalten, wieder aufzustehen und in die kleine Wohnung hinter meinem Büro weiterzugehen.
Na ja, dachte ich, im Grunde hat sie schon recht – viel mehr als ein altes Reiseschach und ein paar mittelprächtige Weine hatte meine Wohnung schließlich auch nicht zu bieten. Auch der Wohnungsinhaber war nicht gerade eine Attraktion.
Höchstwahrscheinlich falscher Alarm, dachte ich, und der Pamperletsch geht dich gar nichts an. Das ist nur eine Klientin. Vielleicht will sie bloß, dass ich ihren Exfreund zusammenschlage oder ihren Erbonkel beschatte oder auch umgekehrt.
Ich ging um die voluminöse Reisetasche herum, umrundete meinen Schreibtisch und setzte mich auf den Rollsessel aus rostrotem Kunstleder, zweifellos das Prunkstück meiner Büroeinrichtung, die ich samt und sonders auf einem kirchlichen Flohmarkt erworben hatte. Die hatten mir fast noch etwas bezahlt dafür, dass ich ihnen den ganzen Krempel in Bausch und Bogen abnahm.
Weil ich nicht recht wusste, was ich mit meinen Händen anfangen sollte, schob ich einen Packen unbezahlter Rechnungen und Mahnungen auf der Schreibtischplatte von links nach rechts und dann doch wieder nach links zurück.
»Ich gehe in einen Kibbuz«, ließ mich die Frau, die ich in einer Art verzweifelter Arbeitshypothese noch immer für eine Klientin hielt, wissen, »für ein paar Monate.«
Das Baby vor ihrer Brust bewegte die Lippen, als versuchte es, im Schlaf mit geschlossenem Mund zu schreien.
»Aha«, bemerkte ich eloquent.
»Die Stadt heißt Arad. Die Männer dort tragen hohe weiße Seidenstrümpfe, Knickerbocker aus schwarzem Stoff und fellbesetzte Mützen mit Streifen aus rotem Fuchs. Die Frauen tragen Perücken, auch wenn sie jung sind. Es ist eine schöne, moderne Stadt. Ich habe Fotos im Internet gesehen.«
»Aha«, sagte ich wieder.
»Die Marktfrauen, die Salat und Radieschen verkaufen, haben breite Patronengurte und großkalibrige Colts um die Hüften geschnallt. Ich habe mir Fotos vom Ausflug einer Kindergartengruppe angeschaut. Die Kinder Hand in Hand in Zweierreihen, angeführt von einer Kindergartentante mit schussbereiter Uzi. Die Nachhut hat die Kindergartenhelferin ebenfalls mit einer automatischen Schusswaffe gebildet. Es ist eine Stadt der Pioniere. Als Frau muss man sich dort unheimlich stark fühlen.«
»Mhm«, machte ich und fügte einigermaßen ratlos hinzu: »Unheimlich, ja.«
»Rund um die Stadt ist Wüste, an allen Ecken und Enden nur Wüste. Diesmal kann ich nicht davonlaufen, diesmal werde ich es zu Ende bringen! Verstehst du, Miert?«
»Verstehe«, antwortete ich, obwohl ich nicht das Geringste verstand.
»Ein paar Monate in diesem Kibbuz und alles wird anders«, sagte die junge Frau mit dem Baby träumerisch.
»Du musst dich selbst finden?«, fragte ich vorsichtig.
»Red keinen Schwachsinn, Miert!«, antwortete die Frau, die Adriana oder Daniela hieß. »Mir ist im Moment einfach alles zu viel. Ich muss eine Auszeit nehmen.«
»Auszeit?«
»In der Tasche sind Windeln, Wischtücher, die Geburtsurkunde, der Mutter-Kind-Pass, Flascherl, Schnuller und alle Babysachen, die ich mir halt leisten konnte. Ja, und auch ein Buch über Säuglingspflege«, erklärte die Frau, die Adriana oder Daniela oder vielleicht auch Clarissa hieß. »Außerdem ein Gerät zum Milchabpumpen. Aber das wirst du nicht brauchen. Er ist schon abgestillt.«
»Er? Abgestillt?«, wiederholte ich blöde.
»Das Buch heißt Säuglingspflege für Dummies, ein Basis-Grundkurs, der keinerlei Vorkenntnisse voraussetzt.«
Da bin ich aber beruhigt, dachte ich.
Beunruhigenderweise begann meine späte Besucherin nun, diverse Druckknöpfe, Schnallen und Laschen an dem Tragegeschirr vor ihrer Brust zu lösen.
»Ich hab einfach niemand anderen als dich, Miert«, sagte sie.
»Das kannst du aber jetzt nicht ernst meinen!«, antwortete ich in aufkeimender Panik.
»Ich melde mich bei dir, wenn ich wieder zurück bin! Versprochen!«
»Das ist aber nett«, antwortete ich.
Mit einem Mal lag das Baby auf meinem Schreibtisch und seine Mutter erhob sich plötzlich von meinem Eichenstuhl.
»Entschuldige mal, das kann doch jetzt unmöglich dein Ernst sein!«, protestierte ich.
»Soll ich ihn im Waisenhaus abgeben? Oder im Wald aussetzen? Oder dem Bürgermeister vors Büro legen?«, schoss die Frau eine Reihe von rhetorischen Fragen auf mich ab.
Sie hat sich von dem Kind, dachte ich, überhaupt nicht verabschiedet, kein Busserl, kein Kuss, nicht einmal eine flüchtige Berührung mit der Hand.
»Das habe ich nicht gesagt, aber es wird doch um Himmels willen irgendjemand anderen geben!!«, protestierte ich heftiger.
»Es gibt nur dich, Miert«, sagte sie auf dem Weg zu meiner Wohnungstür leise, »es gibt nur dich!«
Mamma mia, dachte ich, als das Baby plötzlich aufwachte und wie am Spieß zu brüllen begann. Aber da hatte seine Mutter schon die Tür hinter sich zugemacht und war unterwegs in ein neues Leben.
Natürlich hätte ich der Frau, die Adriana, Daniela oder wie auch immer hieß, sofort nachrennen, sie notfalls an den Schultern packen und unaufhörlich auf sie einreden müssen wie auf einen kranken Esel, um sie doch zu bewegen, sich um ihr Kind zu kümmern und den Pamperletsch gefälligst wieder mitzunehmen. Stattdessen stand ich auf, stützte mich mit beiden Händen auf die Schreibtischplatte und starrte entsetzt auf das Baby. Sein verzweifeltes Weinen begann plötzlich und unvermutet in mein Herz zu schneiden. So ein Schlamassel, dachte ich.
Noch ein paar Sekunden hätte ich wie gesagt die durchaus realistische Chance gehabt, das Kind aufzunehmen, mit ihm in meinen Armen der Mutter nachzulaufen, sie einzuholen, an ihr mütterliches Gewissen oder die Stimme des Blutes oder sonst einen halbwegs glaubhaften Schmarrn zu appellieren und sie so dazu zu bringen, ihr Baby wieder mitzunehmen. Stattdessen stand ich bewegungslos vor dem brüllenden Bauxerl und starrte verzweifelt auf meine riesigen roten Hände, auf meine klodeckelgroßen Pratzen, die zwar bei Schlägereien oder Abbrucharbeiten überaus hilfreich waren, mir aber überhaupt nicht dafür geeignet erschienen, ein so winziges Wesen wie einen menschlichen Säugling anzugreifen und hochzuheben. Vor allem hatte ich eine Heidenangst davor, das Kind mit diesen Mordstrummhänden irgendwie zu quetschen und zu verletzen. So verpasste ich die Chance, die Mutter doch noch abzufangen. Im Verpassen von Chancen war ich immer schon ganz groß gewesen.
Jetzt habe ich doch glatt vergessen zu fragen, dachte ich bestürzt, wie das Baby eigentlich heißt.
***
»Weiß du eigentlich, wie spät es ist, Miert?!«, seufzte Miranda ins Telefon.
Ich liebe ihre Schlafzimmerstimme, dachte ich versonnen. Auch, wenn ich ihrem Schlafzimmer nie näher gekommen war als etwa dem Büro des amerikanischen Präsidenten oder dem Versteck von Osama bin Laden. Das Baby hatte ebenso schlagartig zu brüllen aufgehört, wie es damit begonnen hatte. Es lag ganz ruhig auf dem Rücken und versuchte, ein Stück von seiner eigenen Nase abzubeißen, oder, als ihm das nicht gelang, wenigstens die eigene Oberlippe mit der Unterlippe zu verschlingen.
Das Baby hieß Manuel Higatzberger, seine Mutter Manuela Higatzberger. Von einem Vater war in der Geburtsurkunde des Standesamtes Harland nicht die Schreibe. Weitere Dokumente oder nützliche Hinweise waren in der Reisetasche, die nach Milch und Verzweiflung roch, nicht zu finden gewesen. Immerhin ging aus der Geburtsurkunde hervor, dass Manuel drei Monate und zwei Tage alt war.
»Ich bitte dich, Miranda! Das ist ein Notfall! Ein absoluter Notfall!!«, flehte ich.
»Läufst du wieder Amok gegen einen ganzen Mafiaclan? Haben sich deine sämtlichen Gläubiger gegen dich verschworen und sind zu Dutzenden in dein Wohnbüro eingedrungen, um dir dein Schach und ein paar verschimmelte Kürbiskerne wegzunehmen? Oder hast du gerade Oberleutnant Gabloner erschossen und ich soll jetzt auf einen Sprung bei dir vorbeischauen, um dir beim Zersägen der Leiche zu helfen?«
»Schlimmer«, antwortete ich. »Viel schlimmer.«
Miranda war leider Gottes nicht meine Freundin, aber vielleicht der letzte Freund, den ich noch hatte. Eigentlich war sie Sommelier im einzigen Haubenlokal Harlands, dem »Medici« am Riemerplatz. In Wirklichkeit hieß sie Güleser, aber diesen Namen hatte sie während der Ausbildung abgelegt. Mit einem solchen Namen konnte man hierzulande nur als Küchenhilfe oder Putzfrau Karriere machen. Nicht ablegen konnte sie glücklicherweise die mediterrane Fülle ihres langen, turmalinschwarzen Haares, die ägäische Sonnenhaut und die Augen von der Farbe der rauchigen Erde Anatoliens. Erhalten geblieben war der kleinen Person auch ein Figürchen jenseits allen kalifornisch-calvinistischen Fitnesswahns. Manchmal bildete ich mir ein, in sie verliebt zu sein, und mitunter besuchte sie mich in meinen Träumen. Ihr Gang war so aufregend wie eine Tretmine. Manchmal träumte ich von Seifenschaum und von ihren Beinen. Auch wenn sie vor etwas mehr als drei Jahren geheiratet hatte. Gemeinsam mit ihrem Ehemann hatte sie einen riesigen, verwahrlosten Weinberg in der Nähe von Stoitzendorf gekauft. Dort hatten die beiden einen der interessantesten Cuvées dieses Landes produziert, er wurde mit Preisen geradezu überhäuft. Nur zu gerne wäre ich an der Stelle ihres Mannes gewesen, um ihren Weinberg zu bestellen und ihre Trauben zu pflücken. Vor ein paar Wochen war sie jedoch völlig überraschend nach Harland zurückgekommen und hatte ihre alte Stelle wieder angenommen. Keine Spur mehr von einem Ehemann.
»Und weswegen rufst du mich zur Geisterstunde an und bringst mich um mein bisschen Schönheitsschlaf?«, fragte Miranda noch immer noch ziemlich enerviert, was ich ihr im Übrigen nicht verdenken konnte.
»Du brauchst doch keinen Schönheitsschlaf!«, protestierte ich im Brustton der Überzeugung.
»Weißt du eigentlich, was man in Kurdistan mit Idioten wie dir macht?«
»Sind das leicht die, die selbst bei den harmlosesten Verfehlungen immer gleich irgendwelche Körperteile abschneiden?«, scherzte ich matt.
»Ich lege jetzt sofort auf, Miert!«, drohte Miranda.
»Ein Findelkind ...«
»Was, bitte?«, fragte der Traum meiner schlaflosen Nächte verblüfft.
»Ich sagte es doch: ein Findelkind. Es ist circa 52 Zentimeter groß, es schreit und es stinkt. Und es ist süß, süßer als Baklava. Und ohne Zweifel echt. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich damit machen soll!«
Nicht sehr gentlemanlike verschwieg ich Miranda, dass ich durchaus der Vater dieses Findelkindes sein konnte, das im Übrigen überhaupt kein Findelkind war. Männer sind eben doch Schweine, dachte ich, ich bin da wahrscheinlich keine Ausnahme.
***
»Dir fehlt eine Wickelkommode, dir fehlt ein Kinderwagen, dir fehlt ein Maxi-Cosi, dir fehlt ein Stubenwagen, dir fehlt eine Babybadewanne, dir fehlt ein Fläschchensterilisator, dir fehlt eigentlich überhaupt alles, was man braucht, um ein Baby zu versorgen!«, informierte mich Miranda über meine Babypflege-Lage. »Am besten wird sein, du gibst das Findelkind morgen beim Jugendamt ab. Oder beim Fundamt, so genau kenne ich mich da nicht aus.«
»Habt ihr eigentlich an Kinder gedacht, du und dein Mann?«, fragte ich.
»Mein Privatleben geht dich überhaupt nichts an, Miert!«, entgegnete Miranda kurz angebunden.
»Mein Privatleben, mein ganzes Privatleben ist seit einer Stunde dieses Baby«, antwortete ich. »Deswegen gebe ich es jetzt nicht gleich wieder her. Auf keinen Fall. Soviel ist einmal sicher.«
Miranda hatte mir quasi im Schnellsiedeverfahren beigebracht, wie man Manuel wickelte. Miranda hatte mir gezeigt, wie man aus etwas Sojamilch, Wasser und gekochten, passierten Kartoffeln einen wunderbaren Babybrei fabrizieren konnte. Vorausgesetzt, man verfügte über Milch, Erdäpfel, Passiersieb und Pürierstab. Wunderbarerweise hatte sie all dies mitgebracht und sich selbst gleich mit dazu. Sie trug Jeans und einen enganliegenden roten Rollkragen-Pulli. Und auch wenn sie ungeschminkt wie die Nacht war und ihre Frisur etwas Schwalbennestartiges hatte, sah sie, fand ich, einfach hinreißend aus.
»Gestern Nacht hätte ich gerne davon geträumt, dich pudelfasersplitternackt an ein Messingbett zu fesseln«, faselte ich, während Miranda versuchte, mit Bücher- und Papierstößen als seitliche Begrenzungen den Couchtisch in meinem Wohn-Schlafzimmer zu einem halbwegs brauchbaren Wickeltisch umzufunktionieren. »Aber es ist mir irgendwie nicht gelungen. Die Imagination, meine ich«, redete ich weiter Blech.
»Vollidiot«, meinte Miranda nur.
Das Baby, das bis dahin einigermaßen ruhig in meinen Armen geschlafen hatte, begann plötzlich zu lachen, ja geradezu krächzend zu kudern.
»Wenn meinst du jetzt damit, Manuel oder mich?«
»Willst du es schriftlich haben, Miert, dass du ein Vollidiot bist?!«
»Bist du geschieden, Miranda?«, fragte ich nun ernst.
»Was geht dich das an?«, fragte die Frau, in die ich möglicherweise schon seit Jahren verliebt war, zurück.
»Bist du?« Ich war gespannt.
In aller Ruhe stellte Miranda den provisorischen Wickeltisch fertig. Dann sagte sie: »Fast. Aber bilde dir ja nichts ein, Miert!«
»Du und ich, Miranda ...«, begann ich vorsichtig.
»Es wäre zu früh, viel zu früh ...«, schnitt sie mir das Wort ab.
»Vor drei Jahren war ich zu spät dran, viel zu spät. Ich möchte jetzt einfach nichts mehr falsch machen! Verstehst du, Miranda?«
»Du solltest rasch etwas unternehmen, Miert, dein Kühlschrank schaut nämlich aus, dass es einer Sau graust! Aber das Tuppergeschirr mit dem Erbsenreis habe ich trotzdem hineingestellt. Babys sind robuster, als man denkt.«
»Soll ich den Reis auch pürieren?«, fragte ich unbedarft.
»Klar doch. Ebenso wie die Käsekrainer und die Leberkäsesemmeln, die du dem Baby, wie ich dich kenne, sicherlich in ein paar Tagen füttern wirst.«
»Miranda …«
»Wo wird das Baby übrigens schlafen, Miert? Du kannst es ja nicht die ganze Nacht auf deinem Couchtisch liegen lassen!«
»In meinem Bett. Ich ziehe mich auf die Couch zurück«, entwickelte ich wieder einmal selbst eine Idee. Praktisch aus dem Nichts heraus.
»Dreh die Heizung höher und putz morgen unbedingt den Kühlschrank.«
»Gib mir eine Chance, Miranda.«
»Du hast offenbar schon der Mutter dieses Kindes eine Chance gegeben«, gab sie mit zornig blitzenden Augen zurück.
»Bis vor einer Viertelstunde habe ich nicht einmal ihren Familiennamen gekannt, geschweige denn ihren Vornamen.«
»Ich weiß, Männer sind Schweine.«
Das, dachte ich, habe ich jetzt gebraucht.
»Soll das heißen, dass du nicht über Nacht bleibst?«, fragte ich.
Daraufhin bekam Miranda einen mittelschweren Lachanfall.
Zehn Sekunden später war sie aus meiner Wohnung abgezischt wie eine F16.
***
Um sechs Uhr früh läutete es an der Tür meines Wohnbüros Sturm.
Das vierstöckige, abgewohnte Zinshaus, in dem ich logierte, lag hinter dem Hauptbahnhof zwischen einer kroatischen Grillstube und einer pleitegegangenen Peepshow, die jetzt einem Marktfahrer als Lager für seinen Kram diente. Die uralte Zinskaserne gehörte seit einiger Zeit einer Bank, ebenso wie fast das gesamte Gründerzeit-Grätzel. Alles sollte abgerissen werden. Für noch ein Einkaufs- oder Fachmarktzentrum, für noch einen Büroturm, für noch ein paar Garagen, für noch ein Hotel mit Wellnessoase oder für was auch immer. Für die einen sind Immobilien-Entwickler und ihre Architekten die letzten Visionäre, für die anderen schlicht und einfach Verbrecher. In meinem Haus gab es mittlerweile keinen Hausmeister mehr, kein Licht im Stiegenhaus, das Haustor ließ sich nicht mehr schließen, und manchmal fielen der Strom oder das Wasser aus – für ein paar Minuten, ein paar Stunden oder für ein paar Tage. Mein Nachbar im Erdgeschoß, ein pensionierter Postoberoffizial, war vor einiger Zeit ausgezogen. In den oberen Stockwerken wohnte beziehungsweise hauste wohl noch die eine oder andere Partei, wirklich sicher war ich mir da aber nicht. Man hatte mir eine Abfindung im Gegenwert von etwa zwei neuen Herrenhemden angeboten, wenn ich ebenfalls auszog. Aber ich fand, es wäre doch gelacht, wenn sich dieser Betrag nicht in die Höhe treiben ließe.
Der Jugendstil der Fassade war alt geworden. Zuletzt hatte man ihr wohl zu Zeiten des Bürgerkriegs oder noch früher einen neuen Anstrich gegönnt. Die üppige florale Ornamentik der Fassadengestaltung war längst zu einer Gefahr für Passanten geworden, so brüchig waren die Verputz- und Mauerteile schon. Die Bank hatte die Fassade daher vor einem Jahr mit einem riesigen, dunkelgrünen Baunetz verhängen lassen. Ähnlich trist sah es im Stiegenhaus aus, wo keiner mehr die herabgefallenen Sandstein-Bröckchen und den Ziegelstaub wegkehrte, vom übrigen Müll, etwa gebrauchten Kleenex und Präservativen, ganz zu schweigen. Denn weil das Haustor wie gesagt defekt war und nach meinem Ermessen in diesem Jahrzehnt auch nicht mehr repariert werden würde, nützte gelegentlich die eine oder andere Schöne der Nacht vom nahen Rotlichtrevier den Hausflur des Erdgeschosses als Empfangs- und Arbeitsräumlichkeit. Wenn es daher nächtens vor meinem Wohnbüro grummelte und grammelte oder gar an meiner Tür scharrte, war ich auch im Halbschlaf in der Lage, einen scharfen Wachhund, mindestens einen Dobermann, zu markieren und entsprechend glaubhaft zu bellen. Ich war vor ein paar Jahren hier eingezogen, als mein Einkommen gerade so üppig sprudelte wie ein seichter Brunnen in der tiefsten Sahara und meine Ersparnisse unweigerlich zur Neige gingen. Daran hatte sich kaum etwas geändert, außer dass es längst keinen Spargroschen mehr gab, deshalb war ich noch immer hier. Wenigstens gab diese Büroadresse potentiellen Kunden gleich einen treffenden Eindruck davon, wie billig ich war. Höchstens mein Dickschädel konnte sie teuer zu stehen kommen. Ansonsten war ich wohl der erste Diskont-Detektiv Harlands. Vielleicht war das ja, zumindest hatte ich das anfangs geglaubt, eine Marktlücke. Langsam, aber sicher begann sich dieser Glaube jedoch zu verflüchtigen.
Sturmläuten an der Wohnungstür um sechs Uhr in der Früh war in diesem Wohnviertel kein gutes Zeichen. In der Hoffnung, dass Miranda es sich doch noch überlegt hatte, öffnete ich sofort, ohne erst wie gewöhnlich durch das Guckloch in der Tür zu spähen und trotz des unmöglichen Aufzuges, in dem ich steckte, trotz meines unvorteilhaften Behelfspyjamas, der aus einer löchrigen schwarzen Trainingshose und einem verwaschenen orangen T-Shirt der LA Lakers bestand. Vor mir stand aber keineswegs die Perle Anatoliens, sondern Manuela Higatzberger. Sie war, so kam es mir jedenfalls vor, noch kleiner als gestern Abend. Ihre Augen waren verweint, ihr Mund von Schmerz zerfasert. Ihr dunkelgrüner Parka roch nach schweißiger Verzweiflung.
»Schalom«, scherzte ich matt, »schon wieder zurück aus dem Kibbuz?«
Für meine unpassenden Bemerkungen, dachte ich, bin ich absolut zu Recht mehr berüchtigt als berühmt. Aber da war der flapsige Sager, der noch dazu so unnötig wie Frostbeulen war, leider schon heraus.
Ohne mich einer Antwort zu würdigen – ich konnte es ihr nicht verdenken – trat Manuela über die Schwelle und drängte sich noch immer wortlos an mir vorbei. Ich trat rasch einen Schritt zurück, um ihrer Entschlossenheit Raum zu geben.
Meine Augen waren viereckig. Auf einem Sessel am Fußende meines Bettes hatte ich die halbe Nacht vor dem darin ruhenden Manuel Higatzberger gewacht. Aus Angst, das Bauxerl im Schlaf zu erdrücken, wenn wir beide im selben Bett schliefen. Das Baby hatte glücklicherweise einen ruhigen Schlaf, gelegentlich unterbrochen von dezenten Rülpsern und Fürzen, die wohl auf das Konto meines Kartoffelbreis gingen.
Manuela Higatzberger war gekommen, um ihr Baby zu holen. Das war eindeutig. Und es war auch schön.
Ich setzte mich auf einen der unbequemen Eichenstühle im Vorzimmer meines Wohnbüros und ließ ihr Zeit. An meine unverhoffte Vaterrolle hatte ich mich noch nicht gewöhnt, nicht einmal ansatzweise, da war es damit auch schon wieder vorbei.
Aus meinem Wohnschlafzimmer hörte ich das glucksende Lachen des Babys.
Vielleicht wäre ich sogar ein guter Vater geworden, dachte ich, obwohl das nüchtern betrachtet doch eher unwahrscheinlich war. So ehrlich musste man schon sein, auch zu sich selbst. Mein Leben bestand aus einer Kette von bösen Zores, peinlichen Pannen und schlimmen Schlägereien. Außerdem war ich praktisch permanent pleite. Nicht gerade die idealen Voraussetzungen für ein Vaterdasein.
Manuela Higatzberger hatte es offensichtlich eilig, Manuel wieder mitzunehmen. Nach kaum drei, vier Minuten kam sie mit ihrem Buben im dunkelblauen Tragegeschirr über dem Bauch und der übergroßen, alten Reisetasche in der rechten Hand aus meinem Wohn-Schlafzimmer. Schweigend ging sie im Vorzimmer an mir vorbei und verließ die Wohnung.
Wofür hätte sie sich auch bedanken sollen, dachte ich.
Als das Baby fort war, saß ich noch immer unbeweglich im Vorzimmer auf dem unbequemen Eichenstuhl und rührte mich nicht. Nicht, dass ich mich leer wie eine Bar am Montagmorgen gefühlt hätte, aber so richtig wohl war mir auch nicht. Ich hätte Manuela zum Abschied gerne etwas Gutes, etwas Tröstliches, etwas Aufbauendes gesagt, aber so etwas gelingt Typen wie mir nur in amerikanischen Tragikomödien aus Hollywood. Robert Redford oder wenigstens John Belushi wären an meiner Stelle sicherlich großartig gewesen, ich dagegen brachte den Mund nicht auf.
Ich schloss die Wohnungstür und tappte zurück in meine Wohnschlafküche, aus der sich der Duft des Babys langsam verflüchtigte. Stattdessen begann es, wieder vornehmlich nach schlechter Küche, guten Weinen und tausend vertanen Chancen zu riechen. Anzunehmen, dachte ich, dass Manuela Higatzberger noch immer in der Garçonnière am Schießstattring wohnt. Wenn ich die Augen schloss und dabei konzentriert an Caipirinha dachte, konnte ich mich sogar an Details der winzigen Wohnung erinnern.
***
Ing. Scheibelreiter wollte kein Baby bei mir abgeben. Immerhin. Er sah auch nicht so aus, als ob er in einem Wüsten-Kibbuz ein neues Leben beginnen wollte. Schwarzer Nadelstreifanzug, silbergraue, sehr dezente Krawatte, manikürte Hände und eine aufwendige Föhnfrisur, die sicherlich mehr gekostet hatte, als ich in einem besonders schlechten Monat verdiente. In seiner rechten Hand trug er eine schwarze Gucci-Aktentasche, die, wenn sie keine Fälschung war, mehr wert war als mein Auto – sogar mehr als mein ganzes Leben. Nicht gerade die Art von Klienten, dachte ich, die normalerweise meine Kanzlei frequentieren. Als Arbeitshypothese musste ich leider davon ausgehen, dass sich Ing. Scheibelreiter irrtümlich in das Vor- und Empfangszimmer meines Wohnbüros verirrt hatte und seinen groben Irrtum bald erkennen würde, um meine Wohngegend daraufhin fluchtartig zu verlassen. Allein schon seine schwarzen, sicherlich handgenähten Lackschuhe waren wertvoll genug, um in meinem Grätzel dafür ein Messer in den Hals gesteckt zu bekommen. Im Übrigen war mein Besucher dünn wie der Wahrheitsgehalt eines Politiker-Versprechens, annähernd zwei Meter groß und hatte ein paar Pockennarben in einem glattrasierten, vogelartigen Gesicht. Irgendwie, fand ich, passte seine Physiognomie nicht recht zu seiner Dressed-for-Success-Adjustierung, aber bei Geschäftsleuten war Schönheit wohl eher nachrangig. Auf jeden Fall hatte er eine schöne Visitenkarte mit goldgeprägten Lettern auf beigem Büttenpapier auf meinen Schreibtisch gelegt.
Ing. Manfried Scheibelreiter, MBA
Real Estate Development
Darunter standen eine Anschrift im noblen ersten Bezirk der Bundeshauptstadt, eine Handynummer und eine E-Mail-Adresse.
Noch schöner als die Visitenkarte waren allerdings die beiden violetten 500-Euro-Scheine, die der Besucher unter die Visitenkarte gelegt hatte. Mit ihnen gewann Ing. Scheibelreiter, MBA auch meine vollste Aufmerksamkeit, obwohl er mich beim Frühstück gestört hatte. Erdäpfel mit Butter. Der Rest von Mirandas edler Lebensmittelspende, der nicht zu Brei für Baby Manuel verarbeitet worden war. Selbstredend steckte ich auch noch in meinem Behelfspyjama. Wahrscheinlich war ich weltweit der einzige Berufsdetektiv, der im Dienst Trainingshosen trug. Es war kaum eine Stunde her, seit mich Manuela Higatzberger genauso wort- und grußlos verlassen hatte, wie ich sie einst verlassen hatte.
»Mein Flieger geht in zwei Stunden und 37 Minuten. Also machen wir es kurz!«, meinte Ing. Scheibelreiter knapp.
Zeit ist Geld, dachte ich, jedenfalls seine Zeit, meine Zeit ist wohl nicht ganz so viel wert.
»Was machen wir kurz?«
Fragen war das Wichtigste in meinem Beruf. Und meinen Beruf verstand ich, auch wenn das oberflächlich betrachtet kaum zu glauben war, da ich damit kaum etwas verdiente und in einer Bruchbude hausen musste.
»Ich möchte Sie damit beauftragen, zwei Tage lang ein Haus zu bewachen, das ich kürzlich geerbt habe. Hier in Harland. Die Adresse ist Hinterholz 1. Es liegt einigermaßen abgelegen hinter der ehemaligen Panzerkaserne.«
»Von wem haben Sie dieses Haus denn geerbt?«, fragte ich.
»Von meinen Großvater Isidor Novy, der letzte Nacht im hiesigen Krankenhaus verstorben ist. Natürlich bin ich noch nicht dazu gekommen, seinen Nachlass zu sichten und zu bergen. Die nächsten zwei Tage bin ich auf einer unaufschiebbaren Geschäftsreise. Mein Flieger geht in zwei Stunden und 36 Minuten.«
»Warum beauftragen Sie nicht einfach den ÖWD, den österreichischen Wachdienst, oder irgendeinen anderen größeren Sicherheitsdienstleister?«, wollte ich wissen.
Anstatt die beiden Fünfhunderter einfach einzustecken und den Auftrag anzunehmen, dachte ich, über mich selbst verdrossen, stelle ich völlig überflüssige Fragen.
»Damit irgend so ein Halawachl von denen alle fünf bis sechs Stunden vorbeischaut, lustlos das Haustürschloss und die Fenster überprüft und dann wieder davonfährt? Bewachung heißt für mich, dass Sie die nächsten 48 Stunden in Hinterholz 1 verbringen werden, das heißt, dass Sie dort wohnen werden!«
Das war in der Tat ungewöhnlich, fand ich, auch das Dialektwort Halawachl, vor allem wenn es so ein geschleckter Businessman aus der Wiener City verwendete.
»Wenn Sie eine so umfassende Sicherung des Hauses für notwendig erachten, muss der Nachlass Ihres Großvaters ganz schön wertvoll sein. Worin besteht er?«
»Das hat Sie a nicht zu interessieren und b weiß ich das nicht. Worin er außer dem Haus besteht, meine ich. Mein Großvater Isidor Novy hat mit meiner Mutter, seiner einzigen Tochter, seit 46 Jahren kein Wort mehr gesprochen. Daher natürlich auch mit mir nicht. Ich habe ihn eigentlich so gut wie nicht gekannt.«
»Wieso sind Sie dann so sicher, dass Sie das Haus erben werden?«, fragte ich.
»Weil ich der einzige Enkel bin und er mir aus dem Krankenhaus mit der Post einen Haustorschlüssel und ein vor fünf Tagen handgeschriebenes, sicherlich gültiges Testament geschickt hat.«
Isidor Novy, dachte ich, hat gewusst, dass er bald sterben wird.
»Wie sind Sie gerade auf mich gekommen?«, konnte ich mir ein weiteres Nachfragen nicht verkneifen. Diese Frage hatte ich allen meinen bisherigen Klienten gestellt – und die meisten hatten mich glatt angelogen.
»Ich habe mich erkundigt. Sie sind alleinstehend und werden es schon zwei Tage lang aushalten, auch wenn es sich um das verwahrloste Haus eines uralten Mannes am Ende der Welt handelt. Nehmen Sie eine Campingliege und etwas Proviant mit«, antwortete Ing. Scheibelreiter und blickte auf seine Armbanduhr. Keine Protz-Rolex, aber auch nichts Billiges, ganz im Gegenteil. Eine Glashütte, schätzte ich.
»Die tausend Euro haben mich überzeugt«, sagte ich also, »ich übernehme den Auftrag.«
Wortlos legte Ing. Scheibelreiter einen kleinen, verchromten Schlüssel, vermutlich zu einem ganz gewöhnlichen Zylinderschloss, auf meinen Schreibtisch.
»Übrigens, welche Art von Immobilien, wenn ich fragen darf, entwickeln Sie?«
»Gefängnisse«, antwortete Ing. Scheibelreiter wie aus der Pistole geschossen.
»Gefängnisse?«, wiederholte ich zweifelnd.
»Ja. Wir, das heißt meine Gesellschaft, kaufen europaweit aufgelassene Gefängnisse auf und entwickeln sie zu Seniorenresidenzen.«
Wenn ich an die paar Altersheime dachte, die ich aus eigener Anschauung kannte, brauchte man da wohl gar nicht viel zu ändern. Im Wesentlichen den Namen.
***
Ein schlecht geschotterter, von Unkraut und Gräsern beinahe zugewachsener Feldweg zwischen einer schon vor Jahren aufgegebenen Panzerkaserne und den Fertigteilgebäuden eines deutsch-polnischen Baumarktes am westlichen Stadtrand von Harland zog sich hinter den beiden riesigen Arealen über einen sanften Hügel in den Probstwald. Irgendwo dahinter mochte Hinterholz 1 liegen.