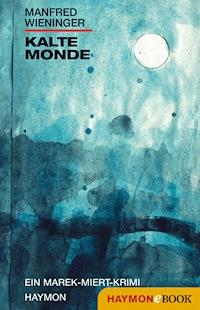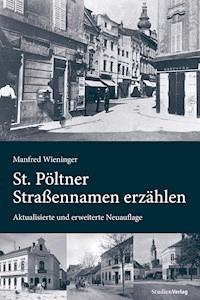Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Marek-Miert-Krimi
- Sprache: Deutsch
Marek Miert, der Privatdetektiv, sitzt trübsinnig im Café. Seine Karriere kommt einfach nicht in Gang. Da tritt ein Unbekannter an seinen Tisch und sagt: "Finden Sie heraus, wer ich bin." Dann verschwindet er. Neugierig geworden, macht Miert sich auf die Suche und landet vor einem Grabstein ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 137
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Haymon Verlag
Manfred Wieninger
FALSCHES SPIEL MIT MAREK MIERT
Kriminalroman
Haymon
© 2013
HAYMON verlag
Innsbruck-Wien
www.haymonverlag.at
Originalausgabe: Rowohlt Taschenbuchverlag Reinbek bei Hamburg 2001
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder in einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
ISBN 978-3-7099-7607-4
Umschlaggestaltung:
hœretzeder grafische gestaltung, Scheffau/Tirol
Probavisti cor meum et iniquitatem non invenisti.
„Sicher ist, daß nichts sicher ist.“Karl Valentin
I
Ich saß über der ersten Melange des Tages und fühlte mich nicht wohl.
Ich saß in meinem gewohnten Tankstellencafé an der Bundesstraße 1 vor der dampfenden Schale wartend auf den Tod oder einen Auftrag. Vor mir auf dem Tisch in bequemer Griffweite das Handy, das nie piepste. Eigentlich hätte ich mich wohl fühlen müssen, die Ersparnisse würden noch einige Zeit reichen, ebenso mein Eigensinn.
Das Café an der Tankstelle, ich besuchte es jeden zweiten, dritten Vormittag, war das nächste zu meinem Wohnbüro in der Birkengasse. Für gewöhnlich bog ich nicht allzu früh - gegen acht etwa - von der Birken- in die Sensengasse, vorbei am Kindergarten, querte die Josefstraße in Höhe des kleinen Supermarktes, ging eine gedeckte Passage hindurch zu den Bundesheerwohnblocks, auf deren Hauswegen ich bis zur Steinfeldstraße gelangte. Diese überquerend ging ich über die offenen Gartenanlagen der Krankenkassenwohnhäuser bis zur Rückseite der Tankstelle. Das daran angeschlossene Café, es trug den Namen der Mineralölfirma, betrat ich nach einem Blick auf die Bundesstraße immer durch den Hintereingang, wodurch es mir fast jedesmal gelang, den Kellner zu erschrecken.
Ich trank die erste Melange des Tages und fühlte mich nicht wohl. Ich hatte die rotblonde, mollige Mutter gesehen, die ihr halbschlafendes Kind wie immer verspätet in den Kindergarten brachte, den grünen Passat, der wie immer um diese Zeit zu schnell die Josefstraße entlang fuhr, die rotgestreifte Tuchent, die wie immer aus dem gleichen Fenster des ersten Heereswohnblocks hing, die hustende Hausmeisterin der Krankenkassenhäuser, die jeden Tag den Gehsteig kehrte, und das Glasauge des Kellners im Café. Ich hatte Milch und Urin aus dem Kindergarten gerochen, den vertrockneten Rasen zwischen den Mietskasernen, den Schotterstaub der Trottoirs, den warmen Brotgeruch der ausgeschüttelten Betten, das Benzol der Tankstelle, die Geschwindigkeit der Bundesstraße. Ich hatte das Geweine gehört, die Ottomotoren, die klappernden Absätze, den unsichtbaren Wind, das Brausen der Blechkarawane und das Zischen der Espressomaschine. Aber irgend etwas oder irgend jemanden hatte ich nicht gesehen, nicht gerochen, nicht gehört, irgend etwas fehlte, irgend etwas in meiner gewohnten Morgenmenagerie war nicht vorhanden, ausgelöscht, perdu.
Ich wollte darauf warten. Denn die Dinge (und die Menschen) verschwinden nicht einfach. Es bleibt immer etwas zurück, entweder ein Kratzer, eine unbezahlte Rechnung, ein Quantum Haß, oder das Verschwundene meldet sich auf einmal zurück wie ein Schleier Spinnweben, wie eine Ahnung des Unglücks, wie ein Traum, den man noch im Schlaf vergessen hat. Man mußte nur darauf warten können, eine sehr spezielle Art des Wartens praktizieren. Denn was man auf der Polizeischule nicht lernte, war das Warten. Das Warten auf nichts. Das interesselose, zwecklose Sammeln von Beobachtungen, von Details. Das Schlangenäugige.
II
„Ich weiß, wer Sie sind“, sagte der alte Mann, „Kellner sind so indiskret, wenn man mit ein bißchen Papiergeld wedelt.“ Er trug ein Pepita-Sakko, eine dunkelblaue Hose, seidenweiße Stutzen und ein Menjou-Bärtchen. Er hatte große rote Hände, Gold im Gebiß und an den Fingern sowie einen beeindruckenden Silberblick und war im übrigen proper wie ein Senior aus einer Hämorrhoiden-Werbung.
„Das ist ja kein Geheimnis“, dachte ich und antwortete mit einem unbestimmten Brummlaut.
„Ich beobachte Sie jetzt seit fast zwei Wochen, wie Sie mich beobachten. Wie Sie alle und alles in diesem Bumslokal beobachten. Sie haben Schlangenaugen.“
„Na schön“, sagte ich, um halt irgend etwas zu sagen.
„Ich war dabei, als eine junge Frau abgeholt wurde. Sie wollte ihre Häscher mit ein wenig Liebe bestechen. Wir haben sie nackt in den Viehwaggon geprügelt. Ich bin 78, aber daran erinnere ich mich immer noch gern.“ Er nahm die goldene Brille ab und wischte den Dunst seiner Gefühle - welcher Art auch immer - sorgfältig ab.
„Ihre Sache interessiert mich...“, meinte ich vorsichtig.
„In ein paar Monaten werde ich anfangen, zu Methan zu zerfallen. Aber ich will mich nicht beklagen.“
„Nicht?“
„Ich habe Glück gehabt im Leben. Ich bin Hans im Glück und werde es immer sein. Quod erit demonstrandum - Finden Sie heraus, wer ich bin.“
„Ich könnte den Kellner fragen.“
„Ganz so einfach ist es nicht.“
„Warum engagieren Sie einen Detektiv gegen sich selbst?“
„Eine Harlander Fürsorgerin hat einmal zwei betrunkenen Sowjetsoldaten auf der Suche nach Weiberfleisch den Weg zu einem zehn-, elfjährigen Mädchen, ihrem schutzbefohlenen Mündel, ein Stockwerk über ihr gewiesen, um selbst verschont zu werden. Ich habe diese fürsorgliche Frau ein Jahr später geheiratet. Ich verabscheue das Laue. Verstehen Sie?“
„Nein.“
„Ich rieche den Morgen nicht mehr, den frischen, grünen Morgen. Ich spiele gegen mich selbst, um nicht vor dem Fernseher zu verfaulen. Ich stelle die Welt noch einmal auf die Probe. Ein letztes Glücksspiel gegen das Schicksal, eine letzte Herausforderung Gottes.“
„Sind Sie auch Lyriker?“ Ich war mir jetzt fast sicher, es nur mit einem Suderanten, einem redseligen alten Mann zu tun zu haben. Aber eben nur fast.
Der Alte überging meine Frage und redete einfach weiter:“Provinz ist, wo man im Trainingsanzug einkaufen geht und die gleichen Burger ißt wie in allen Hauptstädten auch. Wo der Schrott aus Holywood drei Tage später anläuft als in Holywood selbst, und man diese kurze, aber wohltuende Schonfrist genießt. Wo man über die Funkausstellung in Berlin nur liest und Gottseidank nicht hinzugehen braucht. Wo man die modernen Architekten, diese wahren Terroristen, leider nicht mehr teert und federt, sondern ebenso ungehindert bauen läßt wie in New York, Rom oder Tokyo. Provinz gibt es nicht mehr. Provinz ist eigentlich nur mehr eine Metapher. Aber aus der Provinz stammen die großen Massenmörder und Musiker, jene, die der Welt eindringlich etwas zu sagen haben durch ihre Werke.“
„Sind Sie Musiker?“ fragte ich. Schließlich hatten die amerikanischen
TV-Anwälte die Fangfrage nicht für sich allein gepachtet.
„Finden Sie es heraus! - Und jetzt müssen Sie mich entschuldigen. Unser nettes, kleines Gespräch hat mich doch etwas angestrengt.“
„Was ist mit einer Anzahlung?“
„Ich übernehme Ihren Kaffee. Der ist sowieso überteuert hier.“ Der schöne Alte legte etwas Geld auf den Tisch, stand auf und bewegte sich zur Tür, steif, soldatisch, herrisch wie eine preisgekrönte Dogge.
Ich war seit Monaten schon aus dem Spiel und entsprechend eingerostet.
Seitdem ich mich geweigert hatte, einen BMW einfach aufzubrechen wie irgendein Strauchdieb, schickte die Intercash Factoring Bank längst einen anderen Büttel auf die Suche nach den teuren Limousinen, deren Besitzer die Leasing- oder Kreditraten nicht mehr bezahlen konnten. Der Gewerbeschein als Detektiv und die Eintragung ins Telefonbuch hatten sich als Flop erwiesen, das neue Handy blieb still wie der Tod. Morsch und müde durch das monatelange Nichtstun blieb ich einfach am Kaffeehaustisch sitzen und buchte den properen Senior in Gedanken bereits als Meschuggenen ab.
Aber dann dachte ich plötzlich an dessen Herrenmenschengang. So stolzierte nur einer, der einmal schwarze Stiefel angehabt und damit scharfe Tritte ausgeteilt hatte. Ich lief wie ein gereizter Hamster aus dem Lokal und sah den Alten noch wegfahren, langsam und gravitätisch wie auf Schienen in einem großen, beigen Mercedes. Ich notierte mir die Nummer wie irgendein Pfadfinder auf die Manschette meines Hemdes.
Ich hatte mich für meinen Beruf entschieden.
III
„Wissen Sie, wer das war?“ fragte ich den Kellner.
„Wissen Sie, daß Sie eigentlich nie Trinkgeld geben?!“ Das Glasauge blickte vorwurfsvoll. Jeden Morgen, den ich im Kaffeehaus verbracht hatte, war es pünktlich um halb zehn offenbar von seinem angetrauten Eheweib im Gastraum angerufen und wegen irgendwelcher häuslicher Verfehlungen zur Schnecke gemacht worden.
„Ich verspreche, mich entschieden zu bessern“, antwortete ich und legte einen kleinen Schein auf den Tisch.
„Kommerzialrat Gollwitzer - Ich freue mich immer wieder, wenn sich die Kommunikation mit einem Stammgast verbessert.“
„Was macht er so?“
„Es liegt an Ihnen, die Kommunikation weiter zu verbessern.“
Ich kannte alle verbalen Ausflüchte und Entschuldigungen, deren der Kellner fähig war. Aber vor allem wußte ich auch, daß er unter Druck wegbrach wie feuchter Zucker.
„Hören Sie, Sie haben dem Heini meinen Namen genannt, meinen Beruf und wahrscheinlich auch noch meine Hemdengröße. Ich könnte mich doch glatt bei Ihrem Chef über diese Indiskretion beschweren.“
„Okay, schon gut. Ich glaube, er hatte eine Drogerie in der Innenstadt. Aber das war vor meiner Zeit.“
„Wie hat der Waschlappen bloß sein Auge verloren? Doch nicht in einer Schlägerei?!“ fragte ich mich und entließ den Kellner mit einer Handbewegung. Das Telefon hinter der Theke läutete. Es war Zeit für die heutige matrimonale Abreibung. Aber anders als in den Monaten zuvor, blieb ich nicht sitzen, um zu lauschen.
IV
Die Tankstelle neben dem Café hatte ich eigentlich noch nie betreten, weil ich auftragslos meistens zu Fuß unterwegs war, um mein Konto zu schonen. Aber ich wußte, daß der Tankwart höchstwahrscheinlich ein Student war, der hinter der Kassa in dicken Folianten schmökerte. Mit dickglasiger Brille. Germanistenschicksal.
Die Mineralölfirma war zur Zeit, als Hitler in Wien aquarellierte, von einem mährischen Juden gegründet worden, einem ebenso mittelmäßigen Sonntagsmaler. Er hatte auch das Logo entworfen, das noch immer dasselbe war, obwohl die Tankstellenkette zuerst von der SS, dann von den Sowjets übernommen worden war und jetzt der Kommunistischen Partei gehörte. Die vorherrschende Farbe in der Geschäftsausstattung war lichtblau, der Sommerhimmel über Znaim vulgo Znojmo.
„Fehlt Ihnen etwas?“ fragte ich den Tankwart, der gerade in seiner Glaskabine Quittungen sortierte.
„Ja. Ungefähr 10.000 Schilling für einen Trip nach Aya Napa.“ Doch kein Germanist, sondern ein klassischer Philologe?
„Sonst noch etwas?“
„Mein Chef würde es sicherlich für absolut geschäftsschädigend halten, wenn ich mich in meiner Arbeitszeit mit einem Fußgänger abgebe.“
„Wie kann ich Sie dazu bewegen, doch noch darüber nachzudenken, ob etwas fehlt?“ fragte ich.
„Schwierige Frage.“
„Okay. Mir liegt wirklich daran. Heute ist ein besonderer Tag für mich.“
„Kommen Sie eigentlich für gewöhnlich ohne Psychopharmaka aus?“
„So gut wie immer.“
Der Tankwart begann wieder, in seinen Rechnungen zu blättern. Ich blieb einfach stehen wie ein Baum, der auf den Herbst wartet.
Ohne von seiner Zettelwirtschaft aufzublicken sagte der Tankwart: „Sehen Sie die Brücke?“ Südlich der Tankstelle führte eine Fußgängerbrücke über die Bundesstraße. „Der Verrückte mit der weißen Kapitänsmütze und dem Haarföhn im Anschlag fehlt - keine täuschend echt imitierten Tempomessungen mit der Laserpistole heute, keine Autofahrer, die sich mit quietschenden Reifen einbremsen.“
„Ist das der gleiche, der auch mit Stoppuhr und Diktiergerät Autos registriert?“
„Exakt. Roberto Blanco. Er kauft immer seine Zigaretten bei mir im Tankstellenshop, das heißt, eigentlich versucht er sie zu schnorren.“
„Und er heißt wirklich Roberto Blanco?“
„I wo, ich nenne ihn nur so, weil er meistens blank ist.“
V
Die Fußgängerbrücke aus verwittertem Magerbeton, braun und orange bemoost und beflechtet, spannte sich wie ein schiefer, verfaulender Zahnstocher über die vierspurige Bundesstraße, die eigentlich eine Stadtautobahn war. In den Fünfziger Jahren errichtet, waren der Brücke, da die Ränder der hochrangigen Straße im Lauf der Zeit dicht mit Tankstellen, Fast-Food-Drive-Ins, Heimwerkermärkten und Megashops mit Parkplätzen und kleinen Tiefgaragen verbaut wurden, die Fußgänger ausgegangen. Kein Harlander, der etwas auf sich hielt, ging heutzutage noch zu Fuß, die Kinder kamen hier bereits mit Bleifuß und reserviertem Studienplatz in der Fahrschule auf die Welt, und so war die Zahnstocherbrücke aus der optimistischen Zeit der einsamste Ort in der Stadt. Roberto Blanco hatte unter den gleichgültigen Augen des Tankwartes, der Kaffeehausbesucher und zigtausender Autofahrer wohl Tage und Wochen, vielleicht Monate - ebenso allein wie ich - auf dieser Brücke verbracht, mit seiner exzentrischen Beschäftigung die Zeit totschlagend.
Ich betrat das Bauwerk vom östlichen Aufgang, der nur einige Dutzend Meter von der Tankstelle entfernt lag. Zwischen den Betonritzen der Bodenplatten wucherte Unkraut, das kein Flaneur, kein Passant mehr niedertrat, in Vertiefungen und Ecken hatten sich Zeitungsfetzen, Vogelkot und Flugsand angesammelt, das Geländer aus dünnen Eisenrohren war stark verrostet. Die Brücke vibrierte kaum merklich unter dem zähflüssigen Morgenverkehr unter ihr. Südlich davon flimmerte die Autobahn wie eine Fata Morgana aus Staub und Metall und Tod. Im Westen stand braunvioletter, moribunder Wald, von dem alle paar Tage ein Stück abbrannte zum Gaudium der jugendlichen Florianijünger. Im Osten und im Norden stauten sich schon seit Wochen die drückenden Wolkenformationen einer Warmfront über der Stadt, in der es fast nur mehr heißblütige Hitzköpfe zu geben schien. Der Himmel führte eine Thermotherapie mit Harland durch.
Ich ging auf den westlichen Abgang der Brücke zu und las mit Blick nach Süden die Nummernschilder der unter mir hindurchschießenden Fahrzeuge ab. Plötzlich stieß mein Fuß gegen Glas. Eine leere Flasche Inländer-Rum, dutzende Zigarettenkippen am rissigen Betonboden, noch zwei Flaschen etwa in der Mitte der Brücke. Der billigste und zugleich hochprozentigste Fusel, den man sich in der Stadt beschaffen konnte, und - ich hatte mich nach einer Kippe gebückt und die Aufschrift knapp unter dem Filter abgelesen - ‘Flirt’-Zigaretten, eine Billigsdorfer-Marke für kapitalschwache Nikotinsüchtige. Roberto Blanco war tatsächlich blank gewesen.
Sehr viel mehr hätte man auch mit einer Lupe, einem Elektronenmikroskop oder der Personalreserve des FBI nicht feststellen können, und so ging ich weiter auf den Abgang zu, diesmal aber den Blick pflichtbewußt einige Zentimeter vor den Fußspitzen. Dabei, so dachte ich, hatte mich gar niemand in die Pflicht genommen, ich war ohne Auftraggeber, ich war, weil ich mich nach Monaten des öden Nichtstuns für meinen Beruf entschieden hatte, einfach losmarschiert, ein sturer Hund auf einer Spur, die vielleicht gar keine war, auf der Suche nach einem unwichtigen Menschen in einer unwichtigen Stadt. Na los, die Nase auf den Boden, Miert!
Die Stufen des westlichen Aufganges waren ebenso verwittert wie die seines östlichen Pendants. Der Putz bröselte aus den Fugen, und der Beton hatte mehr Sprünge als ein mittelalterlicher Reliquienzahn. Es gab dort nichts, was auf Roberto Blanco hingedeutet hätte. Im Westen nichts Neues.
VI
Als ich über die Brücke wieder zurückging, hatte ich das Band an einer Strebe des verrosteten Geländers hängend entdeckt. Es war ein dünnes Tonband, wie man es in den Minikassetten von Diktiergeräten verwendete, an einer Stelle gerissen, rund zwei Meter lang, von der Sonne bereits an einigen Stellen ausgebleicht. Ich steckte das Knäuel für alle Fälle ein und machte mich auf den Weg zurück in die Birkengasse, diesmal ertaubt, erblindet, mit zugekniffener Nase gegenüber den sinnlichen Eindrücken des vertrauten Grätzels.
Jeder Anfang hat seine eigene Poesie, und wenn einer zum Beispiel zum ersten Mal einen neuen Beruf in die Hände nimmt und wirklich ausübt, schlägt sein Gehirn auch schon die Funken, die Jahre später den Glanz der Erinnerung ergeben. Aber jeder Anfang ist auch eine Verengung, ein schmaler Tunnel, vor dem man Ballast zurückläßt, um vorwärts zu kommen. Ich ging den Weg durch die Steinfeldstraße, querte die Josefstraße, eilte durch die Sensengasse und erreichte die Birkengasse, aber ich beobachtete nicht mehr wie ein flanierender Amateur, der alle Zeit der Welt hat, sondern wie ein Profi, für den Chronos der Gott der knappen Ressourcen ist. Das zerrissene Band konnte nichts bedeuten, aber auch daß Roberto Blanco in Gefahr war oder schon fetter, gelber Dünger für die Lilien.
Die Birkengasse im Süden Harlands war als Teil eines Paraden- und Aufmarschstraßenrings in der Zeit der Gauwirtschaftshauptstadt angelegt worden und hätte Richtung Südwesten mit einer Brücke aus schwarzem Marmor gekrönt werden sollen. Allerdings wurden die städtischen Ingenieure nach Stalingrad eingezogen und die Kolonnen polnischer Zwangsarbeiter in einem Rüstungsbetrieb zu Tode schikaniert. Geblieben war der inzwischen unbedeutenden Gasse von der zugedachten Ruhmesfunktion nur die Breite von knapp dreißig Metern. Auf einer solchen Fläche hatte auch mein Kübel bequem Platz. Der Ford Granada war Viert- oder Fünftbesitz. Der letzte ‘Besitzer’, ein knapp sechzigjähriger Heiratsschwindler mit Hasenscharte und mehr Schulden als Haaren auf dem Kopf, hatte es geschafft, in knapp vier Jahren nicht eine einzige Leasingrate für sein schnittiges Gefährt zu bezahlen. Als ich ihn im Auftrag der Intercash Factoring Bank aufgestöbert hatte, war er gerade dabei, sich im Fond die Pulsadern aufzuschneiden. Ich hatte noch nie einen Menschen so jämmerlich fluchen gehört wie ihn, als ich ihn in der Erstversorgung des Harlander Zentralkrankenhauses ablieferte.