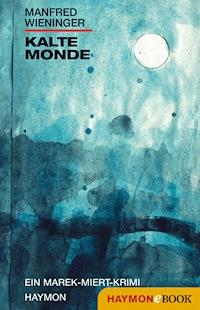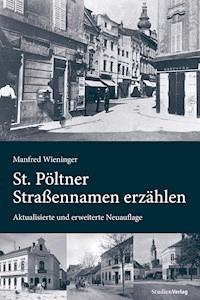Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Residenz
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ein kleiner Gendarm vor einem Berg von Toten: ein Stoff, aus dem keine Krimis sind. Ende April 1945 stranden hunderte jüdische Zwangsarbeiter aus Ungarn auf dem Todesmarsch Richtung Mauthausen in Persenbeug an der Donau. Die Front im Osten wie im Westen ist nahe wie das Ende des Krieges. In Wien ist bereits die Zweite Republik ausgerufen, Adolf Hitler ist tot, da überfällt ein Rollkommando der SS das Auffanglager und richtet in einer Nacht- und Nebelaktion ein Blutbad an - 223 Menschen sterben. Kaum jemand will etwas gesehen oder gehört haben, trotzdem beginnt Revierinspektor Franz Winkler, stellvertretender Kommandant auf verlorenem Posten in der Provinz, zu ermitteln. Er riskiert seinen Kopf, um seine Haut zu retten. Wird ihm das auch mit den neun Überlebenden des Massakers gelingen? Manfred Wieninger dokumentiert in der Balance zwischen Bericht und Fiktion einen einzigartigen Fall österreichischer Kriminalgeschichte. Er macht aus Geschichte eine Geschichte, in der die Opfer Namen haben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 230
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek:
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in derDeutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografischeDaten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
www.residenzverlag.at
© 2012 Residenz Verlagim Niederösterreichischen PressehausDruck- und Verlagsgesellschaft mbHSt. Pölten – Salzburg – Wien
Alle Urheber- und Leistungsschutzrechte vorbehalten.Keine unerlaubte Vervielfältigung!
ISBN ePub:978-3-7017-4288-2
ISBN Printausgabe:978-3-7017-1580-0
für Eleonore Lappin-Eppel
Inhalt
223 oder Das Faustpfand
Epilog
György Stroch beginnt sein Tagebuch am 28. August 1944, an dem Tag, an dem er endlich einen Bleistift ergattern kann. Der 13-Jährige schreibt auf Deutsch in ein kleines, dunkelblaues Schulheft, dessen Namensschildchen er nicht beschriftet. Als Zwangsarbeiter ist der Schüler aus Szolnok Mitte 1944 von Ungarn in die so genannte Ostmark verschleppt worden. Sein Rechtsstatus entspricht dem eines Sklaven. Sein Besitzer ist die Außenstelle Wien des Sondereinsatzkommandos (SEK) unter der Führung von SS-Obersturmbannführer Ferdinand Krumey. Im Juli 1944 gehören dieser SEK-Außenstelle 15.000 Menschen, die entgeltlich über die Arbeitsämter in Wien und Niederösterreich an Arbeitgeber in Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft verliehen werden. György Stroch wird mit seiner Großmutter, seiner Mutter und 3 Brüdern auf das Gut Antonshof bei Schwechat verschickt. Wir sind schon einen Monat hier. Als wir ankamen, mussten wir zunächst Erbsen ernten. Dann mussten wir Zwiebelfelder hacken und jäten. Später haben wir geerntet und gedroschen. Heute bündeln wir das Streu. Die Tage vergehen rasch, mit Fliegeralarmen gewürzt. Wir sind hier 24. 6 sind davon Kinder, 4 kleine, nur mein Bruder und ich sind über 12 Jahre alt […]. Wir sind mit Italienern und Russen beisammen. Tagwache ist jeden Tag um 5 Uhr früh, Arbeitsbeginn um 6, Arbeitsschluss um halb 8 Uhr abends. Sonn- und Feiertagsruhe wird den jüdischen Sklaven auf Gut Antonshof nicht gewährt. Zwei so große Feiertage sind vorbei, die wir nicht feiern konnten. Wir mussten arbeiten. Neujahr und Jom Kippur, notiert der Bub am 1. Oktober 1944. Seine Gedanken kreisen vor allem um das Essen, besser gesagt um die mangelhafte Ernährung, um den Hunger und um die besonders für ein Kind mehr als beschwerliche Zwangsarbeit. Unter dem 30. August 1944 notiert er: Ich habe an der Dreschmaschine gearbeitet. Der Wind wehte und es gab furchtbaren Staub. Am 7. Oktober 1944 schreibt das versklavte Schulkind in sein Heft: Heute ist mein 14. Geburtstag. Ziemlich traurig. Die Kinder haben aus Wiesenblumen einen kleinen Strauß gebunden und mir damit gratuliert. Es hat mir sehr wohl getan, dass sie nicht auf mich vergessen haben. Die monatliche Zucker- und Marmeladeration ist schon aus. Am 26. Oktober 1944 wird der kleinen, ungarisch-jüdischen Zwangsarbeitergruppe etwas befohlen, das György Stroch so trifft, dass er dies erst 5 Tage später niederschreiben kann und von Deutsch auf Ungarisch wechselt: Über Anordnung des Herrn Ingenieurs müssen wir sofort in den Kuhstall übersiedeln. An unserer Stelle kommen ungarische Flüchtlinge. Wir sind in den Stall hinuntergegangen. Das war wirklich ein schlechter Platz. Voll von Mist. Die Kühe haben gemuht und die Jauche floss unter uns. Um uns herum liefen einen halben Meter lange Ratten. Es war wirklich furchtbar. Der Schock sitzt so tief, dass der 14-Jährige nie wieder eine Zeile auf Deutsch schreiben wird. Über die Bevorzugung der ungarischen Neuankömmlinge verliert er in seinem Schulheft kein Wort, der Judenhass in der Ostmark scheint ihm wohl zu allgegenwärtig, zu alltäglich zu sein, als dass er ihm noch eine Bemerkung wert wäre. Die in den Kuhstall Verbannten wagen es zu protestieren: Sofort sind zwei Personen zum Ingenieur gegangen. Sie haben ihm gesagt, dass wir dort nicht wohnen und schlafen können, da die Ratten nicht nur unsere Sachen nicht in Ruhe lassen, sondern auch unsere Nasen angreifen. Wir haben ihm so lange zugeredet, bis er gesagt hat, dass unter uns ein Magazinraum ist, wo Hafer, Weizen usw. liegen, dass man zusammenschlichten muss, um für uns Platz zu schaffen. Wir können dort wohnen, bis ein anderer Raum für uns gerichtet wird. Mehr als einen Monat später ist die versprochene Kammer noch immer nicht fertig. Am 1. Dezember 1944 treffen 28 weitere ungarischjüdische Zwangsarbeiter, die vor allem aus Debrecen stammen, auf dem Antonshof ein, mit denen sich die Alteingesessenen den knappen Raum teilen müssen. So warten seitdem statt 24 52 Juden auf die Stunde der Erlösung, schreibt György Stroch. Mitte Dezember wird die armselige Unterkunft gegen 2 Uhr früh von Polizei gestürmt. Man lässt die jüdischen Sklaven Appell stehen und examiniert vor allem die Krankgemeldeten peinlich genau. Bevor sie aber weggingen, haben sie uns eingeschärft, dass in Zukunft nur der zuhause bleibe, der wirklich krank ist, denn sonst wird er in ein Straflager gebracht, notiert György Stroch. 2 Nächte später wiederholt sich die Sekkatur, diesmal allerdings durch die Gestapo und unter wesentlich mehr Gebrüll und Geschimpfe. Der jüdische Vorarbeiter Pál Feldmesser wird abgesetzt und durch einen anderen ersetzt. Außerdem werden alle Kranken von den Gestapo-Beamten zwangsweise gesundgeschrieben, auch György: Mein Hals tut weh, ich bin schwindlig, ich friere sogar unter zwei Decken, es ist so kalt hier drinnen. Es hat noch nicht geschneit, aber am Himmel ziehen schwere Schneewolken auf. Einen Tag vor Weihnachten schreibt er in sein Schulheft: Die Kälte ist gekommen. Es friert schon so stark, dass es sogar tagsüber nicht null Grad hat. Die Zuckerrüben kann man nicht mehr ernten, da sie eingefroren sind. So ist das auch schon erledigt. […] Das Weihnachtsgeschenk war die Nachricht, dass wir nach Wien in ein Lager kommen und auch dort arbeiten werden. Am 27. Dezember 1944 werden die jüdischen Arbeitssklaven vom Antonshof in ein Lager in der Kuenburggasse 1 im 21. Wiener Gemeindebezirk verlegt: Der Saal, den wir bekommen haben, ist klein und kalt, aber dagegen gibt es noch eine Hilfe. […] Nur gibt es nicht genügend zu essen. Und das ist sehr schlimm. Einen Tag später beschreibt der Bub das Ungenügende, das Wenige, allzu Wenige detailliert in seinem Tagebuch: Das Essen: Jeden Tag in der Früh zwei Deziliter schwarzen Kaffee. Mittagessen: Kartoffelgemüse. Abendessen: Marmelade oder Butter. Die ganztägige Brotration ist für Erwachsene 25 Dekagramm, für Kinder 12 Dekagramm pro Person. Trotzdem ist Schwerstarbeit gefordert: Wegen Mangels an Schuhen gehen wir abwechselnd zur Arbeit. Ich schlage mit meiner Großmutter zusammen Ziegel ab. Das Mittagessen ist ausgezeichnet, aber sehr wenig, notiert György am 20. Jänner 1945. Genau 2 Monate später berichtet der Junge in seinen Aufzeichnungen von einer weiteren dramatischen Verschlechterung der Lage: Während eines Fliegeralarmes schreibe ich mein Tagebuch im Tunnel von Döbling und denke über unser trauriges Schicksal nach. Vor 5 Tagen traf eine Bombe unser Lager und alles verbrannte. Ohne Decke, ohne ein Kleid und ohne Wäsche zum Wechseln stehen wir da. Die überlebenden Zwangsarbeiter werden auf die Lager Leopold-Ferstl-Gasse und Mengergasse, beide im 21. Bezirk, aufgeteilt. Unter dem 6. April 1945 ist im Tagebuch zu lesen: Die Russen beschießen Wien. Innerhalb von Sekunden wurde das Lager geräumt, und jetzt gehen wir alle mit kleinen Binkeln auf dem Rücken gegen Stockerau. Die nächste Eintragung vom 10. April ist noch kürzer, gehetzter: Wir gehen seit vier Tagen zu Fuß in Richtung Tulln. Wir wissen nicht wie weit. Die Tagebucheintragung vom 20. April 1945 fasst die Qualen des Todesmarsches mit dem Ziel KZ Mauthausen in wenigen, kurzen Sätzen zusammen: Drei Wochen sind seit unserer Vertreibung vergangen. Unser Ziel ist Linz. Ohne Essen, frierend, hungernd – wer weiß wie lange. Am 30. April schreibt György Stroch noch 2 Zeilen, dann brechen seine Aufzeichnungen für immer ab: Wir sind stehen geblieben zwischen Krems und Linz in Persenbeug. Hier wurde ein Lager errichtet. Nur Essen wäre genug. Wenig mehr als 2 Tage später wird man ihn mit Benzin überschütten und anzünden.
Unter dem Datum 26. Juni 1944 notiert der sechzigjährige Handelsvertreter József Bihari aus der ungarischen Stadt Szolnok in einen Taschenkalender: Wir sind zu Fuß mit unserem Gepäck in fürchterlicher Hitze 15 Kilometer weit nach Debrecen marschiert, wo alle entkleidet wurden, das heißt, es wurde uns alles weggenommen. Noch am selben Abend wurden wir einwaggoniert. Es war furchtbar. 88 in einem 15-Tonnen-Waggon, nur mit Handgepäck. Unendlich viel haben wir an Hitze und Wassermangel gelitten. Ich habe von einer Fischkonserve eine Vergiftung bekommen. Auf dem Weg haben wir gehört, dass Szolnok schon weggekommen ist. Wir sind in der größten Verzweiflung, ob wir uns jemals treffen werden. Es war furchtbar, es war furchtbar. Endlich (29. Juni) heute Mittag um ein Uhr sind wir angekommen. Man hat uns in Strasshof bei Wien auswaggoniert. Die Hälfte von Szolnok war hier, die andere Hälfte ist noch nicht angekommen. Meine Rózsi ist nicht da. József Bihari hatte sich gerade auf einer Reise befunden, als er in die Mühlen von Eichmanns Vernichtungsmaschinerie geraten ist. Die Trennung von seiner Frau Rózsi, die offenbar von beider Wohnort Szolnok deportiert worden ist, wird ihm noch schwer zu schaffen machen. Auch die neuen Lebensumstände in der Sklaverei sind für einen älteren Menschen wohl nicht leicht zu verkraften: Heute, am 30. Juni, hat man uns desinfiziert. Die Nacht haben wir unter freiem Himmel verbracht. Ein furchtbarer Platz. Das Essen ist ungenießbar. Heute Nacht (1. Juli) habe ich unter einem Dach geschlafen. Nachmittag um fünf Uhr wurden wir einwaggoniert. Der kränkliche Mann landet als künftiger Zwangsarbeiter in einer Schule in der Konstanziagasse 24 im 22. Wiener Gemeindebezirk. Das Essen ist furchtbar, bin ganz abgemagert, meine faciale Lähmung will nicht besser werden. Ich habe keine Medikamente. Mein Bein ist ganz bamstig. Seit einer Woche spüre ich nichts mehr. Ich weiß nicht, was damit sein wird, es beunruhigt mich sehr, schreibt József Bihari am 5. Juli 1944 in seinen Kalender. Weit mehr noch als die deprimierenden Lebensumstände und die gesundheitlichen Probleme beunruhigt ihn die Trennung von seiner Gattin und vor allem die Ungewissheit über ihr Schicksal: Leider habe ich von meiner Rózsi noch immer nichts gehört. Es tut mir furchtbar leid, dass wir nicht zusammen sein können. Was ist mit der Armen? Oh, wenn ich nur etwas über sie erfahren könnte. Alles in allem ist József Biharis Tagebuch vor allem ein Dokument der Sehnsucht nach seiner Frau, ein Dokument der Liebe und Treue. Mehr als die Hälfte der Eintragungen in seinem Taschenkalender beschwören die gemeinsame Vergangenheit mit Rózsi in Szolnok und beklagen ihre Abwesenheit. Nur wenn ich von meiner Rózsi etwas wüsste, könnte ich alles besser ertragen, notiert József Bihari am 3. August 1944. In seinem Schmerz um die verlorene Gattin meldet sich der alte Mann, dessen körperlicher Zustand von Tag zu Tag schlechter wird, freiwillig zur Arbeitsleistung: 142 hat man zur Arbeit geschickt. Mich hat man hier gelassen, da ich über 60 bin. Ich habe mich freiwillig gemeldet, weil es furchtbar ist, hier zu sein, und man wird ganz verzagt. Ich habe schlechte Gefühle. Um zu den Arbeitsstellen zu gelangen, brauchen die Zwangsarbeiter aus der Konstanziagasse dreieinhalb Stunden mit der Straßenbahn, danach ist noch eine Strecke zu Fuß zurückzulegen. Der tägliche Arbeitseinsatz endet nicht vor 6, 7 Uhr abends. Am 28. Juli 1944 heißt es im Kalender: Ich bin körperlich unten durch. Die Arbeit wäre nicht schlecht, aber man gibt uns nichts zu essen. Die häufigen Eintragungen über das Essen (ungenießbar, furchtbar schlecht, furchtbar mies) korrespondieren mit Eintragungen über Diarrhöe. Bereits am 18. Juli 1944 notiert József Bihari: Vor Hunger komme ich fast um. Sein Ernährungszustand bessert sich ab 9. August zwischendurch ein wenig, als er zur Zwangsarbeit in der Mautner-Bierfabrik in der Prager Straße 20 eingeteilt wird: Wir mussten Schutt abtragen. Die Arbeit ist sehr schwer, aber in der Kantine gibt es Mittagessen und ein Krügel Bier. Zu allem Unglück wird József Bihari auch noch von diversen Abszessen gequält, die Lähmungserscheinungen am Bein und im Gesicht bessern sich nicht. Seine wiederholten Krankmeldungen werden nicht akzeptiert. Ich habe mich wieder krank gemeldet, aber man lässt mich nicht. Man muss hier krepieren, notiert er am 11. September 1944. Vom freiwilligen Charakter der Arbeit für über Sechzigjährige ist längst keine Rede mehr. Bihari muss 7 Tage die Woche als Bauhilfsarbeiter und Maurer schuften, stundenlang 8 bis 10 Ziegel auf einmal am Rücken in ein Stockwerk hinauftragen, Mörtel mischen und mit dem Krampen arbeiten. Freie Tage sind so selten wie ausreichende Tagesrationen: Heute haben wir einen freien Tag, da eine Bombe den Architekten erschlagen hat und heute ist sein Begräbnis. Ohne die Solidarität seiner Leidensgenossen in der Konstanziagasse hätte József Bihari wohl das Jahr 1944 nicht überlebt. Ein Mitgefangener namens Lászlo, geschickt im Organisieren von Lebensmitteln, versorgt ihn mit zusätzlicher Nahrung. 2 Frauen, Ethel Epstein und Frau Tabak, beginnen für den weitgehend hilflosen, heimwehkranken, deprimierten und wohl auch nicht besonders geschickten Mann zu waschen und zu nähen. Ich bin sehr gealtert. Ich bin schon ein Greis geworden, aber das sieht man auch bei den anderen, notiert er am 21. Oktober 1944. Ab Mitte November hat er in der Destillerie, Hefe- und Konservenfabrik der Familie Mautner in der Simmeringer Hauptstraße 101 zu schuften. Die Arbeit beschreibt er als relativ leicht, nur zwingt sie ihn, den ganzen Tag im Freien zu verbringen. Der einzige Anzug, den József Bihari besitzt, besteht mittlerweile nur mehr aus Flicken und zerfällt ihm am Körper. Seine Wäsche ist so derangiert, dass auch Stopfen und Flicken nichts mehr nützt. Wir haben gar keine Wintersachen, und wenn die Kälte kommt, dann werden wir sehr kritische Tage erleben, befürchtet er am 1. Dezember 1944. Dem alten Mann fällt es schwer, auf dem Weg von und zur Arbeit Passanten anzubetteln. Es ist interessant zu bemerken, dass immer Laci [= Koseform für Lászlo; M. W.] vielerlei bekommt und ich noch nirgends etwas bekommen habe, aber ich wünsche es auch nicht, da es furchtbar ist, etwas anzunehmen, gesteht er am 22. November 1944 seinem Tagebuch. Einige Tage vor Weihnachten schreibt er: Ich würde alles ertragen, nur wenn ich von meiner Rózsi was wüsste und wenn ich mich noch hier auf Erden mit ihr treffen könnte, dann könnte ich ruhig sterben. Was ist mit der Armen? Ich weiß es nicht. Ich beschäftige mich ständig mit ihr, obwohl ich dies niemandem sage, aber ich klage, wenn mich niemand sieht. Zu diesem Zeitpunkt ist seine Gattin wohl längst nach Auschwitz deportiert worden. Ältere jüdische Frauen haben in diesem Konzentrations- und Vernichtungslager keinerlei Überlebenschance; sie wurden nach der Ankunft sofort vergast. Am Stephanitag notiert József Bihari in den Kalender: Völlige Ruhe. Es hat minus 10 Grad. Das Zimmer wird nicht geheizt. Wir leiden viel. Das Mittagessen war auch miserabel, ungenießbar und dazu furchtbar wenig. Am 30. Dezember 1944 verfasst der Einundsechzigjährige seinen vorletzten Eintrag: Wenn ich von meiner Rózsi etwas wüsste, so wäre alles in Ordnung. Ich weiß wirklich nicht, was mein Ende sein wird, aber ich fühle, dass ich es nicht mehr lange durchhalte. Am 14. Jänner 1945 notiert er in seinen Kalender: Wir haben einen Bombentreffer erhalten. Es ist seine letzte Tagebucheintragung, danach hat der Einundsechzigjährige wohl keine Kraft mehr zum Schreiben. Im März oder April 1945 wird er auf einen Todesmarsch Richtung KZ Mauthausen getrieben. Nach ein paar Tagen oder Wochen bleibt er völlig erschöpft liegen, wahrscheinlich irgendwo im Raum Melk, vielleicht in Gottsdorf. Er wird sich gewundert haben, dass er von den Wachen, es mögen Volkssturmmänner oder Waffen-SSler gewesen sein, nicht unverzüglich liquidiert, sondern von Gendarmen in das Auffanglager Persenbeug geschafft worden ist. Dort kommt er zwischen dem 25. April und dem 2. Mai 1945 an.
Der 10-jährige Tibor Yaakow Schwartz wird im Juni 1944 gemeinsam mit seiner Mutter, seinen beiden Schwestern und seinem älteren Bruder im ungarischen Sammellager Szaljol in Viehwaggons getrieben. Je 120 Menschen, vorwiegend Kinder und Frauen, werden in einen Waggon gepfercht. Zu diesem Zeitpunkt hat der in Puspokladany nahe Debrecen geborene, aber in Budapest aufgewachsene Bub bereits fast 3 Monate Ghetto- und Lagererfahrung in Ungarn hinter sich. Das dortige Regime erfüllt seine Pflichten gegenüber dem Bündnispartner Großdeutschland eifrigst. Bereits im Mai 1938 ist das erste einer ganzen Reihe von antijüdischen Gesetzen in Kraft getreten, die von Novellierung zu Novellierung immer schärfer werden, bis schließlich im Sommer 1941 eine Gesetzgebung gilt, die den Nürnberger Gesetzen zum Verwechseln ähnlich ist. In diesem Sommer beginnt die ungarische Fremdenpolizei KEOKH auch damit, jüdische Flüchtlinge, die sich vor Hitlers Greifkommandos nach Ungarn gerettet haben, in das frisch eroberte Galizien zu deportieren. Damit spielen sie bewusst deutschen Einsatzgruppen in die Hände, die diese Asylanten Ende August 1941 zu Tausenden bei Kamenetz Podolsk erschießen. Am 4. April 1944, nach dem Einmarsch der Wehrmacht im März 1944 beginnt die ungarische Gendarmerie, die jüdischen Bürgerinnen und Bürger ihres Landes zu erfassen, spürt mit großem Diensteifer auch noch die letzten Landjuden auf, zwingt Hunderttausende in primitive, provisorische Ghettos in Lagerhallen, Fabrikruinen, Ziegeleien und so weiter und stellt sie für die von Adolf Eichmann und seinem 200-Mann-Stab organisierten Deportationen bereit. Ab 27. April 1944 beginnen die ungarischen Viehwaggons in Massen nach Auschwitz zu rollen.
Der Zug aber, in dem Tibor Yaakow Schwartz und weitere rund 2.400 Unglückliche einem ungewissen Ziel entgegenfahren, ändert im tiefsten Ungarn unvermutet die Richtung. Statt auf die Hölle von Auschwitz rollt der Sklaventransport auf Budapest zu. Die Bedingungen in den völlig überfüllten Waggons sind unerträglich. Neben der drangvollen Enge und der Ungewissheit über ihr weiteres Schicksal quält die Deportierten bald Durst und Hunger, auf der tagelangen Fahrt gibt es für sie weder Verpflegung noch Trinkwasser. Als der Transport schließlich im niederösterreichischen Straßhof, dem zentralen Verschiebebahnhof und Durchgangslager für Zwangsarbeiter in der Ostmark, ankommt, liegen in jedem der 20 Waggons bereits Tote – Menschen, welche die Strapazen und Schrecknisse der Fahrt nicht überstanden haben. Nach einigen Tagen in Straßhof wird Tibor Yaakow Schwartz, der von seiner Familie Yaakow gerufen wird – sein erster Vorname ist wohl nur dem Magyarisierungsdruck im scharf antisemitischen Ungarn zuzuschreiben –, gemeinsam mit seinen Angehörigen neuerlich in Waggons gepfercht. Er hat von den NS-Beamten eine Karte erhalten, auf der das Fahrtziel genannt wird: Floridsdorf. Die Familie wird dort in einer Schule untergebracht. Zu essen gibt es für jeden nur 2 Schnitten Brot pro Tag. Yaakow Schwartz’ Angehörige werden bald zu Schwer- und Schwerstarbeit im Floridsdorfer Shell-Werk, einem petrochemischen Betrieb, eingesetzt. Der 10-Jährige dagegen muss unter der Oberaufsicht eines erwachsenen Ukrainers in einer Horde von bis zu 40 Sklavenkindern im 1. Wiener Gemeindebezirk Aufräumungsarbeiten nach Luftangriffen leisten. Er wird vor allem auf hohe und höchste Dächer getrieben, um beschädigte Dachziegel zu entfernen und durch neue zu ersetzen. Natürlich gibt es für ihn im Gegensatz zu den einheimischen Dachdeckern keinerlei Ausrüstung zur Eigensicherung bei Abstürzen. Oft werden er und die übrigen Kinder auch zum Räumen von Schutt und Trümmern eingesetzt. Diese lebensgefährliche Schwerarbeit ermöglicht es Yaakow Schwartz immerhin, Passanten anzubetteln und um Lebensmittel oder Brotmarken zu bitten. Eine seiner Schwestern hat ihm den Judenstern auf seinem Overall aus grobem Zeltstoff so angenäht, dass er ihn wegklappen kann und damit als Jude nicht mehr sofort erkennbar ist. Ein bettelndes, jüdisches Kind hat 1944, das weiß er nur zu bald, auch oder gerade in der noblen Inneren Stadt nur selten mit einer milden Gabe zu rechnen, höchstens mit ein paar Fußtritten und Ohrfeigen und einer Anzeige, einer Denunziation. Während er die Passanten anspricht, hält er angestrengt nach patrouillierender Polizei, Gestapo und nach urlaubenden Waffen-SSlern Ausschau, die Hand immer am Overall, um den gelben Stern blitzschnell wieder herausklappen zu können. Seiner Mutter und seinen Schwestern gelingt es, bei Shell kleine Mengen an Diesel abzuzweigen und auf dem Schwarzmarkt gegen Lebensmittelkarten zu tauschen. Natürlich steht für jüdische Sklaven auf all diese illegalen Aktivitäten die Verbringung in ein KZ, aber die Schwartz haben keine andere Wahl mehr. Immerhin haben sie es besser als in den Deportationszügen. Auch wenn die Floridsdorfer Schule, in der Yaakow Schwartz und seine Familie mit vielen anderen Arbeitssklaven untergebracht sind, eines Tages bombardiert wird und völlig ausbrennt. Die Schwartz werden in eine andere Zwangsarbeiter-Unterkunft, ebenfalls eine Schule, in der Leopold-Ferstl-Gasse im gleichen Bezirk eingewiesen. Im Jänner 1945 wird Yaakows älterer Bruder Shlomo Alexander jäh aus dem Familienverband herausgerissen und nach St. Anna am Aigen deportiert, wo er zu schwersten Schanzarbeiten für einen militärisch völlig sinnlosen Stellungsbau eingesetzt wird. Seiner Mutter Ilona Schwartz gelingt es am 9. März 1945, eine Postkarte an ihren älteren Sohn abzusenden, die auch tatsächlich in St. Anna ankommt. Danach zerstören Bombentreffer auch das Quartier in der Leopold-Ferstl-Gasse. Yaakow Schwartz, seine Mutter und seine beiden Schwestern erhalten Unterkunft in der Mengergasse 33 im 21. Bezirk. Als sich die Rote Armee Wien nähert, wird das Lager von der Waffen-SS am 7. April 1945 völlig überhastet geräumt, die Insassen werden bewacht von Wehrmachtsangehörigen und Volkssturmmännern wie Vieh zu Fuß Richtung Westen getrieben. Dabei sind von den rund 300 ungarisch-jüdischen Zwangsarbeitern der Marschkolonne, der die Familie Schwartz zugeteilt wird, Tagesetappen von 25 bis 40 Kilometer zu leisten, ohne dass die Menschen mit Verpflegung und mit ausreichend Trinkwasser versorgt würden. Marschiert wird bei jedem Wind und Wetter. Die Angehörigen des Volkssturms werden von Etappe zu Etappe ausgewechselt. Yaakow Schwartz, seine Mutter, seine Schwestern und die Übrigen versuchen auf dem Weg bei Bauern Lebensmittel zu erbetteln oder zu stehlen. Als das immer weniger Erfolg bringt, beginnen sie in der Nacht Gras zu essen. Wochenlang ist die Marschkolonne bis zur völligen Entkräftung unterwegs. Wer nicht mehr weiter kann, wird von den Volkssturmmännern und den Soldaten der Wehrmacht erschossen. Yaakows Füße sind mittlerweile blutig, die Haut seiner Fußsohlen ist bis auf das Fleisch abgewetzt. Der Todesmarsch führt über Nebenstraßen immer weiter Richtung Westen, Hauptstraßen werden nach Möglichkeit gemieden. In den Dörfern und Ortschaften sind viele Menschen entsetzt über den maroden Zustand der jüdischen Kinder, Frauen und Greise. Andere dagegen betrachten die Marschierenden durchaus mit Genugtuung, gelegentlich treffen sie Beschimpfungen und Steine. Nach einer kurzen Rast in Melk gelingt es einer Gruppe von 5 kaum mehr marschfähigen Familien, sich eines Abends bei einem Dorf in Donaunähe aus der großen Marschkolonne davonzustehlen und in eine Bucht auf eine Halbinsel zu flüchten. Darunter sind auch der Bub mit den blutenden Füßen und der Rest seiner Familie. Gemeinsam wollen die Erschöpften auf die herannahende Rote Armee warten oder auf den Tod durch Entkräftung und Auszehrung. Eine Bauernfamilie aus dem Dorf, in dem sie am Abend lagerten, versucht noch Essen zu bringen, aber die Hilfe wird verraten. Eine Streife der Waffen-SS greift die Erschöpften wieder auf. »Aufstehen! Auf, auf! Marsch!« Den verzweifelten Menschen wird befohlen, weiter zu marschieren, mit Kolbenstößen und -hieben setzt man sie brutal in Bewegung und treibt sie unbarmherzig an. Die Bewachung auf dem weiteren Weg am Donauufer Richtung Westen ist scharf. Unterwegs trifft man auf eine neue Gruppe zurückgebliebener, ungarisch-jüdischer Arbeitssklaven, die erschöpfte, abgerissene Nachhut einer anderen Marschkolonne. Am 26. April 1945 kommen beide Gruppen gemeinsam in dem kleinen Ort Persenbeug an der Donau an und werden auf 3 windschiefe Holzbaracken am Ufer aufgeteilt. In den armseligen Unterkünften treffen sie auf weitere marode, ausgezehrte, ungarische Juden, wie sie selbst sind, auf Bekannte aus dem Lager in der Wiener Mengergasse, aber auch auf viele Unbekannte aus anderen Arbeitslagern, zumeist Frauen, Kinder, Halbwüchsige, ältere und alte Menschen, erschöpft, ausgemergelt, ausgehungert, verzweifelt und bar jeder Hoffnung.
Der 55-jährige Mediziner Dr. Henrik Weisz, der als Hilfsarbeiter in der Shell-Ölraffinerie in Wien-Floridsdorf seit Monaten schwerste Zwangsarbeit zu leisten hat, hat am 7. April 1945 gerade mal 10 Minuten Zeit, um seine Habseligkeiten zu packen und sich marschfertig zu machen. Dann jagen Militär und Waffen-SS ihn und über 600 Leidensgenossen, darunter auch seine Gattin Olga, seine ältere Schwester Szeréna Weisz und seine jüngere Schwester Paula Precz-Weisz mit ihren 5 Kindern Lilli, Éva, Erszébet, Béla und György aus dem Zwangsarbeiterlager in der Mengergasse 33 im 21. Wiener Gemeindebezirk. Unter Geschrei und Gebrüll, Stock- und Kolbenhieben formiert sich eine große Marschkolonne, die Richtung Westen getrieben wird. Am Abend des ersten Marschtages, an dem keiner der Arbeitssklaven auch nur ein Stück Verpflegung, einen Bissen Essen erhält, wird die Kolonne von Gendarmen übernommen. Die Beamten bemühen sich in den folgenden Marschtagen, auf dem Weg Lebensmittel für ihre Gefangenen aufzutreiben, aber das ausgeblutete Land gibt nicht allzu viel her, schon gar nicht für Juden. Jeden Tag können ein paar der rasch schwächer werdenden Marschierenden nicht mehr weiter und werden von den Wachen einfach zurückgelassen, in Auen und Wäldern, Dörfern und Weilern, auf und neben Landstraßen und Wegen. Am 10. April 1945 erreicht die Marschkolonne Krems und wird dort am Abend im Gefängnis sehr gedrängt untergebracht. Auch der aus dem ungarischen Mezötúr im Komitat Szolnok stammende Dr. Weisz ist spätestens in Krems den Strapazen des Marsches nicht mehr gewachsen. Zusammen mit einer Gruppe von Kranken, nicht mehr Marschfähigen wird er im Häfen zurückgelassen. Zu seinem Glück im Unglück gibt es im Kremser Gefängnis neben Anstaltsleiter Hofrat Kodré eine kleine Gruppe von Justizwachebeamten, die dem NS-Regime ambivalent bis ablehnend gegenübersteht. Dr. Weisz erhält zumindest rudimentäre Unterstützung bei seinem Versuch, sich um die Erschöpften medizinisch zu kümmern. Am Morgen des 25. April 1945 bekommen er und seine Gruppe einen Marschbefehl Richtung Linz. Zu ihrer Verblüffung wird ihnen keine Wache für den Marsch zugeteilt. Sie verlassen das Gefängnis, unschlüssig, wohin sie sich tatsächlich wenden sollen. Unter den ungarisch-jüdischen Zwangsarbeitern aus der Mengergasse hat sich zu diesem Zeitpunkt bereits herumgesprochen, dass Linz, das befohlene Marschziel, nichts anderes ist als ein Tarnname für das KZ Mauthausen. Mauthausen aber, das ahnen sie, das wissen sie, bedeutet im April 1945 für sie den Tod, den Tod durch Verhungern oder den Tod durch Vergasung. Auf der anderen Seite wagen sie es aber auch nicht, sich entgegen dem Marschbefehl Richtung Osten zu wenden und sich damit in das unmittelbare Frontgebiet zu begeben. Entlaufene Zwangsarbeiter, jüdische obendrein, werden in Kampfgebieten von der Waffen-SS unbarmherzig gejagt und sofort liquidiert. Also bleibt Dr. Weisz und seiner Gruppe an diesem 25. April gar nichts anderes übrig, als sich langsam Richtung Westen zu bewegen. Das geht nur kurz gut, nur bis Groisbach, dort werden sie von der Gendarmerie festgenommen und weitergetrieben. Die kleine Gruppe schwillt rasch an, die Gendarmen verhaften auf dem Weg eine ganze Reihe von ungarischen Juden, die sich in den Dörfern versteckt gehalten haben, und treiben sie Richtung Westen. Am 25. April 1945 kommt Dr. Henrik Weisz im so genannten Judenauffanglager am Donauufer in Persenbeug an. Die Qualen des Marsches durch Wien und halb Niederösterreich sind für ihn und seine Familie zu Ende.
Am Vormittag des 25. April 1945 erhält der Gendarmerieposten Persenbeug, der gemeinsam mit dem lokalen Gericht in einem stattlichen Haus am Rathausplatz untergebracht ist, telefonisch Befehl vom Gendarmeriekreis Melk, ein Judenauffanglager zu errichten. Für Postenkommandant Engelbert Duchkowitsch ein denkbar unangenehmer Befehl. Mit schmalen, blassen Lippen und knirschenden Zähnen nimmt er ihn am Telefon entgegen, stehend und den Hörer gegen das rechte Ohr gepresst. Er, der einen Gutteil seiner 6 Gendarmen schon seit Tagen ins Umland Richtung Melk ausschickt, um erschöpfte, aus den Evakuierungsmärschen ausgescherte oder liegen gebliebene, versteckte Juden aufzustöbern und weiter nach Westen zu treiben, hätte als überzeugter Nationalsozialist andere Methoden bevorzugt, um mit dem Problem fertig zu werden, ganz andere. Aber Gendarmeriemeister Duchkowitsch schweigt submissest gegenüber dem vorgesetzten Kommando, presst seine Lippen aufeinander, bis sie blutleer sind, und denkt verärgert, dass er beileibe nicht dazu da ist, im letzten Moment noch diese dreckigen, verlausten Itzigs womöglich zu Hunderten zu beherbergen und zu verpflegen, hier in seinem Rayon. Nach der dienstlich kurzen Befehlsausgabe zwingt sich Postenkommandant Duchkowitsch, den Hörer nicht auf die Gabel zu knallen und das Telefon nicht vom Schreibtisch zu fegen. Er weiß, dass er im Ort nicht gerade sehr beliebt ist und durch die Errichtung eines Judenlagers nicht unbedingt beliebter werden wird. Die Persenbeuger haben schon vor Wochen, ja Monaten begonnen, sich vor den russischen, polnischen, ukrainischen, italienischen und französischen Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen ein wenig zu fürchten, die in und um den Ort für sie und für das Reich schuften, manche von ihnen schon seit 1941, die meisten davon in der Forstverwaltung der Habsburger, die als kriegswichtiger Betrieb eingestuft ist und Buchenholz für die Kampfflugzeug-Produktion liefert. Noch ist in und um Persenbeug Wehrmacht einquartiert, fast 2.000 Mann, aber kein Hiesiger weiß, wie sich die Zwangsarbeiter und Kriegsgefangenen verhalten werden, wenn einmal die Front über Persenbeug hinweggerollt ist. Es gibt eine Menge offener Rechnungen.