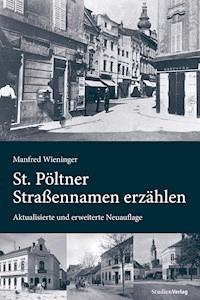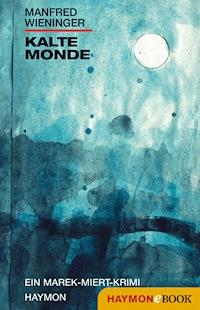
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Marek-Miert-Krimi
- Sprache: Deutsch
MORD IN DER PROVINZ: PRIVATDETEKTIV MAREK MIERT AUF DER JAGD NACH EINEM SERIENMÖRDER Marek Miert ist wieder da. Und er ist ganz der Alte: grantig und stur, cholerisch und melancholisch, aber das Herz auf dem rechten Fleck. In Harland, der tristesten aller Landeshauptstädte, hat sich auch nicht viel verändert. Noch immer hängt eine Dunstglocke über der Stadt, gehen Politiker mit Hassparolen auf Stimmenfang, verpestet der Mief der Vergangenheit die Gegenwart. Doch dann passiert ein Mord. Und die Jagd auf den Mörder, der seine Opfer übel zurichtet und ganz Harland in Angst und Schrecken versetzt, beginnt. Oberleutnant Gabloner ist nicht zimperlich, wenn es um Schuldzuweisungen geht, und die Medien greifen die Mär von den blutrünstigen Ausländern dankbar auf. Nur Marek Miert glaubt nicht an die offizielle Version der Kriminalpolizei und mischt sich unverfroren in die Ermittlungen ein. HOCHDOSIERTE SPANNUNG, UNVERFÄLSCHTER LOKALKOLORIT UND BISSIGER HUMOR Es ist die dunkle Seite der österreichischen Mentalität, die uns in den Krimis von Manfred Wieninger entgegentritt. Sein eigenwilliger und grundsympathischer Ermittler Marek Miert taucht in seinem vierten Fall wieder tief in den Sumpf ewiggestriger Gesinnung und liefert einen Befund über den Zustand unserer Gesellschaft, der in seiner Schärfe und in seinem Sprachwitz seinesgleichen sucht. WEITERE MAREK-MIERT-KRIMIS: - Der Mann mit dem goldenen Revolver - Prinzessin Rauschkind - Rostige Flügel - Der Engel der letzten Stunde
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 288
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wieninger : Kalte Monde
Manfred Wieninger
KALTE MONDE
Ein Marek-Miert-Krimi
© 2006 HAYMON verlag Innsbruck-Wienwww.haymonverlag.at
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder in einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
ISBN 978-3-7099-7467-4
Umschlag: Benno Peter Satz: Haymon Verlag
Dieses Buch erhalten Sie auch in gedruckter Form mit hochwertiger Ausstattung in Ihrer Buchhandlung oder direkt unter www.haymonverlag.at.
„Für einen Diskont-Detektiv haben Sie ein ganz schön starkes Chakra“, sagte mein erster potentieller Klient seit Monaten etwas undeutlich über den Schreibtisch in meinem Empfangszimmer hinweg und zerbiss genüsslich die vierte Mozartkugel. Die kleine Glasschale mit den restlichen drei Kugeln und den Mannerschnitten hatte er längst von der Schreibtischplatte genommen und balancierte sie auf seinem rechten Knie, übrigens nicht einmal ungeschickt.
Ich erwiderte nichts. Vor allem weil ich mir nicht sicher war, ob das jetzt eine Beleidigung oder doch so etwas wie ein dünnes Lob gewesen war. So von meinem umfangreichen Bauchgefühl her empfand ich die Äußerung als nicht gerade schmeichelhaft, aber andererseits war ich in diesem Empfangszimmer schon seit Monaten so allein wie der Heliozentriker Kopernikus in seiner geozentrischen Zeit. Ich konnte mich nicht einmal mehr an das Gesicht meines letzten Klienten erinnern. Seit Gamper & Gamper ihre Filiale mit dutzenden Mitarbeitern in Harland aufgemacht hatten, war das Brot für das hiesige Sicherheitsgewerbe ganz schön hart geworden. Steinhart für mich. Ich war so gefragt wie die Vogelgrippe.
„Was ist jetzt, Miert? Sie haben gerade noch fünf Minuten, um sich zu entscheiden!“
Der Grund, warum ich mich noch immer nicht für die Sache entschieden hatte, war vielleicht mein potentieller, drängender Klient selbst. Ein falten-, narben- und haarloses Botox-Gesicht, wie aus Vanillepudding modelliert, glatt wie der Tiegel einer Anti-Falten-Creme. Ein seltsam geformter, kleiner Mund, eine unauffällige Nase, beinahe farblose Augen und ebensolche Augenbrauen. Ein dunkelblaues Club-Sakko, ein kühn ausgeschlagener, silberweißer Hemdkragen, graue Flanellhosen und teure Böcke, sicherlich aus so etwas wie handgegerbtem Rehkitz-Leder. Hände so weich und blass, wie wenn er seit seiner Geburt permanent Handschuhe getragen hätte. Ein teurer Herrenduft, dezent wie Hollywood. Schnelle, fließende, aber dann immer wieder auch eckige Bewegungen, wie eine leere Coladose, die der Wind stoßweise durch die Gassen rollt. Seit Stan Getz und Dave Brubeck, fand ich, war es eigentlich niemandem mehr wirklich gelungen, so richtig cool zu sein, diesem Schnösel hier schon gar nicht. Es gab eigentlich keinen vernünftigen Grund dafür, aber irgendwie widerstrebte mir die ganze Erscheinung. Mein Solarplexus oder meine Zirbeldrüse oder was auch immer waren jedenfalls dagegen.
Der Bursche hatte eine protzige Visitenkarte aus Büttenpapier auf den Tisch gelegt, auf der in rotgoldenen, irgendwie altmodischen Lettern geschrieben stand:
Horst Heider
Parlamentarischer Mitarbeiter
Nicht gerade die Klientel, für die ich normalerweise arbeitete. Mein letzter Kunde war Friseur gewesen und Notstandshilfe-Bezieher.
Sonst stand nichts auf der Karte, nur eine Handynummer.
Vielleicht mochte ich auch nur den Namen nicht. Dabei hatte mich Haha aus einem ereignislosen Vormittag gerissen, ebenso leer wie die Vormittage davor, in der meine einzige sinnvolle Tätigkeit jeweils darin bestanden hatte, mir zu überlegen, welches Fertiggericht ich zu Mittag auftauen und in die Mikrowelle schieben sollte.
„Wie sind Sie auf mich gekommen? Telefonbuch? Oder hat mich jemand empfohlen?“
„Der Zusatz ‚Diskont-Detektiv‘ in Ihrem Telefonbucheintrag hat mich letztendlich überzeugt. Außerdem glaube ich, Ihr Bild schon einmal in der Lokalzeitung gesehen zu haben. Sie waren ziemlich formatfüllend, in der Breite, aber auch in der Höhe.“
Draußen auf der Gasse, giftete ich mich, hatte der wahrscheinlich ein schneeweißes Porsche-Cabrio mit roten Ziegenledersitzen stehen – aber hier herinnen zuerst heftig um das Honorar feilschen und dann auch noch dauernd auf dem „Diskont-Detektiv“ herumreiten.
„Warum beschützen Sie ihn nicht selbst?“
Ich war schon immer ein Meister darin, gegen mein eigenes Geschäft zu reden.
„Ich bin ein Schreibtischtäter.“
„Dabei habe ich Ihren Abgeordneten nicht einmal gewählt.“
„Den hat überhaupt noch niemand gewählt – vor drei Monaten ist er durch den Tod des Listenersten im Bezirk in den Nationalrat gerutscht“, erwiderte Haha.
„Normalerweise überprüfe ich den Hintergrund meiner potentiellen Klienten ein wenig, bevor ich einen Auftrag annehme …“
Na ja, große Worte, viel hatte ich in den letzten Monaten nicht zu überprüfen gehabt.
„Für wen außer Schneewittchen arbeiten Sie derzeit noch?“
„Mein höchstpersönliches Abenteuer der Tugend besteht eben darin, dass ich nicht für jeden arbeite.“
„Sie würden auch nicht für jeden arbeiten, sondern für einen Abgeordneten, Miert!“
„Göring war auch Abgeordneter.“
Irgendwie liebte ich es, Gesprächssituationen auszureizen. Eine meiner verhängnisvollen Eigenheiten, die mir zuverlässig die Kunden verscheuchte. Oder anders gesagt: Ich habe meine große Klappe noch nie halten können.
„Geschenkt.“
Der Bursche, dachte ich, musste zeitlich ganz schön unter Druck stehen, wenn er sich solche Frechheiten gefallen ließ. Noch dazu von einem wie mir.
„Welche Partei übrigens?“
„Im Moment keine, vor drei Tagen hat er sich von seinem Klub abgespalten.“
„Von welchem Klub?“
„Lesen Sie keine Zeitungen, Miert?“
„Nicht, wenn es sich vermeiden lässt. Und der Innenpolitik-Teil lässt sich fast immer vermeiden.“
„Da sind Sie ja prächtig qualifiziert, direkt überqualifiziert“, feixte Haha. Irgendwie hatte ich das leise Gefühl, dass ihm sein Chef ziemlich egal war. Nach übermäßiger Loyalität klang das jedenfalls nicht.
„Von welchem Klub?“, insistierte ich.
„Vom Splitterklub eines Splitterklubs. Nichts, was Sie interessieren müsste, Miert.“
Wenn mir jemand andeutete, dass mich etwas nicht zu interessieren hatte, dann interessierte es mich erst recht. Eine Art Berufskrankheit. Außerdem, dachte ich, wenn es so weitergeht mit diesen dauernden Fraktionierungen bis ins letzte Dorfparlament, haben wir über kurz oder lang einen neuen Bürgerkrieg.
„Wie sind übrigens Sie zu ihm gekommen?“
„Irgendwer muss ja meine Stromrechnung bezahlen, Miert, und die Extravaganzen meiner Frauen.“
Außerdem ist der Knabe, dachte ich, wahrscheinlich der Großneffe irgendeines Bezirksparteivorsitzenden oder so, sonst wäre er kaum zu diesem Job gekommen.
„Wovor fürchtet er sich?“
„Das weiß nicht einmal ich, aber er hat mich etwa vor einer Stunde in Panik aus dem Parlament angerufen und angewiesen, ihm einen Leibwächter zu besorgen, so einen ab hundert Kilo und größer als die meisten Zaunlatten.“
„Bingo.“
„Dann hat er mich noch einmal von der Autobahn aus angerufen, noch immer echauffiert, und gesagt, dass er jetzt auf dem Weg zum Harlander Messegelände sei.“
„Was tut er dort?“
„Das Übliche – eine Eröffnung. Ich habe übrigens zufällig eine Kopie der Rede mit dabei, die ich für ihn geschrieben habe. Wollen Sie die etwa auch noch studieren, bevor Sie sich endlich entscheiden?“
„Ich bin ja Gott sei Dank kein PR-Berater.“
„Also, was ist jetzt? Die fünf Minuten sind vorbei!“
Vor allem, bemerkte ich, waren auch die Mannerschnitten aufgefuttert.
Wie schaffte es der Typ, ärgerte ich mich, bei dem Appetit bloß, so schlank zu bleiben? Die Welt war ungerecht; ich dagegen nahm schon zu, wenn ich die Neapolitaner nur von weitem ansah.
„Ich werde Ihnen jetzt einmal eine Geschichte erzählen…“, sagte ich.
Mein Gegenüber verzog keine Miene. Wahrscheinlich hatte er so viel Botox unter der Haut, dass er das auch gar nicht konnte.
„Also, meine Geschichte handelt von einem Volksschuldirektor aus der Südstadt, ein harmloser Kerl um die fünfzig, Junggeselle mit zwei Goldfischen, politisch und gesellschaftlich nicht gerade aktiv, Durchschnitt halt. Und der fragt bei der Schulanmeldung der Erstklassler die Eltern von so einem kleinen, dunklen Murl nicht nach einem Meldezettel, nicht nach einem Pass, nicht nach einer Aufenthaltsgenehmigung. Im nächsten Jahr fragt er wieder zwei Elternpaare, die kaum Deutsch können, nach keinem amtlichen Wisch, sondern notiert einfach die Namen der Kinder, die Geburtsdaten und so weiter und lässt sie in seine Schule gehen. Damit es nicht so auffällt, fragt er im Jahr darauf überhaupt niemanden mehr nach irgendwelchen Dokumenten, sondern füllt seine Schule bis zum Dach mit kleinen Menschen, die etwas lernen sollen. Aber irgendwann fällt es doch auf. Die Staatsanwaltschaft beginnt Vorerhebungen wegen Amtsmissbrauch, der Bezirksschulinspektor leitet ein Disziplinarverfahren gegen ihn ein, weil er die Illegalen der Meldebehörde anzeigen hätte müssen. Die Sache zieht sich zunächst, aber nach etwas mehr als zwei Jahren steht der gut Fünfzigjährige ohne Job und mit einer bedingten Vorstrafe da. Eine ganze Kinderschar landet mit ihren jeweiligen Eltern in der Schubhaft, manche schaffen es durch Hungerstreik, Selbstverstümmelung oder Rechtsanwälte, da wieder herauszukommen, aber die Spuren der meisten verlieren sich schließlich in irgendwelchen schmutzigen Kriegen in Afghanistan, Ecuador, Usbekistan und so weiter und so fort. Der ehemalige Direktor schließlich zertrümmert eines Tages in einem Milchtopf eine Bierflasche, zerkleinert die Splitter noch ein wenig mit einem Mörserstößel und beginnt das Ganze aufzuessen. Er spült mit Rohrreiniger nach. Zwei Tage später stirbt er in der Intensivstation.“
„Was wollen Sie mir damit sagen?“, fragte Horst Heider ein wenig leiser als zuvor. Ein bisschen wenigstens hatte es seine Blasiertheit verblasen.
„Vielleicht, dass ich die Sorgen eines Abgeordneten nicht ernster nehme als die anderer Leute“, erwiderte ich.
Der Abgeordnete, so hieß es, würde sich erheblich verspäten. Und damit würde sich auch die offizielle Eröffnung verspäten. So wanderte ich zwischen den Messeständen umher. Umsonst war hier nur der Tod, nicht jedoch die Nusstruhe „Letzte Adresse“, die Astro-Urne, der klassische Eichensarg „Abendrot“, die biologisch abbaubare Bestattungshülle aus Polyvinylalkohol und der Designersarg „Magritte“ aus toskanischem Edelpappelholz mit ewigem Daunenschlafsack. Ich ließ mich zudem aus purer Langeweile eingehend über Seebestattung an der dalmatinischen Küste, über mit Beton auffüllbare Plastikgrabsteine, über die Internetplattform www.schoeneleich.at und über Münz-Friedhofsgießkannen nach dem praktischen Einkaufswagerl-Prinzip informieren. Das Ewige Licht neuester Bauart, so wurde mir überdies erklärt, sei absolut UV- und wetterbeständig und die Batterie müsse nur mehr höchstens einmal im Jahr, zu Allerheiligen, gewechselt werden. Außerdem nahm ich an einer praktischen Vorführung eines Grablicht-Automaten und zur Gestaltung von Kranzschleifen mit PowerPoint teil. Auf das Probeliegen verzichtete ich allerdings, weil mir die angebotenen Särge für meine Leibesfülle doch etwas zu beengt erschienen. Ich werde mich, dachte ich, aus Platzgründen dereinst wohl verbrennen lassen müssen, obwohl der Tod ja schlank macht, wenn auch nicht sofort. Ein Steirer wollte mir zudem einen ausrangierten Chrysler-Grand-Voyager-Leichenwagen „zum Schwarzfahren“, wie er sagte, verscherbeln und dann auch noch einen antiken ägyptischen Sarkophag um zwanzigtausend Euro, weil er mich mit einem Prokuristen der Wiener Städtischen Bestattung verwechselte.
Der Sensenmann stand unsichtbar in einer Ecke der Harlander Messehalle und freute sich über das Zusammentreffen mit seiner großen Familie auf der „Devota“. Die meisten Bestatter waren von ganz normalen Leuten nur durch ihre sehr dezente Berufskleidung zu unterscheiden. Unter den Budeln ihrer Verkaufsstände entdeckte ich Biergläser, Schokolade-Müsliriegel, Geschicklichkeitsspiele und Softporno-Illustrierte. Einen Attentäter konnte ich allerdings nirgends entdecken.
Horst Heider hatte mir eine Liste mit den nächsten Terminen des Abgeordneten übergeben und einen Vorschuss in der Höhe von drei Tagessätzen. Einen Überstundenzuschlag hatte ich ihm nicht herausreißen können. Wahrscheinlich strich er den selber ein, denn es war sehr fraglich, ob ein österreichischer Parlamentarier zu so etwas Konstruktivem wie dem Lesen und Verstehen einer Rechnung überhaupt fähig war.
Gegen die Mittagszeit wurde ein mittelgroßer, glatzköpfiger, solariumgebräunter Mann in einem dunkelblauen Firmungsanzug mit weißem Hemd und schwarzer Krawatte vom niederösterreichischen Gremialvorsteher des Bestattergewerbes als der Herr Abgeordnete Helmar Topf, der gleich die offizielle Eröffnung vornehmen werde, angekündigt und wie eine frische Leiche begrüßt. Die beiden, denen außer den vier Stellvertretern des Gremialvorstehers und dem Messedirektor niemand die geringste Aufmerksamkeit schenkte, standen für einen Moment Schulter an Schulter hinter dem kleinen Rednerpult aus Aluminium, vor dem zwei rachitische Palmen in schwarzen Plastiktöpfen den dekorativen Part zu übernehmen hatten. Die Rede des Abgeordneten könnte man unter dem Satz „Umsonst ist nicht einmal der Tod“ subsummieren. Ich stand bald am Rande eines hysterischen Lachanfalles und verzog mich, um unter all den ernsten Männern in dunklen Anzügen nicht unangenehm aufzufallen, an das Buffet in eine Nebenhalle, wo man bereits mit dem Aufbau der Dekoration für die nächste Fachmesse, eine „Erotica“, begonnen hatte. Ein paar türkische Hilfsarbeiter schraubten Aluminium-Kojen zusammen oder schleppten lebensgroße Puppen hin und her, die mit schwarzem Latex und Leder sowie allerlei Metallketten behängt waren.
Auf der Budel, auf der ich von einer herzhaft gähnenden Standlerin im graublauen Arbeitskittel eine Käswurst-Semmel auf einer leicht dubiosen Serviette serviert bekam, lag die gestrige Ausgabe der „Harlander Nachrichten“. „Massenansturm von Asylanten? Tschetschenische Kommandos nach Harland?“, lautete die aufgeregte Schlagzeile, und wenn man auf Seite zwei weiterlas, konnte man den Eindruck gewinnen, als stünde uns eine dritte Türkenbelagerung inklusive Osama bin Laden bevor. Auf Seite drei wurde der Abgeordnete Topf mit ein paar wilden Sagern gegen „diese Wilden“ zitiert. Er war angeblich drauf und dran, hier in Harland eine Bürgerinitiative gegen „diese tschetschenischen Terroristen, mit denen die Republik viel zu streichelweich umgeht“, zu gründen. Erst am Schluss des Artikels wurde klar, dass lediglich ein paar tschetschenische Flüchtlingsfrauen und Kinder aus dem überfüllten Horror-Lager Traiskirchen in eine Harlander Pension einquartiert werden sollten.
„Alles auf unsere Kosten! Nur wir lassen uns immer auf den Kopf scheißen!“, kommentierte die resche Standlerin meine Lektüre.
„Glauben Sie immer alles, was in der Zeitung steht?“, antwortete ich kauend. Eine frische Serviette wäre mir lieber gewesen als der Kommentar der Buffetkraft. Ich glaube ja, dachte ich, ein ganz leidlicher Demokrat zu sein, aber bei manchen Leuten wäre es besser, sie hielten ihr Leben lang den Mund, ein Haufen Berufspolitiker mit eingeschlossen. Im Übrigen war ich etwas besorgt, dass sich ausgerechnet mein einziger Kunde als eine Mischung aus George Armstrong Custer und Abraham a Sancta Clara entpuppen könnte. Wundern würde es mich aber nicht, dachte ich, in diesem Land hat der Hass immer Saison.
„Wenn S’ eh nicht daran glauben, warum nehmen S’ das Blattl dann mit?“, rief mir die Standlerin nach.
Es wäre ein bisserl genant gewesen zuzugeben, dass ich ein paar Lagen Zeitungspapier unter meinem Podex ganz gut gebrauchen konnte, weil die Heizung meines Ford Granada ausgefallen war. Besonders der Politikteil des Blattes wurde damit, so fand ich jedenfalls, einer durchaus adäquaten Verwendung zugeführt.
Ich hatte den Abgeordneten natürlich ansprechen wollen, als ich – man muss Prioritäten setzen im Leben – die Käswurst-Semmel verzehrt hatte und wieder in die Haupthalle zurückgekehrt war. Aber er steuerte bereits eilenden Schrittes auf den Haupteingang zu, war schon durch und ließ sich sofort in seinen schweren, dunkelblauen BMW fallen, der praktischerweise auf einem Behindertenparkplatz direkt vor dem Eingangsbereich stand. Ich dagegen musste zu meinem Ford Granada, zu meinem Klassiker, dem mittlerweile das Pickerl von Jahr zu Jahr nur mehr gnadenhalber verlängert wurde, erst einige Meter über den dünnen, grauen, schmierigen Schnee laufen, bevor ich daran denken konnte, ihm zu folgen. Im Winter war es überhaupt jedes Mal ein Vabanquespiel, die Zündung noch einmal in Gang zu bringen. Selbst im Sommer sprang der Motor nur mehr an, wenn man das Gaspedal und die Kupplung gleichzeitig durchdrückte und nach vier, fünf Sekunden den Zündschlüssel mit einem Stoßgebet umdrehte. Vorzugsweise die Jungfrau Maria oder Judas Thaddäus halfen hier. Der Winter biss in den Motor, aber der kleine Starter brachte das Werkel wieder einmal zum Laufen. Wie ein Traktor begann sich der schwere Granada beharrlich über die vom Schnee verschmierte Fahrbahn zu schieben. Aus immer größer werdender Entfernung sah ich, dass der Abgeordnete offenbar schon auf der Messestraße das Gaspedal seines großen, schweren Wagens voll ausreizte. Kunststück, der Bursche war immun. In die Porschestraße bog er über den Streusplitt schlitternd ein und spätestens in der Obergrafendorfer Straße hätte er mich sowieso längst abgehängt gehabt.
Irgendwie war das für diesen Fall symptomatisch, in dem mir bisher alles zu schnell gegangen war, angefangen von Horst Heiders Stippvisite bis zu einem rasenden Parlamentarier, der sich vor lauter Angst für einen der beiden Schuhmachers hielt oder gleich für alle beide. Im Übrigen hatte ich aber schon weit Schlimmeres erlebt als eine Zielperson zu verpassen und von einem Sechzehn-Zylinder-Boliden abgehängt zu werden. Zum Beispiel ein Dreivierteljahr nach meinem Ausscheiden aus dem Polizeikorps, als mir die Gattin von Amtsrat Törna mit fettigem Stolz mitgeteilt hatte, dass ihr Göttergatte mit dem Ehrenzeichen zweiter Klasse für Verdienste um die Republik dekoriert worden war. „Die längst fällige Anerkennung“, hatte ich etwas gequält gemurmelt. Mein linker Arm hatte nämlich gerade bis zur Achsel im Ansaugrohr der Teppich-Tuba gesteckt und meine Finger hatten in einem nassen Filz aus Haaren, Schmutz und Textilresten gewühlt. Die Teppich-Tuba war überhaupt mein größtes Problem gewesen, seit sie in das Verkaufsprogramm von Reinex aufgenommen worden war. „High-Tech auch für die Hausfrau“, lautete der dazugehörige Slogan. Die Teppich-Tuba hatte nur einen einzigen, klitzekleinen Nachteil gehabt: Sie funktionierte nicht. Daher hatte ich mich damals bereits wochenlang geweigert, weitere Tubas an die Hausfrau zu bringen. Die Zentrale war natürlich etwas sauer gewesen. Ein großer Teil meines Fixums war gestrichen worden. Auch meine Chancen, es jemals zum Reinex-Bezirksverkaufsleiter zu bringen, waren rapide dahingeschwunden. Ich wollte damals auch nicht länger darauf warten, bis die dreiundzwanzig von mir bereits verkauften Teppich-Tubas in rund zehn Jahren endgültig durchgerostet sein würden und es dann mit den vermaledeiten Reparaturen ein Ende haben würde, und hatte daher beschlossen, Privatdetektiv zu werden.
Aber andererseits war ich diesmal klar im Vorteil, dank Heiders Terminliste wusste ich nämlich immer, wohin der Abgeordnete unterwegs war. Diese Liste, schoss es mir mit einem Mal durch den Kopf, wäre auch für einen Attentäter eine feine Sache.
Die kalte, schwefelige Luft in der Südstadt roch süßlich. Ein weißlichgrauer Himmel hing tief wie die Körperhöhle eines ausgeweideten Tieres herab. Das Vorgebirge ein paar Kilometer vor mir im Süden war ein schmutziggrauer Gedankenstrich, der leicht schräg aufwärts zog. Das Zementwerk bei Ganzendorf verheizte gerade wieder einmal alte Autoreifen und sonstige Reste unseres Wohlstandes. Bevor der böhmische Gefreite mit seinen Schäferhunden in die Hölle abgefahren war, hatte es Zwangsarbeiter verheizt und die eine oder andere Waggonladung zu Matsch geschlagener Juden aus St. Aegyd. Aus dünnen Lagen mittelalten, schmutzigen Schnees wuchsen Tankstellen wie Paläste aus Tausendundeiner Nacht, daneben und dazwischen Drive-in-Frittenbuden und Grillrestaurants, Fernfahrerpuffs, die rund um die Uhr im wahrsten Sinne des Wortes offen hatten, Baumärkte für die Profi-Pfuscher, die unvermeidlichen Schuhdiskonter, Reifenhändler, Lagerhallen, Autofriedhöfe und wilde Schuttabladeplätze – an der Ausfallstraße Richtung Süden wurde richtig Geld gemacht. Seit die Fernfahrer der Maut wegen die Autobahnen mieden, war hier noch mehr los, die Straße war die einzig brauchbare Verbindung vom Großraum Harland in die Steiermark, nach Kärnten, Slowenien und den Balkan hinunter. Ich bemühte mich, den Granada sauber im dichten, nervösen Verkehr zu halten und nach Möglichkeit auch noch die hirnrissigsten Überholmanöver vor und hinter mir zu überleben. Auf dieser Straße war ich immer froh, einen schweren, soliden Wagen zu fahren, in dem noch kein Gramm Aluminium eingebaut war, einen Wagen, der auch bei einem gröberen Unfall nicht zusammenknicken würde wie eine leere Coladose unter einem Fußtritt.
Nach St. Georgen bog ich rechts in eine alte Landstraße ein, eigentlich nicht mehr als ein asphaltierter Feldweg. Über einen Sattel zwischen zwei bewaldeten Höhenrücken ging es ins Pielachtal. Es wurde kälter, so kalt, dass ich es in den Nasenlöchern spüren konnte. Denn die Heizung des Granada war wieder einmal komplett ausgefallen.
Krampusse hatte ich auf der ganzen Fahrt noch keine entdecken können, dafür war es wohl zu früh am Tage, aber heute war ihre Nacht. Im Prinzip, so dachte ich, war es idiotisch, unbekannten jungen Mädchen und Frauen mit Weidenruten auf Beine und Hinterteile zu schlagen, um einem jahrtausendealten Fruchtbarkeitsbrauch Genüge zu tun. Vor allem war es idiotisch, weil sich am Abend des 5. Dezember, der Krampusnacht, sowieso niemand – und schon gar kein Harlander Mädchen, das Wert auf die Unversehrtheit seiner Strumpfhosen legte – auf den Straßen blicken ließ und die Sache für gewöhnlich damit endete, dass sich die frustrierten Krampusse gegenseitig verbläuten. Das Christentum, fand ich jedenfalls, hatte mit so manchen heidnischen Spinnereien nicht konsequent genug Schluss gemacht. Man hatte die alten Götter zwar vom Olymp vertrieben, aber von da aus waren sie in die Diaspora, das heißt überallhin gegangen.
Den Loizenbacher See, mein Fahrtziel, kannte hier in der Gegend jeder. Kurz vor dem Zusammenbruch hatte eine halbe SS-Panzerdivision ihre Waffen und ihr Gerät und ein paar Dutzend ihrer Gefangenen in seinen dunkel-schlammigen Fluten versenkt und war dann stiften gegangen. Schon bald waren Gerüchte aufgekommen, dass die getürmten SS-ler noch etwas ungleich Wertvolleres im See gelassen hatten als Stahlhelme, Karabiner und russische Sergeanten. Die ersten illegalen Schatzsucher waren Anfang der Fünfzigerjahre auf- beziehungsweise, besser gesagt, untergetaucht im See. Und bald fielen von Jahr zu Jahr mehr gutgläubige Hobby-Abenteurer und schneidige Glücksritter auf die lokale Folklore herein. Bis heute lebten in Loizenbach einige Familien von dieser Schatzsuche. Einerseits indem sie Touristen und Badegäste auf geführten Tauchgängen ein paar verrostete Schrauben und Bolzen im Faulschlamm finden ließen, andererseits indem sie dem Vernehmen nach in nächtlichen Taucheinsätzen die Geschütze und Panzer im See auseinanderschweißten und die Einzelteile dann an Sammler verkauften, neuerdings auch über das Internet. So manche Schatzsucher, die auf die guten Dienste der Loizenbacher verzichten zu können glaubten, sollen allerdings schon schlimmen Tauchunfällen zum Opfer gefallen sein. Besonders die Barsche und Welse im Loizenbacher See, hörte man, waren größer und fetter als anderswo.
Eine von tausend Unwettern ausgewaschene, schlechte Schotterstraße führte gewunden hinunter zum See durch gefrorenes Marsch- und Sumpfland, durch ausgedehnte, weißbraune Flächen, aus denen die Stämme und Stauden des Auholzes und die Rispen der Schilfgräser ragten. Den weißen Toyota der Harlander Staatspolizei, der hinter einer weißgrauen Buschgruppe abgestellt war, bemerkte ich erst, als ich fast schon an ihm vorbeigefahren war. Praktischerweise gab es keine andere Zufahrt zum See. Auf jeden Fall keine, die außer den Loizenbachern noch jemandem bekannt gewesen wäre. Der Stapowagen wendete sofort und fuhr mir nach. Nicht gerade mit Vollgas und Blaulicht, aber doch.
„In der Sprache der Eskimos finden sich jede Menge Ausdrücke für die verschiedenen Kältegrade. Das Deutsche kennt nur zwei: Kühlschrank und Gefrierfach“, dozierte der ältere der beiden Staatspolizisten auf Höhe meiner Autotür, während er noch immer intensiv meinen Handelskammerausweis studierte. Ich hatte das Fenster heruntergekurbelt, lächelte monoton und blickte auf seinen dicken, grünen Lodenmantel, den mächtigen, schwarzweiß-karierten Wollschal und das schwarze Stirnband mit Ohrenschützern.
„Trösten Sie sich, bei mir im Wagen ist es auch nicht unbedingt wärmer, die Heizung ist ausgefallen“, versuchte ich mich ebenfalls in Smalltalk.
Sie hatten mich am neuen, geteerten und gefegten Parkplatz vor dem westlichen Seeufer abgefangen, und jetzt wusste ich auch, warum ausgerechnet die Stapo eine solche Veranstaltung irgendwo am Ende des Landkreises zu schützen hatte. Denn auf den Stellplätzen standen nicht nur mehr als ein Dutzend schwere Mercedes, Volvos und BMWs und drei Kamerawagen mit den Logos der Sendeanstalten, sondern auch zwei Fußballmannschaften an Chauffeuren und Sekretären herum. Entweder war das hier die kleinere Ausgabe des Davoser Weltwirtschaftsgipfels oder ein autochthoner politischer Almauftrieb.
Neben dem Parkplatz konnte ich ein neues, sehr groß dimensioniertes Blockhaus ausmachen, vielleicht eine Art Lounge für die erwarteten Touristenströme oder der Sitz der Parkverwaltung. Das rotbraune Holz glänzte frisch lackiert, die Bauhütte und das Mobil-WC aus grünem Plastik für die Bauleute seitlich davon waren noch nicht abgetragen worden.
„Viele Ehen scheitern für gewöhnlich an der Frage, wer als Nächster den Kühlschrank abzutauen hat. Daher lehnen es die Eskimos vermutlich auch standhaft ab, sich Kühlschränke zuzulegen“, murmelte der Staatspolizist mit dem Eskimo-Tick weiter, während er noch immer in meinen Ausweis starrte, den er jetzt wahrscheinlich schon sechs- oder siebenmal gelesen hatte. Seine Gedanken kreisten aber offenbar nicht um meine Daten, sondern um die Kälte hier am See. Seinen Fahrer, einen jüngeren Beamten in einer neonorangen Daunenjacke und Lammfellstiefeln, hatte er schon vor geraumer Zeit in das offenbar neu erbaute Gästehaus geschickt, wahrscheinlich um den Abgeordneten Topf zu fragen, ob der einen Leibwächter namens Marek Miert hatte.
„Wie lange arbeiten Sie schon für den Abgeordneten?“
Offenbar waren ihm die Eskimo-Schmähs ausgegangen.
„Sie werden lachen: seit vier Stunden und dreiundzwanzig Minuten, um genau zu sein.“
Der Beamte lachte nicht. Im Gegenteil. Ich sah zu, wie er seine linke Hand langsam und unauffällig in seinen Lodenmantel schob. Wahrscheinlich, um nach der Glock zu tasten.
„Irgendwelche verbotenen Waffen, die Sie bei Ihrem Job benützen und jetzt gerade dabeihaben?“
Eigentlich hatte ich antworten wollen: „Eine Bazooka im Kofferraum und einen zerlegten Granatwerfer unter dem Beifahrersitz“, aber dann fiel mir mit Schrecken ein, dass die Handgranate aus Opa Mierts Beständen tatsächlich irgendwo im Handschuhfach herumkugelte. Wenn sie mich damit erwischten, konnten sie mich für einige Zeit aus dem Verkehr ziehen.
„Nein“, antwortete ich schmallippig.
Der Abgeordnete hatte sich offenbar im Auto umgezogen. Er trug jetzt zu meiner Verblüffung Military-Gummistiefel, eine Art langärmelige, wattierte Anglerjacke und so etwas wie einen Tropenhut in Khaki. Außerdem schleppte er eine Kamera mit einem gewaltigen Teleobjektiv von fast einem halben Meter Länge mit sich herum. Den jüngeren Stapobeamten im Schlepptau, war er zielsicher auf den Granada zugestiefelt und hatte sofort mit mir zu reden begonnen. Offenbar hatte ihm Heider telefonisch eine ganz gute Beschreibung meiner Person durchgegeben. Der ältere Beamte hatte die Situation schnell erkannt und sich dezent verzogen. Der Jüngere blieb dagegen wie angewurzelt stehen, bis ihn Topf mit einer Art unwirschem Grunzer und der Bemerkung: „Haben Sie nichts zu tun, Herr Kollege?“ verscheuchte. Immerhin, meine Granate war dadurch zunächst einmal vor amtlicher Entdeckung gefeit. Ich hätte Opa Mierts Krempel schon längst wegwerfen sollen, aber kann man eine scharfe Eierhandgranate, eine russische Leuchtpistole und eine Schrotflinte, die weiland dem Harlander Volkssturm gehört hatte, einfach im nächstbesten Müllcontainer entsorgen?
„Das Gelände ist ein wenig unübersichtlich – wo ist Ihr zweiter Mann, Miert?“
Ich dürfte etwas zu langsam geschaut haben, denn der Abgeordnete fragte eindringlich weiter: „Sie haben doch sicherlich einen zweiten Mann mitgebracht? Wo ist er?“
Welcher zweite Mann, dachte ich? Was hat dem bloß dieser Heider mit e sonst noch erzählt? Sackt der die Honorare für ein ganzes Team ein oder was?
„Äh, ja, dort drüben im Gebüsch, unter den Weiden.“
„Gut getarnt, das kann man wohl sagen!“
„Wir schicken unsere Leute auf eigene Lehrgänge dafür.“
„Das sieht man.“
Bevor ich noch weitere imaginäre Mitarbeiter erfinden musste, öffnete sich das Tor des Gästehauses und ein ganzer Strom an Politikern, Journalisten, Pressesprechern und Adabeis ergoss sich auf den Parkplatz. Wahrscheinlich hatten sie desinteressiert irgendeinen Einführungsvortrag über das neue Naturschutzgebiet absolviert. Die Umweltministerin sprach im Abgehen noch ein kurzes Statement in die Mikrofone und rauschte dann gemeinsam mit ihren beiden Pressereferenten oder Sekretären in einer schwarzen Limousine ab, dicht gefolgt vom Stapowagen. Topf hatte sich sofort nach dem Erscheinen des ganzen Trosses brüsk von mir abgewendet und war um die Kameras herumgeschlichen, aber verglichen mit der Ministerin war er hier für die Medien wohl nur der vierte Zwerg von links.
Etwas war mir aufgefallen: Der Abgeordnete schien weder zittrige Hände noch tiefe Ringe unter den Augen zu haben, weder übermäßig zu schwitzen noch nervös oder blass oder fahrig zu sein, ganz im Gegenteil, der Typ war eigentlich ganz schön forsch und hatte wahrscheinlich vor niemandem Angst, kein bisschen, vor nichts und niemandem, schon gar nicht vor irgendwelchen tschetschenischen Terrorzellen. Seltsam, dachte ich, dass so jemand einen Leibwächter engagierte, noch dazu einen wie mich.
Nach der endgültigen Abfahrt der Ministerin und ihrer Eskorte war der Tross aus den Landtagsabgeordneten, den Bürgermeistern und Lokalpolitikern der umliegenden Gemeinden, den Redakteuren, Kameraleuten, Tonassistenten und drei Parkangestellten in langen, wattierten Jacken mit Tarnmuster langsam in das Gelände vorgedrungen. Schwemmland mit verwehtem Schnee, Eisschotter, unförmiges Gesträuch, ocker- und sandfarbener, gefrorener Auwald, der in der Wintersonne wie Hundekot bräunte. Nach rund dreiminütigem Marsch, bei dem eine Menge Halbschuhe im harten, firnigen Schnee zuschanden gingen, erreichten wir einen Schottersee in der Größe von vielleicht acht, neun Fußballfeldern. Seltsamerweise gab es keinerlei Eis auf der Oberfläche und Schwaden von Dampf schwebten über den Wassern. Man hatte fast den Eindruck, als schleppte die Wolfssonne ihren blonden Seim einzig und allein in dieses Gewässer. Am Ufer des Sees waren ein paar Schilfhütten aufgestellt. Diese Beobachtungsplätze sollten wohl den Tagestourismus in der gottverlassenen Gegend ankurbeln. Als erstes monierten die anwesenden Journalisten, dass es an diesem Strand keine Bar gab.
Topf mied die Hütten, weil er sich unbedingt in den Kameralinsen der drei Fernsehteams und der Zeitungsfotografen spiegeln wollte, und tat am Schotterteich mindestens so interessiert wie Charles Darwin auf Galapagos. Dabei war er sichtlich gelangweilt gewesen, als der Parkleiter, ein leibhaftiger Hofrat in wattiertem Khaki, auf dem langen Marsch von Feenkrebsen und Rückenschalern, von Schafstelzen und Grauammern, Laubfröschen und Gelbbauchunken geschwärmt hatte. Die lokalen Fernsehjournalisten ignorierten jedenfalls sowohl den dozierenden Parkbeamten wie auch den zünftigen Abgeordneten geflissentlich, denn sie hatten schon die Umweltministerin im Kasten und brauchten jetzt eigentlich nur noch die Viecher aufzunehmen, die hier angeblich zu sehen waren.
Der Khaki-Hofrat erklärte derweil etwas von warmen Quellen und artesischen Brunnen und Mergelschichten, während seine beiden Mitarbeiter Slibowitz im Flachmann und Ferngläser an die Truppe ausgaben. Die Fotografen und Kameraleute und Bürgermeister und Landtagsabgeordneten hockten sich in die Hütten, während Topf vor den Kameraausnehmungen und Sehschlitzen in den Schilfwänden auf und ab lief oder mit seinem Teleobjektiv allerlei interessante Posen einnahm. Früher hatte man alles getan, um in den Himmel zu kommen. Heute tat man alles, um ins Fernsehen zu kommen. Habemus Papam: Andy Warhol.
Dann tat sich zunächst einmal fast eine Stunde lang nichts, aber auch gar nichts. Zwei Redakteure und ein Kamerateam zogen ab und stolperten eskortiert von einem Parkwächter durch den Auwald zurück.
Danach tat sich wieder eine halbe Stunde nichts. Eine gereizt-gelangweilte Stimmung kam auf, wie wenn man beim zwanzig- oder dreißigjährigen Klassentreffen eine Menge Leute viel zu lange auszuhalten hatte, die man schon als Fünfzehnjähriger nicht hatte ausstehen können.
„Achtung! Da sind sie!“, wisperte der Hofrat plötzlich emphatisch.
Daraufhin war laut und deutlich die schallende Frage des Abgeordneten Topf zu hören: „Wer denn?“
Dicke, schwarze Scheiben von der Größe eines kleineren Brotlaibes tauchten aus den warmen Wassern, gepanzert, dunkel und angeblich älter als die Dinosaurier – zwei, drei, fünf Exemplare der Europäischen Sumpfschildkröte hievten sich unspektakulär auf den Schotterstrand, vielleicht fünfzig, sechzig Schritte rechts von uns. Die Kameras surrten und klickten und der Abgeordnete Topf versuchte, in die Bilder zu springen, wurde aber verscheucht. Seine Kamera gab kein Geräusch von sich, wahrscheinlich hatte er sich das teure Stück nur ausgeborgt und nicht einmal einen Film eingelegt.
„Emys orbicularis sieht ganz gut und hört nicht schlecht – Sie sollten alle in die Hütten gehen!“, wisperte der Outdoor-Hofrat aufgeregt.
Da waren die Schildkröten auch schon wieder ins Wasser abgetaucht und die Pirsch zu Ende.
Auf dem Rückmarsch gelang es mir, den Abgeordneten für einen Moment von einer Gruppe von Redakteuren, bei denen er sich wichtig machen wollte, und deren geistigen Stärkungsmitteln abzudrängen.
„Ich würde gerne eine Sicherheitsüberprüfung Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung vornehmen.“
„An sich eine gute Idee, über die wir diskutieren sollten. Aber ich muss anschließend noch zu einer Sitzung des Landesparteivorstandes. Da bin ich unabkömmlich und brauche keinen Schutz, alles Parteifreunde!“, der Abgeordnete ging in den für ihn zu großen Gummistiefeln wie ein hochschwangerer Maulesel. „Wo ist übrigens der zweite Mann?“
„Hat das Gelände auf einer anderen Route, auf einer Abkürzung bereits verlassen, um unsere Abfahrt zu decken.“
Ich sah es seinen Augen an, dass er gleich den Hofrat nach dieser Abkürzung fragen würde, und musste ihn irgendwie ablenken: „Soll ich Ihre Kamera tragen? Scheint ja ziemlich schwer zu sein.“
„Sie sollten Ihre Hände immer frei haben für Ihre Waffe! Und was für eine benützen sie?“
„Eine Walther PPK. Mit adaptiertem Verschluss für eine schnellere Schussfolge.“
Ich verschwieg ihm natürlich, dass ein ehemaliger Polizist, der im Unfrieden von der Truppe geschieden war, niemals einen Waffenschein oder eine Waffenbesitzkarte erhalten würde. Dafür sorgten die Ex-Kollegen schon.
Als wir den Parkplatz wieder erreicht hatten, brannte das Gästehaus lichterloh. Die Loizenbacher wollten offenbar keinen nicht von ihnen kontrollierten Tourismus. Im gelbmilchigen Widerschein des Brandes sprintete der Abgeordnete zu seinem BMW und legte einen filmreifen Kavaliersstart hin. In der ersten Aufregung kümmerte sich niemand um ihn und sein Verhalten, auch ich nicht. Nach wenigen Sekunden war der dunkelblaue Bolide hinter der ersten Biegung der Aupiste in der Reiflandschaft des Überschwemmungsgebietes verschwunden. Mit meinem Ford Granada hatte ich gar nicht erst versucht, da mitzuhalten. Es kam mir nur irgendwie seltsam vor, dass jemand, der mit einem möglichen Attentat auf seine Person rechnete, gerade im Angesicht eines Kapitalverbrechens nicht die Nähe seines Leibwächters suchte, sondern ganz im Gegenteil …
Da ich keine Veranlassung sah, in der aufgeregten Hühnerschar der Exkursionsteilnehmer über die Brandstiftung und die Gründe dafür mitzugackern, setzte ich mich in den Wagen und machte mich daran, nach Harland zurückzufahren. Niemand hinderte mich daran. Die Probleme der Obrigkeit mit den Loizenbachern und umgekehrt gingen mich, fand ich, nichts an.
Mein Ziel war ein verlorener Haufen Häuser südlich der Harlander Südstadt. Was ein Parlamentsabgeordneter und mit ihm seine ganze Landespartei dort zu suchen hatte, war mir aber schleierhaft. Ich hatte eben keine Ahnung von Politik, nur von Käsekrainern, Chardonnay und dem Dreck, in dem ich von meinem Beruf her zu wühlen hatte.
Kurz vor Loizenbach, an der Kreuzung der Zufahrtsstraße zum See mit der Landesstraße, lud ich meinen imaginären Assistenten auf ein Paar Debreziner mit scharfem, hellgelbem Senf ein. Für mich bestellte ich eine dicke Scheibe warmen Leberkäse mit ein paar süß-sauren Essiggurkerln. Beides schmeckte vorzüglich, ohne die Institution des Würstelstandes müsste ich mir ernsthafte Sorgen um meine Ernährung machen. Denn ich konnte so gut kochen, wie der alte Beethoven zuhören konnte.
Der Würstelstand war in einem alten VW-Bus am Straßenrand untergebracht, dessen Seitenwand man aufgeschweißt hatte, um eine Budel zu schaffen, nicht mehr als ein poliertes Holzbrett auf zwei in das Bankett eingerammten Metallstangen. Eine unbeholfene Werbeaufschrift kündete von „Sepp’s Putenkebab“. Etwas Faderes als Putenfleisch, dachte ich schaudernd, gab es nicht, da konnte man ja gleich an einer alten Kokosmatte herumkauen. Ich war auch weit und breit der einzige Gast, sah man von meinem imaginären Assistenten, der mir dankenswerterweise seine Debreziner überließ, einmal ab. Eine einsamere Kreuzung gab es wohl im ganzen Voralpenraum nicht.
„Schon was vom Brand des Seehauses gehört? Oder gerochen?“, fragte ich den Standler, einen großen, dürren Mittfünfziger in einem grünen, verwaschenen Trainingsanzug, worüber er noch eine orange, grobe Jacke wie ein Straßenarbeiter trug.
„So was kommt vor. Kurzschluss vielleicht.“
„Bei einem Neubau?“
„Oder halt ein Lausbubenstreich.“
„Wahrscheinlich Max und Moritz.“
„Von der Kieberei, was?“
„Wenn ja, hätte ich dann keine Würstel gekriegt?“
„Ich lasse mich auf keine Diskussionen mit der Staatspolizei ein.“
Das ist, dachte ich, eine weitere seltsame Antwort und zugleich ein weiser Grundsatz. Der fliegende Würstelstand hier, allein auf weiter Flur, ging mir jetzt langsam auf, war vielleicht nichts anderes als der Beobachtungsposten der Loizenbacher für die ganze heutige Aktion. Auf einer Ablagefläche neben dem Kühlschrank sah ich drei Handys liegen. Wer weiß, was der Standler noch alles unter der Budel hatte?
„Schon mal was vom Abgeordneten Topf gehört, Loizenbacher?“
„Wen interessiert’s schon, Meister, wie die Großkopferten alle heißen?“
„Sie sollten vielleicht langsam abbauen, bevor Ihnen wirklich noch die Stapo einen Besuch abstattet.“
„Was wollen Sie damit andeuten?“
„Wenn Sie an dieser hoffnungslosen Kreuzung pro Tag mehr als zwei, drei Kebabs verkaufen, wär’s ein Wunder …“
„Geht Sie meine Standortwahl etwas an?“
„Wenn ich Sie wäre, würde ich wenigstens die Handys wegräumen.“