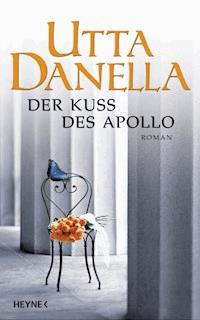6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Fast alles hat der Breslauer Buchhändler Matthias Wolff im Krieg verloren: den Beruf, die schlesische Heimat und vor allem seine geliebte Frau. Geblieben sind ihm sein unbesiegbarer Lebensmut und zwei erwachsene Töchter: Ricarda, die bei ihm in Breslau geblieben ist, und Charlott, der es kurz vor Kriegsende noch gelungen ist, in den Westen zu fliehen, zu dem Mann, den sie ihrer Schwester fortgenommen hat. Was sie ihr damit angetan hat, wird sie erst viel später erkennen, als der Vater die beiden Schwestern nach 16 Jahren wieder zusammenführt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 780
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Utta Danella
Der Maulbeerbaum
Roman
Ein paar Worte zuvor
Wie ich dazu kam, dieses Buch zu schreiben, will ich versuchen zu erklären. Es handelt sich um eine ganz alltägliche Geschichte, es passiert durchaus nichts Ungewöhnliches. Und warum ich Anteil nahm am Schicksal dieser Menschen, von denen ich erzählen will, hat mehr oder weniger persönliche Gründe.
Am Anfang war es nichts als eine flüchtige Reisebekanntschaft. Ich traf Werner Fabian und seine Frau vor einigen Jahren in einem Schweizer Kurort, und sie unterschieden sich in keiner Weise von anderen wohlhabenden Bundesbürgern, die man heutzutage auf Reisen im Ausland trifft. Ein tüchtiger Geschäftsmann, der es zu etwas gebracht hatte, eine hübsche, verwöhnte Frau mit teuren Kleidern, und zusammengenommen ein Ehepaar, das sich nicht mehr viel zu sagen hat. Das war damals schon offensichtlich.
Das Besondere an Werner Fabian war vielleicht nur, dass er sehr gut aussah, ein Mann, nach dem die Frauen schauten und der das sehr gut wusste und wohl auch seinen Nutzen daraus zog. Ein großer Sportsmann dazu, ein hervorragender Skifahrer – in dieser Sportart jedenfalls begegnete er mir zuerst –, ein guter Tänzer und ein charmanter Plauderer. Charlott Fabian machte sich nichts aus Schifahren, sie bevorzugte den Liegestuhl oder die Eisbar, und da ihr Mann ihr selten dabei Gesellschaft leistete, suchte sie nach anderer Unterhaltung. Wir lagen einige Male nebeneinander in der Sonne, sie erzählte dabei dies und das, was mich kaum interessierte, doch ich horchte auf, als sie das erste Mal, ganz nebenbei, die beiden anderen erwähnte: ihren Vater und ihre Schwester.
Ich stellte ein paar Fragen, und sie war erstaunt über mein Interesse. Viel konnte sie mir nicht sagen über das Leben dieser beiden Menschen, ihr Resümee lässt sich am besten in zwei Sätzen zusammenfassen: Es ist so lange her, und es ist so weit weg. Dagegen ließ sich nicht viel sagen.
Später dann erfuhr ich mehr. Wir blieben in Verbindung, sahen uns gelegentlich, ich lernte sie besser kennen, und so kam es, dass ich in den vergangenen Jahren als Beobachter am Rande das Schicksal dieser Familie miterlebte. Oder besser gesagt, einiges davon miterlebte. Manches habe ich mir berichten lassen, vieles musste ich erraten.
Ricarda sprach niemals gern von sich, es war schwer, ihr nahezukommen, wird wohl immer schwer sein. Und was Charlott so dahinplaudert, ist nicht ganz ernst zu nehmen. Obwohl man natürlich aus diesem Geplauder vieles entnehmen kann, was mit Worten nicht ausgesprochen wird.
Am meisten erfuhr ich schließlich von Matthias. Matthias Wolff, der Großpapa. Er war nie verschlossen, erzählte gern und sehr plastisch, und es war nicht nur anregend, ihm zuzuhören, es war auch ein Gewinn, ihm zuzusehen. Seine Mimik, sein Lächeln, seine sparsamen, aber prägnanten Gesten; manchmal dachte ich, es wäre zweifellos ein guter Schauspieler aus ihm geworden. Und hierbei, während der Gespräche mit ihm, kamen nun also meine persönlichen Gefühle mit ins Spiel. Hier wurde ich angesprochen und angerührt.
Die Stadt, die ich als Kind gekannt hatte, erstand neu vor meinen Augen, so wie sie einmal war und nie mehr sein wird. Ihre alten Häuser, die Türme und Brücken, der breite silberne Strom, das geschäftige Leben in ihren Straßen. Und weiter, nicht nur die Stadt, auch das Land, die grüne Ebene ringsum, der dunkle, fruchtbare Boden, und in der Ferne, langsam näher rückend, wenn man darauf zufuhr, genau wie ich es einst gesehen und erlebt hatte, die blauen Berge. Der Kamm, die Koppe, die Bauden. Das Riesengebirge.
Ein Teil meiner Kindheit, auf ewig verloren. Ferngerückt, als gehöre es in eine frühe Märchenwelt, genauso wie Rübezahl, der Herr der Berge, der mir doch einst so wirklich erschien wie das Gebirge, das Land und die Stadt.
Was behält ein Kind an Eindrücken von einer Stadt, von einem Land? Oder besser gesagt, was gewinnt es für Eindrücke? Die Straßen, durch die es geht, die Kinder, mit denen es spielt, der Gebirgsbauer, bei dem man wohnt und der ein zutrauliches Pferd im Stall stehen hat, das man streicheln und mit Zucker füttern darf. Man bekommt die Zügel in die kleinen Hände und darf mit auf die Wiesen fahren, um das Heu einzuholen. So etwas vergisst sich nicht. Und was noch? Die Wohnungen der Verwandten und Bekannten, das Geschäft des Onkels, wo man von den Verkäuferinnen immer so liebevoll begrüßt wurde, das wuchtige Buffet im Wohnzimmer einer Tante, in dem Schokolade und Bonbons aufbewahrt wurden, die freundliche Nachbarin, die jedes Mal staunend dasselbe sagte: »Jedid nee, nee, wie groß das Kindel geworden ist!« Dann das Haus der Großmutter in der Nähe der Stadt, ein altes, geräumiges Haus mit einem großen Garten rundherum, in dem im Mai unendlich viele Fliederbüsche blühten und im Monat darauf die köstlichsten Erdbeeren zu ernten waren. Und die Tiere natürlich: Treu, der Hund, ein grauer Schäferhundbastard von zärtlicher und zugleich heftiger Gemütsart, mit dem man heimlich das Frühstücksbrot teilte, die Katzen, die Hühner, im Frühling gab es kleine Zicklein, die ein seidenweiches Fellchen hatten und drollige Sprünge machten und mitleidslos Ostern verspeist wurden. Das verschwieg man mir jedoch. Als ich es später wusste, weigerte ich mich standhaft, am Ostersonntag zu essen. Dann wurden keine Zicklein mehr gezogen, der Braten gleich im Laden gekauft.
Später, als ich zur Schule ging, waren es nur mehr Ferienerlebnisse, denn ich wuchs ja in Berlin und nicht in Breslau auf. Aber was waren das für herrliche Ferien! Ausflüge ins Land, herrliche Wochen im Gebirge, das Baden in der Weide und in der Lohe, das Reiten aus der Stadt hinaus, am Südpark vorbei in die Ebene, bis zu einem kleinen Ort, der Oltaschin hieß.
Das alles kehrte zurück, wenn Matthias Wolff erzählte. Und noch vieles andere: der Scheitniger Park, die Jahrhunderthalle, der Zoo, alles Dinge, die einem Kind Eindruck machen. Das Rathaus, mitten auf dem großen Ring gelegen, die Würstelbuden davor, der große Platz vor dem Schloss, der erste Theaterbesuch, die Konditorei Huthmacher, wo es den guten Kuchen gab, die herzliche, fröhliche Art, in der die Menschen mit einem sprachen, wie gern sie lachten, wie gut ihnen der Korn schmeckte – doch hat ein Kind Verständnis für die Schönheit eines gotischen Bauwerks? Die barocke Front der Universität? Kann man noch wissen, wie der Dom aussah, die Sandinsel? Die Zeit, auch dies zu sehen und zu begreifen, blieb nicht mehr. Und wenn man wirklich einmal an der Hand eines Erwachsenen in die dunkle Kühle eines Kirchenschiffes mitgenommen worden ist, man weiß doch nicht mehr, welche Kirche es war. Man hat inzwischen so viele gesehen, hierzulande und anderswo, sehr berühmte darunter, große Kathedralen, lichte Barockkirchen. Die vagen Bilder der Kindheit sind verblasst.
Doch nein. An eine Kirche erinnere ich mich sehr gut. Obwohl sie nicht in Breslau stand, sondern drinnen im Gebirge. Die Kirche Wang. Über Brückenberg gelegen, wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht. Dort wurde eine Tante oder eine Cousine, vielleicht auch eine Freundin der Familie, genau weiß ich es nicht mehr, getraut. Ich weiß nur noch, dass ich mit meinen Eltern dort war, vielleicht vier oder fünf Jahre alt, und zum Blumenstreuen engagiert worden war. Es war ein heller, strahlender Sommertag, die Wiesen ringsum blühten vor dem dunklen Wald, man blickte weit ins Tal, alle waren fröhlich und vergnügt, und nachdem das Brautpaar aus der Kirche gekommen war, wandte sich die junge Braut zu den Bergen, hob grüßend die Hand und rief übermütig: »Rübezahl! Hörst du mich? Rübezahl! Wünsch mir auch Glück!«
Ich weiß noch, dass alle lachten, ich aber hielt erschrocken den Atem an und wartete auf die Antwort. Sie hatte ihn Rübezahl genannt. Das durfte man nicht. Das war sein Spottname und das nahm er übel. Aber kein Donner erscholl, kein Fels brach herab, nur die Tannen rauschten leise im Sommerwind.
Heute ist das alles weg, verschwunden, Breslau, Schlesien, das Riesengebirge, als habe es nie existiert, sei nie vorhanden gewesen. Der Krieg hat den Mund aufgesperrt und hat es verschluckt. Er frisst ja alles, was er kriegen kann: Menschen, große und kleine, Erwachsene und Kinder, Häuser, Schiffe und Flugzeuge, Geld und Gut und das Glück der Menschen. Und eben auch Länder und Städte. Dieses Land und diese Stadt haben ihm offenbar gut geschmeckt. Es ist nichts davon übrig geblieben.
Anfangs hatte man noch davon gesprochen, was wohl aus allem geworden sein mag. Ob das Haus der Großmutter noch stehen mochte? Solange sie lebte, hatte sie gehofft, heimkehren zu können. Heute denkt kaum einer noch dran. Ob im Garten Erdbeeren wachsen? Wen interessiert das noch. Erdbeeren gibt es massenhaft zu kaufen in unserem Wunderland, sogar mitten im Winter. Gelegentlich hat man sich an dies oder das erinnert, an Freunde und Bekannte, manche fanden sich wieder, manche blieben verschollen. Für mich war es nicht so interessant, wohl mehr für die ältere Generation. Froh war ich immer darüber, dass Treu schon tot war, als die große Flucht begann, dass er nicht verlassen und verständnislos zurückbleiben musste. Nur die schwarze Katze blieb beim leeren Haus. Was sie sich wohl gedacht haben mag? Es war ein sehr kalter Winter mit vierundzwanzig Grad unter null, und sie war gewohnt, auf der Bank am Ofen zu liegen, manchmal auch in der Stube im Sessel, wenn es die Großmutter nicht sah.
Ich habe es der Großmutter geradezu übel genommen, dass sie das Tier nicht mitnahm auf die Flucht. »So eine kleine Katze«, sagte ich damals, Januar 1945, »die hättest du doch in die Tasche stecken können.«
Aber wer dachte an so etwas? Die Großmutter war alt. Und vollkommen verstört, dass sie plötzlich Haus und Hof verlassen musste, den Ort, wo sie geboren war und an dem sie zeitlebens gewohnt hatte. Sie hatte ja sowieso so gut wie nichts mitnehmen können, nichts anzuziehen, kein Bett, gerade das bisschen Schmuck, ein paar Bilder, ihr altes Gesangbuch – du lieber Gott, da soll man eine Katze in die Tasche stecken!
»Ich hätte es getan«, sagte ich unvernünftig, als wir die Großmutter dann glücklich nach Süddeutschland bugsiert hatten. Dabei war ich damals, 1945, so klein auch nicht mehr. Alt genug, um so viel Verstand zu haben, zu wissen, dass man nicht an eine kleine schwarze Katze denken konnte, wenn die Welt unterging.
Aber all das will ich eigentlich gar nicht erzählen; es soll weder die Rede von mir noch von meiner Kindheit und schon gar nicht von meiner Großmutter sein. Ich wollte damit nur erklären, wie es dazu kam, dass mich das Schicksal von Großpapa Wolff und seinen Töchtern und allen, die noch daran hingen, so schrecklich interessierte. Gleich als ich das erste Mal von ihnen erfuhr, und erst recht, als ich den Alten kennengelernt hatte. Es tauchten bei mir so viele Erinnerungen auf. Und wenn Matthias Wolff erzählte – und wie ich schon berichtete, er erzählte gern –, dann dachte ich bei mir, er könnte genauso gut mein Großpapa sein, der mir von dem fernen Land meiner Kindheit Kunde gab. Von Breslau, der schönen alten Stadt an der Oder. Von Schlesien, dem viel umkämpften Land, das jeder haben wollte und keiner gern hergab. Vom Zobten, vom Riesengebirge, von Rübezahl und seinen guten und schlimmen Taten. Und schließlich von den Menschen, die dort lebten, und von denen ich – zur Hälfte jedenfalls – auch abstamme.
Dazu kam die Familie Fabian, die mich in diesem Zusammenhang auch zu interessieren begann. Ich sprach ja schon davon. Werner Fabian, der reich gewordene Unternehmer, ein wenig verdorben vom Wirtschaftswunder, jedoch, was er geleistet hatte, musste anerkannt werden. Und Charlott, nun ja, Frauen wie sie gibt es viele, gepflegt, hübsch, oberflächlich, ein bisschen dumm, berechnend, ein Kind unserer Zeit und der Welt, in der wir nun einmal leben.
Die Kinder? Teenager, wie sie heute eben sind. Brigitte, reichlich kess, sehr intelligent, offen gesagt intelligenter als Vater und Mutter zusammen, die junge Generation, die nichts weiß von dem Erleben der Älteren und auch nichts wissen will.
Der Junge, Thomas, ist noch ein Lausebengel, in der Schule ein Versager, im Gegensatz zu seiner Schwester. Dafür mit einem frechen Mundwerk begabt.
Ja und – Ricarda, die Schwester von Charlott Fabian. Ein abscheuliches Frauenzimmer, das war mein erster Eindruck. Verbittert, verbiestert, boshaft, unzugänglich. Und hochmütig. Hochmütig bis zur Arroganz. Keiner wusste, warum und worauf. Mein zweiter Eindruck, als ich sie etwas besser kannte: ein unglücklicher Mensch. Eine Frau, die um alles betrogen worden war, was einem Menschen das Leben lebenswert machen kann. Um Liebe, um Kinder, um einen Beruf, um irgendeine Art der Erfüllung. Betrogen um ihre Jugend, um ihre schönsten Jahre. Und das wusste sie sehr genau. Darum war sie so unausstehlich.
Eines Tages kam ich ganz folgerichtig zu der Erkenntnis: Aber sie sind ja typisch. Sie sind typisch für unsere Zeit, für das, was wir erlebt und erlitten haben. Sie sind geradezu erstklassige Modelle für die Menschen in unserem Land zur Jahrhundertmitte.
Dieses Wirtschaftswunderland mit seinen Wirtschaftswunderkindern! Wie gut, wie schön lebt es sich hier! Die Schornsteine rauchen, die Räder rollen, die Wagen werden immer größer. Werner Fabian hat natürlich einen Mercedes und außerdem für seinen Privatgebrauch einen Jaguar, Charlott fährt einen Citroën, dies nur nebenbei. Wie viel Belegschaft Werner heute in seinem Betrieb hat, weiß ich nicht genau, ich könnte ihn fragen, aber es ist nicht so wichtig; ich weiß auch nicht, was er für Umsätze macht, auf jeden Fall müssen sie beachtlich sein. Die Kinder sind verwöhnt. Brigitte kleidet sich wie ein Mannequin, obwohl sie erst siebzehn ist und noch zur Schule geht. Sie hat ein eigenes Reitpferd, und ihr Vater, der vernarrt ist in seine Tochter, erfüllt ihr jeden Wunsch.
Charlott hat natürlich einen Nerz und Werner eine Freundin, sie haben die schönsten Reisen gemacht und haben sich nichts mehr zu sagen, aber das schadet fast gar nichts, sie sind ja Wunderkinder. Wunderkinder unserer Zeit. Was einmal war, haben sie vergessen. Dass sie auf die Flucht ging mit dem Baby auf dem Arm und er halb verhungert aus der Gefangenschaft kam – wer denkt denn noch daran? Gerade darum sind sie ja Wunderkinder, nicht weil sie alles haben, was sie haben, sondern weil sie so leicht vergessen konnten, was geschehen ist.
Denn das Wunder hat sich nicht nur in ihren Geldbörsen, sondern auch in ihren Herzen und Köpfen vollzogen.
Ja, das sind die einen. Ganz deutlich aber erlebte ich am Beispiel dieser Familie, dass es auch noch andere gibt. Wahrscheinlich viel mehr, als wir wissen und vermuten. Die Stiefkinder. Die ihre Gefühle und Gedanken nicht so leicht umkrempeln konnten, deren Portemonnaies leer blieben, deren Träume immer nur Träume blieben und für die die Wirklichkeit immer grau und böse und hoffnungslos ist. Keine Hoffnung für Stiefkinder. Kein Weg, der fort-, der weiterführt. Kein Leben, das sich lohnt zu leben.
So ein Stiefkind war Ricarda. Und sie wusste es. Sie wusste auch, wie ungerecht es vom Schicksal war. Sie war viel klüger als ihre Schwester, viel reifer, viel warmherziger im Grunde, wenn sie sich auch alle Mühe gab, kalt und herzlos zu erscheinen. Sie war ein Mensch, der am Leben und an sich selber litt. Ein Mensch, der vom Glück vergessen worden war. Ihr konnte keiner helfen. Wenn sie selbst sich nicht half.
Die Wunderkinder. Die Stiefkinder. Hat es unbedingt etwas mit unserer Zeit zu tun? Möglicherweise gab es das immer schon. Genau wie die dritte, die ganz seltene, ganz kostbare Art von Menschen. Für die mir lange keine Bezeichnung einfiel. So einer wie der Großpapa, der alte Matthias Wolff.
Er ist weder das eine noch das andere. Ich weiß nicht, wie er in seiner Jugend war. Wie er war als Mann in der Mitte des Lebens. Ich kenne ihn nur so, wie er heute ist. Groß und hager und ungebeugt, mit immer noch geraden Schultern. Das Gesicht scharf geprägt, geradezu edel in seiner vom Alter gemeißelten Klarheit, nichts Verschwommenes, nichts Zaghaftes darin, klare graublaue Augen und ein dichter schneeweißer Schopf. Eine hohe, kluge Stirn, doch dazu die Verschmitztheit in den Augenwinkeln, die Güte um den schön gezeichneten Mund, die Liebe zu den Menschen und zum Leben, das große, weise Verstehen im Blick. Dabei nicht ohne Kritik und unbestechlich im Urteil. Und immer bereit zum Lachen, zum Scherzen, zum Erzählen, zu einem guten Schluck.
Schwärme ich? Kann sein. Aber er ist einfach zum Verlieben. Mir ist jedenfalls so ein Mensch noch nicht begegnet. Nicht in alt und nicht in jung. Ich nehme an, seiner Mutter hat Rübezahl gewiss Glück gewünscht, als sie den Knaben zur Welt brachte. Denn Großpapa ist im Riesengebirge geboren, gar nicht weit von der Kirche Wang entfernt, das hat er mir jedenfalls erzählt.
Keine seiner Töchter hat sein Aussehen und sein Wesen geerbt. Sie sind beide auf ihre Art keine unebenen Mädchen. Charlott, das sagte ich ja schon, muss man durchaus als hübsche Frau bezeichnen. Und Ricarda – erlöst aus ihrer Bitternis – wäre sogar eine außerordentlich attraktive Frau.
Am ehesten finde ich den Alten noch in Brigitte wieder, diesem schrecklichen Fratz mit seinen siebzehn Jahren. Natürlich nicht seine Weisheit, seine Güte, seinen Humor. Aber die klaren graublauen Augen, das ebenmäßige Gesicht, das dichte Haar – sie wird eine Schönheit, daran ist nicht zu zweifeln. Und vielleicht wird sie einmal ein brauchbarer Mensch.
Aber wie klassifiziere ich den Großpapa? Er gehört nicht zu unseren Wunderkindern und natürlich auch nicht zu den Stiefkindern. Er ist – ja, wie nennt man das?
Ich wüsste schon einen Ausdruck. Aber es ist schwer, so etwas hinzuschreiben. So etwas kann man genau genommen heutzutage nicht mehr sagen und schreiben. Ganz leise vielleicht nur. Er ist – ein Gotteskind.
Sagte ich vorhin, Rübezahl muss seiner Mutter Glück gewünscht haben? Das genügt wohl nicht. Das war es nicht allein. Der liebe Gott selbst hat da seine Hand im Spiel gehabt. Irgendwann hat er den Finger ausgestreckt und gesagt: »Der da! Das ist einer für mich.«
Und dann hat er ihm zugelächelt.
Ehe der Knabe geboren wurde? Als er in der Wiege lag? Als er die ersten Schritte machte? Als er zum ersten Mal über eine blumige Wiese unter den Bergen kullerte? Als er an der Hand seiner Mutter zum ersten Mal die Kirche Wang betrat? Ich weiß nicht, wann so etwas geschieht. Aber geschehen sein muss es, so viel ist sicher. Und darum sage ich es noch einmal, diesmal laut. Der Großpapa, der Matthias Wolff, der vor drei Jahren aus Breslau kam und den ich die Freude hatte kennenzulernen, der ist ein Gotteskind.
Vor dem Spiegel
Über dem Kiefernwäldchen im Osten dunkelte der Abend herauf. Im Westen dagegen, wo eben die Sonne untergegangen war, leuchtete der Himmel in glühendem Rot. So glühend und heiß, wie der Tag gewesen war.
Brigitte Fabian, die auf dem schmalen Sandweg von den Tennisplätzen hinüber zur Villa radelte, sah beides nicht. Sie trat lässig die Pedale und blickte mit gerunzelter Stirn vor sich auf den Weg. Sie ärgerte sich. Erstens, weil sie den letzten Satz 6 : 2, 6 : 4 und noch mal 6 : 2 verloren hatte, was eine Schande war, und zweitens, weil dieser unverschämte Kerl sie hinterher auch noch geküsst hatte.
Was der sich einbildet! Weil er studiert und ich noch in die Schule gehe, denkt er vielleicht, er kann mir imponieren. Mir imponiert keiner. Nichts und niemand. Meine Backhand war schlecht heute, faul und kraftlos. Vielleicht weil es so heiß war. Nächste Woche werde ich ein paar Trainerstunden nehmen. Dann werde ich es ihm zeigen. Sein Vater ist bloß Lehrer. Studienrat. Auch schon was. Was verdient man da schon groß? Und diese trübe Flasche studiert und gibt an wie eine Mondrakete. Wie der eigentlich zu uns in den Klub kommt? Da ist Jimmy ein ganz andrer Kerl, fährt ein MercedesCabrio, und sein Vater – na, Baumaschinen, der macht noch mehr als mein Vater. Besser küssen kann er auch. Bettina ist scharf auf ihn. Aber Bettina ist keine Konkurrenz für mich. Bei Jimmy nicht. Und überhaupt in keiner Beziehung.
Ehe sie in den Zufahrtsweg zur Villa einbog, warf Brigitte noch einen flüchtigen Blick hinüber zur Fabrik, die man von hier aus gerade noch sehen konnte. Eben flammte die Leuchtschrift auf. Metallisch blau, weithin zu sehen. WEFA-MÖBEL.
Oben auf dem flachen Dach noch einmal, riesengroß, nicht zu übersehen. WEFA.
Das hatte Vater eine Menge Mühe gekostet, bis er die Genehmigung dafür bekam. Es gab Leute, die fanden, dadurch werde die Landschaft verschandelt. Lächerlich. In der Nacht sah man sowieso nichts von der Landschaft. Dafür beherrschte der blaue WEFA-Schrei nun die Nacht. Bis hinüber zum Bahndamm konnte man die Schrift lesen. Vom Zug aus genau wie von der Landstraße konnte keiner den Firmennamen übersehen. Bis vor zwei Jahren hatte das WEFA-Blau in ihre Schlafzimmer geleuchtet. Damals wohnten sie noch auf dem Werksgelände, im alten Haus der Großeltern, das immer wieder erweitert, verbessert, modernisiert worden war.
Vater war sentimental. Er trennte sich ungern von dem alten Haus. Doch dann hatte Charlott sich durchgesetzt, das neue Haus wurde gebaut. Groß und prächtig. Repräsentativ. Und nur zum ganz geringen Teil mit werkseigenen Möbeln ausgestattet.
Brigitte kurvte um das Haus herum in den Garten, lehnte das Rad an die Terrassenmauer, wo es wohl über Nacht stehen bleiben würde, wenn Plaschke es bei seinem abendlichen Rundgang nicht fand und in den Garagenanbau brachte.
Die Colliehündin, die unter der Koniferengruppe gelegen hatte, kam geschmeidig herangetrabt und begrüßte die Tochter des Hauses mit gemäßigter Freude.
»Na, dir ist wohl auch heiß?«, fragte Brigitte und streichelte flüchtig die Hündin. Dann ging sie durch die offene Terrassentür ins Haus.
Alles leer. In der Diele traf sie Fanny, das Hausmädchen. Fanny stand vor dem großen Spiegel, sehr elegant in einem hellen geblümten Kleid, stark geschminkt, tadellos frisiert.
»Sie gehen aus, Fanischka?«
»Das wissen Sie doch, Fräulein Brigitte.«
»Immer noch der Supermarkter?«
»Immer noch! Wie Sie wieder reden, Fräulein Brigitte. Ich kenne ihn ja gerade vier Wochen.«
»Bei Ihnen will das nicht viel heißen, vier Wochen sind eine lange Zeit, da kann sich viel ändern. Da war der Italiener, dann der Vertreter und dann der Barmusiker und – ich weiß gar nicht mehr alles.«
»Das waren doch nur Kleinigkeiten. So kurze Flirts. Nichts Ernsthaftes.«
»Und diesmal ist es ernsthaft?«
»Na ja.« Fanny schob sich die dunkle, dicke Haarwelle tiefer in die Stirn, betrachtete sich prüfend aus halb geschlossenen Augen. »Vielleicht. Er verdient gut. Und später wird er mal Filialleiter.«
»Da wird Karl aber unglücklich sein. Wenn es diesmal wirklich ernst ist.«
»Ach der! Das ist doch kein Mann für mich. Ein Lastwagenfahrer!«
Alle Verachtung der Welt lag in Fannys kindlich heller Stimme.
»Er verdient doch auch gut.«
»Ja, schon. Aber das ist auf die Dauer keine soziale Position für mich.«
Brigitte grinste. »Das ist der krasse Materialismus, Fanita. Sie sollten sich schämen. Wo bleibt die Liebe?«
»Liebe?« Fanny drehte sich um, endgültig zufrieden mit ihrem Spiegelbild. »Aber ich liebe ihn ja.«
»Welchen?«
»Na den. Den Neuen.«
»Karl haben Sie auch geliebt.«
»Karl hat mich geliebt«, stellte Fanny sachlich fest.
»Ist auch was Schönes. Und er ist ein anständiger Kerl.«
»Schon.« Karl, seit Jahren Fahrer bei der WEFA, treu, erprobt, zuverlässig, hatte sich wirklich sehr nachhaltig in das hübsche Stubenmädchen seines Chefs verliebt, kaum dass es seinen Posten vor einem Jahr angetreten hatte. Und er hatte es ernst gemeint. Selbst Brigitte mit ihren siebzehn Jahren hätte ihn als gute Partie für Fanny betrachtet. Nicht nur wegen des Verdienstes. Auch weil er war, wie er war. Anständig eben. Aber Fanny hatte Ehrgeiz. Und eine Menge Chancen.
»Wie machen Sie es eigentlich, dass Sie so viel Erfolg bei Männern haben?«, fragte Brigitte mit ehrlicher Neugier.
Fanny lächelte geschmeichelt und betrachtete sich noch einmal befriedigt im Spiegel. »Wie ich das mache?«
Ihr Blick traf sich mit Brigittes Blick im Spiegel.
»Damit«, sagte sie herausfordernd.
Brigitte nickte. »Ich verstehe. Sie sehen wirklich gut aus. Nichts gegen zu sagen. Neues Kleid, nicht? Steht Ihnen gut.« Auch sonst war alles in Ordnung. Die Figur, die Beine. Und der leicht ordinäre Zug um Fannys Lippen störte die Männer wohl nicht. Ganz im Gegenteil vermutlich.
»Und wie ist das mit Ihrer eigenen sozialen Position?« Mit ironischer Betonung wiederholte Brigitte Fannys hochtrabende Formulierung. »Ich meine, als was gehen Sie so für gewöhnlich?«
»Ich sage, ich bin Kindermädchen hier in der Familie. Kindergärtnerin sozusagen.«
Brigitte lachte amüsiert. »Die Kinder sind ein bisschen groß, nicht?«
»Das wissen die doch nicht.«
»Auch wieder wahr.«
»Da kommt er.«
Fanny schob ihr Gesicht noch einmal dicht vor den Spiegel. Von draußen hörte man ein dezentes Hupsignal.
»Na, dann viel Spaß. Und überlegen Sie sich eine gute Erklärung dafür, warum Sie die Babys am Abend so oft allein lassen können. – Übrigens, sind meine Eltern da?«
Fanny, auf dem Weg zur Haustür, blieb abrupt stehen und wandte sich um. Ein boshaftes Lächeln erschien auf ihrem Gesicht, es sah aus, als wolle sie etwas sagen, aber dann schluckte sie es hinunter.
»Die Herrschaften sind weg. Heute ist doch das Sommerfest.«
»Ach ja, richtig. Die Gartenparty bei Wellmanns. Na, da haben sie ja Schwein mit dem Wetter.«
»Sie haben doch auch Party heute Abend, Fräulein Brigitte.«
»Klar. Geht gleich los. Also tschüs. Und verloben Sie sich nicht gleich, sonst brauchen wir schon wieder ein neues Kindermädchen.«
Brigitte blieb nun ihrerseits vor dem Spiegel stehen und betrachtete sich von Kopf bis Fuß. Ihre Beine, schlank und braun gebrannt, wirkten in den weißen Shorts noch länger, als sie sowieso schon waren. Sie drückte mit dem Finger auf eine Stelle an der Wade, die sich leicht verfärbt hatte. Das gab einen blauen Fleck. Da war sie gegen die Bank gestoßen, als der Kerl sie küssen wollte. Nicht einmal etwas dazu gesagt hatte er, nur gerade nach ihr gegriffen und sie an sich gezogen. Das könnte dem so passen. Brigitte Fabian war eine viel zu gute Partie für so einen kleinen Lehrersohn. Nicht mal einladen würde sie ihn, wenn sie im August ihre große Geburtstagsparty gab. Das würde ihn ärgern.
Sie ging in die Küche, die leer und aufgeräumt war, öffnete den riesigen Kühlschrank und hielt kurze Musterung. Dann mixte sie sich Zitronensaft mit Selters, goss einen Schuss Gin hinein und trank das Glas gleich halb leer. Wie still alles war! Frau Plaschke und ihr Mann waren offensichtlich auch schon in ihrer Wohnung. Beim Fernsehen vermutlich, das war nun deren ganzes Glück. Und die alten Herrschaften waren bei der Gartenparty. Ob Mutti nun doch das weiße Spitzenkleid angezogen hatte? Mit einer roten Rose am Ausschnitt? Kitschig. Aber so was gefiel ihr nun mal.
Was ziehe ich heute Abend an? Das Hellblaue? Käse. Auch weiß? Ich könnte genauso gut in Shorts bleiben bei dieser Hitze. Nein, viel was Besseres. Ich ziehe das Pariser Schwarze von Charlott an, das mit dem tiefen Dekolleté. Ist mir natürlich viel zu weit, aber das macht nichts, ist eben dann ein Sack. Jimmy wird verrückt. Und Bettina platzt.
Das Glas in der Hand, schlenderte sie in den ersten Stock hinauf. Alles still. War der Bengel etwa auch nicht da?
Thomas saß in seinem Zimmer, beide Hände in seinen dichten Schopf vergraben, vor sich Bücher und Hefte, eine halb gerauchte Zigarette zwischen den Fingern, die er an seiner Seite verschwinden ließ, als die Tür aufging.
»Ach, du bist’s!«, sagte er wegwerfend, hob die Hand wieder und nahm einen langen Zug.
»Du sollst doch nicht rauchen.«
»Geht dich gar nichts an. Ich muss denken.«
»Daran muss man natürlich gewöhnt sein. Wo hängt’s denn?«
»Latein.«
»Kann ich mir denken. Du wirst ja schließlich immer blöder.« Sie beugte sich über seine Schulter. »Na und? Ariovist. Was ist denn daran so kompliziert?«
»Ich muss das übersetzen.«
»Was du nicht sagst!«
Ihr spitzer Finger landete auf einer Zeile. »Was hast du denn da für einen Unsinn geschrieben?«
Und ohne zu zögern, flüssig und melodisch, las sie den Absatz herunter.
»Quod sibi Caesar denuntiaret se Haeduorum iniurias non neglecturum, neminem secum sine sua pernicie contendisse. Cum vellet, congrederetur; intellecturum, quid invicti Germani virtute possent. Ist doch kinderleicht. Hat der Adlerhorst geschrieben.«
»Wer?«
»Na, Adlerhorst. So hieß Ariovist auf Germanisch. Ich möchte wissen, was du eigentlich lernst auf deiner Penne. Das ist doch Käse, was du da schreibst. ›Wenn du willst, dann werde ich dich besiegen.‹ Wer sagt denn so was? ›Wenn du willst, komm zum Kampfe!‹ Oder: ›Wenn du willst, stell dich zum Kampf. Dann wirst du erleben …‹ Warte!«
Sie nahm ihm den Füllhalter aus den verschwitzten Fingern, zog einen Zettel heran und schrieb, ohne auch nur eine Minute zu zögern, den ganzen Absatz in gutem Stil nieder.
»So ungefähr.«
»Danke«, sagte der Junge mürrisch. »Mensch, werd ich froh sein, wenn die Ferien losgehen.«
»Noch drei Wochen, dann hast du’s überstanden. Jedenfalls bis zum September.«
»Das wird meinen Nerven gut bekommen.« Thomas klappte das Buch zu, stand auf und streckte sich.
»Was ist denn nun los?«
»Ich hab keine Zeit mehr. Muss zu Dieter.«
»Was? Du auch? Geht denn heute alles aus?«
»Scheint so.«
»Und wann machst du deine Aufgaben?«
»Morgen. Ist schließlich Sonntag, nicht? Hab Zeit genug. Auf Familienbetrieb lege ich sowieso keinen Wert. Du, apropos Familie – wir sind die längste Zeit eine gewesen.«
»Wieso?«
»Dicke Luft. Die alten Leute haben sich vielleicht vorhin in der Wolle gehabt. Sie lassen sich scheiden.«
»Ach!« Brigitte glitt in einen Sessel, warf die nackten Beine über die Lehne. »Gib mir mal eine Zigarette.«
»Ich denke, du rauchst nicht.«
»Nur wenn große Dinge passieren. Sie lassen sich scheiden?«
»Ja. War vielleicht ein Krach heute Nachmittag. Da war alles dran. Mutti hat geweint und geschrien, und Vater hat auch allerhand ausgepackt. Er hat ’ne Freundin, und sie weiß es.«
»Na und? Ist doch nichts Neues.«
»Seine Sekretärin?«
»Fräulein Lessing? Das ist doch lange vorbei. Nee, das ist jetzt was anderes.«
»Weißt du, wer?«
Brigitte warf ihrem Bruder einen raschen, prüfenden Blick zu und schüttelte den Kopf. »Keine Ahnung.«
»Ich dachte, du wüsstest es. Scheint aber ernst zu sein. Er will sich scheiden lassen.«
»Na, wennschon. Früher oder später war das zu erwarten.« Thomas starrte finster vor sich hin. »Ich weiß nicht – ich finde das blöd. Alles so ein Theater. Warum können sie sich denn nicht vertragen?«
»Das ist eben in einer Ehe so«, sagte Brigitte weise. »Ist eben schwierig. Und so wie Vater ist …« Sie sprach nicht weiter. Thomas war zu jung, er verstand das sicher nicht. Aber Brigitte liebte ihren Vater. Er war ein Mann, der den Frauen gefiel.
Er gefällt den Frauen. Er sieht gut aus, er hat viel Geld. Und wenn er einen so ansieht – also es geht mir ja selber so, und ich bin seine Tochter. Wenn er mich ansieht und zu mir sagt: »Gitti-Schatz, wir verstehen uns, nicht wahr?« Also dann werde ich ganz schwach. Und wie mag er erst mit einer Frau reden, die er liebt. Mit Charlott nicht. Er liebt sie nicht mehr. Und sie ist ja auch – ihr fehlt eben manches. Weißes Spitzenkleid und eine Rose am Ausschnitt. In ihrem Alter. Sie müsste das ganz anders machen mit ihm. So einen Mann wie Vater muss man anders behandeln. Ich wüsste es. Und außerdem weiß ich, wer die Frau ist. Jetzt weiß ich es. Sie muss sehr gescheit sein. Journalistin. Gar nicht mal so viel jünger als Charlott. Aber ein ganz anderer Typ. Eigentlich – ein Typ wie ich. So wie ich später einmal sein werde.
»Was machen wir denn dann, wenn sie sich scheiden lassen?«, fragte der Junge. Und es klang betrübt.
»Das wird sich finden. Und so weit ist es ja noch nicht. Geht gar nicht so leicht. – War denn der Krach so laut, dass du das gehört hast?«
»Ein doller Krach. Ich hab alles gehört.«
»Du solltest dich schämen.«
»Ich? Warum denn? Die sollten sich schämen. War gar nicht zu überhören. Ich kam gerade vom Schwimmen. Fanny hat es auch gehört.«
Eine steile Falte erschien auf Brigittes Stirn. Daher also Fannys schadenfrohe Miene. »So etwas hasse ich«, sagte sie böse. »Man kann das auch leise erledigen, das Haus ist groß genug. Krach vor den Kindern und vor dem Personal. Das ist schlechter Stil.«
»Mensch, spiel dich bloß nicht so auf. Du hast ja ’nen Vogel.« Brigitte stand rasch auf und drückte die Zigarette im Aschenbecher aus. Sie hatte keine Lust mehr, die Eheprobleme ihrer Eltern mit ihrem kleinen Bruder zu erörtern.
»Scher dich weg zu deinem Dieter. Und komm nicht wieder so spät nach Hause.«
»Mensch!« Thomas tippte sich an die Stirn. »Du solltest Lehrerin werden.«
Sie ging aus dem Zimmer, ohne noch etwas zu sagen.
Matthias Wolff betrachtete mit einem kleinen Lächeln den kümmerlichen Blumenstrauß, der vor ihm stand. Wie nett sie alle zu ihm gewesen waren! Kein Hass mehr. Nein. Fast kein Hass mehr. Schwester Bronislawa hatte sich sogar zu ein paar deutschen Worten aufgeschwungen. »Gesundheit und langes Leben, Panje Wolff«, hatte sie gesagt.
Gesundheit und langes Leben! Wann hatte es eigentlich angefangen, dass die Menschen wieder Menschen wurden? Kaum merklich war der Übergang gewesen. Man hatte gar nicht gemerkt, wie viel sich geändert hatte. Nun ja, drei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre – die Zeit lief davon. Sie hatte Blut und Tränen getrocknet, sie hatte den Hass ganz sachte einschlafen lassen. Duldung war daraus geworden. Gleichgültigkeit. Und nun vielleicht am Ende gar Freundschaft?
Ich brauche keine Freundschaft mehr, von nichts und niemand. Der Tod ist mein Freund. Das Leben ist mein Freund. Das Leben ist noch mein, doch der andere wird kommen. Die Menschen sind keine Freunde. Man braucht sie deswegen nicht zu hassen. Man kann sie sogar lieben. Und verstehen. Aber man wächst darüber hinaus, sie als Freunde zu betrachten. Ihre Freundschaft zu suchen. Eine Freundschaft, die man nicht gewinnt, kann man nicht verlieren. Und die Zeit ist so kostbar geworden, dass es sich nur noch lohnt, Dinge zu gewinnen, die man nicht verlieren kann. Aber das ist ja nicht wahr. Man kann alles verlieren. Man muss sogar alles verlieren. Die Freunde, die Dinge, die schön sind und habenswert, und das Leben. Sich selbst. Seltsam zu denken. Man verliert sich eines Tages selbst. Oder auch nicht? Was weiß man schon? Gar nichts weiß man. Wie gut. Und wie armselig.
Mein Gott, so alt zu werden und so arm zu sein, dass man nichts weiß. Ich weiß, dass ich nichts weiß. – Nicht gerade eine neue Erkenntnis. Nun musste er über sich selbst lächeln. Nicht gerade bedeutend, so alt zu werden und nur nachzudenken, was andere schon gedacht hatten. Wenn sie aber recht gehabt hätten. Dann blieb wohl nichts anderes übrig, als dasselbe noch einmal zu denken und als eigene Erkenntnisse zu betrachten.
Außerdem war es gar nicht wahr, was er eben alles gedacht hatte. Er ging gerade daran, neue Dinge zu gewinnen. Auch neue Menschen. Sogar ein neues Leben. Und das mit siebzig Jahren.
Der alte Mann lachte vor sich hin.
Er war sehr neugierig auf dieses neue Leben. Er konnte es kaum erwarten.
Heinrich hatte das gewusst. Wenn man es genau betrachtete, war das eine Art Testament, das er ihm hinterlassen hatte.
»Ich weiß ja, dass du fort willst. Du hast es immer gewollt. Und jetzt ist höchste Zeit. Höchste Zeit, Matthias. Nicht nur für dich. Auch für das Mädel.«
»Mir bleibt nicht mehr viel Zeit«, hatte er erwidert. »Es lohnt sich nicht mehr.«
»Dir bleibt noch Zeit genug. Und für dich lohnt es sich. Kannst’s mir glauben. Ich weiß es. Für dich lohnt es sich.«
Das waren eigentlich seine letzten klaren Worte gewesen. Gerade so viel Luft hatte er sich aufgespart, um ihm das zu sagen. Eine Stunde später war er gestorben.
Matthias trank den letzten Schluck Wein aus seinem Glas. Dann stand er auf, reckte sich zu seiner ganzen imponierenden Größe. Also, dann würde man eben gehen. Ganz gleich, wie lang oder wie kurz die Zeit war. Heute hatte es sich entschieden. Gerade heute. Ein Tag war so gut wie der andere. Oder auch nicht.
Heinrich war gestorben an diesem Tage. Der letzte Freund. Verloren dieser Freund, wie alles verloren war.
Es ist nicht wegen mir. Wegen ihr. Sie muss fort. Ich muss ihr helfen. Und heute hat sie Ja gesagt. Kaum zu glauben, aber sie hat Ja gesagt. Morgen wird sie es zurücknehmen wollen, aber ich werde es nicht gelten lassen. Sie und ich, wir werden zusammen gehen. Für mich eine kleine Zeit. Für sie, wenn Gott will, noch eine lange Zeit. Und eine gute Zeit.
Ja, eine gute Zeit für sie. Ganz heiß und inbrünstig war dieser Wunsch in ihm. Sie hatte es verdient. Und Gott konnte nicht so hart sein, ihr immer wieder alles zu versagen.
Und jetzt würde er noch ein bisschen gehen. Er würde einen kleinen Spaziergang durch den warmen, hellen Sommerabend machen. Zur Oder hinunter, er würde in den Fluss blicken, bald würde er ihn nicht mehr sehen. Er würde die Türme anschauen, den Himmel über der Heimat; heute Abend war es Zeit, mit dem Abschied zu beginnen.
Er ging zum Schrank, nahm bedächtig den breiten schwarzen Hut heraus. Doch ehe er ihn aufsetzte, blieb er vor dem ovalen Spiegel stehen, der über der Kommode hing, und sah sich selber ins Gesicht.
Siebzig Jahre. Er musste sich das vorsagen, um es zu glauben. Konnte es möglich sein, dass er wirklich siebzig Jahre alt war? Wo war die Zeit eigentlich geblieben?
Klar blickten ihn seine Augen an. Sein Mund lächelte. Nun also denn. Wer wusste denn, ob es zu früh oder zu spät war? Einmal war die rechte Stunde. Heinrich war genauso alt gewesen wie er. Siebzig Jahre. Und heute war er gestorben.
Ein Spaziergang also durch die Stadt. Er setzte den Hut auf, gab ihm einen leisen Ruck nach rechts. – Bis zur Oder hinunter. Und dann würde er den toten Freund noch einmal besuchen. Anndel würde froh sein, wenn sie nicht den ganzen Abend mit ihm allein blieb.
War es übrigens unrecht, Anndel allein zurückzulassen? Unsinn. Sie blieb nicht allein. Sie hatte Kinder und Enkelkinder, eine ihrer Töchter war mit einem Polen verheiratet. Anndel würde es bestimmt an nichts fehlen.
An der Tür kehrte er noch einmal um, ging zum Tisch zurück und nahm den kleinen Blumenstrauß aus dem Glas. Den würde er dem toten Freund mitnehmen. Seine Geburtstagsblumen. Einer würde ihm wohl auch Blumen bringen, wenn er einmal starb.
Aber ihm war absolut nicht nach Sterben zumute.
In ihrem Zimmer stieg Brigitte aus den Shorts, warf das weiße Blüschen auf die Couch. Mit einem Tuch band sie sich das aschblonde Haar hoch und begab sich ins Badezimmer. Sie blieb ausdauernd unter der Dusche, erst lau, dann kalt, dann heiß, dann wieder kalt. Ohne sich abzutrocknen, ging sie in ihr Zimmer zurück und stellte sich vor den Spiegel. Wie immer entzückte sie sich an ihrem Körper. Wie Perlen hafteten die Tropfen auf der seidenglatten Haut, die rundherum gleichmäßig braun war. Ihr Körper war knabenhaft schlank, die Schultern breit und wohlgeformt, die Brust schon entwickelt, klein und fest.
Ich bin schön, ich werde immer schön sein. Weil ich Rasse habe. Das sagt Vater. Jimmy hat neulich auch so etwas Ähnliches gesagt. Bettina hat keine Rasse. Ihre Oberschenkel sind zu dick, der Popo sitzt zu tief, und in fünf Jahren wird sie einen Busen haben wie eine Kuh. Komisch, dass man so oder so sein kann. Man kann nichts dafür.
Sie verrieb mit zärtlichen Fingern etwas Creme in ihrem Gesicht, puderte sich, Augenbrauenstift und Wimperntusche brauchte sie nicht. Die Wimpern waren lang, die Brauen dicht und schön geschwungen. Aber um die Augen malte sie sich mit geübter Hand eine kräftige schwarze Linie, die sich leicht im Augenwinkel verlängerte. Für die Lippen ein blasses Rosa. So.
Sie zog sich das Tuch vom Kopf, schüttelte das Haar mit beiden Händen aus und bürstete es dann energisch gegen den Strich. Viel mehr war nicht zu tun, es fiel dann ganz von selbst in die gewünschte Form. Die gewünschte Form war: etwas ungebärdig, etwas unordentlich.
Nun galt es aber ernsthaft, das Problem zu überdenken, was man anzog. Sie öffnete beide Flügel ihres Kleiderschrankes und blickte grübelnd hinein. Auswahl war genug da. Sie verwarf die rosa, hellblauen und weißen Cocktailkleider, die Charlott so gut gefielen. Kein Anlass heute Abend. Kleine Party bei Bettina, ihre Eltern waren auch bei Wellmanns eingeladen. Man würde ganz unter sich sein. Unter sich, das waren ein paar Söhne und Töchter reicher Leute. Ein paar Außenseiter dabei. Der Sohn einer Straßenbahnschaffnerswitwe, der außerordentlich gut aussah und ein blendender Autofahrer war. Er musste immer diejenigen fahren, die noch zu jung waren, um einen Führerschein zu besitzen. Und die Tochter vom Platzwart des Tennisklubs. Sie war ein verdorbenes kleines Luder, man sagte, sie habe mit allen Männern geschlafen, die je auf diesem Tennisplatz einen Schläger in der Hand gehabt hatten.
Brigitte verzog das Gesicht. Das war natürlich übertrieben. So schön war die auch nicht. Aber sie hatte irgendetwas, das stimmte schon. Und sie legte großen Wert darauf, zu diesen Partys der Jeunesse dorée zugezogen zu werden, was ihr auch fast immer gelang. Die Mädchen interessierte es, ihr zuzuhören und zuzusehen. Sie tanzte nur barfuß, und sie tanzte sehr gut. Und sie erzählte ohne Scham von ihren Erlebnissen. Erzählte vermutlich mehr, als sie je erlebt hatte, erlebt haben konnte mit ihren knapp achtzehn Jahren. Und dann war immer der Sohn von dem Schauspieler dabei. Sein Vater war der Charakterheld des Stadttheaters. Die Mädchen waren alle ein wenig verliebt in ihn, obwohl sie es nie zugegeben hätten. So etwas tat man heute nicht mehr, für einen Schauspieler schwärmen. Immerhin – ein schöner, begabter, viel geliebter Mann. Er besaß eine vernachlässigte Frau und häufig wechselnde, immer sehr attraktive Freundinnen. Und ebendiesen Sohn, der den von allen geliebten Vater abgrundtief hasste. Wenn er etwas getrunken hatte, malte er ihnen in allen Einzelheiten aus, wie er den eitlen alten Gockel eines Tages umbringen würde. Das unterhielt auch immer auf das Beste.
Brigitte, vor dem Kleiderschrank, seufzte. Es war immer dasselbe. Jimmy würde da sein, Axel, Doris, dieser blöde Charly, der einen ewig mit Liebeserklärungen anödete, und der und der und die und die. Immer dieselben. Man würde reden, tanzen, bisschen trinken, bisschen knutschen – ach!
Kein Grund, sich in Gala zu werfen. Sie zog müßig ein weißes Leinenkleid aus dem Schrank und ließ es dann auf die Couch fallen.
Wenn der käme, der heute Nachmittag vom Tennisplatz, das würde mir Spaß machen. Den könnte ich den ganzen Abend ärgern. Ich würde nur mit Jimmy flirten, mit Jimmy tanzen, Jimmy küssen. Der würde platzen. Aber der kommt nicht. Bettina hat ihn nicht eingeladen. Sie kommt gar nicht auf die Idee. Er gehört nicht zu uns. Ich muss Bettina mal fragen, wieso er eigentlich im Klub spielen darf. Wer ihn mitgebracht hat. Klubmitglied ist er natürlich nicht. Wahrscheinlich käme er gar nicht zu unsrer Party. Er bildet sich ja ein, erwachsen zu sein. Für den sind wir nur Schulkinder. Teenager. Ob er eine Freundin hat? Ob er heute mit der ausgeht? Oder sitzt er bei seinem Vater, dem Studienrat, und macht Zukunftspläne? So einer ist das. So etwas macht der glatt. Zu Hause sitzen, Bücher lesen, büffeln, nur an das Examen denken. – Also was ziehe ich nun an?
»Tschüs«, kam von draußen die Stimme ihres Bruders. »Ich geh jetzt.«
»Tschüs«, rief sie zurück. »Und komm nicht so spät nach Hause.«
Er war zwei Jahre jünger als sie. Aber da sie ein Mädchen war und er ein Junge, war das so gut wie zehn Jahre.
Das ist es eben. Und warum soll ich mich eigentlich mit den dummen Bengels abgeben, die auch nicht viel gescheiter sind als mein kleiner Bruder. Jimmy ist neunzehn. Der vom Tennisplatz – na ja, der wird vielleicht vierundzwanzig sein. Sieben Jahre älter als ich. Vielleicht ist er auch fünfundzwanzig. Bestimmt hat er eine Freundin.
Nackt, wie sie war, ging sie auf den Gang hinaus, zur anderen Seite des Stockwerks hinüber, wo die Zimmer ihrer Eltern waren. Man konnte ja mal einen Blick in Charlotts Kleiderschrank werfen.
Sie knipste das Licht an, als sie das Ankleidezimmer ihrer Mutter betrat, und sah sich selbst. Direkt gegenüber der Tür befand sich ein riesiger Spiegel.
Da war sie. Eine nackte junge Göttin, braun und bloß, das Haar schimmernd unter dem hellen Licht der Deckenlampe. Noch die Leuchten rechts und links vom Spiegel, jetzt war das Licht weicher. Mit einem wollüstigen Seufzer drehte sie sich vor dem Spiegel. Wie schön! Wenn er sie so sehen könnte, dieser Mensch von heute Nachmittag, er würde glatt hier vor ihr auf den Knien liegen.
Irgendwie benahm sie sich albern. Sie schnitt ihrem Spiegelbild eine Grimasse und drehte eine rasche Pirouette. Schließlich hatte sie ja auf Charlotts Wunsch einmal Ballettunterricht gehabt. Nicht sehr lange, denn sie hatte sich nicht viel daraus gemacht. Sport war ihr lieber. Reiten, Schwimmen, Skilaufen, Tennisspielen. Charlott konnte das nicht begreifen. Sie war Tänzerin gewesen und wäre, das erklärte sie jedem, der es hören wollte oder nicht, sogar eine weltberühmte Tänzerin geworden, wenn nicht der Krieg gewesen wäre und alles, was er mit sich brachte.
»Der Krieg hat meine Karriere zerstört«, sagte Charlott immer mit ihrer gedehnten Stimme. »Ich wäre eine zweite Pawlowa geworden. Monsieur Duval hat das immer gesagt.«
Monsieur Duval war ihr Tanzlehrer gewesen, in Breslau, als Charlott noch ein Kind war und im Ballett der Oper mitgetanzt hatte. Sogar schon einmal einen Solopart.
Aber dann war eben Krieg, Charlott musste fliehen, die Oper war vermutlich abgebrannt und mit ihr alle Ballettröckchen. Breslau war eine Festung, und man tanzte kein Ballett mehr. Von Monsieur Duval hatte man nie mehr etwas gehört. Vielleicht hatten ihn die Russen mitgenommen, und er schulte mittlerweile eine neue Pawlowa. Oder er war irgendwann mit einer Bombe in die Luft geflogen.
So what, dachte Brigitte. Sie glaubte sowieso nicht an Charlotts tänzerische Begabung. Lächerlich, sich Charlott als Tänzerin vorzustellen. Obwohl Vater es sogar bestätigt hatte. Er habe sie selber tanzen sehen. In »Carmen«, als Spanierin. Und im Holzschuhtanz in »Zar und Zimmermann«. »Na bitte, mein Kind«, sagte Charlott beleidigt.
Brigitte zog aus dem Schrank, was sie die ganze Zeit im Sinn hatte. Das schmale schwarze Kleid mit dem tiefen Dekolleté. Charlott hatte es aus Paris mitgebracht, aber nie getragen. Es war ihr einfach zu eng. Brigitte hatte gemeint: »Du kannst es mir ja geben.«
»Dir? Aber Gitti, für Schwarz bist du viel zu jung. Das ist kein Kleid für dich.«
»Du kannst es doch nicht anziehen.«
»Ich werde es schon anziehen. Es war schrecklich teuer. Wenn ich meine Diätkur gemacht habe, passt es mir bestimmt.«
Nie würde es passen. Charlott aß so gern Kuchen und Konfekt. Tanzen tat sie nicht mehr, und für Sport hatte sie nichts übrig. Vor Pferden hatte sie Angst und zum Tennisspielen zu empfindliche Gelenke.
Als Brigitte das Kleid angezogen hatte, stieß sie einen leisen Pfiff aus. Das war schlechthin fantastisch. Das schlug jeden Rekord. Und dazu Charlotts silberne Sandaletten mit den hohen Absätzen. Und lange silberne Ohrgehänge. Die Schuhe sind ein bisschen eng. Macht nichts. Aber sonst ist das einfach umwerfend. Warum zieht sie sich nicht so an? Macht ihre Diätkur und zieht das an. Dann würde Vater vielleicht keine Freundin haben.
Sie ließ das Licht brennen und stöckelte die Treppe hinab in die große Diele. Still und stumm war das Haus. Kein Mensch da. Sie knipste alle Lichter an und ging mit lässigen Schritten durch alle Räume. Das große Terrassenzimmer, Vaters Zimmer daneben, der helle Salon mit den Biedermeiermöbeln – alles nicht von der WEFA möbliert –, das Esszimmer, der halbdunkle Raum mit der Hausbar, dem Plattenspieler und dem Fernseher.
Sie legte eine Platte auf und drehte sich tanzend durch die Räume. Schön, wenn das Haus so leer war.
Herrlich, so allein zu sein. Lassie war ins Haus gekommen und folgte dem Mädchen langsam von Raum zu Raum.
Und wieder vor dem Spiegel in der Diele. Da, wo vor einer Stunde noch Fanny stand.
Nun ja, das war ein anderes Bild. Brigitte betrachtete sich entzückt. Aber natürlich war das viel zu schade für die blöde Kellerparty. Und sie hatte auch gar keine Lust mehr, dorthin zu gehen. Zu all den halbwüchsigen Gören. Es wäre schön, wenn jemand sie sähe. Aber nicht die. Nein, die nicht. Das Telefon. Bettina.
»Wo bleibst du denn, Gitti? Du bist noch zu Hause? Alle sind schon da.«
»Tut mir schrecklich leid, Bettina. Aber ich kann nicht kommen.«
»Du kannst nicht kommen? Warum denn nicht?«
»Wir haben Besuch gekriegt. Ganz plötzlich. Von auswärts. Freunde von meinen Eltern.«
»Na und?«
»Die alten Leute sind bei Wellmanns, das weißt du doch. Ich muss hierbleiben und den Besuch unterhalten.«
»Du lieber Himmel! Du spinnst ja. Warum denn gerade du?«
»Wer denn sonst?«
»Was sind denn das für Leute?«
»Ach, so ein älteres Ehepaar.« Sie dämpfte die Stimme. »Ich kann nicht so laut reden, sonst hören sie es.«
»Was fängst du denn mit denen an?«
»So reden halt. Bisschen Musik machen. Was trinken.«
»Ist ja grässlich.«
»Grässlich.«
»Kannst du nicht sagen, du musst dringend weg? Jimmy kann dich holen.«
»Es geht wirklich nicht. Ich habe es Vater versprochen, dass ich hierbleibe. Wirklich, tut mir leid. Amüsiert euch gut.«
»Na, weißt du …«
Die Lüge war ihr leicht über die Lippen gegangen. Nicht eine Minute hatte sie überlegt. Ganz von selbst hatte sich das ergeben. Hier allein im leeren Haus zu bleiben, war viel verlockender als die kindische Party. Im Tanzschritt drehte sie sich zurück bis zur Bar.
»Darf ich Ihnen noch einen Cocktail mixen?«, fragte sie lächelnd vor den leeren Sesseln. »Oder möchten Sie lieber etwas essen?« – Die imaginären Besucher wollten gern einen Cocktail trinken.
»Champagnercocktail«, entschied Brigitte befriedigt und begann sogleich zu mixen. »Und etwas Musik.«
Frank Sinatra: »It’s easy to remember …«
Ach, was für eine Stimme! Ging einem durch und durch. Sie sitzt im Sessel, trinkt den Cocktail, ist glücklich. Aber dann … Sie lassen sich scheiden. Na, ich glaub’s noch nicht. So einfach ist das nicht. Will Vater die Frau denn heiraten?
Sie kennt sie. Reporterin an einer Tageszeitung dieser Stadt. Jung, ehrgeizig, intelligent, sehr gut aussehend. Was ganz anderes wie die kleinen Mädchen oder Fräulein Lessing. Die wusste, was sie wollte, dieses Fräulein Helten. Erst heute Abend ist es ihr gelungen, zwei und zwei zusammenzuzählen. Sie hat Vater einmal mit dieser Person in der Stadt gesehen. Rein zufällig. Daran war nichts Besonderes. Fräulein Helten hatte schließlich vor einem halben Jahr die große Reportage über das Werk gemacht. WEFA-Möbel, ein Name, ein Begriff. ›Werner Fabian, ein junger Unternehmer, wie er in unsere Zeit passt. Ein gut aussehender Mann, der seine Tüchtigkeit hinter Charme versteckte.‹ So hatte sie damals geschrieben. Vater hatte geschmeichelt gelacht, als er die Zeitung las. Die Reportage war auch in ein paar auswärtigen Zeitungen erschienen.
Fräulein Helten versteckte offensichtlich ihren Charme hinter ihrer Tüchtigkeit. Irgendwann war Vater darauf gekommen. Was nicht zu verwundern war, denn er hatte viel Verständnis für die Reize einer Frau. Und diese Sybille Helten war mal etwas anderes. Ein gescheites Frauenzimmer. Vor vier Wochen war sie im Tennisklub aufgetaucht. Es war ein sehr exklusiver Klub, in dem Brigitte und ihr Vater spielten, nur die beste Gesellschaft. Aber eine tüchtige, junge Karrierefrau, die überdies noch hübsch war, hatte möglicherweise Zugang zur guten Gesellschaft.
Am Anfang spielte sie nicht besonders gut. Aber inzwischen hatte sie Trainerstunden genommen, und dann gab es eine Menge gut spielender junger Männer, die gern mit der attraktiven Frau spielten. Sie hatte Fortschritte gemacht, das musste Brigitte zugeben.
Nicht, dass sie im Klub auffallend mit Vater geflirtet hätte, oder er mit ihr. Da mal eine Cola, mal einen Whisky nach dem Spiel, meist in größerer Gesellschaft. Zwei- oder dreimal hatte er mit ihr gespielt, öfter nicht. Und trotzdem wusste Brigitte jetzt genau, dass sie es war und keine andere. Fräulein Lessing? Lächerlich. Sie würde noch zwanzig Jahre mit Vater arbeiten und ihn anbeten und, wenn er wollte, mit ihm schlafen. Sybille Helten also. Wie alt mochte sie sein? Achtundzwanzig, dreißig? Charlott war sechsunddreißig. Kein Alter für eine Frau. Vater war fünfundvierzig. Erst recht kein Alter für einen Mann. –
Frankieboy sang: »But what else can you do at the end of a love affair?« – Was für eine Trompete!
Brigitte dachte: Nimm dich in acht, Charlott. Diesmal wird es ernst.
Dann stand sie auf und schlenderte in die Küche. Sie würde jetzt etwas essen. Und dann vielleicht fernsehen. Oder weiter Platten hören. Sie konnte auch noch zur Party gehen. Die Besucher konnten ja inzwischen schlafen gegangen sein. Noch einmal blieb sie vor dem Spiegel stehen, betrachtete sich von Kopf bis Fuß. Die Beine, die schmalen Hüften, noch schmäler in dem Schwarz, die nackten Schultern und dann ganz aus der Nähe: ein schönes, schmales Gesicht, die Haut frisch wie ein Blütenblatt, klare graublaue Augen, schwarz umrandet. Sie gefällt sich sehr.
Ein paar Hundert Kilometer entfernt, in einer anderen Stadt, einem anderen Land, in einer anderen Welt, blicken auch zwei Augen in den Spiegel. Dunkle, fast schwarze Augen. Der Spiegel ist klein, zeigt nur das Gesicht. Ein müdes, blasses Gesicht, ein verdüstertes Gesicht, ohne Freude, ohne Hoffnung. Nur die Augen leben, die Resignation ist noch nicht in ihnen angekommen, in ihnen ist Abwehr, Trotz. Und dann, während sie noch dasteht und sich in die Augen blickt, wechselt ihr Ausdruck in Verzagtheit und Angst. Staunen.
Ich habe Ja gesagt. Warum habe ich Ja gesagt? Ich will gar nicht. Nur um ihm eine Freude zu machen? Weil ich weiß, dass er gern hinaus möchte. Dass er nicht resigniert hat wie ich, dass er glaubt, das Leben hat noch ein großes Wunder für ihn bereit. Oder viele kleine Wunder. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass er fortfliegen möchte, wie ein eingesperrter Vogel fortfliegen will.
Sie denkt es wirklich: wie ein eingesperrter Vogel. Und muss selbst über diese Formulierung lächeln.
Sie denkt für gewöhnlich nicht in poetischen Wortbildern. Das liegt ihr nicht. Und es ist in diesem Falle doppelt absurd, weil sie es im Zusammenhang mit einem Siebzigjährigen denkt. Ein alter Mann von siebzig Jahren, ein Mann am Ende seines Lebens, wenn man nach herkömmlichen Spielregeln geht. Ein Mann, der so viel erlebt und erlitten hat, dass man meinen sollte, seine Jahre seien zur doppelten Last geworden, er sei nicht siebzig, sondern hundertundvierzig Jahre alt.
So wie ich nicht achtunddreißig bin, sondern achtzig, hundertachtzig, längst gestorben.
Ihr Vater jedoch ist siebzig Jahre alt und keinen Tag mehr. Heute ist sein Geburtstag. Am Nachmittag haben sie zusammen gesessen und den Wein getrunken, den Andrej ihr für ihn gegeben hat. Außerdem hat er von ihr ein Hemd aus grobem blauen Stoff bekommen und zwei Paar Socken.
»Mehr kann ich dir leider nicht schenken«, hat sie gesagt.
»Ich habe genug bekommen«, hat er erwidert und auf die Gaben gedeutet, die er aus der Klinik mitgebracht hatte. Mehrere Flaschen Schnaps, einen dicken Schal, den man zwar jetzt im Sommer nicht, aber dafür im Winter brauchen kann, und dann Lebensmittel. Alles mögliche haben ihm die Leute gebracht: Eier, Speck, Fleisch, Zigarren, Tabak. Ein kleiner Strauß von rosa Federnelken ist auch dabei. Und zwischen allen Geschenken ein merkwürdiges Stück: eine dicke goldene Kette. Eine schwere altmodische Uhrkette.
»Wie gern sie dich haben«, hat sie gesagt. Und als sie die Kette sah: »Lieber Himmel, von wem ist denn die?«
»Die brachte mir der dicke Krazowec. Du weißt schon, der alte Bauer, der hinter Hundsfeld den großen Hof bewirtschaftet.«
»Dieser alte Geizkragen? Der ewig seine Schulden nicht bezahlt hat? Einer der widerwärtigsten Patienten, an den ich mich erinnern kann.«
»Das war er zweifellos.« Ihr Vater schmunzelte vergnügt vor sich hin. »Außer mir wollte keiner mehr zu ihm hineingehen. Er schmiss mit allem, was ihm zwischen die Finger kam, wenn das Bein ihn schmerzte. Und wie er sich aufführte, wenn seine Maruschka ihm ein Fläschchen Wodka gebracht hatte. Weißt du noch? Ach, und seine Flüche! Wenn ich mal Zeit habe, muss ich hinausfahren und mir ein paar davon aufschreiben.«
Sie musste lachen. »Ich glaube nicht, dass das nötig ist. Soweit ich mich erinnere, hast du damals schon die wichtigsten auswendig gelernt.«
Der Bauer war vom Heuwagen gestürzt, und das Rad war über sein Bein gegangen. Komplizierte Brüche, Quetschungen waren die Folge, später kam eine gefährlich aussehende Embolie dazu.
Sie hatten ihn lange in der Klinik liegen. Ein Patient, der ihnen das Leben zur Hölle machte.
»Er wird uns ewig dafür dankbar sein, dass er gesund nach Hause gehen konnte«, sagte ihr Vater.
»Das glaubst du.«
»Das weiß ich. Auch wenn er sich eher die Zunge abbeißen würde, ehe er Danke sagt. Auf jeden Fall brachte er mir heute die Kette. Ich traute meinen Augen nicht. Sie ist nämlich echt, weißt du.«
»Beuteware wahrscheinlich, was sonst? Er wird sie einem gestohlen haben, als er fünfundvierzig ins Land kam. Oder er hat einen Deutschen dafür erschlagen. Ein feines Geburtstagsgeschenk.«
»Ja. Ich denke auch nicht, dass er sie rechtmäßig erworben hat. Sie muss ihm sehr viel bedeutet haben, dass er sie in all den Jahren nicht auf dem schwarzen Markt verhökert hat.«
»Auf das Geschenk kannst du dir etwas einbilden.«
»Tu ich auch.« Matthias grinste wie ein Lausbub, hob die Kette hoch und ließ sie schaukeln. »Ich würde sagen, ich habe sie ehrlich verdient. Fünf Monate lag er auf meiner Station. Manchmal träume ich heute noch davon.«
Und plötzlich, ganz unvermutet sagte ihr Vater: »Du könntest mir schon noch ein Geburtstagsgeschenk machen, Ricarda.« Sie blickte misstrauisch zu ihm hinüber. Seine Stimme hatte zwar ganz normal geklungen, aber es war ein Unterton darin, der ihr sagte, dass es sich um keine Bagatelle handelte.
»Was?«, fragte sie kurz.
»Lass uns hinübergehen.«
Sie schwieg überrascht. Er hatte lange nicht mehr davon gesprochen. Sie hatte gedacht, er hätte den Wunsch begraben. Ohne ihn anzusehen, langte sie nach den Zigaretten, schob sich eine zwischen die Lippen. Wie immer gab er ihr höflich Feuer und füllte dann noch einmal ihre Gläser.
Sie wartete, ob er noch etwas sagen würde. Aber er hatte Geduld, er wartete auf ihre Antwort.
»Aber jetzt doch nicht mehr«, murmelte sie schließlich.
Es hatte eine Zeit gegeben, da wäre sie gern gegangen. Gleich nach dem Krieg, auch die folgenden Jahre noch. Hinüber, wo das Leben war. In das Land der Verheißung, in die Freiheit. In eine neue Heimat, da man ihnen die alte genommen hatte. Hinüber, das hieß nicht nur in den Westen, das hieß auch: endlich ein eigenes Leben haben. Mensch sein, Frau sein. Ihr Studium vollenden, ein Ziel vor sich sehen. Und wieder gleichwertig zu sein den anderen, die um einen lebten, Rechte haben, eine Stimme, ein Gesicht, nicht mehr ausgestoßen und minderwertig zu sein.
Aber es gab keine Möglichkeit, hinauszukommen. Das Leiden ihrer Mutter, die ganze ausweglose Situation. Auch ihre Arbeitskraft war wertvoll genug, ihr die Ausreise zu verweigern. Aber es war ein Sklavendasein, und so hatte sie es immer betrachtet. Dann kam eine Zeit, da wollte sie nicht mehr fort. Die Lebensbedingungen wurden einigermaßen erträglich. Und natürlich Andrej, der behauptete, sie zu lieben, und sie dennoch, auch er und er erst recht, noch mehr versklavte. Vor zwei Jahren hatte er geheiratet, ein junges, farbloses Mädchen, die Tochter des Chefarztes. Inzwischen war Andrej Stellvertreter des Chefarztes geworden. Aber er liebte sie immer noch. Er wollte sie nicht loslassen, er sah sie an mit seinen glühenden Augen, er streifte ihre Hand, er kam immer wieder in ihre Nähe.
Er hatte immer Freude daran gehabt, sie zu quälen. Es war seine Art von Liebe. Und es hatte eine Zeit gegeben, da hatte sie sich gern quälen lassen. Als er heiratete, dachte sie, nun würde sie ihn hassen. Aber nicht einmal das. Eine tiefe Gleichgültigkeit erfüllte sie.
»Zwischen uns wird sich nichts ändern«, das waren seine Worte gewesen.
Sie hatte ihn stumm angeblickt. Und dann gelächelt. Und seitdem war Kampf zwischen ihnen. Ein Kampf, in dem sie unterliegen würde, auch das war ihr klar.
Lass uns hinübergehen. Auch dieses Problem würde damit gelöst sein.
»Sie werden uns nicht gehen lassen.«
»Doch. Ich glaube, diesmal gelingt es uns. Vielleicht wird dir Andrej helfen.«
Sie lachte. »Meinst du? Denkst du, er wäre erleichtert, wenn ich nicht mehr hier wäre?«
»Vielleicht. Schließlich ist er nun verheiratet. Und der Chef weiß genau Bescheid über dich und ihn. Er ist heute dein Feind, denn schließlich ist seine Tochter Andrejs Frau. Man kann das verstehen. Oder nicht?«
»Doch.«
»Er würde deine Ausreise gewiss befürworten.«
Daran hatte sie noch nicht gedacht. Ja, der Professor würde alles tun, damit sie bald und reibungslos das Land verlassen konnte. Wohin sie wollte, auch in den Westen.
Auf einmal erschien es ihr so wünschenswert wie nichts auf der Welt, bald fortzugehen. Der Professor war ihr Feind. Wenn es ihm zu viel wurde, konnte er sie jederzeit entlassen. So knapp waren die Schwestern heute nicht mehr. Andrej war auch ihr Feind. Er hatte zwar eine junge Frau, die in drei Monaten ein Kind erwartete, aber er wollte, dass sie weiterhin seine Geliebte blieb. Und sie würde es wieder sein, auch wenn es ihr bis jetzt gelungen war, hart zu bleiben.