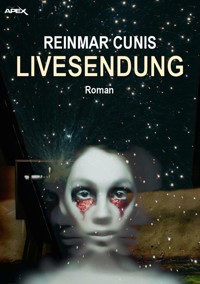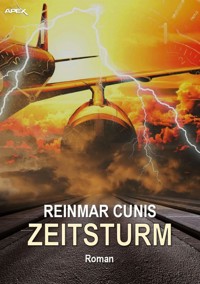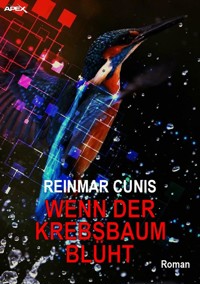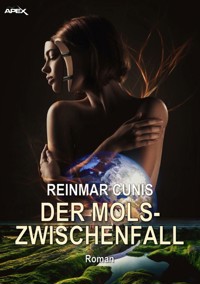
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Mols - stilles Land zwischen dänischen Mooren und Kattegat, Heimat der Geisterseher und Totenbeschwörer, Spiritisten und Sonderlinge. Hier liegt der Schlüssel für den abrupten Umschwung in der marxistischen PSI-Forschung: damals, 1985, als ein geheimnisvolles sowjetisches Forschungs-U-Boot die NATO-Herbstmanöver begleitete, als die bemannte Raumstation Saljut XII aus ihrem Orbit stürzte, als in den Dünen das Labor des PSI-Amateurs Einar Brodersen in Flammen aufging. Was geschah wirklich?
Was verschweigt der sogenannte Molsland-Bericht, der den Internationalen Parapsychologen-Kongress in Oslo erregte?
Der Zwischenfall am Kattegat gibt die überraschende Antwort, belegt mit Zeugenaussagen, Dokumenten, bisher unbeachteten Veröffentlichungen und sensationellen Geheimpapieren...
Der Roman Der Mols-Zwischenfall von Reinmar Cunis (* 8. August 1933 in Bremen; † 16. April 1989) erschien erstmals im Jahre 1981 und gilt als moderner Klassiker der Science-Fiction-Literatur aus Deutschland sowie als herausragender Social-Fiction-Roman.
Der Apex-Verlag veröffentlicht Der Mols-Zwischenfall als durchgesehene Neuausgabe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Reinmar Cunis
DER MOLS-ZWISCHENFALL
Roman
Apex-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
Der Autor
DER MOLS-ZWISCHENFALL
Vorbemerkung
ERSTER TEIL
ZWEITER TEIL
DRITTER TEIL
Das Buch
Mols - stilles Land zwischen dänischen Mooren und Kattegat, Heimat der Geisterseher und Totenbeschwörer, Spiritisten und Sonderlinge. Hier liegt der Schlüssel für den abrupten Umschwung in der marxistischen PSI-Forschung: damals, 1985, als ein geheimnisvolles sowjetisches Forschungs-U-Boot die NATO-Herbstmanöver begleitete, als die bemannte Raumstation Saljut XII aus ihrem Orbit stürzte, als in den Dünen das Labor des PSI-Amateurs Einar Brodersen in Flammen aufging. Was geschah wirklich?
Was verschweigt der sogenannte Molsland-Bericht, der den Internationalen Parapsychologen-Kongress in Oslo erregte?
Der Zwischenfall am Kattegat gibt die überraschende Antwort, belegt mit Zeugenaussagen, Dokumenten, bisher unbeachteten Veröffentlichungen und sensationellen Geheimpapieren...
Der Roman Der Mols-Zwischenfall von Reinmar Cunis (* 8. August 1933 in Bremen; † 16. April 1989) erschien erstmals im Jahre 1981 und gilt als moderner Klassiker der Science-Fiction-Literatur aus Deutschland sowie als herausragender Social-Fiction-Roman.
Der Apex-Verlag veröffentlicht Der Mols-Zwischenfall als durchgesehene Neuausgabe.
Der Autor
Reinmar Cunis (* 08. August 1933, † 16. April 1989).
Reinmar Cunis war ein deutscher Soziologe, Journalist und Autor von Science-Fiction-Romanen.
Geboren in Bremen, absolvierte Cunis eine Banklehre, studierte anschließend in Berlin und Köln Soziologie, Psychologie und Wirtschaftswissenschaften. Er promovierte im Jahre 1964 mit einer Arbeit in Soziologie über künftige Militärverfassungen in demokratischen Industriestaaten und arbeitete beim NDR.
Mit 17 Jahren veröffentlichte er seine erste Kurzgeschichte und schrieb anschließend für Zeitungen und Zeitschriften. Im Jahre 1966 schließlich wurde sein erstes Hörbild Alpträume und Wunschbilder im NDR-Rundfunk ausgestrahlt.
Reinmar Cunis drehte auch Fernseh-Reportagen zu wirtschafts- und sozialpolitischen Themen und war überdies einige Jahre Projektgruppenleiter bei der Fernsehspielabteilung des Norddeutschen Rundfunks.
Sein erster Science-Fiction-Roman Livesendung erschien 1978. In ihm geht es um den Besuch eines Außerirdischen, der allerdings von der betriebsblinden Presse nicht wahrgenommen wird. Cunis' zweiter Roman Zeitsturm wurde im Jahre 1979 veröffentlicht: Er befasst sich mit dem Thema Zeitreise mittels Drogen und ist vom Werk so unterschiedlicher Autoren wie Philip K. Dick und J. G. Ballard beeinflusst.
Zu Reinmar Cunis' Lieblingsthemen gehörten außersinnliche Wahrnehmungen, Teleportation, psychedelische Drogen, Psi-Phänomene und Leben nach dem Tod.
Als seine herausragendsten Werke gelten Am Ende eines Alltags (1982), eine Sammlung von Kurzgeschichten, sowie der Roman Wenn der Krebsbaum blüht (1987).
Für die Kurzgeschichte Polarlicht wurde er 1986 mit dem Kurd-Laßwitz-Preis ausgezeichnet.
Der Apex-Verlag widmet Reinmar Cunis eine umfangreiche Werkausgabe.
DER MOLS-ZWISCHENFALL
Vorbemerkung
Vor zwei Jahren tauchte auf dem Internationalen Parapsychologen-Kongress in Oslo ein Schriftstück auf, das viel Aufsehen erregte und bald unter der Bezeichnung Molsland-Bericht von PSI-Forschem in Westeuropa, in Lateinamerika und in den USA als Sensation herumgereicht wurde. Das Papier trug ein Datum des Jahres 1985, war aus den Geheimakten der damaligen sowjetischen Abwehr entwendet worden und auf mysteriöse Weise nach Oslo gelangt. Einige hielten es für gefälscht, weil es ihrer Meinung nach zu viele Details brachte, die in den achtziger Jahren unmöglich der Moskauer Akademie der Wissenschaften mitgeteilt worden wären. Die meisten aber glaubten, nun endlich eine Erklärung für den völligen Umschwung in der sowjetischen PSI-Forschung in Händen zu halten, der seit zwanzig Jahren festzustellen ist.
Da sich die Kollegen vom ehemaligen Wassiljew-Institut in Leningrad stets in Schweigen geübt hatten, war man bisher auf politische Spekulationen angewiesen gewesen. Kreml-Analytiker waren im Laufe der Jahre zu immer fantastischeren Vermutungen gelangt, warum in den osteuropäischen Staaten den Wissenschaftlern, die Telepathie, Hellsehen und Präkognition untersuchten, die Arbeit unmöglich gemacht worden war – und das zu einem Zeitpunkt, als die marxistische Parapsychologie weitaus bedeutendere Erfolge aufzuweisen hatte als die Forschung in der westlichen Hemisphäre. Ich will all diese Vermutungen nicht noch einmal aufgreifen. Mich hat aber dieses Dokument, das zweifellos echt ist, nicht zufriedenstellen können.
Ich bin deshalb den wenigen darin enthaltenen Fakten nachgegangen und habe mich in diesem idyllischen Landstrich an der dänischen Kattegatküste, der Mols genannt wird, gründlich umgesehen. Es leben noch einige Zeugen, und sie haben mir bereitwillig auf meine Fragen geantwortet. Ich habe Notizen und Aufzeichnungen gesammelt und Briefe, die ich im Wortlaut wiedergeben darf, ebenso Auszüge aus den damals in Aarhus erschienenen Parapsychologischen Heften. Sehr aufschlussreich war für mich auch weiteres sowjetisches Geheimmaterial, das ich in Dänemark durch einen merkwürdigen Zufall entdeckte. Allen, die mir bei meinen Recherchen geholfen haben, danke ich an dieser Stelle, besonders Frau Hedwig Brodersen, die trotz ihrer 79 Jahre nicht müde wurde, mir aus ihrer Vergangenheit zu erzählen. Leider ist sie vor wenigen Wochen gestorben, ohne das Ergebnis meiner Arbeit gesehen zu haben.
Mir ist klar, dass auch meine Version des Mols-Zwischenfalls einige Fragen offenlässt. Die Thesen des dänischen PSI-Amateurs, auf den ich durch das Osloer Dokument aufmerksam wurde, sind heute genauso wenig zu beweisen wie vor zwanzig fahren. Vielleicht verwirren auch einige Behauptungen Frau Brodersens die Zusammenhänge eher, als sie im streng naturwissenschaftlichen Sinn zu klären. Man sollte aber diese Zeugenaussagen nicht mit dem naiven Hinweis verwerfen, die Molsländer gälten in Dänemark als belächelnswerte Spinner und Sonderlinge, und eigentlich seien sie alle geistig etwas beschränkt und deshalb nicht ernst zu nehmen. Solche Vorurteile gegenüber Bevölkerungsgruppen in Randgebieten gibt es in jedem Land; meist sind sie dadurch entstanden, dass sich diese Menschen wegen ihrer besonderen geographischen Lage mehr mit sich selbst als mit ihren Nachbarn beschäftigt haben. Und um esoterisch veranlagte, introvertierte Menschen hervorzubringen, eignet sich das Molsland ebenso gut wie Schottland, die Bretagne oder Ostfriesland.
Amelinghausen, den 19. Januar 2005
Reinmar Cunis
ERSTER TEIL
Erstes Kapitel
Die Wörter tropften in die stickig-feuchte Enge des Bugraums, klirrend sprangen sie über die verknoteten Rohrleitungen, durch Schotte und Luken, über Messgeräte und Papier.
»Drei«, sagte Fedor Rade, dann: »Rot, Kreis, viernullsieben.« Kurze Pause. »Krasnoznamennyi Baltyskij Flot. Zehn Uhr siebenunddreißig.«
Der rotgesichtige Versuchsleiter neben ihm sah auf die Stoppuhr, zeichnete den Zettel ab und verschloss ihn sorgfältig in einer Kassette. Radek blieb unbewegt sitzen, mit geschlossenen Augen und kaum hörbarem Atem. Durch die Stahlwände des U-Bootes liefen hohle, schlürfende Geräusche, es roch nach Öl, Schweiß und Scheuerseife.
Längst hatte Oberstleutnant Tscherengoff, fernab im kühlen Laborraum des Forschungsschiffes, die vorbereitete Botschaft empfangen, leicht verzerrt und nicht ganz störungsfrei.
»Drei«, hatte er Ilitschews Stimme im Kopfhörer vernommen, »Rot, Kreis, viernullsieben, Krasnoznamennyi Baltyskij Flot. Zehn Uhr siebenunddreißig.« Dann, wie eine Korrektur: »Zehn Uhr dreißig.«
Sie hatte es um 10 Uhr 30 gesagt.
Tscherengoff nickte. Sieben Minuten, vier und dreiundvierzig Zehntel Sekunden schneller, las er genau ab und gab die Daten in einen Speicher. Zufrieden blickte er aus dem Bullauge des Labors und verfolgte eine Möwe, die im Gleitflug vorbeizog. Das 45.000 Tonnen große Forschungsschiff Kosmonaut Juri Gagarin kreuzte wenige Meilen vor Rostock, gerade so weit von der Küste entfernt, dass seine charakteristischen Aufbauten vom Ufer her nicht mehr auszumachen waren. Die vier großen Parabolantennen und die über hundert feinen, bizarren Stabantennen reckten sich aus dem Schiff in einen milchig-weißen Herbsttag, so als ob sie alle dem Hörspiel lauschten, das aus der Ostsee aufstieg und vom Himmel zurückkam.
Rings um den grauen Schiffsleib dehnte sich gläsern das Meer und spiegelte die Aquarellfarben der Luftschichten wider, lachshelle Wolkenstreifen mit quellenden Schattierungen, im Westen wie mit Messing eingefasst, weiter nördlich setzten sie einen Hauch von Bronze an. Irgendwo dort, unter diesem bronzenen Helm über Dänemark, räkelte sich der hundert Meter lange Bauch des Forschungs-U-Bootes, und dazwischen stampften die Zerstörer und Tragflügler, Schnellboote und Fregatten des NATO-Herbstmanövers durch die anglerstille See. Es war, als fände hier eine Vorstellung in der Badewanne statt; die Herren im Galadress beugten sich sachkundig und mit glänzenden Augen über ihr milliardenschweres Spielzeug und stippten mit gepflegten Fingern an die grau und braun gepinselten Masten, Brücken, Kanonen und Raketenwerfer, und sie blinzelten, um tief darunter die sowjetische U 83 auszumachen, die in ihrem Code Victor II hieß. Sie gehörte zu ihrem Spiel; erstaunt wären sie gewesen, hätten sie diesen Zaungast nicht gehabt, der so tat, als ob er ganz zufällig im Kattegat schwämme.
Wieder meldete sich die leicht verzerrte Stimme in Tscherengoffs Kopfhörer, wieder früher als festgesetzt.
»USS Plainview«, gab sie die amerikanische Bezeichnung mit stark russischem Akzent durch, »AG, EH, One. Achtundfünfzig Knoten. Bestückung: Vier Fla-Raketenwerfer. Zehn Uhr einundvierzig.«
Tscherengoff wusste bereits, was nun folgte.
»Zehn Uhr vierunddreißig.«
Die Kontrolluhr über seinem Arbeitsplatz stimmte mit der zweiten Angabe überein. Sieben Minuten und fünf Sekunden später zeichnete der Versuchsleiter im U-Boot den Zettel ab und legte ihn ebenfalls in seine Kassette. Oberleutnant zur See Radek fiel wieder in scheinbar unbeteiligtes Schweigen.
Tscherengoff lachte über die Manöverdaten. Sollten die Offiziere auf den NATO-Schiffen nur glauben, sie würden beobachtet! Ihre Sensoren hatten längst das U-Boot ausgemacht: mit Sicherheit wurde es auch mit den Funksprüchen in Zusammenhang gebracht, die über die Ostsee strichen, bevor sie von den tausend Ohren der Juri Gagarin eingefangen wurden.
Admiral Sinowjeff, sowjetischer Beobachter der NATO-Herbstmanöver im Kattegat, hatte vermutlich sein sparsames Lächeln aufgesetzt, um zu verbergen, dass auch er nicht erklären konnte, auf welche Weise die Funksprüche aus dem tief getauchten Boot die Oberfläche erreichten.
Denn auch Sinowjeff wusste zu diesem Zeitpunkt nicht, dass in der U 83 Fedor Radek saß, mit einer zusätzlichen Dosis Adrenalin in den Adern und beeinflusst von dem ersten, nach Tscherengoffs eigenen Entwürfen gebauten Gravitationsverstärker. Außer dem Genossen Oberstleutnant auf der fernab liegenden Kosmonaut Juri Gagarin wussten es nur der schwitzende Versuchsleiter, der bei jedem Spruch auf die Stoppuhr sah, den Zettel abzeichnete und ihn verschloss, und der ebenfalls verschwitzte, brillengesichtige Uniformierte neben ihm, der bedächtig Zettel für Zettel aus einer Mappe zog und ihn Radek reichte. Der prägte sich die Daten ein, sprach sie laut, langsam und konzentriert und gab den Zettel zur Abzeichnung weiter, genau sieben Minuten und vier Sekunden später als sein eigenes, stratosphärengedämpftes Echo in Tscherengoffs Kopfhörern.
Und auch der dritte Parapsychologe wusste es, der in einem noch engeren Raum neben diesem Echo saß, das Peter Ilitschew hieß und die Augen ebenso geschlossen hielt wie Fedor Radek drunten im Meer. Ilitschew, rosig, pausbäckig und jung, bewegte die breiten Lippen wie Kiemen, wenn er sprach, und was er sagte, hatte der blasse Fedor Radek gedacht.
Ilitschew schwebte, nur wenige Gramm schwer, eingebettet in das tintige Blau des Planeten, zufrieden wie ein gestillter Säugling zwischen dem Tageslicht der Lüfte und der nächtlichen Weite der Sterne. Die zärtliche Bewegung des Raumschiffs Saljut XII wiegte ihn, Fröhlichkeit spielte über seinen Mund. USS Plainview? Dieses Wort war ihm von den Lippen gekommen, es war Radeks Wort, und Ilitschew hatte es nachgesprochen, ohne zu verstehen. Es war schwierig und sicher bedeutend, aber verstanden hatte er es nicht.
Als die Möwe wieder am Bullauge vorbeischoss, krächzte sie bösartig, stieg in weitem Bogen zum Horizont auf und kam im Sturzflug zurück. Ihr krummer, vergilbter Schnabel riss eine tiefe, schwarze Wunde in die frische Haut des Wassers, wütend schmetterten ihre Flügelspitzen auf und nieder und schlugen Wellenring auf Wellenring, dann stieß sie einen zweiten Krächzer aus und verschwand; die jähe Zeichnung im Wasser verebbte. Tscherengoffs Blicke waren starr geworden, sein maskenhaftes Gesicht klebte auf dem dicken Fensterglas.
Ein leichter Windzug bewegte die altersschwache Holztür der Hütte, die Angeln knarren, leise raschelt das Papier.
»Drei«, wiederholt Einar Brodersen, als ob er aus einem schweren Traum erwacht, »rot, Kreis, vier-null-sieben. Krasnoznamennyi Baltyskij Flot. Zehn Uhr siebenunddreißig.« Er versteht so viel russisch, um die Angaben zu begreifen und aufzuschreiben, aber er zögert. »Nein«, sagt es in ihm, »zehn Uhr dreißig.«
Beide Daten stimmen nicht mit seiner Armbanduhr überein.
Die knarrende Tür schlägt wieder gegen den Rahmen, öffnet sich erneut, Minuten wehen herein.
»USS Plainview«, sagt Brodersen mit russischem Akzent, »AG, EH, one. Achtundfünfzig...«
Er stockt.
»Einundvierzig...«
Dann überschwemmen ihn Eindrücke; schwitzende Gesichter, Uniformen, vierunddreißig, hämmert es in seinem Hirn, und Furcht kriecht ihm unter die Haarwurzel.
Zweites Kapitel
Zum ersten Mal machte er sich die Mühe, diesen ungeschlachten Kirchenbau näher zu betrachten, und eine Mühe war es schon, denn das Gebäude war unhandlich, viel zu groß geraten und schutzlos obendrein. Mürrisch blickte der kantige Turm über die wenigen, reetgedeckten Häuser des Ortes, die sich zwischen den Höhenrücken im Osten und den nassen Wald jenseits der Landstraße schmiegen, ein Stelzenturm mit Treppengiebel, auf dem die roten Dachziegel Wie eine speckige Seemannsmütze sitzen, und – Lehmann hatte davon gehört – eine Seefahrerkirche war sie auch gewesen, früher, als das Kattegat noch bis an die sandigen Höhen heranreichte, und dem Schutzheiligen der Seeleute war sie gewidmet, Sankt Nikolaus. Nun gab es keine See und keinen Hafen mehr, Dünen hatten sich davorgelegt, und der Wind mit dem brackigen Salzgeruch blieb dort draußen, nur Reste schalen Wassers hatten sich hinter der Kirche gesammelt und dämmerten zwischen Birken und Schilf. Ein vergessener See voller Mücken und Krähen, Überreste einer anderen Zeit wie der hochbeinige Kirchturm, den man einst abgerissen und neu gebaut hatte; warum, wussten die Leute von Draaby nicht mehr.
»Es hat etwas mit Tod zu tun«, hatte Brodersen gesagt, »nur so kann ich es formulieren, aber erklären kann ich es nicht.«
»Mit Tod?«, fragte Lehmann. Unwillkürlich blickte er hinauf zu den Gräbern, die sich im Schatten der Kirche duckten. »Dein eigener, Einar?«
Der Lehrer zögerte. Sie gingen den laubbedeckten Weg hinter der Kirche zu Ende, vom See stiegen Krähen auf, ganze Schwärme farbloser Krähen.
Brodersen sagte: »Ja. Nein. Ich kann es nicht deuten. Ich glaube, der Tod von vielen, sehr vielen Menschen.« Und dann sagte er noch: »Im Krieg.«
Lehmann dachte an den Tag, als die fremden Soldaten das Land überrannten, sie brachten feiste Männer in Braunhemden mit und Schergen, die nach Stiefelwichse und Haarpomade stanken. Damals waren viele jüdische Flüchtlinge hier vom Molsland aus über das gefährliche stille Wasser gezogen, mit leisen Rudern und spurlos im Nachtwind, und von denen, die sie hinüberbrachten, kehrten einige nicht zurück ins Dorf, vielleicht begrub man sie in fremder Erde wie die britischen Flieger, die hier oben neben der großen Kirche in dänischem Boden lagen.
Und er sagte laut: »Krieg! Das geschieht jeden Tag auf der Welt.«
Hanns Lehmann war Realist, meinte, die nüchterne, messende Betrachtungsweise seinem Beruf schuldig sein zu müssen. Die struppigen, grau gewordenen Augenbrauen beschatteten tiefliegende, kritische Augen, und wer ihn kannte, wusste auch, dass die ironisch-spöttischen Falten drumherum aus vielen Jahren oft unerfreulicher wissenschaftlicher Arbeit stammten. Sie zeigten, dass er Abstand gewonnen hatte. Lehmann nahm das Wunderbare als natürlich hin und das Böse als Ausdruck menschlicher Schwäche. Geburt und Tod betrachtete er als vorgegeben, als Teil eines Programms der Geschichte und unvermeidlich wie das Resultat eines Computers. Und was sich die Menschen antaten, hatten Geburt und Erziehung ihnen unverwischbar eingestanzt. Ein mechanistisches Prinzip, aber ein überaus brauchbares, von dem er meinte, dass es vorurteilsfrei sei.
Hanns Lehmann war Professor für ein höchst vorurteilsbeladenes Fach: Er lehrte in Aarhus Parapsychologie.
Die Fältchen um seine Augen traten stärker hervor: »Wir leben in ständiger Furcht vor dem Krieg«, sagte er herablassend, und er sagte es so, als beträfe es ihn gar nicht, sondern als sei es ein Lehrsatz, den er seinen Studenten einbläute. »Dieses ganz groteske Gleichgewicht des Schreckens hat es nie vermocht, uns in der Sicherheit des Friedens zu wiegen. Entspannung, Abrüstung, Schlussakte von Helsinki, alles dummes Zeug! Niemand kann auf seine Ideologie verzichten, die ihm sein geistiges Korsett liefert, und schon gar nicht auf die Waffen, die ihm den Fortbestand dieser Ideologie garantieren sollen. Wozu also das ganze Gerede, das nur der menschlichen Eitelkeit dient! Krieg steckt immer in uns selbst, und solange er dort steckt, wird es ihn geben.«
Doch Brodersen schien ihm gar nicht zugehört zu haben. Er starrte auf das Laub, das sich unter den Birken sammelte, und sah es nicht.
»Es waren nichts als sinnlose Zahlen, ein Code, dazwischen militärische Bezeichnungen, denen absichtlich der Zusammenhang fehlte. Und doch spürte ich den gewaltsamen Tod, von dem sie berichteten.«
Jetzt legte ihm Lehmann begütigend die Hand auf die Schulter. »Wir können uns von diesen Vorstellungen nie mehr frei machen«, sagte er. »Wenn wir einen militärischen Ausdruck hören, meinen wir bereits das verkohlte Holz von Ruinen zu riechen, und die Schreie verzweifelter Frauen hallen in unseren Ohren. Das steckt in uns, solange wir leben! Wir waren jung und aufnahmefähig, in unserer Psyche lässt sich das nie mehr löschen.«
Wieder stiegen Krähen aus dem Schilf, unflätig laut wie eine Horde von Strolchen. Wind, der vom Wald herüberkam, roch nach Schimmelpilzen. Brodersen schüttelte den Kopf.
»Das meine ich nicht.« Und heftiger sagte er: »Nein, das ist es ganz und gar nicht. Ich fühlte den Krieg, der noch kommen wird, den Krieg, der uns alle ergreift und vernichtet, den Krieg mit seinem brüllenden Tod und der langen, modrigen Leere.«
Amüsiert blieb Lehmann stehen.
»Lass das nicht die mächtigen Herren hören, die da oben die protzige Kirche hinstellen ließen, du armer Schulmeister. Lange, modrige Leere! Sagst du das zu deinen Schülern, wenn sie dich nach dem Jenseits fragen?«
Brodersen drehte sich zu ihm um, und zum ersten Mal an diesem Tag sahen sich die beiden voll an.
»Die Zeit!«, sagte Brodersen mit Nachdruck. »Was mir Angst machte, war, dass es noch erst geschehen wird! Sie dachten nicht an den Krieg, der gewesen ist, an den Feldzug der größenwahnsinnigen Germanen.« Und ganz leise fügte er hinzu: »Es war der Computer, der ihnen die Fahne vorantrug.«
»Aber wir sind doch von der Vergangenheit belastet, wenn wir an die Zukunft denken!«, sagte Lehmann dozierend.
Brodersen schüttelte unwillig den Kopf. »Du verstehst mich nicht. Sie sprachen von einer Zeit, die nicht die meine war. Nicht Zukunft oder Vergangenheit, nichts in meinem Lebenslauf. Verschoben, begreifst du das? Herausgehoben aus unserer Zeitebene, um Minuten nur, aber unüberbrückbar.«
Lehmann kannte Brodersens Eifer, und er fühlte, dass es etwas Wichtiges war, das den Freund beschäftigte. Aber er konnte nichts damit anfangen.
»Es ärgert dich, dass du es nicht erklären kannst?«, sagte er aufs Geratewohl, und wenn er sich richtig entsann, hatte Brodersen drauf nicht mehr geantwortet, er hatte überhaupt nichts mehr auf diesem Spaziergang gesagt. Stumm waren sie am See weitergegangen, das Laub raschelte, und die Krähenschar kehrte lärmend ins Schilf zurück, und erst sehr viel später, als Lehmann im Auto saß und nach Aarhus zurückfuhr, war ihm aufgefallen, dass Brodersen sich nicht bemüht hatte, den Vorgang zu beschreiben.
Als er jetzt wieder, unschlüssig noch, zwischen dem alten, leeren Schulhaus und der großen, leeren Kirche stand, fiel ihm endlich der Satz ein, den Einar ganz zu Anfang gesagt hatte.
»Ich darf das nicht für mich behalten, es ist zu wichtig, deshalb musst du mir zuhören, Hanns.«
Hanns Lehmann wandte sich von der Kirche ab und ging zum See hinunter. Nichts hatte sich hier seitdem verändert.
Drittes Kapitel
Die kleine Bäckerei an der Hauptstraße zitterte; mitten durch Draaby polterten olivgrüne Fahrzeuge in langen Kolonnen, Lastwagen mit olivgrünen Jungs, die rotwangig und ungewaschen aussahen, gewaltige Lafetten mit Geschützen, dazwischen Geländewagen mit ganz ernsten, olivgrünen Offizieren. Hedvigs Augen folgten dem Bataillon, sie genoss das erhebende Schauspiel, dann seufzte sie tief und wandte sich wieder ihrer Geldtasche zu, aus der sie gerade zwei Kronen für den unvermeidlichen, täglichen Kranzkuchen fingern wollte.
In diesem Augenblick flog die Tür auf, ein stürmischer Kanonier rempelte sie an, Tasche und Geldstück fielen zu Boden. Kaum dass sich die Ordonnanz entschuldigt hatte, war sie auch schon wieder draußen, bewaffnet mit mehreren Kuchenstangen und einer Tüte voller Rundstücke. Hedvig sah noch das schwarze Barrett, die hochroten Ohren, die wasserhellen Augen vor sich, als der Soldat Geld und Tasche wieder aufgehoben hatte; sie lachte.
»Unsere Jungs!«, sagte sie, und noch einmal: »Unsere Jungs!«
Der olivgrüne Jeep war der Kolonne nachgebraust; vom Ende des Ortes, wo die Straße aus dem bewaldeten Tal hinaufsteigt auf die lehmigen, beackerten Höhen, hörte man noch das Rumpeln und Dröhnen des Militärkonvois.
Sie sagte: »Es gibt mir immer ein sicheres Gefühl, wenn ich unsere Armee sehe«, und sie sagte es ohne jede Ironie. Die Konditorfrau beeilte sich, etwas Passendes zu erwidern. »Sie können sich doch selbst schützen, Frau Brodersen, wo Sie schon so lange in der Heimwehr sind!«
Hedvig sagte stolz: »Das will ich wohl meinen!« Aber sie fühlte, man könnte diese Bemerkung nicht allein stehenlassen, auch sei der Eindruck falsch, die Heimwehr könnte das Land ausreichend verteidigen, und um nicht etwas Politisches sagen zu müssen, meinte sie unvermittelt: »Am schönsten sind immer unsere Gymnastikabende.«
Doch die Konditorfrau sagte eifrig: »Mein Mann war damals auch Soldat. Damals.«
Hedvig bekräftigte: »Wir würden die Deutschen nicht noch einmal in unser Land lassen.«
Die Konditorfrau schob mit Bedacht die Registrierkasse zu, so als ob die fremden Besatzungstruppen schon unmittelbar vor Draaby stünden, dann sagte sie langsam: »Wir sind doch heute Partner der Deutschen! Nein, nein, Frau Brodersen, der Russe ist es, vor dem wir uns schützen müssen.«
»Jaja«, sagte Hedvig unbehaglich, »das ist Politik, davon verstehe ich nichts, aber als die Deutschen hier gehaust haben, darüber weiß ich genug, und deshalb steht bei mir zu Hause das Gewehr im Schrank.«
Hedvig Brodersen hatte die Besatzungszeit als junges Mädchen erlebt, die Furcht ihrer Eltern, den drei behüteten Töchtern könnte etwas zustoßen, hatte sich auf sie übertragen, und als tatsächlich ihre älteste Schwester mit einem deutschen Offizier auf und davon ging, verwirrten Furcht und Hass die Familie völlig. Für ihren Vater, einen treuen, dänischen Beamten, der stets zu Königs Geburtstag und anderen hohen Festlichkeiten ging und die stolze Vergangenheit des Herrscherhauses beschwor, hatte der Deutsche die Tochter vergewaltigt, eingeschüchtert und verschleppt. Hedvig erinnerte sich zwar, ihre Schwester Margret habe gestanden, sie liebte diesen Mann und wollte ihm ins ferne Rheinland folgen, sobald der Krieg vorüber sei, aber für den Vater war jeder Deutsche ein Nazi, und besonders die Deutschen in Uniform.
Von Margret wurde fortan nicht oder wie von einer Toten gesprochen, niemals war sie wieder nach Draaby gekommen, und Hedvig und ihre jüngere Schwester Desiree wagten bald nicht mehr, nach ihr zu fragen. Jahre vergingen, die Welt war längst zwischen den Siegern geteilt, die ersten Deutschen räkelten sich als Touristen an Dänemarks weiten, weißen Stränden, dänische Urlauber reisten über Hamburg in die wärmeren Gebiete der westlichen Welt, doch Hedvigs Vater hörte nie auf, die Verbrechen aufzuzählen, die in ihrem ganzen Ausmaß erst nach der Zerschlagung des Naziregimes in der Welt bekannt geworden waren, er schmückte sie aus mit immer neuen Details, und nie vergaß er dabei die Haltung des Königs zu rühmen.
Überhaupt – wenn über Politik gesprochen wurde, dann über die Taten Christians X., alles andere schien Bagatelle, Firlefanz, Wichtigtuerei von Parteipolitikern, unwürdig der Erörterung im Hause eines Beamten.
Erst als ihr Vater tot war – längst hatte Hedvig den schüchternen Lehrer Brodersen geheiratet –, erfuhr sie von ihrer Mutter, Margret habe ihr hin und wieder heimlich geschrieben, es ginge ihr gut, sie habe Zwillinge, Peer und Lars, aber selbst zu Vaters Beerdigung habe sie sich nicht mehr nach Draaby gewagt – der Leute wegen, und das sei ja wohl verständlich. Nun drängte Hedvig ihren Mann, Margret zu besuchen, in dieses unaussprechliche Duisburg zu reisen, sie meinte, die Familie habe etwas wiedergutzumachen, nicht länger dürfe sich Margret als Verfemte fühlen. Trotz ihrer großen Furcht, in Deutschland könne ihr Böses zustoßen, müsse sie nun endlich diese Reise wagen, Einar würde sie schon ritterlich beschützen. Doch er bat immer wieder um Aufschub, seine Studien, seine Schriften, seine Lehramtsvorbereitungen, seine Seminare, alles unabweisbare Gründe, gerade jetzt nicht zu reisen, und schließlich verschanzte ersieh immer häufiger hinter der Behauptung, Reisen sei überhaupt etwas für dumme, unerfüllte Menschen, die nur auf der Flucht vor sich selbst seien, für Arbeit wie für Urlaub sei Draaby der einzig richtige Platz auf der Welt.
Im Laufe der Jahre verblasste Margrets Bild zur Phantasmagorie, es gab keine Briefe mehr, die Schwester war in einem finsteren Land lebendig begraben.
Hedvig gab es auf, Einar zu einer Reise zu bewegen, aber allein brachte sie den Mut nicht auf, in Krusaa die Grenze zu überqueren, dorthin, woher einst die Faschisten gekommen waren, und wo nun wieder – wie man hören konnte – Polizeistiefel und staatliche Lauscherei, Bespitzelung und Drangsalierung herrschten. Hedvig verstand inzwischen ausreichend Deutsch; dank des viel verlockenderen Fernsehprogramms von Flensburger Sendemasten hatte sich die Sprache mehr und mehr ins Land geschlichen, aber dieses Fernsehprogramm lieferte auch neue Erkenntnisse über das mächtige, gewalttätige Nachbarland, erschreckend, wie sie es von ihrem Vater gehört hatte.
Die Konditorfrau sagte bewundernd: »Niemals hätte ich ein Gewehr in die Hand nehmen können.«
»Wir müssen alle gut zusammenhalten, nicht wahr?«, entgegnete Hedvig und merkte, dass ihr Vater diesen Satz oft gesagt hatte.
Mit freundlichen Dankesbezeugungen, die sich im Dänischen wie eine wahre Salve von Tak, tak, tak anhören, verließ sie den Laden und folgte dem längst entschwundenen Bataillon, die Straße hinunter bis zur Biegung, wo sie vor Lindstroms butzigem Ladenfenster stehen blieb. Hier hatte sie schon als Kind ihre Nase plattgedrückt, denn Vater Lindstrom verkaufte seit Noahs Zeiten Malstifte und Buntpapier, Ankleidepüppchen und Märchenbücher, Ansichtskarten, Zeitungen und Magazine, er war ihr Hans Christian Andersen und ihr Sankt Nikolaus. Sie trat ein und griff die bunten Prospekte, da hörte sie seine Fistelstimme vom Nebenzimmer: »Was soll’s denn diesmal sein, Hedvig?«
»Westdeutschland. Frankreich.«
Er legte noch einen knallroten Bilderbogen obendrauf.
»Spanien«, schmunzelte der alte Mann.
Viertes Kapitel
GEHEIM!
Berlin/Hauptstadt der DDR
20. August 1983
Abwehrstelle
B. Nr. 664/83
5. Ausfertigungen
1. Ausfertigung
Geheime Kommandosache
Betr. Erster zusammenfassender Bericht über Einar Brodersen, Draaby/Dänemark.
Bez. Versuchsreihe 13/2/84 Funktelepathie Prof. Oberstlt. Tscherengoff, FS Kosmonaut Juri Gagarin.
Einar Brodersen, geb. 21. 06. 1923 in Ebeltoft, einziges Kind des Schiffszimmermanns Ragnar Brodersen. Der Vater ist 1962 in Ebeltoft gestorben, auch die Mutter lebt nicht mehr. Die uns bekannte Lea Preskott geb. Brodersen ist offenbar die einzige lebende Verwandte Brodersens. Nach Angaben unserer Abwehrstelle 23 ist Lea mit dem NASA-Techniker Harry L. Preskott, Houston/Texas (USA), verheiratet.
Brodersen wuchs in einfachen Verhältnissen auf. Seine Lehrer wurden früh auf ihn aufmerksam, weil er außerordentlich fleißig und wissensdurstig war. Lehrer Jensen, Rugaardvej 21, Ebeltoft, erinnerte sich besonders gut an diesen Schüler, dessen mathematische und philosophische Begabung weit über dem Durchschnitt liegen sollen. Brodersen äußerte früh den Wunsch, selbst Lehrer zu werden, und wurde von Jensen an die Universität Aarhus vermittelt.
Während des Studiums ging Brodersen als Freiwilliger nach England, um gegen die deutsche Besatzungsmacht in seiner Heimat zu kämpfen. Nachweislich wurde er dort zum Agenten und Untergrundkämpfer ausgebildet, kam aber – wie wir von einem seiner Kameraden erfuhren – nicht zum Einsatz. Nach Dänemark zurückgekehrt, wurde er 1946 Lehrer in Draaby. In diesem Jahr reiste er in die USA; dies blieb seine einzige Reise. Unsere Abwehrstelle 23 bestätigte seinen Aufenthalt bei Preskott in Houston/Texas (USA). Danach hielt er sich ausschließlich in Draaby auf, heiratete die am 01. 02. 1925 geborene Hedvig, zweite Tochter des dänischen Postbeamten Madsen, gestorben 1955, und ließ sich in der Wohnung des Schulhauses nieder.
Brodersen wurde von verschiedenen Kontaktpersonen als reizbar und nervös geschildert. Erste Hinweise, er sei ein versponnener und deshalb unzuverlässiger Typ, wurden nicht erhärtet. Im Gegenteil, unsere Beobachtungen lassen den Schluss zu, dass er mit äußerst geschickter Tarnung klar formulierte Ziele seiner Auftraggeber verfolgt. Brodersen hockt lange Nachmittage und Abende in seiner Hütte, die unmittelbar auf der Steilküste des Molslandes über der internationalen Kattegat-Seeschifffahrtsstraße liegt. Es handelt sich um ein festes Holzhaus, beheizbar und durch zwei Schlösser gesichert, in dem amerikanische elektronische Geräte neuester Bauart aufgestellt sind. Leider ist es uns bisher nicht gelungen, die Kontaktstellen des Funkverkehrs ausfindig zu machen. Die Hütte ist außerdem mit einem Tisch, einem Schrank, einem Bett, einem Kocher mit Propangas und einem Kühlschrank ausgestattet, sodass Brodersen ohne weiteres längere Zeit darin zubringen kann.
Wir stellten bisher zwei Besucher fest, die häufiger und dann für Stunden bei Brodersen in der Hütte zu Gast waren. Besucherin Nr. 1 ist die jetzt 19jährige Dorte Jacobsen, wohnhaft im benachbarten Ort Holme. Dorte ist eine Schülerin Brodersens, seit ihrer Schulentlassung hilft sie im elterlichen Haushalt. Uns wurde von einem Informanten die Vermutung zugetragen, die Beziehungen Brodersens zu Dorte seien unsittlich, aber von den Eltern ebenso wie von Frau Brodersen geduldet. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass Frau Brodersen die Hütte ihres Mannes noch niemals besucht haben soll. Seit etwa vier Jahren ist Dorte Jacobsen Mitglied eines spiritistischen Zirkels, den Brodersen vor längerer Zeit in Aarhus gegründet und später nach Draaby verlegt hat. Die Eltern Dortes, Besitzer einer landwirtschaftlichen Vollstelle in der Kommune Holme, haben Brodersens Einfluss auf das Mädchen offenbar stets als Ehre für die ganze Familie betrachtet. Von Spiritismus verstehen sie nichts.
Besucher Nr. 2 ist Professor Hanns Lehmann, Ordinarius für Parapsychologie an der Universität Aarhus. Lehmann ist für uns die wichtigste Schlüsselfigur. Wir erhielten den ersten Hinweis auf Brodersen vom Genossen Pjetschoff, der routinemäßig den Lehrkörper der Universität Aarhus überprüfte. Lehmann ist regelmäßig Teilnehmer parapsychologischer Kongresse. Wegen der neuen Versuchsreihe 13/2/84 haben wir Lehmann besonders überwacht. Das Gutachten über seine bisherigen Publikationen steht noch aus. Nach dem ersten Bericht Pjetschoffs (Nr. 592/82) hat sich Lehmann bisher hauptsächlich mit quantitativen Messungen telepathischer Vorgänge beschäftigt. Eine Zusammenarbeit mit amerikanischen oder britischen Dienststellen der NATO konnte nicht nachgewiesen werden. Trotzdem bestätigen seine Kontakte zu Brodersen den dringenden Spionageverdacht, zumal Lehmann mehrmals im Jahr nach England und in die USA reist, während Brodersen Draaby niemals verlässt.
Weitere Berichte folgen.
Iswolski
»Was sollen die vielen Vermutungen!«, sagte Tscherengoff geringschätzig, »in dem Papier steht nichts weiter drin, als dass ein verrückter dänischer Lehrer okkulte Sitzungen abhält.« Er sagte mit Absicht okkult, um deutlich zu machen, dass er die Niederschrift für das Machwerk eines Dummkopfs hielt. Dann zuckte er die Achseln, sagte: »Nun, wennschon!«, und starrte dem bleichen, schmallippigen Abwehroffizier böse in die Augen. »Ist das alles, was Ihre Leute zustande bringen, Genosse Oberst? Wer ist denn dieser Iswolski, der Ihnen drei Seiten Dichtung als Wahrheit abliefert?«
In dem Raum war es stickig. Der Mann hinter dem Schreibtisch wischte sich mit einem Taschentuch über den schweißnassen Kragen.
»Er ist zuverlässig, der Iswolski«, sagte er hilflos, »doch, doch, zuverlässig ist er.«
Tscherengoff legte die Papiere achtlos auf den Schreibtisch zurück und verließ mit einem Grunzen das Zimmer.
Fünftes Kapitel
Die dänische Halbinsel Djursland reckt sich wie ein schützender Arm über die einzige große Stadt, die das anspruchsvolle und eifersüchtige Kopenhagen neben sich duldet: Aarhus, im Mittelpunkt des heutigen Königreiches und doch hoffnungslos abseits in der Provinz gelegen, der Stolz handeltreibender, produzierender und kulturpflegender dänischer Bürger, die sich des Abends die vorgewärmten Hausschuhe anziehen, gemächlich an ihrer Pfeife saugen und durch Butzenscheiben auf die lieblichen Buchten hinausschauen, die die untergehende Sonne rosa färbt.
Lieblich ist auch das Hügelland ringsumher, die Wälder, Moore und Seen, die vielen kleinen Ortschaften, die alle so aussehen, als ob sie nur zur Sommerfrische aufgestellt worden wären. Der südliche Zipfel des Djurslandes, der sich mit sandigen Halbinseln vor den Hafen von Aarhus legte und ihn so schon seit vielen Jahrhunderten zu einem willkommenen Zufluchtsort für Seefahrer werden ließ, ist besonders gut bestückt mit diesen Ferienhäusern, der Strand ist nah, friedlich die See, und an den vielen kleinen Binnengewässern lassen sich blaue Forellen angeln. Wenn es die Sonne gut meint mit den Urlaubern, steigt der warme Duft aus den Kiefernwäldern, an den zahlreichen Kiosken gibt es Hot-Dogs mit Ketchup und gerösteten Zwiebeln, und unter all die Behaglichkeit mischt sich vom Meer her der Geruch von Seetang, Schweröl und verendeten Quallen. Aber die Sonne meint es nicht allzu häufig so gut, öfter als es den devisenbringenden Fremden lieb ist, weicht ein sanfter Regen die Waldwege auf, schwemmt den Würstchenduft über den spiegelnden Straßenasphalt und begräbt gnädig die Quallen am Strand. Dann nicken die Dänen bedächtig mit den Köpfen, es ist schon recht, wie es der liebe Gott eingerichtet hat, und wenn die Regenwolken nach Schweden weitergezogen sind, wird auch die Sonne wieder scheinen, und wenn morgen nicht, dann vielleicht nächste Woche. Das hat alles seine Ordnung wie die täglichen Fährschifffahrten nach Samso und Kalundborg, nach Horten und Oslo, und es behindert in keiner Weise das Geschäftsleben.