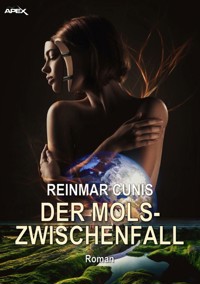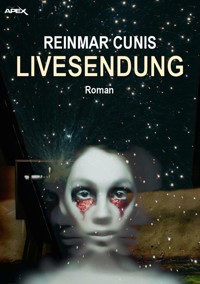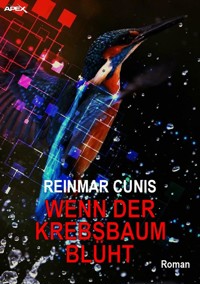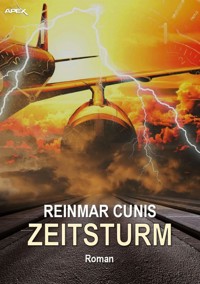
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
An der französischen Atlantik-Küste stürzt ein Jumbo-Jet der Lufthansa ab. 398 Passagiere und 11 Besatzungsmitglieder kommen bei diesem Absturz ums Leben. Fünf Passagiere entgehen wie durch ein Wunder der Katastrophe.
Zu den fünf Geretteten gehört Mello Kramer: 36 Jahre alt, Spezialist für Fernsehtechnik. Er hat schwere Verbrennungen davongetragen. Als er im Hospital erwacht, schießen ihm Erinnerungen durch den Kopf, die unmöglich seine Erinnerungen sein können - es sind Erinnerungen an die Zukunft.
Und plötzlich stellen sich merkwürdige Besucher ein, die er nicht kennt, die ihn jedoch sehr genau zu kennen scheinen...
Der Roman Zeitsturm von Reinmar Cunis (* 8. August 1933 in Bremen; † 16. April 1989) erschien erstmals im Jahre 1979 und gilt als moderner Klassiker der Science- Fiction-Literatur aus Deutschland.
Der Apex-Verlag veröffentlicht diesen Roman als durchgesehene Neuausgabe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Reinmar Cunis
ZEITSTURM
Roman
Apex-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
Der Autor
ZEITSTURM
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Zwanzigstes Kapitel
Einundzwanzigstes Kapitel
Zweiundzwanzigstes Kapitel
Dreiundzwanzigstes Kapitel
Vierundzwanzigstes Kapitel
Fünfundzwanzigstes Kapitel
Sechsundzwanzigstes Kapitel
Siebenundzwanzigstes Kapitel
Achtundzwanzigstes Kapitel
Neunundzwanzigstes Kapitel
Dreißigstes Kapitel
Einunddreißigstes Kapitel
Zweiunddreißigstes Kapitel
Dreiunddreißigstes Kapitel
Vierunddreißigstes Kapitel
Fünfunddreißigstes Kapitel
Sechsunddreißigstes Kapitel
Siebenunddreißigstes Kapitel
Achtunddreißigstes Kapitel
Neununddreißigstes Kapitel
Vierzigstes Kapitel
Einundvierzigstes Kapitel
Zweiundvierzigstes Kapitel
Dreiundvierzigstes Kapitel
Vierundvierzigstes Kapitel
Fünfundvierzigstes Kapitel
Sechsundvierzigstes Kapitel
Das Buch
An der französischen Atlantik-Küste stürzt ein Jumbo-Jet der Lufthansa ab. 398 Passagiere und 11 Besatzungsmitglieder kommen bei diesem Absturz ums Leben. Fünf Passagiere entgehen wie durch ein Wunder der Katastrophe.
Zu den fünf Geretteten gehört Mello Kramer: 36 Jahre alt, Spezialist für Fernsehtechnik. Er hat schwere Verbrennungen davongetragen. Als er im Hospital erwacht, schießen ihm Erinnerungen durch den Kopf, die unmöglich seine Erinnerungen sein können - es sind Erinnerungen an die Zukunft.
Und plötzlich stellen sich merkwürdige Besucher ein, die er nicht kennt, die ihn jedoch sehr genau zu kennen scheinen...
Der Roman Zeitsturm von Reinmar Cunis (* 8. August 1933 in Bremen; † 16. April 1989) erschien erstmals im Jahre 1979 und gilt als moderner Klassiker der Science- Fiction-Literatur aus Deutschland.
Der Apex-Verlag veröffentlicht diesen Roman als durchgesehene Neuausgabe.
Der Autor
Reinmar Cunis (* 08. August 1933, † 16. April 1989).
Reinmar Cunis war ein deutscher Soziologe, Journalist und Autor von Science-Fiction-Romanen.
Geboren in Bremen, absolvierte Cunis eine Banklehre, studierte anschließend in Berlin und Köln Soziologie, Psychologie und Wirtschaftswissenschaften. Er promovierte im Jahre 1964 mit einer Arbeit in Soziologie über künftige Militärverfassungen in demokratischen Industriestaaten und arbeitete beim NDR.
Mit 17 Jahren veröffentlichte er seine erste Kurzgeschichte und schrieb anschließend für Zeitungen und Zeitschriften. Im Jahre 1966 schließlich wurde sein erstes Hörbild Alpträume und Wunschbilder im NDR-Rundfunk ausgestrahlt.
Reinmar Cunis drehte auch Fernseh-Reportagen zu wirtschafts- und sozialpolitischen Themen und war überdies einige Jahre Projektgruppenleiter bei der Fernsehspielabteilung des Norddeutschen Rundfunks.
Sein erster Science-Fiction-Roman Livesendung erschien 1978. In ihm geht es um den Besuch eines Außerirdischen, der allerdings von der betriebsblinden Presse nicht wahrgenommen wird. Cunis' zweiter Roman Zeitsturm wurde im Jahre 1979 veröffentlicht: Er befasst sich mit dem Thema Zeitreise mittels Drogen und ist vom Werk so unterschiedlicher Autoren wie Philip K. Dick und J. G. Ballard beeinflusst.
Zu Reinmar Cunis' Lieblingsthemen gehörten außersinnliche Wahrnehmungen, Teleportation, psychedelische Drogen, Psi-Phänomene und Leben nach dem Tod.
Als seine herausragendsten Werke gelten Am Ende eines Alltags (1982), eine Sammlung von Kurzgeschichten, sowie der Roman Wenn der Krebsbaum blüht (1987).
Für die Kurzgeschichte Polarlicht wurde er 1986 mit dem Kurd-Laßwitz-Preis ausgezeichnet.
Der Apex-Verlag widmet Reinmar Cunis eine umfangreiche Werkausgabe.
ZEITSTURM
Erstes Kapitel
Die wirren Träume ließen ihn auch nicht los, als er aufwachte. Noch immer umgaben ihn Stille und Dunkelheit. Schweigen, das in den Ohren dröhnte, Finsternis, in der die Adern glühten. Pulsierender Schmerz machte sich breit und ließ ihn an den Rand der Ohnmacht zurücksinken. Er fiel durch kalte und heiße Luftschichten, glitt in öliges Wasser. Die sprühende Kühle der Wolken, der schwere Mantel des Regens, Schaumkronen, brennendes Meerwasser, das alles lief ab wie ein Stummfilm, ihm über den Kopf gestülpt, immer wieder beginnend, es gab kein Ende, kein Entrinnen, die Nacht, die ihn umgab, war vollständig.
Er wollte die Hände heben und an seinen Kopf greifen, aber da waren keine Hände, er wusste nicht einmal, ob sein Körper noch da war, er spürte ihn nicht, es war, als ob sein Gehirn allein sei mit den toten Ausgängen, die einmal Augen, Ohren, Nase und Mund gewesen waren. Kaum war ihm sein Wachsein bewusst geworden, sehnte er sich nach dem Zustand des Träumens zurück, nach dem sanften Schweben und Gleiten durch graue, blaue, weiße und grüne Schichten, nach dem Knistern und Prasseln, das in ihm gelärmt hatte. Die langsam, unablässig mahlende Zentrifuge in seinem Innern spülte Erinnerungsfetzen herauf, die ihm nichts sagten, die keinen Anhaltspunkt boten für sein schwebendes, körperloses, schmerzerfülltes Dasein. Aber diese zusammenhängenden Wörter waren kein Traum mehr, von Sekunde zu Sekunde wurde ihm deutlicher, dass es ihn gab, und doch gab es nichts um ihn herum und nichts in ihm selbst, die Vergangenheit brachte kein Erkennen und die Gegenwart keine Erinnerung.
Piptadenia Peregrina, schoss es ihm durch den Kopf, aber was war das? Ein Name? Er selbst? Eine Landschaft, aus der er stammte? Jetzt formten sich aus dem stetigen Kreisel in ihm Gesichter, ein blonder, kräftiger junger Mann, ein schmales, langhaariges Mädchen. War Piptadenia Peregrina der Name des Mädchens? Der blonde Mann, war er das selbst? Der Schmerz machte es unmöglich, eine Antwort zu finden, schon drängten sich gänzlich unverständliche Zahlen- und Wortkombinationen nach vorn, 4 – Poryloxy N, N Poryloxy 4, N, ich denke Dinge, die nicht sind, versuchte er seine Vernunft anzuregen, aber das alles schien ihm nicht unvernünftig, seinen Gedanken fehlte auch dieser Maßstab.
Ich bin noch nicht geboren, dachte er, die pulsierende Dunkelheit, die schwimmende Stille, die steuerlose Unbeweglichkeit, ich werde das Licht der Welt erst noch sehen. Jäh stieg ein anderer Gedanke auf: Ich bin tot, die Welt hält mich nicht mehr fest, aus meinem Grab wächst Piptadenia Peregrina.
Da war wieder dieser Name. Nicht mehr das Mädchen, eine Pflanze. Ja, dachte das Gehirn und forschte nach dem Körper, den es nicht spürte, ich nähre eine Pflanze, der Mann, der ich war, ist zur Erde zurückgekehrt. Die dröhnende Finsternis, die grüne Luft, das stechende Wasser, Stationen einer Heimkehr. Wenn das die Vergangenheit war, was war dann jetzt? Konnte man tot sein und doch leben? Zeit, die nebeneinander existierte, gab es das wie die Räume, durch die er geschwebt war? Das Gehirn bejahte diese Fragen, noch während sie sich formten, Spritzer der Erinnerung, die aus dem toten Körper dunsteten. Das langhaarige Mädchen, erinnerte sich dieser Dunst: Sie war lang und dünn, so wie die Haare waren, wie Regenfäden hing es an ihr herab, ihre großen Augen schwebten über der Treppe, und der Dunst stieg zu ihnen auf.
Er schien wieder zu träumen, der Schmerz in seinem Gehirn verebbte, umso deutlicher ließ der Schlaf die Erinnerung werden. Der Gedanke an den prallen Körper, die weichen, runden Brüste wurde mächtiger. Ihr Bauch war nass und warm, ich schwimme darin, dachte das dünstende Gehirn. Ich werde erst leben, meine Augen sehen noch nicht, meine Lunge atmet noch nicht, um mich selbst zu spüren, fehlt mir noch der Geburtsschock. Erst wenn die Luft in mich einströmt, werden meine Hände greifen und meine Blicke tasten können. Die Brüste, eingerahmt von den langen Haaren, werde ich noch erst schmecken, sie bergen das Leben, das jetzt nicht in mir ist.
Piptadenia Peregrina, sagt eine Stimme seufzend, erschreckt stellte er fest, dass es nicht seine eigene ist, die er in seinem Gehirn hört. Eisiger Schmerz springt auf, krampfhaft zuckt das Gehirn zusammen, die Stimme zerschneidet die Träume wie Blitzlicht die Dunkelheit.
Was sagen Sie?, will er fragen, aber er hat keine Sprache, sich auszudrücken, keinen Mund, um es zu formulieren.
Ätwu Miöame, kleckert es in sein Gehirn, Vokale und Konsonanten sinnlos zusammengequirlt.
Ich kann Sie nicht verstehen, ich lebe noch nicht, will er schreien, ich bin tot, einerlei, ob das Leben vor mir liegt oder hinter mir, was ist schon ein Zeitpunkt? Ich kann Sie so wenig begreifen wie mich selbst!
Die eindringliche Stimme kriecht weiter durch sein Trommelfell, ätwu Miöame, ekutema, sagte das langhaarige Mädchen. Dann löscht Schmerz auch diese Empfindung aus.
Zweites Kapitel
»Êtes-vous, Monsieur Kramer?«, wiederholte die Schwester und beugte sich noch tiefer über das Bett des Verletzten. Und dann, mit den Lippen dicht an dem weißen Verband, der Ohren, Augen und Mund des Fremden verbarg, fragte sie: »Écoutez-moi?« Aber es gab keine Reaktion in der reglosen Gestalt.
Prüfend glitt der Blick der Krankenschwester über die leichte Bettdecke, auf der die Arme des Patienten ausgestreckt lagen, vermummt bis zu den Fingerspitzen. Aus dem bandagierten Kopf ragte eine geschiente Nase, fast übergangslos mit einer Kanüle verklebt, ebenso fest mit dem Patienten verbunden führte eine zweite Kanüle unter den Verband des linken Armes. Routiniert verstellte die Schwester das Tropfventil, blickte auf die Uhr über dem Zimmereingang, zögerte einen Moment, bevor sie das Fenster öffnete und den klaren, salzigen Wind hereinließ.
Der Stationsarzt trat ein.
»Unverändert«, sagte sie, »keine Reaktion, offenbar noch immer bewusstlos.«
Der Arzt lächelte, warf einen zustimmenden Blick auf das geöffnete Fenster, sagte:
»Danke, Schwester, Sie müssen hier nicht ununterbrochen wachen, am Zustand des Patienten wird sich in den nächsten Stunden kaum etwas ändern.«
Colette nickte und verließ den kleinen Raum, behutsam schloss sie die Tür hinter sich, obwohl der Patient bisher nicht auf den Staubsauger und schon gar nicht auf ihre eindringlichen Fragen reagiert hatte.
Dr. Claude Meunier blieb mitten im Zimmer stehen, einem Sonderraum der Intensivstation, nahe dem Operationssaal. Das Bett ließ sich leicht durch die Tür schieben, und auch das übrige Mobiliar war nüchtern und praktisch: ein großer Beistelltisch, Armaturen für die unmittelbare Versorgung des Kranken, ein Handwaschbecken, ein flötendünner Spind. Meunier starrte in den Raum, ohne etwas zu sehen, ihn beschäftigte die Frage, warum dieser Mann dort in dem Bett so unanregbar, so verschüttet blieb, obwohl die zahlreichen Verletzungen und Verbrennungen keineswegs das Gehirn in Mitleidenschaft gezogen hatten.
Man müsste ein Fenster zu ihm aufmachen, dachte der Arzt, aber noch liegen nicht alle Tests vor, als dass ich es schon wagen könnte. Ein seltsamer Fall, erregte er sich, seltsam, weil dieser Mann bei der Einlieferung zunächst alle Fragen freimütig beantwortet, seinen Namen jedoch hartnäckig verschwiegen hatte. Er verkrampfte sogar in einer Gedächtnislähmung, die einige Kollegen als erstes Zeichen einer Agonie deuteten. Seltsam auch, weil der Patient nach der mehrstündigen Behandlung der Verletzungen und Verbrennungen pünktlich aus der Narkose wieder aufgewacht war, kaum hatte Meunier ihn aber in deutscher Sprache nach seinem Befinden gefragt, fiel er schockartig in Bewusstlosigkeit zurück. Zugegeben, nickte der Arzt in sich hinein, dieser Mann war von den fünf Überlebenden der am schwersten verletzte, aber sein Kopf wies neben dem Nasenbeinbruch und zahlreichen kleineren Verbrennungen keine Schlagwunden oder Brüche auf, die auf eine ernste Gefährdung des Gehirns schließen lassen mussten. Selbst die Beeinträchtigung der Augen erklärte die Reaktion nicht. Traumatisch, dachte Meunier, die Bewusstlosigkeit war traumatisch, der Mann hatte kurz vor oder während des Absturzes etwas erlebt, das er zu verbergen suchte!
Der Arzt schüttelte seinen voranhängenden, mit schwarzen Locken zugewachsenen Kopf, wandte den Blick von den schroffen, meterhohen Felsen, um die sich die stetigen Wellen des Atlantiks kräuselten, und ärgerte sich, dass er wieder und wieder auf den karg bewachsenen Vorsprung gestarrt hatte, der dort draußen hoch über dem Meer zum Ziel seines täglichen Spazierganges geworden war. Du träumst, Claude, sagte er, hier ist die Unfallstation und nicht die Psychiatrie. Halte deinen Mund, sonst kannst du die Koffer sofort packen.
Ohne den Patienten noch einmal anzusehen, verließ er schnell den Raum, heftig schloss er die Tür hinter sich, der Luftzug wehte die Zeitung der Schwester vom Tisch herab, das Regionalblatt für Auray und Umgebung, mit der reißerischen Fünfspaltenüberschrift: Fünf überlebten die Hölle auf dem Meer.
Darunter im braven, mickrig-faden Nachrichtenteil:
Auray, 3. Juli (eig. Bericht). Nach letzten Angaben der Deutschen Lufthansa sind 398 Passagiere und 11 Besatzungsmitglieder bei dem Unglück ums Leben gekommen, das sich gestern in den frühen Morgenstunden vor der Wilden Küste der Quiberon-Halbinsel ereignet hatte. Aus bisher ungeklärter Ursache stürzte das Linienflugzeug vom Typ Boeing 747 B im dichten Nebel ab, nachdem beide Tragflächen Feuer gefangen hatten. Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr von Quiberon und Fischer konnten fünf Überlebende aus dem brennenden Treibstoff retten, der sich auf dem Meer ausgebreitet hatte. Wie durch ein Wunder blieben vier nur leicht verletzt, der fünfte Passagier erlitt schwere Verbrennungen. Die später eintreffenden Rettungsmannschaften, unterstützt von Spezialisten aus Brest, konnten weitere Flugzeuginsassen nur noch tot bergen. Marcel Jeudi, der mit seinem Fischerboot als erster an der Unfallstelle war und zwei Überlebende an Bord nahm, soll morgen vom Maire Godard eine Belobigung erhalten.
Bei den Toten handelt es sich vorwiegend um Bürger der Bundesrepublik Deutschland, außerdem sollen vierzehn Amerikaner, drei Kanadier und zwei Brasilianer an Bord gewesen sein. Entgegen ersten Meldungen waren keine Franzosen unter den Passagieren. Heute Nachmittag treffen Fachleute aus Paris, eine deutsche Expertengruppe aus Hamburg und verantwortliche Ingenieure der Herstellerfirma aus Seattle in Brest ein, von wo aus sie sich an die Unglücksstelle begeben wollen. Die Unfallspezialisten werden im repräsentativen Hotel Sofitel wohnen.
Die Bürger von Quiberon und Umgebung werden gebeten, die bereits begonnenen Bergungsarbeiten nicht zu behindern, das betroffene Gebiet an der Wilden Küste nicht zu betreten und auch mit Booten nicht in die von der Wasserschutzpolizei abgeriegelte Region zwischen der Belle Ile und der Côte Sauvage zu fahren.
Drittes Kapitel
Das gleichförmige Brausen in seinem Kopf schwoll auf und ab, vom Beginn seiner Tage an bis in alle Zukunft, auswechselbar wie die Zeit und immer gleich. Die Augenblicke des Hebens und des Senkens knüpften nicht aneinander an, sie waren gleichzeitig und in der Zukunft ebenso wie in der Vergangenheit, die Gegenwart war weggewischt.
Während in ihm das Bewusstsein langsam das Träumen verdrängte, wurde das Brausen quälender, impulsiv wollte er sich die Ohren zuhalten, doch dann erinnerte er sich, dass da keine Ohren waren und keine Hände, um sie darauf zu pressen.
Aber das Brausen kommt von außen, dachte er trotzig, es dringt in meinen Kopf ein, ist nicht Bestandteil meines zeitlosen Seins, nicht Ewigkeit, die in mir pulsiert, es ist irdisch und gegenwärtig. Trotz der wehen Dunkelheit, die ihn umgab, trotz der Unbeweglichkeit seines Körpers konnte er plötzlich das Brausen räumlich empfinden, als ein fernes Rauschen wie an einer Meeresküste. Meer, dachte er. Das brach herauf aus seiner zerstückelten Erinnerung, schob sich nach oben in amorphen Brocken, grau, feucht, weit, kalt, wogend, wie wabernder Beton. Ein Steinfeld, in dem hie und da Lämpchen aufglühten, dann wieder eine Nebelwand, schwammartig klebte sie an ihm, türmte sich auf, färbte sich rot, glühte und sprühte wie zuckendes Licht. Über der weiten, nassen Betonfläche leuchteten rote Buchstaben, formten ein Wort, das er kannte, aber nicht wissen wollte, spiegelten sich in der hohen Glasfassade des Gebäudes wider, vor dem sie standen, und verloren sich schließlich auf dem regenüberschwemmten Beton des Rollfeldes. Auch die Zubringerbusse waren rot, rote Punkte hockten auf den Mastspitzen, auf dem oberen Sims des Abfertigungsgebäudes, auf den nass und schwarz wartenden Flugzeugen am Rande der Startbahn. Dann zerschnitten dröhnende Linien diesen Erinnerungsfetzen, wie Eisschollen schoben sie sich übereinander, untereinander, drückten in sein Gehirn und machten es zu einer schweren, aufgeblasenen Rettungsweste.
Rettungsweste! Das zuckte wieder in ihm auf, unförmig wie die rote Rettungsweste, dachte er, die sich um ihn breitmachte, während die roten Punkte draußen vor dem Fenster immer mehr wurden, durch den schleimigen Nebel sprangen, über den Sitzen aufleuchteten: Fasten Seat Belt, ABC.
»Kein Grund zur Beunruhigung«, sagte die schlanke Stewardess mit ihrem roten Mund, »wir haben einen kleinen Fire Trouble im Triebwerk. Kein Grund zur Beunruhigung. Wir bitten Sie, sich ruhig zu verhalten und den Anordnungen des Kapitäns Folge zu leisten.«
Groß und schlank steht sie da, etwas blass in ihrem schlanken Gesicht, von der sorgfältig hochgesteckten Frisur hängen lange schlanke Strähnen herab, kerzengrade steht sie da, während sich der Boden des Flugzeuges immer stärker nach vorn neigt, kaum kann sie sich noch auf den Beinen halten, aber ihre Strähnen hängen schlank herab.
»Du hast keine Schuld«, sagt sie und schlägt die Augen zu ihm auf, und in den Augen spiegelt sich die rote Leuchtbuchstabenzeile auf dem Abfertigungsgebäude, Nebel schwimmt in ihrem Blick, als sie wiederholt: »Du hast keine Schuld. Sie hätten dich nie in diese Situation treiben dürfen.«
»Sie müssen verstehen, dass wir Sie nicht länger hierbehalten können«, sagt der elegante, grauhaarige Herr, und der Nebel senkt sich in seinen Blick, »diese unglaubliche Angelegenheit muss bereinigt werden, es darf kein Schatten mehr zwischen den Firmen stehen.«
»Du kannst doch nicht von mir verlangen, dass ich dir das Patent ausliefere«, sagte er selbst, und noch einmal, dröhnend wie durch den Ansagelautsprecher, über den die Stimme des Flugkapitäns herabfällt: »Du kannst doch nicht von mir verlangen, dass ich dir das Patent ausliefere.«
Aber das Mädchen mit den schlanken, strähnigen Haaren hält ihm den Mund zu.
»Legen Sie mir die Entwicklungszeichnungen auf den Tisch, sodass wir in zwei Jahren serienreif produzieren können.« Der kleine, dickleibige Ulrich scheint zu drohen. »Ich verlange, dass Sie für die Firma arbeiten, die Sie bezahlt, und nicht für Ihre eigenen Hirngespinste! Legen Sie alle die Schwimmwesten an! Folgen Sie den Anordnungen der Stewardessen!«
Einige Passagiere fügen sich nicht, ducken sich nicht unter diese Vorderlehne, sie springen auf, schreien, starren mit schreckensgroßen Augen in den betonierten Nebel.
»Der Schlüssel heißt Piptadenia peregrina. Weißt du, was das ist?«
Der heisere junge Mann hat glühende Augen, in den Pupillen spritzen rote Punkte hin und her.
»Die Entlassung ist endgültig.« Der elegante Herr blickt ihn nicht an. »Verkriechen Sie sich nicht in sich selbst. Sie wissen, dass wir dem Aufsichtsrat einen Mitarbeiter opfern mussten.«
Der kleine, schwarzgekleidete Passagier steht auf seinem Sessel und kreischt.
»Einige müssen sich opfern«, brüllt er mit seiner Falsettstimme, »sie müssen im Heck ein Gegengewicht schaffen! Opfern Sie sich!«
»Sie können doch nicht von mir verlangen, dass ich Ihnen das Patent ausliefere«, antwortet er und starrt die Stewardess an.
»Weißt du, was das ist?«, fragt der heisere junge Mann, dann brechen die roten Punkte aus seinen Augen hervor, die dröhnenden Linien schieben sich wieder durch die Erinnerung, das Metall zerreißt, überall toben die roten Punkte. Es ist spät, zu spät fast, er muss sich losmachen, aber das Mädchen mit den strähnigen Haaren blickt ihn an und lässt ihn nicht gehen. Sie will noch etwas sagen, aber er muss jetzt den Bus besteigen, der ihn zum Flugzeug bringt, er sieht ihre Lippen und kann nicht mehr hören, was sie sagt, weil die vielen Lautsprecher trommeln:
»Letzter Aufruf für Passagier Mello Kramer, gebucht auf LH 326 nach New York, Ausgang A 23.«
»Ich bin nicht Mello Kramer!«, brüllt er gegen die Stimmen an, »Fasten Seat Belt, ABC, leisten Sie den Anordnungen der Stewardessen Folge.«
»Wer sind Sie?«, fragt eine tiefe, sehr sanfte Stimme. Die singendweichen S-Laute schweben dahin, Nebel, Beton, brechendes Metall sind mitgeschwebt, versickert wie die sprühenden roten Punkte. »Können Sie mich hören?«, fragt die Stimme, sehr nah und eindringlich.
Er versucht zu nicken, aber er hat keinen Kopf, mit dem er nicken könnte.
»Ich sehe, Sie hören mich«, sagt der Arzt. »Versuchen Sie noch einmal zu sprechen. Es geht, glauben Sie mir. Sie können sprechen. Sagen Sie mir, wer Sie sind.«
»Piptadenia peregrina«, quillt es aus den aufgesprungenen, verbrannten Lippen des Patienten.
Viertes Kapitel
Ich heiße Kurt Berring, dehnte sich ein Gedanke in seinem Kopf aus, bin 36 Jahre alt, von Beruf Farbfernseh-Spezialist. Wir haben zusammen aus Kieselsteinen Bilderpuzzles gemacht, als wir klein waren, später den Physiklehrer ins Fehlexperiment gelockt, zusammen haben wir in Bochum die Immatrikulation beantragt und hoch über der Innenstadt in einem alten Miethaus bürgerlichen Stils gehaust auf unbürgerliche Art. Der Dachstuhl dieses prächtigen Scheusals, verwinkelt und im Laufe der Jahre knorrig verwachsen wie eine alte Weide, barg mehrere Mansardenzimmer und eine Waschküche. Der findige Hausbesitzer hatte aus dem Waschraum Küche und Bad entstehen lassen und die Zimmer zu kräftigen Preisen an Studenten vermietet, als die Universität ihren Betrieb aufnahm. Seither hatten Generationen von Erstsemestern Einzug gehalten und als Diplomanden oder mit höheren Orden dekoriert den Dachstuhl wieder verlassen, und so – hofften wir – würde es uns auch ergehen. Wir hatten einen Nachbarn – alle drei Zimmer lagen mit ihren Fenstern in einer durchgehenden Mansarde nach Westen –, der aus dem Hannoverschen kam. Trotz seiner heiseren und undeutlichen Aussprache hörte man das vorlaute S heraus, und dann blitzte es jedes Mal in seinen fiebrigen Augen. Udo war ein Alchimist, der auf uns Elektroniker einen bizarren Eindruck machte. Je länger wir mit ihm zusammen waren, desto selbstverständlicher wurden wir in die Welt der Phenylalkylamine und Tryptaminderivate hineingezogen. Es war eine andere Welt als die, die wir normalerweise empfinden, man muss ihrem Zauber widerstehen, denn jedermann weiß, dass der Weg zurück eines Tages versperrt bleibt. Ich hatte Udo zuerst nicht recht ernst genommen, mehr um ihm einen Gefallen zu erweisen, ging ich auf ihn ein. Zugegeben, Doktor, er war süchtig, und die vielen Trips hatten ihren Preis in seine Haut gekratzt. Aber seine genialen Einfälle faszinierten mich mehr und mehr.
Der Patient stockte, die Erinnerung schien ihn an dieser Stelle zu täuschen. Die Versatzstücke des Berichts passten nicht aneinander, aber es gelang ihm nicht zu ergründen, wo der Fehler lag. Obwohl bisher kein einziges Wort über seine verbrannten Lippen gekommen war, glaubte er, dem Arzt zu antworten. Längst waren Stunden vergangen, er lag allein in dem Sonderraum des Krankenhauses von Quiberon. Dr. Meunier zelebrierte jetzt die Visite im linken Flügel des Gebäudes, vergilbten Gesetzen des Spital-Fahrplans folgend. Die Schwester, von Meunier ihrer fortwährenden Anwesenheit entbunden, trank zwei Stockwerke tiefer im Aufenthaltsraum Kaffee. Jetzt lösten sich in dem einsamen Patienten Bruchstücke der Erinnerung, immer größer und zusammenhängender schwappten sie nach oben.
Es war das erste Mal, Doktor, dass mein Schulfreund und ich unterschiedlicher Meinung waren, sowohl über die abstrusen Thesen dieses Drogensüchtigen als auch über die Art und Weise, wie man ihn behandeln müsse. Abende und Nächte verbrachten Udo und er mit Gesprächen, über Fachbücher gekrümmt oder – wie sie es nannten – bei Experimenten, Trips also, die sie gemeinsam machten. Er synthetisierte dem Süchtigen Psilocybin, Sie wissen, was das bedeutet, Doktor, 20 Milligramm Psilocybin reichen für einen mehrstündigen Trip, der den Kopf freilegt und die Wirklichkeit verändert.
Der Patient unterbrach sich, für kurze Zeit lauschte er den Möwen, den fizzligen Wellen und dem Mahlen der Brandung in den kiesgefüllten Felslöchern. Er meinte den Arzt fragen zu hören, das tiefe, stimmhafte S drang in sein Hirn, aber er kniff die Lippen zusammen, weil er fürchtete, zu viel zu sagen. Zwanzig Milligramm Psilocybin, dachte er, das ist ein entscheidender Wert, den ich verschweigen muss, niemand darf auch nur einen einzigen Anhaltspunkt über die Formel erhalten, es wäre eine tödliche Bedrohung für mich.
Der findige Hausbesitzer hatte den knorrigen Dachboden für Studenten ausbauen lassen, begann er mitten in seiner Geschichte noch einmal wie jemand, der wieder und wieder Sätze formuliert, die ungesagt bleiben. Hoch über der Innenstadt, eine unschätzbare Lage für Leute, die dieses Drumherum als notwendig für ihre Selbstverwirklichung bezeichnen, hockten wir beneidet und bewundert von Studienfreunden, die es nicht zu dieser stilechten Kulisse gebracht hatten. Wir saßen oft mit zehn, zwölf Leuten auf Fußböden, Kissen und Matratzen und fühlten uns erhaben wie die Scheiche am Persischen Golf, nur Udo hielt das alles für ekelhaft unemanzipiert. Der Patient war mit der Neufassung seiner Geschichte wesentlich zufriedener, genoss die überlegenen Formulierungen und war nun auch bereit, dem Arzt ein weiteres Stück Erinnerung zu öffnen.
Die einzige, die sich wirklich Mühe gab, Udo von seinem chemischen Irrweg abzubringen, war Kathrin. Ich hatte mich von Udo zurückgezogen, mein Freund nutzte den armen Kerl aus, aber Kathrin versuchte alles, um ihm einen Weg in unsere Welt zurück zu bereiten. Kathrin ist meine Freundin gewesen, Doktor. Ich bin jetzt zehn Jahre älter als zur Dachbodenzeit, der Abstand ist groß genug, um nicht einem Fehlurteil zu erliegen. In diesen Jahren hat sich als wahr erhärtet, dass ich nur sie geliebt habe. Verstehen Sie, Doktor, ich muss das so sachlich sagen, weil mein Bericht unvollständig bliebe ohne diese Erklärung. Sie würden nicht verstehen, wie verzweifelt ich war, als ich erkannte, dass Kathrin das Positive an Udos Experimenten nicht sehen mochte. Es war, als ob jemand von der Heilsarmee einem Brahmanen erklären wollte, dass er auf dem falschen Wege sei. Udo lächelte nur, und wenn sie dann endlich einsah, dass ihre Bemühungen vergeblich waren, zerrte sie mich hinaus und hielt mir einen langen Vortrag, dass ich Udo noch Hilfe leistete, anstatt ihm jede Unterstützung zu verweigern. Worte benutzte sie, die ich sonst nie von ihr zu hören bekam, die sich tief eingruben und noch beim Atemholen verletzten. Dann kam es sogar vor, dass Kurt ihr beipflichtete, seine Vorwürfe wiederholte, und ich wusste mich nicht mehr zu verteidigen.
Wieder stockte der Patient, ihm schien der Faden abhandengekommen, der Bericht verwirrte sich, die Personen, die in seine Erinnerung getreten waren, verschwammen. Er glaubte, erschöpft zurückzusinken, obwohl er die ganze Zeit unbeweglich gelegen hatte, und wie um zu ordnen, was von Minute zu Minute konfuser geriet, murmelte er noch einmal:
»Ich heiße Kurt Berring, bin 36 Jahre alt, von Beruf Farbfernseh-Spezialist. Kathrin ist meine Frau.«
Niemand hörte es.
Fünftes Kapitel
»Bitte beim Chef melden!«, blecherte es aus dem Tischsprechgerät. Er sah das grinsende Gesicht seines Kollegen Hartel vor sich, mit dem er das Büro teilte, und hörte:
»Das lässt sich Ulrich der Kleine nicht nehmen, einem neuen Mitarbeiter den Ritterschlag zu versetzen!«
Dann war er schon auf dem Flur, zog sich die Jacke glatt, sprang in einen Aufzug, um in die oberste Etage zu gleiten. In der metallenen Fahrstuhltür spiegelte sich seine überaus schmale Gestalt, leicht unscharf und von auslaufenden Konturen gerahmt nach Art eines Jugendstilfotos. Die kurzgeschnittenen, kabeldicken, zwischen braun und schwarz schimmernden Haare machten sein Gesicht schmaler, als es war, die lange, kräftig vorspringende Nase und das ebenso kräftige Kinn verstärkten den asketischen Eindruck. Schmal war auch der Körper, den das silbrige Nebelbild reproduzierte, kantig und widerstandsfest wie das Metall der Fahrstuhltür selbst. Für einen ehrgeizigen Augenblick sah er sich in die Ahnengalerie der Großen aufgenommen: Paul Nipkow, John Loggie Baird, Henri le France, Walter Bruch – auch er vielleicht eines Tages einer von denen, die das Fernsehen einen entscheidenden Schritt vorangebracht hatten! Doch bevor er noch darüber lächeln konnte, zerteilte sich sein Bild der Länge nach, die Fahrstuhltür stand offen, er blickte auf die pompös-geschmacklose Möbelausstellung der obersten Etagenhalle.
Ulrich der Kleine, wie der Ingenieur Hartel juxte, Ulrich Hartmann, Vorstandsvorsitzender der Asch-Electronic-Gruppe, residierte wie die meisten reichsunmittelbaren Feudalherren des zwanzigsten Jahrhunderts in einer Dekoration, die aus dem Modediktat führender Raumausstatter und dem Nippesgeschmack seiner elterlichen Wohnküche zu unheilvollen Kombinationen gediehen war. Hartmann gehörte zur Spitze der Deutschen Wirtschaft, behauptete stets, von Politik weder etwas zu verstehen noch sich dort einzumischen, war dessen ungeachtet Mitglied im Vorstand seines Arbeitgeberverbandes und im Bundesvorstand des Verbandes der Deutschen Industrie, Honoratiorenclubs also, die durch schlichte Absprache für Konjunktur und Rezession, Preis-, Gewinn- und Arbeitslosenraten sorgten und so über das Wohl der Lohnabhängigen wachten. Ihm war jede Art von Bundesregierung recht, aber eine rechte war ihm rechter. Das hatte in seinen Augen alles noch gar nichts mit Politik zu tun, denn ihm ging es nur darum, das freie Unternehmertum auch für die Zukunft zu erhalten, denn es hatte doch wohl unbestreitbar Deutschland nach dem Kriege schöner und bedeutender gemacht, als es je zuvor gewesen war.
Dieser Satz war ein Teil seiner Rede, die er Neueingestellten zu halten pflegte, aber die Dramaturgie der Szene geriet in Unordnung, weil dieser junge Mann mit dem Franziskanergesicht einen seltsamen Disput heraufbeschworen hatte.
»Ich habe Ihre Diplomarbeit gelesen, Herr Kramer, meine Anerkennung!« Der Pykniker Hartmann nötigte den überschlanken Ingenieur in einen Sessel. »Nur verstehe ich nicht, warum Sie sich im Vorwort als Biophysiker bezeichnen – sind Sie denn Physiologe?«
Die Frage war als Wortspiel gemeint. Hartmann erwartete keine Antwort, aber er erhielt sie.
»Biophysik betrachte ich wie Biotechnik als Zukunftsaufgabe für jeden Ingenieur in dem Sinne, dass die Einzelvorgänge im menschlichen Organismus Ausgangspunkt und Ziel unserer technischen Entwicklung sein müssen.« Das leere Zitat aus seiner eigenen Arbeit gefiel ihm nicht, deshalb versuchte er, sein Credo etwas reißerischer zu fassen:
»Früher hat sich der Mensch der Technik untergeordnet. Heute sind wir soweit, dass wir die Maschinen in den Dienst des Menschen stellen. In Zukunft dürfen technische Apparate nichts anderes sein als spezialisierte Hilfen menschlicher Funktionsabläufe. Dazu müssen wir noch viel mehr die natürlichen Kräfte im menschlichen Körper erforschen als bisher. Da ich das möchte, nannte ich mich einen Biophysiker.«
Hartmann lachte befangen, verstanden hatte er nichts von dem, was der junge Ingenieur gesagt hatte.
»Bei uns werden Sie wohl mehr Kräfte in einer Farbfernsehröhre erforschen als die im menschlichen Körper. Der menschliche Körper...« – er glaubte einen Scherz von herb-männlicher Burschikosität zu machen – » ist wohl zu anderer Tageszeit und in anderer Umgebung besser zu erforschen.«
Da Hartmann mächtig lachte, fiel ihm nicht auf, dass der Neue verbissen darüber nachsann, wie offen er mit seinem obersten Herrn sprechen dürfte. Er fühlte sich in dieser ungewohnten Umgebung unsicher, deshalb entschied er sich zufällig für das Richtige und lachte einen Schlussakkord lang ehrerbietig mit.
»Aber Sie haben sicher recht!«, gluckste der rundliche Gebieter über 20.000 Arbeitsplätze, »wir müssen die Technik noch menschlicher gestalten, alles muss dem Menschen dienen, so entwickeln wir immer mehr Lebensqualität.«