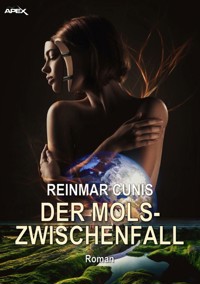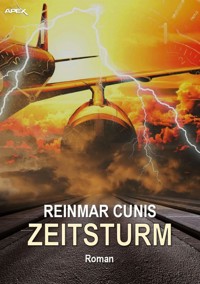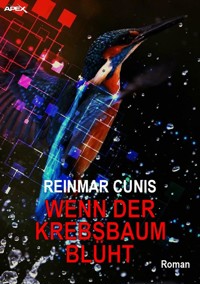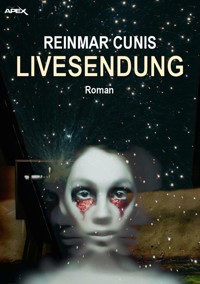
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Fernseh-Starreporter Jochen Berner ist ständig auf der Jagd nach Sensationen. Doch an der fantastischsten Geschichte seines Lebens rennt er blind vorbei. War es nur ein belangloser Kriminalfall, was im neu gegründeten europäischen Raumfahrtzentrum geschah? War es Intrige, Spionage, Landesverrat? Keine Livesendung des Deutschen Fernsehens wird je darüber berichten, was der junge Wissenschaftler Hadrich entdeckte...
Der Roman Livesendung von Reinmar Cunis (* 8. August 1933 in Bremen; † 16. April 1989) erschien erstmals im Jahre 1978 und gilt als moderner Klassiker der Science- Fiction-Literatur aus Deutschland.
Der Apex-Verlag veröffentlicht diesen Roman als durchgesehene Neuausgabe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Reinmar Cunis
LIVESENDUNG
Roman
Apex-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
Der Autor
LIVESENDUNG
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Zwanzigstes Kapitel
Einundzwanzigstes Kapitel
Zweiundzwanzigstes Kapitel
Dreiundzwanzigstes Kapitel
Vierundzwanzigstes Kapitel
Fünfundzwanzigstes Kapitel
Sechsundzwanzigstes Kapitel
Siebenundzwanzigstes Kapitel
Achtundzwanzigstes Kapitel
Neunundzwanzigstes Kapitel
Dreißigstes Kapitel
Einunddreißigstes Kapitel
Zweiunddreißigstes Kapitel
Dreiunddreißigstes Kapitel
Vierunddreißigstes Kapitel
Fünfunddreißigstes Kapitel
Sechsunddreißigstes Kapitel
Siebenunddreißigstes Kapitel
Achtunddreißigstes Kapitel
Neununddreißigstes Kapitel
Vierzigstes Kapitel
Das Buch
Fernseh-Starreporter Jochen Berner ist ständig auf der Jagd nach Sensationen. Doch an der fantastischsten Geschichte seines Lebens rennt er blind vorbei. War es nur ein belangloser Kriminalfall, was im neu gegründeten europäischen Raumfahrtzentrum geschah? War es Intrige, Spionage, Landesverrat? Keine Livesendung des Deutschen Fernsehens wird je darüber berichten, was der junge Wissenschaftler Hadrich entdeckte...
Der Roman Livesendung von Reinmar Cunis (* 8. August 1933 in Bremen; † 16. April 1989) erschien erstmals im Jahre 1978 und gilt als moderner Klassiker der Science- Fiction-Literatur aus Deutschland.
Der Apex-Verlag veröffentlicht diesen Roman als durchgesehene Neuausgabe.
Der Autor
Reinmar Cunis (* 08. August 1933, † 16. April 1989).
Reinmar Cunis war ein deutscher Soziologe, Journalist und Autor von Science-Fiction-Romanen.
Geboren in Bremen, absolvierte Cunis eine Banklehre, studierte anschließend in Berlin und Köln Soziologie, Psychologie und Wirtschaftswissenschaften. Er promovierte im Jahre 1964 mit einer Arbeit in Soziologie über künftige Militärverfassungen in demokratischen Industriestaaten und arbeitete beim NDR.
Mit 17 Jahren veröffentlichte er seine erste Kurzgeschichte und schrieb anschließend für Zeitungen und Zeitschriften. Im Jahre 1966 schließlich wurde sein erstes Hörbild Alpträume und Wunschbilder im NDR-Rundfunk ausgestrahlt.
Reinmar Cunis drehte auch Fernseh-Reportagen zu wirtschafts- und sozialpolitischen Themen und war überdies einige Jahre Projektgruppenleiter bei der Fernsehspielabteilung des Norddeutschen Rundfunks.
Sein erster Science-Fiction-Roman Livesendung erschien 1978. In ihm geht es um den Besuch eines Außerirdischen, der allerdings von der betriebsblinden Presse nicht wahrgenommen wird. Cunis' zweiter Roman Zeitsturm wurde im Jahre 1979 veröffentlicht: Er befasst sich mit dem Thema Zeitreise mittels Drogen und ist vom Werk so unterschiedlicher Autoren wie Philip K. Dick und J. G. Ballard beeinflusst.
Zu Reinmar Cunis' Lieblingsthemen gehörten außersinnliche Wahrnehmungen, Teleportation, psychedelische Drogen, Psi-Phänomene und Leben nach dem Tod.
Als seine herausragendsten Werke gelten Am Ende eines Alltags (1982), eine Sammlung von Kurzgeschichten, sowie der Roman Wenn der Krebsbaum blüht (1987).
Für die Kurzgeschichte Polarlicht wurde er 1986 mit dem Kurd-Laßwitz-Preis ausgezeichnet.
Der Apex-Verlag widmet Reinmar Cunis eine umfangreiche Werkausgabe.
LIVESENDUNG
Erstes Kapitel
Der Reisende hatte eine Strecke gewählt, die hauptsächlich für Rohstofftransporte benutzt wurde. Sie führte in einen Bereich der Milchstraße, der nur dünn besiedelt war, wenige, weit voneinander liegende Planeten gab es hier, ihre Sonnen waren klein und kraftlos. Hier konnten die Transporte große Entfernungen geradlinig überwinden, nichts hemmte ihren Weg, zwang sie zu Zeitverzögerungen.
Der Reisende hatte sich nach langen Überlegungen für diese Strecke entschieden, denn sie führte genau in die Gebiete fernab von der Zivilisation, denen man so wenig Bedeutung beimaß und ohne die doch das ganze System nicht funktionieren würde. Der Reisende hoffte, dort Erkenntnisse zu gewinnen, die ihm bei seinen täglichen Meditationen verschlossen geblieben waren. Seine Freunde hatten über diese Idee die Köpfe geschüttelt, es war ganz und gar nicht üblich, Nachforschungen anzustellen, wenn man Zusammenhänge erkennen wollte. Sich in sich selbst versenken, lange nachsinnen, den Flug der Gedanken verstärken, sich mit anderen verbinden, gemeinsam begreifen, registrieren, deuten, das alles waren Mittel, die einem Forscher und Philosophen anstanden. Auf diese Weise hatte sich die Menschheit entwickelt, hatte Weisheit gewonnen, war aufgestiegen zur Herrscherin über die Natur, und das war es, worin sie sich von allen anderen Wesen im Universum unterschied.
Aber der Reisende wollte die Randgebiete selbst sehen, die Meditation half ihm nicht weiter, und wenn ihm auch die anderen niedere Abenteuerlust vorhielten, so bestand er doch darauf, dass Forschung mehr war als Gedanken addieren. Schauen und das Unfassbare als Realität hinnehmen, das schien ihm mehr wert zu sein als das Beharren in festgefahrenen Denkvorstellungen.
Er stellte sein Gerät sorgfältig ein, überprüfte mehrfach die Zielpeilung, schließlich war es ein überdurchschnittlich weiter Weg, den er zurücklegen würde. Er hoffte, in einem Monat zurück zu sein, aber es kam ganz anders.
Der unglaubliche Zufall wollte es, dass in der Nähe einer kleinen, gelben Sonne, die am Weg des Reisenden lag, ein skurriles Gefährt von einem toten, atmosphärelosen Gestirn aufstieg, angepeilt von einem Zielgerät, das in einer hundertstel Sekunde den Weg des Reisenden hemmte. So unwahrscheinlich dieses Zusammentreffen auch war – der Reisende hatte keinen Augenblick diese Möglichkeit auch nur erwogen seine Fahrt nahm dadurch eine völlig unerwartete Wendung. Grau und schmerzlich war sie zu Ende, irgendwo in den kalten Zonen der Randgebiete.
Zweites Kapitel
Jochen Berner löffelte seine heiße Tomatensuppe und blickte dabei sein Gegenüber an, den runden, blonden Kopf des Tagesschau-Redakteurs Harmbeck. Berner hatte gerade ein paar randgefüllte Tage hinter sich, und er wusste, dass die nächsten nicht weniger turbulent sein würden. Er machte Reportagen, ganz aktuell, am liebsten direkt vom Platz des Geschehens, live also, und er wusste, dass er mit diesen Berichten gut lag, das war etwas, was er konnte.
Das Lob seiner Kollegen und der Fernsehzuschauer zog er sich täglich wie ein frisches Hemd an.
Harmbeck hatte ihm eben eine saftige Geschichte erzählt, Haustratsch, und sie lachten beide.
»Mitten in der Sendung?«, fragte Berner noch einmal, um den Spaß auch ganz auszukosten.
Harmbeck nickte. »Es sollte doch live sein, aber der liebe Chefkommentator hatte nicht bis zur Sendung warten wollen. Er hatte seinen Beitrag auf Band aufgezeichnet, und das natürlich nicht nur einmal, sondern viermal, bis es ihm besonders gelungen schien. Er hatte wieder letzte politische Weisheit verspritzt, und so einen Versprecher, den konnte sich der große Herr doch nicht leisten.«
»Und da hat er gesagt, zum Donner, das machen wir noch einmal?«
Harmbeck lachte bei der Erinnerung wieder. »Das wäre ja nicht schlimm gewesen, nur wurde leider dieses Band gesendet und nicht das endgültige. Wir waren alle so entgeistert, dass uns erst Sekunden später bewusst wurde, was da über den Bildschirm gegangen war! Mitten in der Sendung sagt der große Chefkommentator, zum Donner, das machen wir noch einmal, und blinzelt nervös in die Kamera.«
»Der ist zu Haus im Sessel zusammengebrochen«, sagte Berner und schlürfte genussvoll seine Suppe.
Harmbeck schüttelte lachend den Kopf. »Zusammengebrochen ist der Regisseur unten im Studio. Der große Herr hing keine Minute später am Telefon und machte sich beim Chefredakteur Luft. Na, du kannst dir vorstellen, was nach der Sendung los war.«
Berner lehnte sich in seinem Stuhl zurück, zündete sich eine Zigarette an und blickte zufrieden um sich. Die Kantine war um diese Zeit voll, und viele Kollegen grüßten ihn von den Nachbartischen her, manche, die er gar nicht kannte, aber für die er einer der bewunderten Fernsehstars war. Er brauchte Zuschauer, auch hier in der Betriebskantine. Er schob Harmbeck die Zigarettenpackung hin und sagte, weil er wusste, dass es gut ankam: »Dann traf die Schuld mal wieder den Kleinsten, der sich nicht wehren kann.«
»Davon, dass der Kommentar aufgezeichnet und nicht live gesendet war, sprach keiner mehr«, meinte Harmbeck zustimmend, »aber der arme Kerl, der die Bänder mit der Aufzeichnung vertauscht hatte, der wurde geköpft.«
»In eine andere Abteilung versetzt?«
Harmbeck beugte sich vor und beschrieb, wie sich Ärger und Wut, aber auch Angst um die eigene Position und Scham vor den Kollegen wie eine Flutwelle über den Techniker ergossen und ihn auf staubige Nebenarbeiten gespült hatten. Berner hörte nicht mehr zu. Uninteressant, was da in diesem elektronischen Schaltwerk moderner Fernsehtechnik passierte, Hilfsarbeiten für seine eigenen großen Auftritte. Die Technik hatte zu funktionieren; wie, das war nicht seine Sache, und es lag ihm fern, sich damit zu beschäftigen. Plötzlich stand er auf, hatte das Gefühl, lange genug hier gesessen und freundliche Worte gewechselt zu haben. Er klopfte Harmbeck auf die Schulter, murmelte ein Schönen-Tag-noch und war schon an der gläsernen Ausgangstür, breitschultrig, nicht ganz so schlank, wie er es sich wünschte, in einem gutsitzenden Schneideranzug, die Blicke der anderen auf seinem Rücken spürend.
Geht langsam auf die Vierzig zu, dachte Harmbeck, als er ihm nachsah, der ist mit seiner Karriere noch nicht am Ende, so selbstsicher und gewandt, kaltschnäuzig und ehrgeizig, ein Kerl, dem der Beruf ebenso auf den Leib geschneidert ist wie der Maßanzug.
Die Unruhe in der Kantine schreckte den Redakteur aus seinen Gedanken auf. Viele Kollegen waren aufgestanden, hatten sich in einen Nebenraum zurückgezogen, um dessen Tür sich Nachkommende drängten. Hier, im Fernsehzimmer, zitterte die Direktübertragung vom Mondflug über die Mattscheibe, das oft schon gehörte Wechselgespräch mit dem Mutterschiff Europa I in englischer Sprache, nun aber zum ersten Mal ein Deutscher, ein Franzose, ein Engländer und ein Italiener an Bord dieses Mondlandeunternehmens.
Drittes Kapitel
Der Kontrollmonitor zeigte gestochen scharfe Bilder aus dem Mutterschiff. Die Landefähre hatte sich vom Mondboden abgehoben und kam in weitem Bogen auf den Rendezvouspunkt zu. Hier im Mess- und Kontrollraum des Deutschen Raumfahrtinstituts war Hochbetrieb, eine stickige Atmosphäre, in der das Piepen, Schlürfen und Schnalzen der Elektronik wie geronnene Puddingmasse standen. Etwa dreißig Frauen und Männer, Wissenschaftler und Ingenieure, saßen in dem niedrigen, fast fensterlosen Raum, zwischen dem Blech, den Röhren, Kontrolllampen, Schaltern, Magnetspulen, Transistoren und Verstärkern. An der einen Wand, über die offen verlegte Kabel verliefen, stand ein zimmerlanger Holztisch, auf dem die Kontrollmonitore und Messgeräte aufgebaut waren. Hier war das Überwachungszentrum. Dahinter Tischreihen für die Wissenschaftler, die die Daten überprüften und neue errechneten. Hinter ihnen, fast schon an der gegenüberliegenden Wand, die Schaltpulte des Rechenzentrums, scheinbar planlos in Tausenden von Plastikadern mit Geräten außerhalb dieses Raumes verbunden. An der Schmalseite des Raumes, auf einem hölzernen Podest und mit einer Glaswand abgetrennt, das Chefzimmer, ein Führerstand, in dem die wichtigsten Fäden zusammenliefen. Die Luft hätte hier wohltuend kühl, der Lärm erträglich sein können, wenn nicht immer die Glastür offen gestanden hätte.
»Messwerte normal«, sagten die Stimmen in der stickigen Luft, in den Mikrophonen auf den Tischen, in den Lautsprechern an der Decke und im Chefzimmer, die Stimmen in den kilometerlangen Kabeln zu den anderen Haupträumen des Instituts und in den Telefonleitungen zu den anderen europäischen Raumfahrtstationen, zur Abschussbasis und zum Steuerzentrum.
»Keine Abweichungen--------- Ankopplung beendet--------- Europa I bitte kommen--------- Europa I bitte kommen.«
Im leeren Chefzimmer schrillt das Telefon. Bevor die Sekretärin vom Vorzimmer aus den Schreibtisch erreichen kann, ist einer der Wissenschaftler von seinem Pult auf gestanden, durch die offene Tür geeilt und hat den Hörer abgenommen.
»Hadrich«, meldet er sich, »nein, der Chef ist noch nicht zurück. Die Ankopplung hat gerade geklappt – ja, danke, wir sind alle sehr zufrieden, ihr könnt das Fernsehteam schon heraufschicken, die müssen ja noch einleuchten vor dem Interview.«
Der Wissenschaftler legt den Hörer auf und starrt einen Augenblick lang durch die Glaswand in den Messraum. Ein Bild, das sich seit Wochen kaum verändert hat, Tag und Nacht, nervenfressendes, konzentriertes Arbeiten am Höhepunkt eines ehrgeizigen, mehr politisch als technisch bahnbrechenden Projekts. dass jetzt auch Europäer den Mond betreten haben, aus eigener Kraft, mit eigenen Mitteln, in jahrelanger, selten harmonisch verlaufender Vorarbeit geplant, dass sie jetzt alle dabei sind und dazugehören, das erfüllt sie mit Stolz. In diesen Wochen und Monaten musste auf private Wünsche verzichtet werden, es hatte manches harte Wort gegeben, überreizt, wie sie waren. Auch der Chef, denkt Hadrich, kühl und besonnen, wie der Chef ist, auch er hatte einige Male unnötig scharfe Worte gebraucht.
Hadrich lächelte. Jetzt dürfte der Chef zufrieden sein, die schwierigste Phase ist vorüber, kein Zweifel, dass die Astronauten sicher zurückkehren werden. Schon damals bei den amerikanischen Mondflügen gab es ja kaum noch Unsicherheitsfaktoren. Als sie alle vor Jahren von hier aus die Apolloflüge verfolgten, waren sie hingerissen von der technischen Perfektion. Jetzt beherrschten sie sie selbst. Sie waren nicht schlechter als die in Houston. Hadrich, vierunddreißig Jahre alt, Junggeselle, mit weichem, braunem Haar, schwarzer Hornbrille, Tennisspielerfigur, Hadrich gehörte jetzt zu den Experten in der Welt.
Viertes Kapitel
Dr. Gerd Kramlo hatte viele Jahre gebraucht, bis er seine berufliche Laufbahn mit diesem Erfolg schmücken konnte. Ingenieur mit politischen Interessen, übermäßig ehrgeizig und ständig von dem Gedanken verfolgt, ihm könne einmal ein Fehler unterlaufen, hatte er sich Zug um Zug dem Direktorensessel entgegengeschoben, nichts überhastet, aber auch keine Gelegenheit ausgelassen. Jetzt, Mitte Fünfzig, war er Leiter des Deutschen Raumfahrtinstituts, einer Einrichtung, die in den letzten Jahren internationales Ansehen und innerhalb der europäischen Gemeinschaft eine führende Rolle erworben hatte. Kramlos Sohn Andreas, der neben ihm stand und auf ihn einredete, schien nichts vom Vater ererbt zu haben. Das einzig Gemeinsame zwischen beiden war gleichzeitig auch das am stärksten Trennende: Beide trugen die Uniform ihrer Generation. Kramlo erschien wie stets in seinem Büro in einem eng geschnittenen, in warmem Ton gehaltenen Anzug, den breiten Schlips unter einem sorgsam gestutzten Bart wie eine Blumenwiese drapiert. Sein Sohn dagegen war wie fast alle Zwanzigjährigen kahl rasiert und trug die zottige, fellähnliche Kunstfaserkleidung, die an die Tracht kanadischer Pelztierjäger erinnerte.
»Du könntest doch wenigstens heute Abend für eine Stunde kommen, Vater, ich weiß nicht, warum du so störrisch bist. Das ist unsere erste Ausstellung, der Beginn einer Malerei, die zum ersten Mal Piet Mondrian...«
»...ins Geistige transponiert«, lächelte Kramlo und schüttelte mit knapper Bewegung den Kopf. »Das hast du mir alles schon erzählt, Andreas. Aber heute beginnt der Rückflug, wenn du dich bitte erinnern willst. Ich bin – wir alle sind hier verantwortlich für die Männer im Raumschiff, für ihre Rückkehr und für die nutzbringende Verwendung der öffentlichen Mittel.«
»Du redest zu mir wie zu deinem Aufsichtsrat. Die öffentlichen Mittel sind mir egal, und dass die Herren Raumfahrer heil zur Mami kommen, dafür hast du hier ja einen Riesen-Stab von gut trainierten Leuten sitzen. Heute Abend sagt der Singbai was zu seinen Bildern, gelben und orangeroten Spiralen in mathematisch gegliederten Sphären, Zeitspiralen, die dich die Verschiebung der Dimensionen erahnen lassen, verstehst du, nein, du verstehst nur immer öffentliche Mittel.«
Kramlo war weitergegangen, in Gedanken bereits an seinem Schreibtisch und bei den vielen Verpflichtungen, die auf ihn warteten. Als sich Andreas ihm jetzt in den Weg stellte, gestikulierend und nicht gewillt, den Vater ohne Zusage vorbeizulassen, wurden seine Lippen schmal.
»Die öffentlichen Mittel, die du verspottest«, sagte er eindringlich, »ernähren uns und ermöglichen dir dein Studium. Würdest du dir das einmal unter die Glatze schreiben?«
In diesem Augenblick veränderte sich das monotone, hier auf dem Flur des Raumfahrtinstituts gedämpft blubbernde und piepende Geräusch aus den Mess- und Kontrollräumen, aus den Rechenzentren und Büros. Der Lautsprecher über der Tür des Chefzimmers schaltete sich knisternd ein, dann sagte die kalte, unpersönliche Stimme des Ersten Physikers:
»Keine Daten vom Schiff. Energieentladung im Gammabereich. Versuchen, die Verbindung wieder herzustellen.«
Die Worte fielen wie Steine herab. Kramlo zögerte nur eine Sekunde, dann hatte er mit einem Satz die Tür zu seinem Zimmer erreicht, über der der Lautsprecher diese unglaubliche Nachricht verbreitet hatte.
Sein Sohn reagierte nicht so prompt. Er starrte dem Vater nach, sackte dann in seinem Trapperfell zusammen, reckte den Kopf vor, klopfte sich mit den Knöcheln der Faust gegen die Stirn und murmelte:
»Nichts verstehst du von Gelb. Immer nur deine Raumfahrt, die hast du im Kopf. Was da sonst noch drin ist, weißt du selber nicht, Angst könnte man bekommen vor dem, was da drin ist.«
Aber Kramlo hatte die Tür bereits hinter sich geschlossen, überfallen vom Stimmengewirr. »Europa I, bitte melden«, sagten die Stimmen. »Noch immer kein Kontakt. – Unterbrechung in Position BA Siebzehn-Null-Neun. – Europa I, bitte melden.« Und dazwischen, fast drohend, die Stimme des Ersten Physikers, noch einmal: »Energieentladung im Gammabereich.«
Kramlo stand an seinem Schreibtisch und teilte kurze, präzise Anordnungen aus, diese Situation stellte ihn, er nahm sie als Herausforderung. Seine engsten Mitarbeiter standen um ihn herum, vertrauten seiner Umsicht, warteten auf Weisungen.
»Informieren Sie das Startzentrum in Sydney«, sagte Kramlo zu Hadrich.
»Ist schon geschehen, Chef. Was ist mit der Raumfahrtbehörde?«
Kramlo schüttelte den Kopf. »Erst wenn wir Bescheid wissen«, entschied er.
Dann folgten seine Augen einer kurzen, unauffälligen Szene. Einer seiner Wissenschaftler hatte die Tischreihe mit den Messinstrumenten verlassen und war hinausgelaufen, zu schnell und im falschen Augenblick, wie Kramlo meinte.
»Holen Sie Anger zurück«, sagte er zu Hadrich.
In diesen Sekunden scheinen die Lautsprecher das Leben im Raumfahrtinstitut zu diktieren. Anweisungen und Informationen sprühen durcheinander, jeder Mitarbeiter hockt an seinem Platz, bereit, seine Daten beizusteuern, wenn sie abgefordert werden. Die Flure sind leer, die Fahrstühle verlassen.
Anger hat mit einem Sprung einen offenen Fahrkorb erreicht, die Kellertaste gedrückt, jetzt hüpfen die Zahlen über der Tür abwärts. In der Hand hält er ein kleines Gerät, ein Kabel hängt an der Seite heraus. Als sich im Keller die Schachttür wieder geöffnet hat, eilt Anger auf eine Stahltür zu, schließt sie auf, während er weiter das kleine Gerät umkrampft hält.
Als sich die Tür wieder hinter ihm geschlossen hat, sieht der Kellerflur ebenso leer und unbenutzt aus wie alle neun Flure darüber, unmöglich für Hadrich, Angers Spur zu folgen. Hadrich blickt kurz und ohne Erwartung in die Toilettenräume, ruft pflichtgemäß über Haustelefon in die Kantine, zuckt die Achseln und kehrt ins Chefzimmer zurück.
Fünftes Kapitel
Der Reporter hockte auf dem harten Holzstuhl am Pult des Bildingenieurs und lachte. Seit zwei Wochen stand dieser große Übertragungswagen des Fernsehers auf dem Hof des Raumfahrtinstituts und stellte so die elektronische Verbindung zu den Studios im Funkhaus und zu den Sendezentralen her. Hier aus dem Ü-Wagen, wie die Fernsehleute knapp und militärisch sagten, hier aus diesem fahrbaren Studio konnten Meldungen, Berichte und Reportagen direkt überspielt werden. Kein Zeitverlust, Aktualität geht vor, der Zuschauer will wissen, was sich abspielt zwischen hier und dem Mond. Berner, mit den Berichten aus dem Raumfahrtinstitut während dieser ersten europäischen Expedition beauftragt, verstand mit dem Drei-Millionen-Objekt zu spielen. Er war mit seinem Team hier mitten zwischen den blasierten Raumfahrern, er machte die Show. Sein Lachen klang schadenfroh.
»Seit wann sind die Mondfahrer witzig?«, wunderte sich der Bildingenieur und steckte neugierig den Kopf herein. Im Ü-Wagen war alles eng, das Fernsehstudio war auf kleinstem Raum untergebracht. Wenn man mit den Kollegen reden wollte, musste man schon als Schlangenmensch geübt haben.
»Die haben seit Sekunden nur noch Sauerkraut auf ihren Bildschirmen«, sagte Berner und fand das offenbar erheiternd.
Der Kameramann, der Toningenieur und der Fahrer quetschten sich jetzt ebenfalls herein. »Kontaktstörung?«, fragte der Bildingenieur, griff mit geschulter Hand zu den Schaltknöpfen und Mischhebeln am Pult, pegelte das Bild ein, überflog forschend die Kontrollskalen, schließlich stellte er befriedigt fest, dass hier alles in Ordnung war.
»Sieht böse aus«, sagte er ernst, »müssen ganz erhebliche atmosphärische Störungen sein.«
Betroffen hakte Berner ein. »Das kann auch uns das Geschäft verderben«, erkannte er. »Prüft mal die Strecke zum Studio.«
Er machte dem langen Bildingenieur Platz, der sich gewandt auf den Sitz schob, noch beim Hinsetzen die Ruftaste drückte und mit den Kollegen im Sender, hundertachtzig Kilometer entfernt, Kontakt aufnahm. Der Mann im Schaltraum meldete sich sofort. Hier im Ü-Wagen war die Erleichterung zu spüren, die Leitung stand, die Verbindung war tadellos.
»Sagen Sie der Redaktion, wir brauchen mehr als dreißig Sekunden für den Bericht«, gab Berner noch durch, »hier ist allerhand los, ich will ein Interview mit dem Chef machen.«