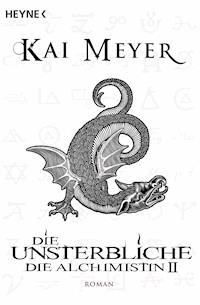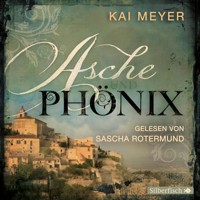9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Ein phantastischer Roman im viktorianischen London - Die Fortsetzung des Bestsellers DIE SPUR DER BÜCHER Londons Straße der Buchhändler – Labyrinthe aus Regalen, Läden voller Geschichten auf vergilbtem Papier. Mercy Amberdale führt hier das Antiquariat ihres Stiefvaters und praktiziert die Magie der Bücher. Als man sie zwingt, das letzte Kapitel des verschollenen Flaschenpostbuchs an den undurchsichtigen Mister Sedgwick zu übermitteln, gerät das Reich der Bibliomantik aus den Fugen. Vergiftete Bücher und nächtliche Rituale, ein magisches Luftschiff und ein mysteriöser Marquis reißen Mercy in einen Strudel tödlicher Intrigen. Denn wer alle Kapitel des Flaschenpostbuchs vereint, kann die Grenze zwischen Wirklichkeit und Fiktion niederreißen. Wenn Mercy ihre Gegner nicht aufhält, droht ihrer Welt der Untergang – und die Invasion der Antagonisten. Mercy Amberdale und das Buch der Macht Am Morgen des 3. Dezember 1880 wurden gegen halb sieben die Lampen in den ersten Buchläden entzündet. Eine Gestalt in einem langen Mantel wanderte an den Fenstern vorüber, vom Licht in den Schatten, vom Schatten ins Licht. Weil niemand sonst so früh die Gasse durchquerte, sah keiner das Gesicht unter dem Hut, der tief in die Stirn gezogen war. Vor einem der Läden hielt der Fremde inne. Liber Mundi stand in goldenen Buchstaben an der Fassade, ein großer, polierter Schriftzug, der sich über das Schaufenster und den Eingang spannte. Die Bücher in der Auslage ruhten dicht gedrängt im Dunkeln, auch im ersten Stock war es ruhig. Alle drei Bewohner des Liber Mundi schliefen noch: Mercy Amberdale in ihrem Zimmer über dem Laden, Tempest und Philander unter dem Dach. Und so bemerkte keiner von ihnen, wie sich die Gestalt auf dem verharschten Schnee dem Eingang näherte und auf halbem Weg unter ihren Mantel griff.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 424
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Kai Meyer
Der Pakt der Bücher
Roman
Über dieses Buch
Londons Straße der Buchhändler – Labyrinthe aus Regalen voller Geschichten auf vergilbtem Papier. Mercy Amberdale führt hier das Antiquariat ihres Stiefvaters und praktiziert die Magie der Bücher.
Als man sie zwingt, das letzte Kapitel des verschollenen Flaschenpostbuchs an den undurchsichtigen Mister Sedgwick zu übermitteln, gerät das Reich der Bibliomantik aus den Fugen. Vergiftete Bücher und nächtliche Rituale, ein magisches Luftschiff und ein mysteriöser Marquis reißen Mercy in einen Strudel tödlicher Intrigen. Denn wer alle Kapitel des Flaschenpostbuchs vereint, kann die Grenze zwischen Wirklichkeit und Fiktion niederreißen. Wenn Mercy ihre Gegner nicht aufhält, droht ihrer Welt der Untergang – und die Invasion der Antagonisten.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Copyright © 2018 by Kai Meyer
Copyright Deutsche Erstausgabe
© 2018 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Michael Meller Literary Agency GmbH, München.
Covergestaltung und -abbildung: buerosued.de
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490189-3
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Erster Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
Zweiter Teil
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
Dritter Teil
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
Nachspiel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
Erster Teil
Wiedersehen auf einer Brücke im Nebel ·Das Flaschenpostbuch · Mister Sharpinknackt Nüsse · Im Pfandhaus der Lieblingsbücher · Blutvergießen im Hotel Savoy · Der Flammenbaum des Feuerschluckers · Egyptienne
1
In der Straße der Buchhandlungen, einer schmalen Schlucht aus Schaufenstern, hinter denen die Wunder aller Welten auf Entdecker warteten, drang der Duft von Papier bei Tag und Nacht unter den Türen hervor.
Wenn die Händler am Cecil Court morgens ihre Eingänge entriegelten und die Schilder hinter den Scheiben auf Geöffnet drehten, dann erwachte mit den verschlafenen Gestalten – müde vom Lesen nach Ladenschluss – ein Universum der gedruckten Worte, der Erfindungen und Entdeckungen, der feinen und der rauen Sprache. Dann wurden Fenster aufgerissen mit Ausblicken auf die Länder der Literatur. Aus ihnen winkten die Heldinnen und Helden aller Erzählungen, der großen und der geringen, der groben und der geistreichen.
Lange nachdem die Nachtwächter ihre Runden beendet hatten, öffneten die Buchhändler sogar im Winter kurz die Türen, nicht um frische Luft hereinzulassen, sondern um die Straße mit Buchduft zu fluten. So kämpften sie gegen den Gestank des Molochs London an, gegen den Atem dieses uralten Ungetüms, fochten gegen den Giftnebel der Hinterhoffabriken, den Odem von Tierkot und Abwasser. Jeden Morgen warfen sie sich von neuem in diese Schlacht, legten eine Duftspur für die Suchenden und die Feingeistigen und boten dem Gewöhnlichen und der Langeweile die Stirn. Dann lockten sie die Londoner in Labyrinthe aus Buchregalen, in Höhlen aus Lederrücken und Pappeinbänden, in das fabelhafte Reich der Geschichten.
Anderswo in der Stadt strömten dann längst die Arbeiter in ihre Höllen aus Schloten und Zahnrädern, wanderten Armeen von Angestellten in enge Büros, nach ihrem Frühstück an schmuddeligen Straßenständen: eine Tasse Kaffee oder Tee für einen Penny, dazu zwei dünne Scheiben Brot.
Während das Gesinde der Reichen auf den Märkten um Fleisch und Gemüse feilschte und an Londons Gerichten das Geschrei anhob, ging man es am Cecil Court gemächlich an. Man kehrte Pfade in den braunen Schneematsch oder legte Sackleinen aus, um den Weg zu den Ladentüren zu erleichtern. Man schürte das Feuer in den Öfen und fluchte über die vereisten Wasserpumpen in den Kellern. Man trug Holz aus dem Hof in die Hinterzimmer, sortierte Liegengebliebenes, blätterte in frisch gedruckten oder liebgewonnenen alten Büchern.
Die Gasse der Buchhandlungen – eine von zweien, die es in London gab, und von der anderen werden wir später hören – war eine Insel der Ruhe inmitten des Gezeters der Großstadt. Gewiss, auch hier wurde gearbeitet, wurden Kisten mit Folianten geschleppt, wurde gemurrt und geflucht über schmerzende Rücken und nachlassendes Augenlicht. Dann und wann gab es Streit, unvermeidlich, wenn zwanzig Läden eng beieinander die gleiche Ware anboten. Doch spätestens am Ende des Tages war der gröbste Zwist beigelegt. Dann traf man sich im einzigen Pub der Straße, über dessen Tür das Bild eines Schinkens hing mit der Aufschrift The Ham.
Frühmorgens jedoch grüßte man erst einmal die Bücher und einander, fror gemeinsam im trüben Licht der Gaslaternen, ehe endlich die Sonne aufging und den schwefelgelben Dunst der Schornsteine schummerig erleuchtete. Wenn es schneite, waren die Schneeflocken grau vom Rauch der Kohlefeuer, und an manchen Tagen fielen schwarze Batzen aus den Wolken, als blätterte die Farbe der Nacht vom Himmel. Auch der Cecil Court, wo man reines Papier und Sauberkeit schätzte, war davor nicht gefeit, und manche Buchhändler reichten ihren Kunden Überzüge für die Schuhe, wenn sie den Laden betreten wollten.
Auch am Morgen des dritten Dezember 1880 wurden gegen halb sieben die Lampen in den ersten Läden entzündet. Viele der Häuser hatten zur Straße hin Erkerfenster, und der Schein im Inneren erhellte die Bände in den Auslagen und warf eckige Schatten auf das Pflaster. Die Geschäfte, deren Besitzer stets als Erste auf den Beinen waren, trugen Namen wie Gargantua&Pantagruel und Temple of Serapis und Prospero’s Isle.
Eine Gestalt in einem langen Mantel wanderte an den Fenstern vorüber, vom Licht in den Schatten, vom Schatten ins Licht. Weil niemand sonst so früh die Gasse durchquerte, sah keiner das Gesicht unter dem Hut, der tief in die Stirn gezogen war. Die Kälte hatte über Nacht den Schneematsch gefrieren lassen, die Kruste brach und knirschte unter jedem Schritt des vermummten Besuchers.
Vor einem der Läden, in dem selten vor acht ein Licht brannte, blieb der Fremde stehen. In der Ferne erklangen das Hufgeklapper der Kutschpferde, die Rufe der Zeitungsjungen, die Glocken zahlloser Kirchtürme und das Gurren der Tauben auf den Dächern. Zwischen den gebeugten Fassaden am Cecil Court war all das nur ein Raunen und Rauschen wie ein tiefes Einatmen, wie ein Luftholen der Bücher, während sie sich für die Kunden in Positur brachten und ihre Umschläge ins beste Licht rückten.
Inmitten dieses Rumorens aus den angrenzenden Straßen und dem Schweigen der Gasse stand die Gestalt vor dem zweigeschossigen Gebäude mit der Hausnummer 14, atmete in ihren schwarzen Seidenschal und betrachtete den Laden im Erdgeschoss.
Liber Mundi stand in goldenen Buchstaben an der Fassade, ein großer, polierter Schriftzug, der sich über das Schaufenster und den Eingang spannte. Die Bücher in der Auslage lagen dichtgedrängt im Dunklen, auch im ersten Stock war es ruhig. Hinter zwei winzigen Giebelfenstern schien eine Kerze zu flackern, doch bei genauem Hinsehen entpuppte sich der Schein als Spiegelung vom Haus gegenüber.
Alle drei Bewohner des Liber Mundi schliefen noch: Mercy Amberdale in ihrem Zimmer über dem Laden, Tempest und Philander eine Etage höher unter dem Dach. Sie waren nie die ersten Buchhändler am Cecil Court, die aus ihren Betten krochen, auch wenn der Laden stets pünktlich um acht Uhr öffnete. Während anderswo bereits Porridge und Stew gekocht wurden, blieb es im Liber Mundi still, und so bemerkte keiner der drei, wie sich die Gestalt auf dem verharschten Schnee dem Eingang näherte und auf halbem Weg unter ihren Mantel griff. Sie schien kurz zu zögern, dann beugte sie sich vor und schob langsam einen Umschlag unter der Tür hindurch, bis er im Laden verschwunden war.
Der Vermummte hielt inne, als wäre er nicht sicher, das Richtige getan zu haben. Schließlich erhob er sich, machte zwei Schritte rückwärts und wandte sich um, nicht ohne einen letzten Blick zu den Fenstern im ersten Stock zu werfen. Dort blieb alles dunkel.
Wieder knirschte der vereiste Morast unter seinen Schritten, anderswo gingen Lampen an. Der Cecil Court erwachte Haus für Haus. Neue Helligkeit fiel auf die Straße, nun wieder menschenleer wie in tiefster Nacht. Wären da nicht die Fußabdrücke gewesen, die zur Tür des Liber Mundi führten und wieder von dort fort, hätte man meinen können, ein Gespenst hätte die Straße heimgesucht, ein Geist aus der Vergangenheit.
2
Am nächsten Abend eilte Mercy Amberdale allein am Ufer der Themse entlang. Sie trug einen Mantel, der zu dünn war für die Winternacht, und eine Mütze mit Fellklappen über den Ohren, die man auf dem Kopf eines Bootsmanns erwartet hätte, aber keinesfalls auf dem einer jungen Frau. Rote Strähnen ringelten sich darunter hervor, während Atemwolken vor ihrem Gesicht aufstiegen. Ihre Hände steckten in einem Muff aus Fell, darin verbarg sie ihr Seelenbuch und ein rechteckiges Stück Karton mit der Aufschrift Nimmermarkt.
Das Liber Mundi hatte geöffnet bis um zehn Uhr abends, so wie alle Läden am Cecil Court, und nun war es noch eine Stunde später. Eine Verabredung um diese Zeit war jenseits aller guten Sitten, aber Sittsamkeit und Anstand einer unverheirateten Dame waren Mercys letzte Sorgen. Um diese Zeit waren Schurken aller Art unterwegs, angefangen von Rudelkopfs Schlägerbanden, die in Soho das Sagen hatten, bis hin zu den Handlangern der Madame Xu, der Königin von Chinatown – ganz abgesehen von all jenen, die sich nur äußerlich den Anschein von Menschen gaben und hinter höflichen Umgangsformen und feinem Zwirn krankhafte Triebe verbargen.
Mercy folgte dem schmalen Weg entlang des Ufers. Rechts von ihr lag der Fluss, links die Fassaden hoher Speicherhäuser. Ein gutes Stück entfernt schimmerten über dem Wasser die Gaslaternen der London Bridge mit ihren steinernen Bögen. Zwei Betrunkene pfiffen Mercy nach, taumelten jedoch weiter in die andere Richtung.
Eine einzelne Laterne stand etwa hundert Yards von der Brücke entfernt, darunter kauerte im Schnee eine schmale Gestalt mit Hut. Auf ihrer rechten Schulter saß eine Taube mit nur einem Flügel. Mercy trat bis auf wenige Schritte an die alte Frau heran und wollte das Wort an sie richten. Da ruckte ihr Kopf nach oben, genau wie der des Vogels. Gaslicht fiel auf gerötete Augen und einen zahnlosen Mund. Die Frau murmelte ein paar Beschimpfungen, dann ließ sie das Kinn wieder auf die Brust sinken. Nur die Taube ließ Mercy nicht mehr aus den Augen und gurrte leise.
Kurz überlegte Mercy, der Fremden ihre Hilfe anzubieten, sie wenigstens zu einem geschützten Hauseingang zu führen, aber die Frau winkte sie weiter wie ein Wachmann vor dem Palast der Königin. Mercy steckte ihr Seelenbuch in die Manteltasche und ließ den Muff vor ihrem Bauch baumeln. In beiden Händen hielt sie jetzt nur noch den beschrifteten Streifen Karton. Nimmermarkt war ein deutsches Wort, hatte ihr der Besserwisser erklärt, aber keines, das er kannte. Es tauchte in keinem der zahllosen Bücher auf, aus denen er seine Kenntnisse bezog.
In dem Umschlag, den sie auf dem Boden hinter der Tür des Liber Mundi gefunden hatte, hatte neben dem Pappstreifen ein Brief gesteckt. Darin standen dieser Ort und diese Uhrzeit, außerdem eine kurze Anleitung, was sie zu tun hatte, sobald sie hier eintraf. Unterwegs hatte Mercy auf Verfolger geachtet, jedoch keine entdeckt. Die Obdachlose am Laternenpfahl war der einzige Mensch weit und breit.
Die Uhren schlugen elf, als sie das Stück Karton vor der Brust zwischen beiden Handflächen presste, für ein paar Sekunden die Augen schloss und dann wieder öffnete.
Die Laterne, die Frau und die Taube waren noch da, aber einige Yards weiter war nichts mehr so wie vor wenigen Sekunden. Dort erhob sich jetzt ein steinerner Torturm, drei Stockwerke hoch, mit einem Kranz aus Zinnen. Das mächtige Bogentor darin stand offen und führte unter dem Turm hindurch auf eine Brücke, die vor Augenblicken nicht dagewesen war. Mercy sah nach links und vergewisserte sich, dass die London Bridge noch an Ort und Stelle war. Sie erschien ihr nun verschwommener, als wäre der Nebel dichter geworden und die Welt dahinter fadenscheinig. Die zweite Brücke, die vor ihr aus dem Nichts aufgetaucht war, schien dagegen fast überwirklich.
Die Frau blieb reglos am Fuß der Laterne sitzen, offenbar hatte sie die Veränderung nicht wahrgenommen. Selbst wenn sie aufgeblickt hätte, wären der Turm und die Brücke für sie unsichtbar geblieben. Sie besaß keine Einladung, der Weg hinüber stand einzig Mercy offen.
Weil es am Tor keine Wachen gab, trat sie entschlossen unter den hohen Bogen und wurde sogleich von Düsternis verschlungen. Vage erkannte sie leere Halterungen für Fackeln an den Wänden. Jenseits des Turms standen Gaslaternen auf den gemauerten Geländern der Steinbrücke, auch sie waren nicht entzündet worden. Nur die Lichter der Stadt auf Mercys Seite der Themse spendeten Helligkeit, brachten den Nebel zum Glühen und schälten die Umrisse der Brücke aus der Nacht. Das gegenüberliegende Südufer war in Schwärze versunken, so als wären dort auf einen Schlag sämtliche Lampen erloschen. Da drüben lag jetzt nicht mehr London – nicht für Mercy, wenn sie diese Brücke benutzte –, sondern ein Ort, der allein Bibliomanten offenstand.
Nimmermarkt war eines der bibliomantischen Refugien, von denen ihr Valentine manchmal erzählt hatte. Nie hatte sie eines mit eigenen Augen gesehen oder gar betreten, und sie war nicht sicher, ob die Stunde vor Mitternacht ein guter Zeitpunkt dafür war.
Ich erwarte Sie auf der Brücke, hatte in dem Brief gestanden, und als sie aus dem Tortunnel trat, wurde in der Ferne ein einzelnes Licht entzündet, weit vorn, auf halbem Weg über dem Fluss. Kommen Sie allein. Ich möchte Ihnen einen Vorschlag machen.
Sie hatte das Schreiben durch das Schlüssellochglas betrachtet, um die Absichten des Verfassers zu prüfen, hatte aber feststellen müssen, dass die bibliomantische Lupe ihr lediglich die Intention von Buchautoren verriet, nicht die von Briefschreibern.
Weil es hier keine Fuhrwerke und Fußgänger gab, war die Schneedecke auf der Brücke fast unberührt. Vereiste Hauben krönten die dunklen Gaslaternen.
Das einsame Licht in einiger Entfernung entpuppte sich als Öllampe mit hohem Glaskolben. Sie war auf dem linken Brückengeländer abgestellt worden. Daneben lehnte ein Mann mit Zylinder, Schal und bodenlangem Mantel, seine Hände steckten tief in den Taschen.
»Schön, dass Sie kommen konnten«, sagte Cedric de Astarac, als sie bis auf fünf Schritt an ihn herangetreten war. Er löste sich vom steinernen Geländer, ging aber nicht auf sie zu. Sein langes schwarzes Haar fiel über den Pelzkragen seines Mantels, sie konnte sein Gesicht nur erahnen. Einmal mehr irritierte sie, wie perfekt sein Englisch war. Nicht die Spur eines französischen Akzents.
»Guten Abend, Cedric.«
»Guten Abend, Mercy. Verzeihen Sie, dass ich keinen weniger zugigen Treffpunkt ausgewählt habe.«
»Sie werden sich etwas dabei gedacht haben.«
Während der fünf Monate, die seit ihrer letzten Begegnung verstrichen waren, hatte sie sich mehr als einmal beim Gedanken an ihn ertappt; oft hatte sie sich gefragt, wie ernst er sie damals eigentlich genommen hatte. Beide waren sie Bibliomanten, sie eine Buchhändlerin, er ein Agent der Adamitischen Akademie. Er hatte herausgefunden, dass Mercy Amberdale nicht der Name war, der ihr bei der Geburt gegeben worden war. Er wusste um ihre wahre Identität als letzte Tochter des untergegangenen Hauses Antiqua. Als Renegatenjäger wäre es seine Aufgabe gewesen, sie zu liquidieren. Stattdessen hatte er ihr das Schlüssellochglas überreicht und war wieder untergetaucht, wie es wohl die schlechte Angewohnheit aller Agenten war.
»Was macht die Jagd auf Abtrünnige?«, fragte sie.
»Nicht mehr mein Metier. Ich habe darum gebeten, mich auf eine andere Aufgabe konzentrieren zu dürfen.«
Die Frage war weniger, ob sie ihm glauben konnte, als vielmehr, ob sie das wollte. Sie wusste zu wenig über die Adamitische Akademie und ihre wahre Macht – und über ihn so gut wie gar nichts. Vielleicht war sein Name wirklich Cedric de Astarac, womöglich war er sogar ein leibhaftiger Marquis. Denkbar auch, dass er nicht einmal Franzose war.
»Und diese andere Aufgabe heißt noch immer Alexandre Absolon?«
Er nickte, und dabei legte sich der Schein der Lampe über seine Züge. Er sah nicht mehr so angeschlagen aus wie bei ihrem letzten Treffen am Cecil Court, trotzdem erschrak sie. Etwas war mit ihm geschehen, und die Wunden, die er davongetragen hatte, schienen diesmal nicht nur äußerlich zu sein. Er sah älter aus und sehr erschöpft.
»Sie haben Ihren Erzfeind also noch nicht gefangen.«
»Er macht es mir nicht leicht.«
Sie lächelte. »Alles andere wäre enttäuschend, nicht wahr?«
Er neigte den Kopf ein wenig, als frage er sich, ob sie ihn verspotten wollte. Ein eisiger Wind wirbelte Eiskristalle vom Brückengeländer und trieb sie über den Schnee. »Kommen Sie, gehen wir ein paar Schritte.«
Er machte eine einladende Handbewegung zum anderen Ende der Brücke. Dort war nichts als Dunkelheit. Hätten sie von hier aus nicht bereits die Lichter des Refugiums erkennen müssen? Aber sie wusste zu wenig über Portale und Übergänge, um sich ernsthaft zu wundern.
Bibliomantische Refugien waren Welten neben der Wirklichkeit, erschaffen mit Hilfe der Buchmagie. Einige von ihnen, so hieß es, hatten bereits zu Zeiten der ehrwürdigen Phaedra Herculanea, der Urmutter aller Bibliomantik, existiert. Die meisten aber waren erst später entstanden. Die Häuser der Adamitischen Akademie, die Herrscher der bibliomantischen Welt, unterhielten eine Gruppe von Refugienschmieden, die Tag und Nacht daran arbeitete, neue Refugien zu entwerfen. Mercys Ziehvater Valentine hatte ihr von einigen dieser Orte erzählt – vor allem von Unika, dem Sitz der Hochschulen –, aber auch er hatte nie einen davon betreten. London sei groß und wunderbar genug, hatte er gesagt, und zugleich denkbar schrecklich. Und welcher Ort könnte bibliomantischer sein als der Cecil Court, das Paradies der Büchernarren?
»Ich weiß so gut wie nichts über ein Refugium namens Nimmermarkt«, sagte sie, als sie zu Cedric aufschloss. Sie war nicht einmal sicher, ob sie den Namen richtig aussprach.
»Das sollte Sie nicht wundern. Kaum jemand weiß, was mit Nimmermarkt geschehen ist.«
Während sie langsam über die Brücke stapften, die Kragen hochgeschlagen und die Schals bis zum Mund gezogen, versuchte Mercy, am anderen Ende etwas auszumachen. Da war eine klobige schwarze Form, vermutlich ein zweiter Torturm wie jener in ihrem Rücken. Dahinter wogte Finsternis.
»Nimmermarkt existiert nicht mehr«, sagte Cedric. »Erinnern Sie sich, dass ich Ihnen einmal erzählt habe, dass Alexandre Absolon ein ganzes Refugium ins Chaos gestürzt hat? Das dort vorne ist alles, was davon übrig ist.«
Je weiter sie gingen, desto deutlicher meinte sie Stimmen zu hören, ein Heulen und Wehklagen, das ebenso gut vom Winterwind in den Mauerfugen stammen mochte.
»Nimmermarkt war eines der hohen Refugien, eines der ersten überhaupt, die von den Häusern des Scharlachsaals erschaffen wurden. Deshalb der deutsche Name, obwohl das Portal dorthin in London liegt.«
Der Scharlachsaal hatte die bibliomantische Welt vor der Akademie regiert. Von den fünf deutschen Familien, die ihn einst gegründet hatten, existierten nur noch drei: Die Häuser Antiqua und Rosenkreutz waren verraten und ausgelöscht worden. Die Cantos, Himmels und von Lohenmuts hatten sich zur Adamitischen Akademie zusammengetan und beherrschten seither die Refugien mit ihren Milizen. Hier in London und anderswo zogen sie die Fäden im Hintergrund, eine geheime Gesellschaft mächtiger Bibliomanten, die durch ihre Ambassadoren und Agenten Einfluss nahm auf das Weltgeschehen.
»Was ist passiert?« Mercy fühlte sich immer unwohler, je näher sie dem dunklen Wabern am Ende der Brücke kamen. »Warum hat Absolon ein ganzes Refugium zerstört?«
»Das ist eine lange Geschichte. Ich glaube, niemand ist in der Lage, ihn wirklich zu verstehen. Selbst ich nicht. Und ich folge seinen Spuren schon seit Jahren.«
Mein Erzfeind, hatte Cedric ihn einmal genannt, meine Nemesis, und Mercy hatte über so viel Dramatik schmunzeln müssen. Seitdem hatte sie jedoch eine Menge eigene Erfahrungen mit Hass und Feindschaft machen müssen und glaubte, ihn besser zu verstehen.
»Fest steht«, sagte er, »dass Absolon in Nimmermarkt etwas entfesselt hat. Er selbst nennt es das Nötige Übel. Es ist eine Art Irrsinn, der das Refugium befallen hat, und es scheint, als hätte Absolon die Wirkung unterschätzt. Tausende haben den Preis dafür zahlen müssen. Ich bin sicher, er arbeitet noch heute daran, das Nötige Übel zu verfeinern und voll und ganz unter seine Kontrolle zu bringen. Falls ihm das gelingt, wird er es sehr viel gezielter einsetzen. Dann gnade uns Gott.«
»Das Nötige Übel«, wiederholte sie leise und horchte wieder auf das Jammern, das über die Brücke heranwehte. Cedrics Jagd auf Absolon war in der Tat weit mehr als eine »unschöne Geschichte von Rache und Gegenrache«, wie er es einmal ausgedrückt hatte.
»Es wird viele Jahrzehnte dauern«, sagte Cedric, »bis dieser Ort wieder bewohnbar ist und zu einem neuen Refugium gestaltet werden kann. Wir beide werden das nicht mehr erleben.«
Sie blieb stehen und hielt ihn am Arm zurück. »Warum erzählen Sie mir davon?«
»Weil Sie verstehen sollen, warum ich vor fünf Monaten einfach verschwunden bin.«
»Sie sind mir keine Rechenschaft schuldig.«
»Absolon ist nicht der Anlass, warum ich Sie heute Abend hergebeten habe, Mercy. Aber er ist der Grund für Ihr Misstrauen, und das möchte ich ausräumen, bevor ich Sie um einen Gefallen bitte.«
Natürlich hatte sie nicht angenommen, dass er sie einfach nur wiedersehen wollte. Nicht ernsthaft. Sie versuchte, sich ihre Enttäuschung nicht anmerken zu lassen.
»Ihnen ist kalt«, sagte er.
»Es ist Winter.«
»Drehen wir um.«
»Wie Sie möchten.« In Wahrheit war sie erleichtert, keinen Schritt weiter in die Richtung des verlorenen Refugiums machen zu müssen.
»Mit dem Passierschein gab es keine Probleme?«, fragte er.
»Ich bin ja hier.«
»Es ist nur ein Stück Karton. Manchmal braucht man mehrere Versuche, bis sich das Portal öffnet. Und Sie haben noch nie einen benutzt, nicht wahr?«
»Sie haben schon wieder in meinen Akten rumgeschnüffelt.«
Er schüttelte den Kopf. »Ich habe nur nichts vergessen, was mit Ihnen zu tun hat.«
»Das klingt ein bisschen unheimlich.«
»Verzeihen Sie.« Zum ersten Mal wirkte er verunsichert, und das erfüllte sie trotz der Kälte und des fernen Wehklagens mit einer gewissen Genugtuung.
Eine Weile stapften sie stumm nebeneinanderher durch den Schnee und näherten sich wieder der Öllampe in der Mitte der Brücke.
»Einen Gefallen soll ich Ihnen also tun«, sagte Mercy schließlich.
»Ja. Und Sie bekommen etwas dafür.«
»Sie hätten einfach fragen können. Ich bin kein Esel, den man mit einer Karotte lockt.«
»Warten Sie, gleich haben wir wieder genug Licht.«
Cedric beschleunigte seine Schritte und trat an die Öllampe. Sie war mehrere Fingerbreit im Schnee auf der Brüstung versunken. Im Hintergrund zogen gelbliche Schwaden über den Fluss.
»Das hier wird Sie interessieren.« Er griff unter seinen Mantel und zog einen Gegenstand hervor, der in Papier eingeschlagen war.
Mercy spürte die bibliomantische Aura bereits, ehe sie ihn entgegennahm. Sie wechselte einen weiteren Blick mit Cedric, bevor sie das Papier abstreifte. Darunter kam eine Flasche zum Vorschein, aus bräunlichem Glas und ohne Etikett. Mercy hob sie mit bebender Hand vor die Öllampe, bis sie im Gegenlicht erkennen konnte, was sie längst ahnte. Im Inneren steckten mehrere Bögen gerollten Papiers.
»Das ist doch nicht –«, begann sie und brach ab, weil sie sehr genau spürte, worum es sich handelte.
»Madame Xus Kapitel des Flaschenpostbuchs«, sagte Cedric. »Das letzte Kapitel, das Ihrem Auftraggeber Phileas Sedgwick noch fehlt, um das Buch zu vervollständigen. Wenn ich richtig informiert bin, hat er Sie gebeten, es ihm zu besorgen. So wie vorher schon die meisten anderen Kapitel, die sich in seinem Besitz befinden.«
»Ich würde es nicht gebeten nennen.«
»Er hat Sie unter Druck gesetzt, ich weiß. Bei Ihrem ersten Versuch, es zu beschaffen, gab es ein« – er zögerte – »ein Unglück.«
»Xu hat Tempests Bruder getötet«, flüsterte sie. »Einen Freund.« Grover war mehr gewesen als das, und sie war sicher, dass Cedric auch das längst wusste.
»Trotzdem hat Commissioner Sedgwick Sie überzeugt, es ein weiteres Mal zu versuchen«, sagte Cedric. »Im Gegenzug hat er ein paar Dinge vertuscht, die Ihnen hätten gefährlich werden können.«
Sie drehte die Flasche in den Händen. »Wer hat das Ding aus Xus Hauptquartier geholt? Sie?«
»Jemand hat ein Gespräch mit ihr geführt. Schließlich hat sie es freiwillig ausgehändigt. So läuft das, wenn sich die Akademie etwas in den Kopf setzt.«
Es verschlug Mercy den Atem, dass die Drei Häuser einflussreich genug waren, um selbst die zweitmächtigste Frau Londons einzuschüchtern. Wahrscheinlich gehorchte ihnen sogar die Königin. Und wenn nicht Victoria, dann doch gewiss ihre Berater und Speichellecker.
»Ich will damit nichts zu tun haben.«
»Kommen Sie schon. Sedgwick liegt Ihnen seit Monaten in den Ohren, dass Sie ihm die Flasche endlich beschaffen sollen. Sie haben ihn wieder und wieder vertröstet.«
»Beschatten Sie mich etwa?«
Er schüttelte den Kopf. »Nein. Ehrenwort. Allerdings hat manch einer großes Interesse an Sedgwick und dem, was er da glaubt, still und heimlich tun zu können. Ihnen mag er ja wie eine mächtige Graue Eminenz erscheinen, aber, glauben Sie mir, die Männer und Frauen, mit denen er sich angelegt hat, sind um ein Vielfaches einflussreicher als er.«
»Wieder die Akademie.«
»Eines der Drei Häuser beobachtet sehr genau, was Sedgwick tut.«
»Heißt das, Sie geben mir das Kapitel im Auftrag der –«
»Ich bin ein Agent, Mercy. Und eigentlich bin ich mit Absolon beschäftigt. Aber das Haus Lohenmut weiß, dass wir beide uns kennen und dass Sie vielleicht auf mich hören, wenn ich Sie bitte, ein Aufgabe zu erledigen.«
Sie hielt ihm die Flasche jetzt am ausgestreckten Arm entgegen. »Warum zum Teufel sollte ich Ihnen vertrauen?«
Er sagte nicht Weil ich Ihr Geheimnis bewahrt habe, aber sie konnte ihm ansehen, dass ihm genau diese Worte durch den Kopf gingen. Es war richtig, er hatte ihr Leben gerettet, als er für sich behalten hatte, dass sie eine Nachfahrin des Hauses Antiqua war. Falls er es für sich behalten hatte. Mit einem Mal war sie da nicht mehr so sicher.
»Haus Lohenmut, hm?«, fragte sie kühl. »Zahlen die Ihren Lohn?«
»Wir Agenten arbeiten für die Akademie und damit für alle Drei Häuser. Aber aus dem Haus Lohenmut stammen traditionell die meisten meiner Vorgesetzten.«
Sie schnaubte verächtlich. »Hier, behalten Sie das Ding.« Als er die Flasche nicht entgegennahm, ließ sie sie vor ihm in den Schnee fallen, drehte sich um und wollte gehen. Das hätte schiefgehen können, aber das war ihr egal.
Er packte sie von hinten an der Schulter. Ihre Finger glitten in die Manteltasche mit ihrem Seelenbuch.
»Warten Sie.« Er zog seine Hand zurück, ehe sie ihn dazu auffordern konnte. »Hören Sie mir bitte erst zu.«
»Ich hab kein Interesse an Ihren Agentenspielchen, Cedric.« Sie wandte sich um und blickte ihm fest in die Augen. »Wir beide allein auf einer Brücke im Nebel, dieses Gerede von Absolons schaurigem Treiben, ein bisschen Weltuntergangsstimmung … Glauben Sie wirklich, dass es so einfach ist, mich vor Ihren Karren zu spannen?«
Er bückte sich und hob die Flasche mit dem Kapitel des Flaschenpostbuches auf. »Absolon hat nichts damit zu tun. Von ihm habe ich Ihnen erzählt, weil ich … weil ich wollte, dass Sie wissen, was ich tue. Warum ich mich nicht mehr gemeldet habe.«
»Nur weil Sie mich verschont haben, verpflichtet Sie das nicht zu regelmäßigen Anstandsbesuchen.« Sie wollte ihn verletzen, weil er ihr das Gefühl gegeben hatte, dass es hier um sie beide ginge. Bis er diese verteufelte Flasche ins Spiel gebracht hatte.
»Hören Sie sich einfach alles an, was ich zu sagen habe.« Er sah nicht besonders betroffen aus, was sie noch zorniger machte. »Die von Lohenmuts haben früher ähnliche Versuche angestellt wie Sedgwick, aber sie sind nie so weit gekommen wie er. Wenn er das letzte Kapitel in Händen hält, wird er der Erste sein, dem es gelungen ist, die Teile des Buchs wieder zusammenzufügen.«
»Wenn es den von Lohenmuts um das Buch geht, warum nehmen sie ihm die übrigen Kapitel nicht einfach ab und bringen das Ganze selbst zu Ende?«
»Weil Sedgwick seit langem Studien betreibt, um den Inhalt des Buches zu verstehen. Es ist in einem geheimen Code verfasst, der sich nur mit Hilfe aller Kapitel vollständig entschlüsseln lässt. Sedgwick muss bereits weit gekommen sein, ihm dürften nur noch ein paar Details fehlen, und diese Seiten werden sie ihm liefern. Mag sein, dass er innerhalb von ein, zwei Tagen bereit ist, das Buch einzusetzen. Die von Lohenmuts würden wahrscheinlich Jahre brauchen, um an diesen Punkt zu kommen.«
»Also lassen sie ihn tun, was immer er da auch tut, und schlagen erst zu, sobald er am Ziel ist. Er erledigt die Arbeit, und sie ernten Ruhm und Ehre.«
»Es ist ein wenig komplizierter, aber ja – im Kern ist es wohl das, was sie vorhaben.«
»Und ich soll tun, als wüsste ich von nichts, soll ihm das Kapitel geben – und dann? Nach Hause gehen und die ganze Sache vergessen?«
Tatsächlich war das ein verlockender Gedanke. Ihr Versprechen, ihm Madame Xus Kapitel zu beschaffen, wäre eingelöst und ihr Pakt mit Sedgwick endgültig Geschichte. Sedgwick, so glaubte sie manchmal, war ein Teufel in Menschengestalt, ein Ungeheuer hinter der Maske des Londoner Polizeichefs, das über Leichen ging, um seine Ziele zu erreichen. Andererseits hatte er sie und Tempest davor bewahrt, wegen Mordes im Gefängnis zu landen. Sie mochte ihn nicht, hatte sogar Angst vor ihm, aber sie stand auch in seiner Schuld.
Cedric ahnte wohl, was ihr durch den Kopf ging. »Sie fühlen sich Sedgwick verpflichtet, und das ehrt Sie. Aber Sie sind nicht für das verantwortlich, was er hinter geschlossenen Türen treibt. Er erwartet von Ihnen Madame Xus Kapitel – und genau das werden Sie ihm bringen. Damit sind Sie ihn endlich los.«
»Ich erfülle mein Versprechen und lasse Sedgwick zugleich ins offene Messer laufen. Das meinen Sie doch, nicht wahr?«
»Wenn Sie es so dramatisch ausdrücken wollen.«
»Jemand hat das clever eingefädelt.«
»Das ist in etwa das, womit wir Agenten uns Tag für Tag herumschlagen müssen.«
»Ihre Berufswahl, nicht meine.«
Erneut reichte er ihr die Flasche mit den Seiten. »Geben Sie ihm das Buch und bitten Sie ihn, dabei sein zu dürfen, wenn er es zusammenfügt und benutzt. Sie müssen nichts tun, als ihn zu beobachten. Und danach Bericht erstatten über das, was Sie mit angesehen haben.«
»Ich soll den von Lohenmuts also auch noch erklären, wie man das verdammte Buch benutzt?«
»Wollen Sie denn nicht wissen, was Sedgwick überhaupt damit erreichen will?«
»Von mir aus kann er mit den Seiten sein Büro tapezieren.«
Sein Blick verriet Skepsis, aber in dieser Sache schätzte er sie falsch ein.
Zweieinhalb Jahre lang hatte sie seltene Bücher für reiche Sammler besorgt, oft unter den widrigsten Umständen, und sie war stets mit äußerster Diskretion vorgegangen. Natürlich war sie dann und wann neugierig gewesen, aber sie war auch gut darin, ihre Wissbegier im Zaum zu halten. Sie hatte Sedgwick während dieser Zeit fünf Kapitel des Flaschenpostbuchs beschafft, aus gut gesicherten Bibliotheken in England und Schottland, und dabei war sie kein einziges Mal in Versuchung geraten, eine der Flaschen zu öffnen und die losen Seiten darin zu untersuchen. Die Ware, die sie ihren Kunden brachte, ging sie nichts an.
»Ich weiß nicht viel über das Flaschenpostbuch«, sagte sie. »Ich hab auch nie vorgehabt, mich tiefer als nötig in diese Geschichte hineinziehen zu lassen, nur um ein paar Wissenslücken zu füllen.«
»Aber diese Geschichte kreist doch längst um Sie! Die Akademie kennt die Rolle, die Sie spielen. Und Sedgwick setzt Sie unter Druck –«
»Was Ihnen natürlich nicht im Traum einfallen würde.«
»Wir Agenten sind Soldaten. Wir befolgen Befehle. Ob uns das gefällt oder nicht.«
Sie schenkte ihm ein trauriges Lächeln und nickte langsam. »Ich kann Ihnen nicht helfen, Cedric. Nicht mit Sedgwicks Buch und erst recht nicht bei Ihren eigenen Problemen.«
»Meinen Problemen?«
»Ihren Zweifeln. Sehen Sie sich uns doch an! Eines Ihrer Probleme bin ich. Sie wollen das hier nicht tun und fühlen sich trotzdem dazu verpflichtet. Viel lieber würden Sie da draußen sein und weiter mit Absolon Katz und Maus spielen, als sich mit mir und diesem Mist herumzuschlagen.« Sie hatte seine Besessenheit von Absolon schon damals durchschaut, und dass dieses Gespräch ausgerechnet hier, unmittelbar vor dem zerstörten Refugium, stattfand, war nur ein weiteres Indiz dafür. Aus irgendeinem Grund wollte er, dass sie ihn verstand, wirklich begriff, was er tat. Und sie fragte sich, ob ihr das schmeicheln sollte oder ob er auch damit nur versuchte, sie zu manipulieren. Sie wurde einfach nicht schlau aus ihm.
»Ich dachte, dass ich Sie mag, Cedric. Vielleicht war das ein Fehler. Denn bei jedem anderen Menschen, den ich mag, fühlt sich das nicht so an wie bei Ihnen. Das hätte mir zu denken geben sollen, bevor ich Ihrer Einladung gefolgt bin.« Damit drehte sie sich um und ging.
»Mercy, bitte.«
Sie stapfte weiter, folgte ihren Spuren im Schnee und fand, dass sich der Wind auf ihren Wangen jetzt noch schneidender anfühlte.
»Mercy!«
Sie schloss die Augen, stieß eine Atemwolke aus und blieb stehen. Als sie über die Schulter blickte, war er unmittelbar hinter ihr. Die Flasche mit den Seiten hielt er noch immer in beiden Händen. Einen Augenblick lang war das Schweigen zwischen ihnen wie eine unsichtbare Wand.
»Sedgwick vertraut Ihnen«, sagte er schließlich. »Haben Sie sich einmal gefragt, warum das so ist?«
Sie achtete darauf, möglichst förmlich zu klingen. »Meine Arbeit für ihn war zufriedenstellend. Am Ende hat er mich einfach nur ausgenutzt.«
Er schüttelte den Kopf. »Wenn man Sedgwick über einen längeren Zeitraum beobachtet, weiß man, dass er niemanden an sich heranlässt. Nicht einmal die Menschen, mit denen er seit Jahren zusammenarbeitet. Abgesehen vielleicht von diesem Lakaien, diesem Sharpin, der ihm auf Schritt und Tritt folgt. Aber auch ihn benutzt er nur wie ein Werkzeug. Sie hingegen … Aus irgendwelchen Gründen zeigt er für Sie so etwas wie Zuneigung.«
»O ja«, rief sie spöttisch, »das wird es sein. Er mag mich.«
»Er sieht sich als Ihr Mentor, Ihr Beschützer. Vielleicht mehr als das.«
»Worauf wollen Sie hinaus?« Sie trat einen Schritt auf ihn zu, bis ihr Gesicht unmittelbar vor seinem war. »Sagen Sie das, weil ich meinen leiblichen Vater nicht kenne? Wollen Sie mir einreden, Sedgwick könnte mein Vater sein, weil Ihnen das gerade in den Kram passt? Das ist sogar unter Ihrem zweifelhaften Agentenniveau.«
»Ich bitte Sie nur, sein Vertrauen zu nutzen, um an ihn heranzukommen.« Er senkte seine Stimme. »Und ich will vermeiden, Ihnen drohen zu müssen.«
Wenn er ihr einen Schlag mit der Faust versetzt hätte, hätte sie das kaum härter treffen können. »Mir zu drohen?«
Zum ersten Mal wich er ihrem Blick aus, wenn auch nur kurz. »Jeden Tag werden in London ganze Straßenzüge abgerissen, um die Untergrundbahn auszubauen oder die alten, maroden Häuser durch neue zu ersetzen. Es passiert längst überall, bald auch in Soho und St Giles. Der Cecil Court wird irgendwann ebenfalls auf einem dieser Abrisspläne auftauchen. Das könnte in zehn oder fünfzehn Jahren sein – oder schon im nächsten Monat.«
Sie schnappte vor Entrüstung nach Luft. Vor allem aber aus maßloser Enttäuschung. »Großer Gott, Cedric …«
»Sie lassen mir keine Wahl.«
»Sie tun nur Ihre Pflicht, nicht wahr?« Ihre Stimme war rau geworden, und das lag nicht am Frost. »Nur Ihre Scheißpflicht!«
»In London geschieht kaum etwas, in dem die Akademie nicht ihre Finger hat. Und nicht nur hier. Es ist dasselbe in Paris, Berlin und weiß der Teufel wo. Wenn die Drei Häuser – oder eines davon – durchsetzen wollen, dass ein bestimmtes Viertel früher dem Erdboden gleichgemacht wird als geplant, dann kostet sie das« – jetzt schien er fast ein wenig verzweifelt – »es kostet sie nichts. Die haben ihre Ambassadoren überall. Und eigentlich haben sie gewollt, dass ich Ihnen sofort drohe, damit Sie gar nicht erst auf die Idee kommen, sich querzustellen. Ich dachte, ich könnte Sie überzeugen, aber nun sage ich es Ihnen, wie es ist: Die werden den Cecil Court abreißen, wenn Sie nicht tun, was sie verlangen. Und es gibt nichts, was ich dagegen machen könnte.«
Sie schüttelte den Kopf. »Muss ich Ihnen wirklich sagen, was Sie hätten machen können, Cedric? Sie hätten einen anderen schicken können. Irgendjemanden. Sie hätten es nicht selbst tun müssen. Aber die Wahrheit ist, dass Ihnen völlig gleichgültig ist, was ich über Sie denke.«
»Mercy, ich –«
»Geben Sie das her.« Sie riss ihm die Flasche aus den Händen und war für einen Moment in Versuchung, sie über die Brüstung in den Fluss zu werfen. Vielleicht gehörte sie dort ja hin, zurück ins Wasser, woher sie einst gekommen war.
Er musste dieselbe Befürchtung haben und schien bereit, sie aufzuhalten.
Doch dann öffnete Mercy nur ihre Tasche und steckte die Flasche hinein. »Sagen Sie denen, dass Sie Erfolg hatten. Sie haben das dumme Ding eingeschüchtert und dazu gebracht, den Befehl zu befolgen. Es ist alles genauso gelaufen wie geplant. Sie können sehr stolz auf sich sein, Cedric.«
Diesmal hörte sie seine Schritte im Schnee, als er ihr ein Stück weit folgte, doch dann blieb er stehen und ließ sie wortlos gehen. Sie war heilfroh darüber.
Schließlich trat sie in den Schatten des Torturms, dann in das Licht der einsamen Gaslaterne am Ufer. Die Frau mit der Taube saß noch immer dort und starrte sie an. Als Mercy sich umdrehte, waren der Turm und die Brücke bereits verschwunden, fortgeweht wie Nebelfetzen über der Themse.
Trotz der Alten kam es ihr vor, als wäre sie der einzige Mensch weit und breit. Sie spürte das Gewicht der Flasche, mehr noch den übrigen Ballast, den sie gern auf der Brücke zurückgelassen hätte, und machte sich auf den Heimweg.
3
Vor ihr klaffte ein roter Vorhang auseinander, als Mercy den ehrwürdigen Lesesaal des British Museums betrat. Er befand sich in einem mächtigen Kuppelbau, der vor gut zwei Jahrzehnten im Innenhof des Museums errichtet worden war. Entlang der Wand der kreisrunden Halle verliefen drei Etagen aus eisernen Bücherregalen, die beiden oberen befanden sich auf Galerien mit kunstvollen Balustraden. Darüber wölbte sich die gigantische Kuppel.
So früh am Morgen war Mercy eine der Ersten im Saal, draußen herrschte noch Dunkelheit. Die Lesetische waren sternförmig angeordnet, wuchtige Ungetüme aus Eiche und Metall mit grünem Bezug. In der Mitte eines jeden Tisches war ein Sichtschutz errichtet worden, der verhinderte, dass sich gegenübersitzende Leser bei der Lektüre störten.
Vor anderthalb Jahren hatte Mercy – selbstverständlich inoffiziell – über einen Mittelsmann zwei Aufträge des leitenden Bibliothekars angenommen. Kurz zuvor hatte der rumänische Botschafter in London ein seltenes Buch mit Liebesgedichten eines georgischen Poeten entliehen, um es, wie sich herausstellte, seiner jungen Ehefrau zum Geschenk zu machen. Als die Bibliothek das kostbare Exemplar zurückforderte, berief der Botschafter sich auf seinen Diplomatenstatus und lehnte die Rückgabe ab. Daraufhin war Mercy des Nachts in die Botschaft in Mayfair eingedrungen, hatte die Wachleute überlistet und den Band vom Nachttisch der Botschaftergattin entwendet.
Ihr zweiter Auftrag war um einiges kniffliger gewesen. Auf einem Bücherstapel auf der oberen Galerie des Lesesaals waren zwei mittelalterliche Codices zerfleddert worden, obwohl sich zum fraglichen Zeitpunkt niemand dort oben aufgehalten hatte. Nach ein paar ergebnislosen Befragungen war Mercy schließlich auf Reste von Vogelkot auf der nahen Balustrade gestoßen, außerdem auf eine schwarze Vogelfeder. Man hatte ihr erklärt, dass sich beim Lüften gelegentlich Vögel durch eines der großen Kuppelfenster in den Saal verirrten. Bevor sie von selbst den Weg nach draußen fanden, hinterließen sie manchmal ihren Schmutz auf den Geländern. So war Mercy den Tätern auf die Spur gekommen. Der silberne Buchschnitt der beiden Bände musste im Sonnenlicht gefunkelt haben, und so hatten Elstern mehrere Seiten herausgerissen und durch das offene Fenster davongetragen.
Drei Tage lang war sie auf den weitläufigen Dächern des Museums herumgeklettert, bis sie schließlich das Nest eines verdächtigen Vogelpaars entdeckt und die Seiten geborgen hatte, wenn auch in desolatem Zustand. Die Buchrestauratoren waren dennoch überglücklich gewesen, und zum Dank hatte Mercy einen privilegierten Leserausweis erhalten, mit dem es ihr erlaubt war, die Bibliothek zwei Stunden vor der offiziellen Öffnung zu betreten und am Abend länger zu bleiben.
Bis vor einem halben Jahr hatte sie den Ausweis kein einziges Mal benutzt. Erst seit sie sich mit Tempest und Philander die engen Räume über dem Liber Mundi teilte, kam sie gelegentlich her, um ungestört nachdenken zu können.
Da nur drei Dutzend Gelehrte, ein paar Adelige und Politiker, außerdem die Mitglieder des Königshauses einen solchen Ausweis besaßen, war sie früh morgens fast allein im Saal. Der diensthabende Bibliothekar wanderte auf der Suche nach einem Buch über die Galerien, sie hörte, wie seine Schritte über ihr näher kamen und sich wieder entfernten. Es war gerade mal kurz nach sieben. Seit der Begegnung mit Cedric hatte sie keinen Schlaf gefunden. Hellwach hatte sie in ihrem Bett gelegen und den Lichtschein angestarrt, den die Gaslaterne von der anderen Straßenseite unter die Zimmerdecke warf.
Schließlich war sie aufgestanden und durch Soho und St Giles nach Bloomsbury gewandert. Selbst entlang der verwinkelten Nebenstraßen, wo keine Kutschenräder den Schneematsch über die Gehwege verteilten, war es kaum mehr als eine Meile vom Cecil Court zum Museum. Trotzdem war sie nach ihrem Marsch durch eine harsche Masse aus Eis, Kohlenstaub und Pferdekot beschmutzt bis zu den Knien. Niemand störte sich daran, weil es jedem anderen Fußgänger im Winter ebenso erging.
Nachdem sie sich an ihrem Leseplatz in der Bibliothek vergewissert hatte, dass sie nicht beobachtet wurde, nahm sie die Flaschenpost aus ihrer Tasche und legte sie vor sich auf den Tisch. Nachdenklich rollte sie sie mit der Fingerspitze vor und zurück und erwischte sich bei der Frage, was wohl ihre Mutter täte, wenn man sie vor eine derartige Entscheidung stellte. Annabelle Antiqua hätte die Initiative ergriffen, und vermutlich wäre dabei jemand ums Leben gekommen.
Sie wusste nicht viel über ihre Mutter, und das wenige genügte, um sie zu verachten. Am schlimmsten aber war, dass Mercy ihr keine Fragen über ihren Vater stellen konnte. War es wirklich Benjamin Cutter, wie jene Dokumente nahelegten, die Florence Oakenhurst ihr übergeben hatte? Ein drittklassiger Verfasser von Geschichten über Revolverhelden und Rothäute, der seit Jahren durch den amerikanischen Westen streifte? Ein Säufer, der sich mehr für Saloons und andere dubiose Etablissements im amerikanischen Grenzland interessierte als für eine Tochter, die er auf dem Papier zwar als Erbin eingesetzt, aber seit fast zwanzig Jahren nicht mehr gesehen hatte?
Sie verdrängte den Gedanken an ihn wie an die Gänsehaut, die sie von draußen mit hereingebracht hatte. Die Kälte konnte sie aussitzen, bald würde ihr ganz von selbst wieder wärmer werden, und sie hoffte, dass es ihr mit den Fragen nach ihrer Herkunft ähnlich erging. Vielleicht würden sie alle irgendwann keine Rolle mehr spielen, wären nur ein paar Fragezeichen mehr, wie sie sich im Laufe eines Lebens eben anhäuften.
Die Flasche kullerte mit einem hohlen Laut gegen den Sichtschutz zum Platz gegenüber. Mercy betrachtete die winzig beschrifteten Seiten, die im Inneren eingerollt und mit einem Stück Schnur umwickelt waren. Durch das dunkle Glas hätte sie selbst gewöhnlichen Text kaum entziffern können, und das galt erst recht für die codierte Geheimschrift. Sie griff in ihre Tasche und zog das Schlüssellochglas hervor, ein bibliomantisches Wunderwerk in Form einer schweren Lupe mit kunstvoll verziertem Rahmen. Blickte sie durch das Schlüssellochglas in ein aufgeschlagenes Buch, verriet es ihr die wahre Absicht des Verfassers.
Sie legte es auf die Flasche und schaute hindurch. Für gewöhnlich dauerte es nur wenige Augenblicke, bis sie die Empfindungen des Autors beim Schreiben wie ein eigenes Gefühl wahrnehmen konnte. Diesmal jedoch geschah nichts. Vielleicht lag es am Flaschenglas. Kurz spielte sie mit dem Gedanken, den versiegelten Korken zu öffnen und die Seiten herauszunehmen. Doch das hatte sie bei keinem der fünf anderen Kapitel des Flaschenpostbuches getan, die sie Sedgwick besorgt hatte, und es kam ihr falsch vor, jetzt damit zu beginnen. Zumal sie nicht wusste, ob sie durch das Schlüssellochglas angesichts des Geheimcodes überhaupt etwas erkennen würde. Dafür würde Sedgwick auf den ersten Blick bemerken, dass die Flasche geöffnet worden war. Sie wollte um jeden Preis verhindern, dass er ihr misstraute, um nicht Gefahr zu laufen, dass er Tempest und sie doch noch als Mörder von Edward Thorndyke verhaften ließ. Tempest hatte in Notwehr geschossen, um Mercy zu retten, aber das würde sich Monate später kaum noch beweisen lassen.
Sie schob das Schlüssellochglas zurück in ihre Tasche. Die Schritte des Bibliothekars auf der Galerie verrieten, dass er sich auf seiner Runde wieder ihrem Platz näherte, darum legte sie ein aufgeschlagenes Buch auf die Flasche. Als sie hochsah, nickte der Mann ihr von oben freundlich zu und ging weiter. Sobald er fort war, stellte sie die Flasche aufrecht, verschränkte die Hände davor auf der Tischplatte und stützte ihr Kinn darauf. Wie hypnotisiert betrachtete sie die Seiten hinter dem braunen Flaschenglas und fragte sich, welches Geheimnis sie bergen mochten, dass sowohl Sedgwick als auch den von Lohenmuts kein Preis zu hoch dafür war.
Sie selbst wusste kläglich wenig über das Flaschenpostbuch, nur das wenige, was der Besserwisser ihr erzählt hatte. Demnach war es im 14., vielleicht auch im 16. Jahrhundert von einem Bibliomanten, Alchimisten und Philosophen namens Barrabas de Barrabas verfasst worden – offenkundig ein Pseudonym, das in keinem anderen Zusammenhang auftauchte. Barrabas, so hieß es, hatte versucht, ein Tor zwischen Fiktion und Wirklichkeit zu öffnen. Mit Hilfe seiner Anleitung sollte es einem Bibliomanten möglich sein, die Welt eines Buchs zu betreten – oder die Figuren aus einem Buch in die Realität herüberzuholen.
Für Mercy klang das nach einem Hirngespinst. In der Literatur fanden sich vereinzelte Berichte aus dritter und vierter Hand darüber, wie es Barrabas schließlich gelungen sei, die Grenze zu den Büchern zu zerreißen – ehe ihm die Gefahren bewusst geworden waren, die eine unkontrollierte Vermischung von Wahrem und Erfundenem mit sich brachte. Allerdings hatte er es nicht über sich gebracht, sein Lebenswerk zu vernichten und das einzige Exemplar seines Buchs zu verbrennen. Stattdessen hatte er die Kapitel auf acht Flaschen verteilt. Während einer Schiffsreise von Marseille nach Malta hatte er sie über Bord geworfen, in weitem Abstand voneinander, und war danach selbst nie wieder in Erscheinung getreten. Ob er sich zuletzt in die See gestürzt oder aber unter seinem wahren Namen weitergelebt hatte, war nicht überliefert. Die Flaschen waren im Laufe der Jahrhunderte wie durch ein Wunder wiederaufgetaucht und hatten ihre Wege in die Sammlungen exzentrischer Buchliebhaber gefunden. Zwei davon hatte Sedgwick selbst aufgestöbert, fünf weitere hatte Mercy ihm besorgt.
Und nun blickte sie auf das achte Kapitel, das einzige, das zur Vervollständigung von Barrabas’ Aufzeichnungen fehlte. Darin steckten jene Informationen, die Sedgwick benötigte, um den Geheimcode in seinen letzten Feinheiten zu entschlüsseln. Zuletzt hatte er Mercy immer nachdrücklicher aufgefordert, ihm das fehlende Kapitel zu bringen. Dass er nicht kurzerhand Polizisten beauftragt hatte, Xus Hauptquartier in Limehouse zu stürmen, war ein Beweis dafür, wie weitreichend der Einfluss der Chinesin war. Andererseits war es der Akademie gelungen, Xu zur Herausgabe des Kapitels zu überreden; das ließ erahnen, über welche Machtfülle die Drei Häuser geboten. Mercy wurde schlecht bei der Vorstellung, dass sie ins Visier dieser Leute geraten war, und dass alles von dieser unscheinbaren Flaschenpost abzuhängen schien, diesem trüben, verkrusteten Glasbalg, der auf wundersame Weise die Jahrhunderte überdauert hatte.
Wieder näherten sich die Schritte des Bibliothekars. Diesmal ließ sie die Flasche in ihrer Tasche verschwinden, stand auf und eilte zum Ausgang. Die Schritte hatten hinter ihr innegehalten, und sie wagte nicht, sich umzuschauen. Cedric hatte behauptet, sie nicht beschatten zu lassen – aber irgendjemand tat es wohl, sonst hätte die Adamitische Akademie nicht so viel über ihre Verbindung zu Phileas Sedgwick gewusst.
Sie eilte durch die hohen Gänge und Hallen, bis sie endlich die breite Freitreppe des Museums erreichte und wieder durchatmen konnte. Hinter ihr erhob sich die Fassade mit ihren weißen Säulen wie ein antiker Tempel.
»Schlecht geschlafen?«, fragte eine Männerstimme. »Sie sehen furchtbar aus. Aber es ist ja noch früh. Kann also nur besser werden.«
»Mister Sharpin.« Sie gab sich keine Mühe, ihre Abneigung zu verbergen.
»Miss Amberdale.«
Etwa fünf Schritt entfernt stand auf der obersten Stufe ein Ungetüm von einem Mann und knackte Nüsse zwischen Daumen und Zeigefinger; auf der Treppe lag bereits eine stattliche Menge leerer Schalen. Er trug einen langen, braunen Kutschermantel, aus dessen Stoff man mühelos Kleidung für zwei normal gebaute Menschen hätte schneidern können. Sein schwarzes Haar war von Grau durchzogen, ebenso der buschige Backenbart, seine Hände waren groß wie Heugabeln. Seit Jahren führte Sharpin die Zügel von Sedgwicks Droschke und erledigte jedwede Drecksarbeit für ihn.
»Der Commissioner schickt mich.«
»Was will er?« Ihre Finger lagen auf der Tasche mit dem Kapitel des Flaschenpostbuches. Sharpin war nur ein Handlanger und konnte die bibliomantische Aura der Seiten nicht spüren. Trotzdem war nicht auszuschließen, dass er etwas darüber wusste.
»Mister Sedgwick erwartet Sie um drei im Hotel Savoy. Wie üblich in der Lobby.«
»Ein bestimmter Anlass?«
»Ist wohl anzunehmen.«
»Herrgott, Sharpin, was genau hat er gesagt?«
Er blinzelte sie aus seinen schmalen Augen an, kam näher und blickte von oben auf sie nieder wie ein Raubvogel aus einer Baumkrone. »Könnte sein, dass Mister Sedgwick die Geduld verliert. Könnte sein, dass er sich fragt, warum Sie ihn so lange hinhalten.«
Es stimmte, dass sie die Beschaffung des letzten Kapitels immer wieder hinausgezögert hatte, und es war keine Überraschung, dass Sedgwick ihr das übelnahm.
Sie wich keinen Fingerbreit zurück. »Behalten Sie Ihre Vermutungen für sich, Sharpin. Bürsten Sie Pferde, oder kratzen Sie Dreck aus Hufen – tun Sie, was Sie eben so tun. Er hat Sie geschickt, um mir eine Nachricht zu überbringen. Wenn das also alles war …«
Sein rechter Mundwinkel hob sich zur Andeutung eines Lächelns, das sie erschaudern ließ. »Ich kenne solche wie Sie, Miss Amberdale. Weibsbilder, die sich für was Besseres halten und Herrschaften wie Mister Sedgwick an der Nase rumführen wollen. Bei ihm wird Ihnen das nicht gelingen. Irgendwann wird er mir befehlen, Sie auf weniger höfliche Weise an Ihre Abmachung zu erinnern.«
Sie wunderte sich nicht über seine plumpe Drohung, sondern nur darüber, dass Sedgwick ihn derart ins Vertrauen zog. Sie schwor sich, Sharpin niemals zu unterschätzen.
»Verfolgen Sie mich eigentlich?«, fragte sie. »Beobachten Sie, was ich so tue den ganzen Tag?«
»Nehmen Sie sich nicht zu wichtig, Miss Amberdale.«
»Woher wussten Sie dann, dass Sie mich hier finden würden?«
Er lachte leise. »Commissioner Sedgwick braucht mich nicht, um ihren Rockzipfeln nachzulaufen, Miss Amberdale. Er hat genügend Augen und Ohren auf den Straßen.« Mit einem Nicken deutete er auf den weiten Vorplatz des Museums, der so früh am Morgen nahezu menschenleer war. Sedgwicks Fuhrwerk stand draußen am schmiedeeisernen Tor zur GreatRussell Street. Erst als sie genauer hinsah, bemerkte sie den Bobby vor den Fassaden auf der anderen Straßenseite, einen der schwarz gekleideten Streifengänger der Polizei. Vor einigen Jahren hatten sie ihre Zylinder gegen schalenförmige Helme eintauschen müssen und waren seither schon von weitem zu erkennen.
»Ist das Ihr Ernst?«, fragte sie. »Sedgwick lässt mich von Polizisten überwachen?«