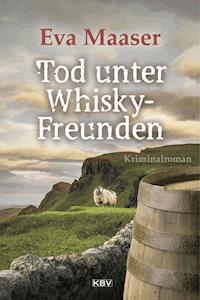5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein prachtvoller Roman: Entdecken Sie „Der Paradiesgarten“ von Eva Maaser jetzt als eBook. Gibt es den Garten Eden wirklich – jenen Ort, an dem die Geschichte der Menschheit begann? Im Jahre 1200 wird die Suche nach dem Paradies auf Erden für den Benediktinernovizen Christoph zur heiligen Aufgabe, aber auch zur Obsession. Seine gefahrvolle Reise führt ihn nach Konstantinopel, nach Kairo und Bagdad ... und schließlich weit über die Grenzen des Vorstellbaren hinaus: Sein Verlangen ist so groß, dass er aus der Zeit gerissen wird. Christoph durchwandert die Jahrhunderte, die prachtvollen Gärten des Orients, das Versailles der Renaissance, das England des 18. Jahrhunderts – doch wird er dem Mysterium, das sein Leben bestimmt, jemals auf die Spur kommen? Jetzt als eBook kaufen und genießen: „Der Paradiesgarten“ von Eva Maaser. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1087
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Über dieses Buch:
Gibt es den Garten Eden wirklich – jenen Ort, an dem die Geschichte der Menschheit begann? Im Jahre 1200 wird die Suche nach dem Paradies auf Erden für den Benediktinernovizen Christoph zur heiligen Aufgabe, aber auch zur Obsession. Seine gefahrvolle Reise führt ihn nach Konstantinopel, nach Kairo und Bagdad … und schließlich weit über die Grenzen des Vorstellbaren hinaus: Sein Verlangen ist so groß, dass er aus der Zeit gerissen wird. Christoph durchwandert die Jahrhunderte, die prachtvollen Gärten des Orients, das Versailles der Renaissance, das England des 18. Jahrhunderts – doch wird er dem Mysterium, das sein Leben bestimmt, jemals auf die Spur kommen?
Über die Autorin:
Eva Maaser, geboren 1948 in Reken (Westfalen), studierte Germanistik, Pädagogik, Theologie und Kunstgeschichte in Münster. Sie hat mehrere erfolgreiche Krimis, historische Romane und Kinderbücher veröffentlicht.
Bei dotbooks erschienen bereits Eva Maasers Kriminalromane »Der Clan der Giovese«, »Das Puppenkind«, »Tango Finale«, »Kleine Schwäne« und »Die Nacht des Zorns«. Kommissar Rohleffs erster Fall »Das Puppenkind« ist auch im Sammelband »Tatort: Deutschland« erhältlich.
Eva Maaser veröffentlichte bei dotbooks außerdem ihre historischen Romane »Der Geliebte der Königsbraut«, »Der Hüter der Königin«, »Der Moorkönig«, »Die Rückkehr des Moorkönigs« und »Die Astronomin«. Zwei ihrer historischen Romane sind auch im Doppelband unter dem Titel »Der Geliebte der Königsbraut & Der Hüter der Königin« erhältlich.
Zudem erschienen bei dotbooks Eva Maasers Kinderbuchserien um Leon und Kim: »Leon und der falsche Abt«, »Leon und die Geisel«, »Leon und die Teufelsschmiede« und »Leon und der Schatz der Ranen«, »Kim und die Verschwörung am Königshof«, »Kim und die Seefahrt ins Ungewisse« und »Kim und das Rätsel der fünften Tulpe«.
***
eBook-Neuausgabe Dezember 2014
Copyright © der Originalausgabe 2001 Rütten & Loening Berlin GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2014 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Atelier Nele Schütz, München, shutterstock/Evdokimov Maxim
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH
ISBN 978-3-95520-809-7
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Der Paradiesgarten« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Eva Maaser
Der Paradiesgarten
Roman
dotbooks.
Meiner Mutter Wally Sewald gewidmet
Erster Teil
Kapitel 1
Tegernsee
1
Die Luft roch nach Schnee. Wie Rauchschwaden hingen dichte Wolken tief über den schneebedeckten Bergen, dunkler als die Wolken schimmerte der Tegernsee, die weite Fläche des Wassers lag eingebettet zwischen den Hängen. Träge stießen Eisschollen aneinander, erzeugten im Zusammenprall einen dumpfen Laut, der sich bis zum Ufer fortsetzte, an den Mauern des Klosters brach und gleichsam in der Kälte erstarrte. Die ungefügen Steinmauern erhoben sich seeseitig direkt aus dem Wasser, sie umzogen in einem großen, unregelmäßigen Bogen die Benediktinerabtei mit ihren weitläufigen Gärten. Ein Ort der Stille, des Schweigens, an dem sich nichtiges Geschwätz und Geplapper verbat, selbst das Zwitschern der Vögel war gänzlich verstummt. Noch am frühen Morgen war ein Vogel erfroren aus dem undurchsichtig grauen Himmel in den verharschten Schnee herabgefallen. Das Leben schien in der Eishand des Winters erstickt.
Wo ein paar Steine aus der Mauerbrüstung herausgebrochen waren, hoben sich die braunen Kutten zweier Mönche vom Schneegrau der Gartenbeete ab. Die Hände tief in die Ärmel gesteckt, verharrten sie, die Köpfe dem Mauerschaden zugewandt, einen Augenblick fügten sich die Männer in die Unbewegtheit der Gartenlandschaft, als hätte der Winter auch sie in Todesstarre versetzt.
Dann aber stampfte der eine mehrmals auf, um das Blut in den nackten, sandalenbeschuhten Füßen zirkulieren zu lassen. Bruder Melchior, der Prior des Klosters, war klein und mager, sein Gesicht prägten scharfe Züge, die auf Askese hindeuten mochten, noch schärfer wirkten die Augen, die eine mögliche Begründung der Askese mit Demut oder schlichter Frömmigkeit in Frage stellten. Melchior war gekommen, um den Schaden an der Mauerkrone zu besichtigen. Er zog die Kutte aus schwerem Wolltuch enger um sich, Ärger glomm in seinem Blick auf, als er den Bruder Gärtner neben sich musterte, den die Kälte augenscheinlich nicht im geringsten anfocht. Aus Anselmus' Sandalen stach Stroh hervor, das die Füße wärmte, der untersetzte Körper des Bruders wirkte trotz vorgeschrittenen Alters unverbraucht kräftig, von genug Lebensenergie durchglüht, um der unwirtlichen Witterung zu trotzen, der Atem wölkte vor dem derben Bauerngesicht. Der Mauerschaden war längst nicht mehr Gegenstand ihres Gesprächs.
»Gott schuf gen Osten einen Garten in Eden ...« Melchior bediente sich eines psalmodierenden Tones, um seiner dünnen Stimme Ausdruck und den Worten Nachdruck zu verleihen.
Eigentlich nur für den Mitbruder bestimmt, hallten die Worte in der stillen Luft, der Klang trieb über die Mauer hinweg. Von der anderen Seite her überragte sie eine Eberesche, einer ihrer Äste reichte an die bröckelige Stelle heran und konnte immerhin Wegelagerer und anderes Gesindel verleiten, ins Klostergelände einzudringen. Eventuell hätte den beiden Mönchen, wenn sie sich die Mühe gemacht hätten, über die Mauer zu spähen, auch das Lumpenbündel Sorge bereitet, das sich am Fuß des Baumes als dunkler Fleck im Schnee ausmachen ließ, der durch den Kontrast an dieser Stelle heller schimmerte als überall sonst unter dem wintertrüben Himmel.
Einem Wunder gleich belebte sich das Lumpenbündel durch Melchiors Stimme. Weiße Haut leuchtete auf, als sich aus dem Bettlergewand die mageren Arme eines Kindes ausstreckten. Der Knabe umfing den Stamm der Eberesche und begann sich langsam aufzurichten, während er lauschte.
»Vier Ströme durchzogen den Garten, Wasser floß in Fülle, es war süß und rein. Bäume pflanzte der Herr in seinem Garten, lieblich zum Anschauen und voll köstlicher Früchte«, fuhr Melchior fort.
Es mußte wohl am Klang der Stimme liegen, am Auf- und Abschwellen der Laute, einem Gesang nicht unähnlich und damit für das Kind ebenso ungewöhnlich wie die Worte selbst, daß der Junge nach den unteren Ästen griff, um den Baum zu erklettern. Das blasse Gesicht wirkte eingefallen und wie durchscheinend, vom Hunger gezeichnet.
»In die Mitte des Gartens setzte der Herr den Baum des Lebens; er überragte die anderen mit seiner herrlichen Krone. Zwölf Ernten trug er in jedem Jahr.«
»Glaubst du wirklich?« fragte Anselmus trocken. »Mir würden schon zwei Obsternten jährlich als Wunder reichen. Außerdem bewegt mich da etwas ganz anderes. Der Garten in Eden muß vor Gewächsen und Tieren aller Art gewimmelt haben, und Gott hatte bis dahin nur einen Menschen geschaffen, könnte doch sein, daß dieser zunächst weder Mann noch Weib war. Müßte merkwürdig ausgesehen haben. Ich frag mich bloß, ob die Geschöpfe in einer Art Zeitlosigkeit existiert haben, ohne die für uns natürliche Abfolge von Werden, Wachsen, Blühen und Reifen. Aber wie soll das gegangen sein?«
»Die Ewigkeit dieses Gartens in Eden, in den Gott den Menschen als erstes Menschenpaar, als Mann und Weib, Adam und Eva, gestellt hat, bleibt das Geheimnis Gottes. Versündige dich nicht in deinen Gedanken, Bruder Anselmus. Du denkst zu sehr als Gärtner und zu wenig als Mönch.« Melchior hatte den salbadernden Ton aufgegeben, seine Stimme klang scharf.
»Du hast die Schlange vergessen, wenn du schon Eva erwähnst. Ich kreide der Schlange die Geschichte mit dem Apfel an. Konnte sie nichts anderes nehmen, irgendeinen glitzernden Stein oder anderen Trödel? Vielleicht aber hat mit der Schlange erst alles angefangen, das Blühen der Wiesen, die süßen Äpfel, Birnen und Pflaumen, Honig und Wein und – ja, das Bier natürlich.«
Von jenseits der Mauer war ein verstohlenes Scharren zu hören, das die beiden in ihren Disput vertieften Mönche nicht bemerkten. Aufmerksam wurden sie erst, als über dem Mauerrand für einen Augenblick das bleiche Gesicht des Jungen erschien. Gleichzeitig teilte sich die Wolkendecke, ein Sonnenstrahl, eine gleißende Lichtbahn, ließ den Schnee in einem nahezu überirdischen Funkeln aufleuchten. Der Blick der dunklen Kinderaugen, von seltsamer Eindringlichkeit, schweifte über die Reihen der Kohlstrünke in den verschneiten Beeten bis zu den kahlen Gerippen des Baumgartens. Bruder Melchior schaute zu dem Kindergesicht auf, nahm ein Leuchten und Staunen wahr, wie es der Erscheinung von etwas Heiligem angemessen gewesen wäre und sicher nicht dem Anblick zweier Klosterbrüder, von denen einer, er selbst, mittlerweile gottserbärmlich fror. Er wandte sich um und erblickte nur den winterlich kahlen, wieder verschatteten Garten.
Plötzlich brach der Ast unter dem Jungen. In einem Regen von Eis und Schnee schlug er am Fuß des Baumes auf, rollte den Hang hinab und kam erst an einem zugefrorenen Bach schwankend auf die Füße. Dann lief er über das verschneite Feld heimwärts, unsicher den Fußstapfen folgend, die er auf dem Herweg hinterlassen hatte.
Bruder Anselmus schürzte eilig die Kutte, zog sich schweratmend an vorkragenden Steinen der Mauer hoch und starrte der kleinen, entschwindenden Gestalt nach.
»Komm zurück!« brüllte er, als ihm aufging, was der befremdliche Besuch zu bedeuten hatte. »Komm zurück, wir tun dir doch nichts!«
Bruder Melchior, der die Kletterei aus schmalen Augenschlitzen beobachtet hatte, trat rasch an die Mauer, langte hinauf und zupfte Anselmus am Kuttensaum. »Was siehst du?«
Der Gärtner schaute noch immer dem Kind nach.
»Was ist, Anselmus? Gib Antwort!« herrschte Melchior ihn an. Ein plötzliches Besinnen auf seine Amtsautorität ließ ihn heftiger am Wollgewand des Mitbruders reißen.
Anselmus wandte den Kopf. »Ein Kind, Bruder Melchior, ein kaum neun- oder zehnjähriger Bub, den wohl der Hunger hergetrieben hat, wollte Gott ihn behüten.«
Mit einem Satz sprang er von der Mauer und riß im Fallen Melchior, der noch sein Gewand gefaßt hielt, beinahe um. »Ich schick einen Klosterknecht hinterher. Es wäre doch schad, wenn das Kind im Wald erfriert.«
»Hat das Kind hergefunden, so findet es auch heim«, beschied der Prior, er rang noch um sein Gleichgewicht, »außerdem, wer sagt dir, daß es nicht zu einer Räuberbande gehört, die im Wald lagert und den Bengel auf Kundschaft geschickt hat. Die Knechte werden in dieser Nacht die Tore schärfer bewachen.«
Die Klosterglocke unterbrach den Disput der Mönche und rief sie zum Gebet.
Kurz vor Einbruch der Nacht kehrte Christoph heim. Die Hofstelle, auf der er mit den Eltern und zwei jüngeren Schwestern hauste – nicht mehr als eine Hütte mit Ziegenstall und ein paar Feldern –, lag oberhalb des Dorfes und des Benediktinerklosters als halbe Enklave im Wald. Sie gehörte wie ihre Bewohner dem Kloster und war eingerichtet worden, um die Urbarmachung des Landes voranzutreiben. Jedes Jahr mußten die schmalen Äcker aufs neue gegen die Wildnis verteidigt werden, denn der Boden spie immer wieder Steine aus, der Wind säte seine eigene Saat aus Kiefern und Tannen, Quecke, Disteln und dornigem Gestrüpp.
In diesem besonders eisigen und langen Winter, 1197, herrschte Hunger in den kleinen Weilern um den See. Und noch mehr als die Dörfler mußten die Bewohner der Einödhöfe darben. An manchen Tagen gab es für Christophs Familie kaum etwas anderes zu essen als das Brot, das der Vater vom Kloster erbettelt hatte, und auch das reichte selten für alle.
Wochen später führte der Wind aus Süden endlich weichere Luft heran. Der Schnee taute, das Eis in den Bächen begann zu singen, dann zu tropfen und schließlich unter dem leichten Druck von Christophs Händen und Füßen zu splittern. Die Lumpen um die Füße band er ab, als an den Feldrändern zaghaft das erste Gras sproß.
In den vergangenen Winterwochen hatte sich zuweilen, wenn ein Sonnenstrahl jäh den Schnee glitzern ließ, eine Erinnerung geregt, ein verschwommenes, schnell entschwindendes Bild. Wie ein Nachhall meldete sich das Gefühl eines überirdischen Friedens und einer strahlenden Heiterkeit und Wärme, und mit ihm wuchs in Christoph die Sehnsucht, der Quelle dieses Gefühls nachzuspüren.
An einem windigen Tag machte er sich auf. Der Wald, den er zu durchqueren hatte, wirkte mit seinen dunklen Föhren und Dickichten aus verfilztem Gestrüpp bedrohlicher als im Winter, da kein Schnee die Düsternis aufhellte. Seltsame Laute wie ein jähes Pfeifen in den hohen Wipfeln, schwerer Flügelschlag und ein Rascheln im Unterholz, bald nah, dann wieder ferner, erschreckten den Jungen. Er wäre umgekehrt, wenn es neben den vagen Sehnsüchten nicht einen zweiten Grund gegeben hätte, der ihn vorwärtstrieb: das saure, harte Klosterbrot, das den Magen mit angenehmer Schwere füllte. Schon der Gedanke daran machte die Leere in seinem Bauch noch fühlbarer, aber es würde ihm wohler werden, wenn er den Baum und die Mauer erreicht hatte, so wie beim ersten Mal, als sich etwas ereignet hatte, was sich dem Begreifen entzog.
Der Bach am Kloster hielt ihn eine Weile auf, er lief an ihm entlang, stocherte mit einem Stock nach Untiefen und fand endlich eine flache sumpfige Stelle, an der das seewärts schäumende Wasser Reisig und Geröll zu einer unter den Füßen schwankenden Furt zusammengewirbelt hatte.
Kein anderer Ast reichte so weit an die Mauer heran, wie der im Winter abgebrochene, erst jetzt fiel Christoph ein, daß er das nicht bedacht hatte. Unschlüssig strich er an der Mauer entlang, kehrte um, und ganz von selbst fanden die Finger die ersten Fugen, die Halt boten.
Auf dem bröckeligen Mauerkamm kauernd, erblickte er den Klostergarten, der noch beinahe winterlich wirkte, aber für ein unwissendes Bauernkind wie ihn trotzdem ein Wunder war. Erhöhte Beetrechtecke wurden von Bretterverschalungen in Form gehalten und durch einen breiten, geraden Mittelweg in zwei Partien getrennt, eine Reihe schmalerer Beete umrahmte das ganze Geviert, es gab nichts Krummes oder Schiefes. Hätte Christoph etwas von Mathematik verstanden, hätte er vielleicht sagen können, daß ihm die Geometrie des Gartens gefiel, die rhythmische Abfolge von Beet und Weg und dunkler, fruchtbarer Erde, die ein Versprechen auf das üppige Grün des Sommers barg, das sich in die strengen geraden Formen einpassen würde.
Erstaunt schweiften seine Blicke über den Garten, der doch wenig mit seiner Erinnerung an etwas überirdisch Schönes zu tun hatte, und kehrten unruhig immer wieder zu der untersetzten Gestalt in der Kutte zurück, die ihm einen breiten, gebeugten Rücken, kräftige nackte Waden und im Aufrichten den graumelierten Kranz der Tonsur zeigte. Bevor der Mönch den Kopf vollends wandte, war der Junge von der Mauer verschwunden. Aber schon wenige Tage später kam er wieder.
Anselmus hatte es halb gehofft, und dennoch wunderte es ihn beim ersten Mal, daß das Kind zurückkehrte. Meist nahm er nicht mehr als eine rasche Bewegung auf der Mauer wahr. Manchmal gelang es ihm aber, scheinbar abwesend auf die Hacke gestützt, einen Moment das Kindergesicht unter dem wirren, dunklen Schopf zu betrachten, den nachdenklichen Blick zu erfassen, in dem er Ausdauer und Lebhaftigkeit und eine für einen Bauernjungen ungewöhnliche Wißbegier erahnte. Hin und wieder überfiel ihn der Gedanke, noch etwas gutmachen zu müssen an dem Kind, das er an jenem Spätwintertag zu bereitwillig seinem Schicksal überlassen hatte.
Im späten Frühling schoben sich Büschel von Stengeln, Wedeln und Blättern immer höher aus dem Boden, hier und da verdickten sich schon ein paar Knospen und Knollen. Bald wehten Düfte bis zur Gartenmauer, fremde Düfte fremder Pflanzen, auf den Feldern des Vaters wuchs nur Korn.
Vollends ergriffen wurde Christoph vom Zauber ruhiger Bewegungen, mönchischer Gelassenheit und Sorgfalt im Umgang mit den Pflanzen. Beinahe vergaß er alle Vorsicht, bis die Klosterglocke ihn aufschrecken ließ, die den Mönch aus dem Garten rief. Christoph sah, wie er bedächtig aus der Hand legte, was er gerade hielt, und ohne Hast dem Klang der Glocke folgte.
Es konnte nicht ausbleiben, daß der Junge eines Tages die Mauer auf der falschen Seite herabkletterte, sich zwischen die Beete vorwagte und stahl, was er fassen konnte: junge Zwiebeln, kaum fingerdicke Mohrrüben, eine winzige Sellerieknolle. Seine Füße hinerließen Abdrücke auf den Wegen und noch deutlichere in der weichen Erde der Beete, er bemerkte es erst, kurz bevor er wieder über die Mauer klettern wollte. In fliegender Eile rannte er zurück und kratzte mit einer Hand über die Spuren, die andere hielt die Beute fest, eine Mohrrübe verlor er. Nach Hause trabend, aß er gierig, das Herz schlug ihm noch hoch im Hals. Das rohe Zeug blähte den Bauch.
2
Irgendwann Ende Oktober lag ein Apfel auf einem vorkragenden Stein der Mauer, an der Seite, die zum Garten wies. Die Frucht war gerade noch für Christophs Hand erreichbar. Vorsichtig nahm er sie an sich. Der Garten lag so still und verlassen unter ihm, daß er sich bäuchlings auf den Mauersteinen ausstreckte, bevor er den Duft einsog. Langsam drehte er den Apfel in der Hand und rieb ihn am Kittel, bis er wie Gold glänzte. An einem Feld des Vaters stand ein Apfelbaum, der holzige kleine Früchte trug, die die Mutter zu bitterem Mus verkochte. Dieser Apfel paßte beinahe nicht in seine Hand, er mußte alle Finger spreizen, um ihn zu halten. Die Apfelschale war kaum zu spüren, so glatt war sie, der Duft verriet schon eine Menge vom Geschmack, nicht eine Spur von Bitternis schwang darin. Es war etwas ganz Neues, den Augenblick der Vorfreude noch etwas auszudehnen. Er ließ seinen Blick vom Apfel bis zu den Bäumen schweifen, die hinter niedrigen Schuppen jenseits des Gartens wuchsen, und suchte den Punkt in ihrer Mitte, wo aus dem Gewirr der Baumkronen ein Balken herausragte, kantig, riesig, seltsam fremd.
Dann erst biß er herzhaft in die Frucht, schloß die Augen bei dem plötzlichen Genuß der feinen Säure, die den Mund füllte, und der nachklingenden Süße, die mit dem Saft in die Kehle schäumte. Mit jedem Bissen träumte er sich tiefer in eine glückliche Erinnerung.
Ein Ruf ließ ihn hochschrecken. Eine Gruppe von Knechten schlurfte durch die Pforte in den Garten, Hacken und Spaten über der Schulter, einer schrie einem nachfolgenden etwas zu. Christoph vergewisserte sich, daß ihn die Männer noch nicht entdeckt hatten, dann glitt er mit einer raschen Drehung von der Mauer.
Daß er nicht gleich am nächsten Tag nachsehen kam, ob wieder ein Apfel auf ihn wartete, lag an der herbstlichen Feldarbeit, bei der er gebraucht wurde. Die Felder mußten gepflügt und dabei die Steine abgelesen werden, damit die Halme des Winterkorns sich ihren Weg durch die Erde brechen konnten. Nach dem Einsäen ging er mit dem Vater Reisig sammeln. Bis zum Wintereinbruch gelang es ihm nicht mehr, sich fortzustehlen.
Mitte Februar hallte die Gegend von der Jagd wider. Reiter sprengten durch den Wald, duckten sich unter niedrig hängenden Zweigen, nichts ahnend von der grauen, kleinen Gestalt, die am Boden kauerte und im Gewirr des Unterholzes schwer auszumachen war. Christoph betrachtete das klingende, silberbeschlagene Zaumzeug der Pferde, die pelzgefütterten Mäntel der Reiter. Den Abt von Tegernsee erkannte er, bei einer anderen Jagd vor zwei Jahren hatte der Vater ihn auf den geistlichen Herrn hingewiesen, den Spender des Klosterbrots. Damals hatte den Jungen neben Dankbarkeit auch Ehrfurcht gepackt, obwohl der hohe Herr auf seinem Roß mehr einem großen, mit einer kleinen Kugel gekrönten Sack glich, der beidseits des breiten Pferderückens herabhing, kaum fähig, die Balance zu halten. Ein anderer Reiter fesselte Christophs Aufmerksamkeit jetzt so sehr, daß er vorsichtig das Gezweig vor seinem Gesicht auseinanderbog, um besser sehen zu können. Wie dunkel glänzendes Metall hoben sich Pferd und Reiter von der Weiße des Schnees ab. Noch nie hatte er einen Mann gesehen, der sich mit solcher Leichtigkeit und Kraft im Sattel hielt, der Fremde bewegte das Tier mehr durch die Schenkel als die Zügel. Eine hochgewachsene Gestalt, ganz in Schwarz mit fremder Eleganz gekleidet. Dem heimlichen Betrachter zeigte sich ein hochmütiges, junges Gesicht mit dunkel getönter Haut und in einer Kopfdrehung ein Habichtprofil unter einem dichten, nachtschwarzen Haarkranz, in dessen Mitte der Spiegel der Tonsur aufschimmerte. Ein Mönch, der in einer fremden Zunge sprach, als er sich einem Nachfolgenden zuwandte, einem jungen Diener oder Knecht. Christoph wünschte sich, daß der schöne Fremde nicht so rasch seinem Gesichtsfeld entglitte, und tatsächlich zügelte dieser seinen Rappen, der feurig den Kopf hochwarf. Wie ein Schleier flog die seidige Mähne auf. Zärtlichkeit klang in der Stimme des Fremden, der seinem Tier zusprach und es gleichzeitig unter seinen Willen zwang. Christoph fühlte eine heiße Freude, Zeuge dieser kleinen Szene zu sein. Da drehte der Mann noch einmal den Kopf, unwillkürlich schauderte der Junge unter dem schwarzen Blick des Fremden, der beiläufig auf das Gebüsch, aber nicht auf ihn fiel.
Als es zu tauen begann, stahl sich Christoph wieder zum Kloster. So wie im letzten Jahr kletterte er über die Mauer, seine Finger und Zehen ertasteten die vertrauten Fugen. Obwohl ihm ein erster Blick bereits gesagt hatte, daß sich niemand zwischen den noch schneebedeckten Beeten aufhielt, drang er nicht sofort in den Garten ein, sondern stand eine Weile still und spähte aufmerksam in alle Richtungen.
In der Stille gehörte der Garten ihm.
Endlich hüpfte er über die letzten Beetreihen und schlüpfte verstohlen durch das Tor im Flechtzaun, das zu den Schuppen und zum Baumgarten dahinter führte. An einem der Schuppen traf ihn ein oft geträumter Duft. Zwei Äpfel aus vorjähriger Ernte mit stumpf goldener Haut lagen auf einem schmalen Sims unter dem Fenster. Er zögerte keinen Augenblick, nach den Früchten zu greifen. Selbstversunken sog er den konzentrierten Duft nach Sommer und Süße ein.
Ein harter Griff packte seinen Arm, gleichzeitig hörte er eine fremdländisch klingende Stimme hinter sich, nah an seinem Ohr.
»Ein Dieb im Kloster.«
Der warme Atem des Unbekannten streifte seinen Nacken. Christoph wand sich in den Fängen des Habichts, dessen schwarze Augen ihn spöttisch und mitleidlos musterten. »Was geschieht mit dem Klosterdieb? Die frevelnde Hand werden sie ihm abhacken, vielleicht auch die diebischen Augen blenden.«
Eine Hand fuhr in Christophs Schopf, drehte den Kopf von links nach rechts unter einem Blick, in dem ein Höllenfeuer jäh aufflammte und heftiger loderte, je mehr sich der Junge wehrte.
»Ich werde dich lehren, was es heißt, sich am Klostergut zu vergreifen!«
Gegen die Kraft des anderen kam Christoph nicht an, obwohl er merkte, daß der Fremde an einem Gebrechen litt: er hinkte stark. Wäre es dem Jungen gelungen, sich loszureißen, hätte er seinem Häscher mit Leichtigkeit davonlaufen können. Aber der Fremde schleifte ihn unbarmherzig mit sich in den Baumgarten bis zu einer abgeschiedenen Stelle hinter einer Strauchhecke.
Ein Stoß ins Kreuz ließ den Jungen auf Knie und Hände fallen, ein eiserner Griff hielt ihn in dieser Stellung, eine Hand zog in einer flüchtigen Bewegung den Kittel hoch und die Hose herunter.
Christoph fühlte die Hände seines Peinigers über seine Haut streichen, besitzergreifend, zudringlich. Er spürte die fremde Zunge, während sich sein Körper in Abscheu bog. Er schrie, als die Zähne in seine Hüfte geschlagen wurden, die Hände sich in sein Fleisch gruben, es drückten, kneteten und schließlich ein sengender Schmerz in seinen Körper fuhr, der ihn zu zerreißen schien.
Der Schnee, der ihn fast erstickte, dämpfte seine Schreie. Über ihm stöhnte der Fremde. Rauhe, tierische Laute entrangen sich ihm tief aus der Kehle. Dazwischen keuchte er: »Du sollst begreifen, was Liebe heißt, hörst du? Liebe, du arme, einfältige Kreatur! Merk dir die Barmherzigkeit, die ich dir tue, und die Lehre, die ich deiner erbärmlichen Seele aufdrücke!«
Die Qual dauerte lange. Mit immer neu entfachter Leidenschaft fiel der Fremde über Christoph her, der längst jeden Widerstand aufgegeben hatte und nur noch wimmernd die Gewalt erduldete. Ein letzter heftiger Stoß warf ihn auf die Seite in den Schnee. Aus den Augenwinkeln sah er, wie sich der Habicht entfernte, gefolgt von einem Schatten, den er in der einsetzenden Ohnmacht nicht erkennen konnte.
Bruder Anselmus fand Christoph bei hereinbrechender Dämmerung. Sprachlos schaute er auf das Kind, die im Schnee liegenden Äpfel und ein paar weiße Blumen; um einen der Stengel krampfte sich die Kinderhand. Der Gärtner bückte sich hastig und zog den Kittel über die blutige Haut, schwerfällig sank er auf ein Knie, um den leblosen Körper zu bergen. Halb in die geschürzte Kutte geschlagen, trug er ihn ins Badehaus. Vor einem der hölzernen Zuber legte er seine Last vorsichtig nieder.
Der Junge gab keinen Laut von sich. Bruder Konrad, Bader und Apotheker, betrachtete kurz das wachsbleiche Gesicht und begann wortlos, das Feuer unter dem großen Kessel zu schüren.
»Gib acht auf den Jungen«, bat Anselmus leise. Sein Blick schweifte argwöhnisch durch den dämmerigen Raum, während Konrad gelassen mit der Zurüstung des Bades fortfuhr. Anselmus sah ihm noch einen Augenblick zu, erst dann begab er sich ins Krankenrevier, um den Bruder Medicus zu suchen, und ins Abthaus, den Abt zu benachrichtigen.
Prior Melchior und Abt Bonifacius kamen gerade noch rechtzeitig, um einen Blick auf den vom Arzt und von Anselmus entkleideten Kinderkörper zu werfen, bevor der geschundene Knabe behutsam in das warme, mit Kräutern und Heilsalz versetzte Wasser hinabgelassen wurde. Der Blick genügte, das Ausmaß des Verbrechens zu begreifen.
Trotz aller Vorsicht schrie Christoph gellend auf, das erste Lebenszeichen, seit ihn Anselmus im Baumgarten entdeckt hatte. Prior Melchior trat mit zwei raschen Schritten neben den Badebottich, ergriff das Kind hart am Arm und schrie es an: »Wer war es?«
Christoph riß entsetzt die Augen auf.
»Wer?« schrie Melchior zum zweiten Mal und beugte sich dicht über ihn.
Der Junge bäumte sich unter dem Griff auf, das Wasser schwappte gegen die Holzwände, in Schwaden stieg der Dampf in die kühle Luft. Anselmus zog die Hände aus den Kuttenärmeln, trat einen Schritt vor, aber eine Handbewegung des Abtes und ein Kopfschütteln des Arztes hielten ihn davon ab, einzugreifen.
»Wer hat dir das getan?« drang Melchior zum letzten Mal mit inquisitorischer Härte in das Kind.
»Der Teufel«, schluchzte Christoph, »es war der schwarze Teufel.«
»Woher willst du wissen, daß es der Teufel war?« fragte Melchior streng.
»Er hinkt.« Der Kopf des Kindes sank an den Wannenrand, die Augen schlossen sich.
»Fulco de ...«, begann Melchior erstaunt.
»Keine Namen«, unterbrach Bonifacius knapp. Der Einwand bewog Melchior, von der Wanne zurückzutreten, halb in den Schatten, den die massige Gestalt des Abtes warf.
»Auch ohne Namen kennen wir jetzt den Täter, der noch vor wenigen Stunden an unserem Tisch gesessen und mit uns gespeist hat«, fiel Anselmus sarkastisch ein. »Ein Mann mit hoffärtigen Manieren und auffahrendem Wesen, sogar unsere Knechte reden nichts Gutes über ihn.«
»Du hörst auf Geschwätz, Bruder Anselmus? Selbst wenn er der Missetäter wäre, was wiegt die Aussage eines Kindes, eines Bettel- oder Bauernbuben, gegen das Wort eines päpstlichen Gesandten?« Melchiors Stimme klang schrill, der Knabe im Bottich schreckte auf, sackte aber, ohne die Augen zu öffnen, wieder zusammen.
»Eines Benediktiners zudem, der sich in unserem Garten, hinter den Mauern dieses Klosters an einem Wehrlosen verging. Vater Abt, willst du die Aussage des Kindes auch in Zweifel ziehen?« stieß Anselmus gedämpft hervor.
»Nein, die Worte waren klar genug. Das Kind hat keinen Grund, etwas anderes als die Wahrheit zu sagen«, antwortete der Abt.
»Und was ist die Wahrheit?« fragte Melchior. Er deutete mit seiner mageren Hand anklagend auf den Knaben. »Ihr seht es selbst, Brüder. Ein ansehnliches Kind. Es ist womöglich weniger unschuldig, als unser Bruder Gärtner, der zu wenig Ahnung vom Bösen in der Welt draußen hat, glaubt, und ohnehin hat es nichts im Kloster zu suchen, ein Eindringling, eventuell ein Dieb. Es kann durchaus ein Einverständnis gegeben haben.«
»Du scheinst nicht richtig hingesehen zu haben, Bruder Melchior«, warf der Medicus trocken ein, »ich kann mir kein Kind denken, das mit derartigen Verletzungen einverstanden wäre. Manches wilde Tier erscheint noch barmherzig gegen diese menschliche Bestie.«
Abt Bonifacius hob gebieterisch die Hand. »Ich will nicht, daß über diesen Mann weiter gesprochen wird.«
Anselmus hatte den Kopf tief in der Kapuze geborgen, er grub die Nägel in die Handballen, der kleine Schmerz half ihm, wenigstens äußerlich die klösterliche Disziplin zu wahren. »Was gedenkst du jetzt zu tun, Vater Abt?« Die Stimme wollte ihm kaum gehorchen, erst ein Blick auf Melchior, auf den geifernden Ausdruck im Frettchengesicht des Priors, gab ihr neue Festigkeit. »Wie du weißt, hat die Gesandtschaft das Kloster bereits wieder verlassen, die Tat muß kurz vor dem Aufbruch geschehen sein.«
»Jeder schnelle Reitertrupp wird ihn einholen«, warf der Bader ein.
Bonifacius funkelte einen Augenblick die Mitbrüder an, bevor sich sein Blick auf einen Punkt richtete, der hoch genug über dem Badezuber lag, um nicht seinen Inhalt sehen zu müssen.
»Wir leben in schwierigen Zeiten, meine Brüder«, begann er. »Papst Innozenz ruft zu einem neuen Kreuzzug auf und erwartet von uns wie von allen Klöstern einen Beitrag, den die päpstliche Gesandtschaft einfordern kam. Die Zisterzienser weigern sich, die Unterstützung zu leisten, wir verhandeln noch und warten ab, was die Brüder von der Reichenau und von St. Gallen sagen. Ein Skandal, wie er aus dieser Tat entstehen könnte, wäre für uns abträglich. Die Gesandtschaft steht dem Stuhl Petri nahe und hat, wenn nötig, ihr Ohr, wir nicht.«
»Du willst den Schuldigen laufen lassen?« fragte Anselmus erbittert.
»Anselmus, Bruder im Herrn, bring nicht göttliche und weltliche Gerechtigkeit durcheinander. Die weltliche ist nicht unsere Sache, die himmlische überlassen wir dem, dem sie zukommt, der Schuldige wird ihr nicht entgehen, wann immer Gott dafür den Zeitpunkt bestimmt.«
Anselmus musterte scharf das feiste Gesicht des Abtes und begriff, daß es zwecklos war, Einspruch zu erheben oder auch nur darauf hinzuweisen, daß das Kloster zumindest Anklage erheben könnte, wie bei jedem anderen Vergehen hinter seinen Mauern.
»Und das Kind?«
»Bleibt bis auf weiteres im Kloster, gib es zu den Knechten, die dir in den Gärten helfen.« Der Abt erteilte einen unbestimmten Segen über die Reihe der Bottiche. »Es ist ratsam, auch zum Wohle des Kindes, daß Schweigen über diese Angelegenheit herrscht«, fügte er im Umwenden hinzu und verließ mit dem Prior das Badehaus.
Christoph war eingeschlafen. Die Mönche hoben ihn aus dem Zuber, und der Medicus versorgte seine Wunden mit Ringelblumenbalsam. Trotz der vorsichtigen Behandlung regte sich der Geschundene und wehrte sich gegen die Berührung. Konrad zwang ihm den Mund auf und flößte ihm einen Baldriansud ein. Als der Junge in eine Decke gewickelt war, ging Anselmus zum Klosterverwalter und ließ sich eine Kutte geben, die er für den Kleinen zurechtschnitt. Die blutigen Lumpen verbrannten im Feuer unter dem Wasserkessel.
Nachdem er das Kind schließlich wohlversorgt im Quartier der Knechte wußte, kehrte er in die Badestube zurück, um aufzuheben, was der Hand des Knaben entfallen war: eine Christrose, im Schnee erblüht, eine weiße Blume der Unschuld, die mehr als alles andere dem Mönch für die Reinheit des Kindes sprach, trotz der zwei gestohlenen Äpfel.
Auf dem Altar der Kirche glomm das Ewige Licht. Im Schein der Kerze daneben, die im Luftzug flackerte und eher Schattenzonen schuf, als den Raum mit den gedrungenen Steinsäulen zu erhellen, sank Anselmus in die Knie. Wände und Säulen strahlten eine Kälte aus, die ihre Kraft scheinbar aus der Dunkelheit zog. Trotzdem legte er sich mit weitausgebreiteten Armen auf den eisigen Steinboden vor dem Altar.
»Oh, Herr«, betete er. »Du gabst uns den Garten als Abbild des Paradieses, damit wir auf Erden etwas zu unserem Trost und unserer Hoffnung haben. Die vier Flüsse deiner Weisheit, die Klugheit, die Gerechtigkeit, die Mäßigung und die Tapferkeit, deinem eingeborenen Sohn entsprungen, die in deinem Garten fließen, sind durch mich versiegt. Deine göttliche Schöpfung offenbarst du uns in deinem Garten. Aber durch mich ist ihr Friede gestört, durch mich hat das Chaos Einlaß gefunden. Ich habe deine Weisheit mißachtet, die diesen Garten als hortus conclusus gewollt hat, durch Mauern von der Welt abgeschirmt und vor ihr geschützt. Nun ist wiederum die Schlange in den Garten eingedrungen und offenbart sich in ihrer Widernatur. Herr, durch mich wurde ein unschuldiges Kind zum Opfer. Mögen seine Wunden, die des Körpers und die der Seele, durch die Heilskräfte des Gartens gesunden, und gib mir die Kraft und die Möglichkeit, meinen Teil dazu beizutragen.«
3
In der Nacht noch erwachte Christoph aus der Baldrianbetäubung und begann zu schreien. Er warf die Decke ab und zerrte an der Kutte. Einer der Knechte packte den Schopf des Kindes, ein anderer drückte die um sich schlagenden Arme in den Strohsack. Unter der groben Berührung bäumte sich der kleine Körper noch wilder auf, ein dritter Knecht machte sich auf die Suche nach Anselmus, die anderen murrten schlaftrunken über die Ruhestörung. Anselmus, gerade von seinem nächtlichen Gebet zurückgekehrt, trug das Kind mit Hilfe des rasch alarmierten Baders in seine Zelle im Gärtnerhaus. Das Toben ließ allmählich nach, die Kräfte des Kindes erschöpften sich. Ihm versengten glühende Zangen den Körper, wimmerte der Kleine. Erst neuer Baldrian ließ ihn verstummen.
»Das ist der Wundschmerz«, erklärte Bruder Konrad.
»Das ist der Schmerz der verletzten Seele«, erwiderte Anselmus.
Am Morgen fällte er seinen schönsten Apfelbaum, den, der die goldenen Früchte trug. Christoph, auf zitternden Beinen hinter ihm, schaute stumm und verständnislos zu. Als die Glocke den Mönch zum Gebet gerufen hatte, strich der Junge, ein kleiner Schatten, schmerzgeplagt an den Gebäuden entlang, durch dunkle Durchgänge und Torwege. Die Knechte fingen ihn bei dem Versuch ab, über die Mauer zu klettern, und sperrten ihn in den Ziegenstall. Er kroch zwischen die warmen Leiber der Tiere.
Um einen neuen Fluchtversuch zu verhindern, stellte Anselmus einen Knecht als Aufpasser ab. Ein paar Tage später nutzte Christoph eine Unaufmerksamkeit des Mannes und stieg über die Mauer. Er rannte den Hang hinab, schlitterte über das Eis des Baches und brach am Rand ein. Die Kutte sog sich bis zu den Knien voll Wasser. Notdürftig wrang er den schweren Stoff am Ufer aus; als er weiterhetzte, klatschte er ihm schmerzhaft gegen die bloßen Beine.
Der Wald erschien ihm bereits wie eine Zuflucht, er stapfte etwas ruhiger und zuversichtlicher voran. Am Saum der Rodung, in der die elterliche Hütte lag, blieb er stehen, jäh begann sein Herz wie wild zu klopfen. Aus dem Loch im Dach der Kate stieg kein Rauch, die Tür schlug im Wind. Der dumpfe Laut, der von Leere und Verlassenheit kündete, drang bis zu Christoph, der bewegungslos noch einen Augenblick verharrte. Dann hastete er über den Acker, lauthals nach den Eltern und den Schwestern schreiend.
Die Asche im Feuerloch war kalt und fettig zusammengebacken. Er hockte sich davor, stocherte mit den Fingern zwischen den schwarzen Klumpen und begann, erbärmlich zu schluchzen. Licht fiel durch die Tür in einen vollkommen leeren Raum, nur etwas altes, durchgelegenes Stroh lag in einer Ecke. Für eine Weile wühlte sich Christoph ins Stroh, das dumpf, pelzig und ein wenig säuerlich roch, schon nicht mehr vertraut. Verzweifelt nach den Verschwundenen rufend, strich er um die Hütte und sah sich noch in dem Verschlag um, wo die Ackergeräte und ein paar Wintervorräte aufbewahrt worden waren. Auch hier gab es nichts, was die Trostlosigkeit dämpfen konnte.
Vom Wald schallten Tierstimmen und Geräusche lauter als sonst herüber, Christoph schauderte es in der Einsamkeit, die Kälte kroch ihm in die Glieder. Zwischen zwei Bäumen erhob sich ein dunkler, mächtiger Schatten, ein furchtbares Grollen brach aus ihm heraus. Der Junge schrak zusammen, wandte sich um und floh bereits den Pfad zurück über das Feld, bevor er nur einen Augenblick nachdenken konnte. Er durchquerte den Wald, ohne innezuhalten, sprang die verschneiten Hänge hinab und kroch atemlos an der alten Stelle über die Klostermauer. Gleich dahinter griff ihn unversehens sein Bewacher auf, ein vierschrötiger Kerl, der ihn ins Kreuz stieß und mit seiner fleischigen Pranke auf das Gesindehaus wies.
»Mach zu, du!« raunzte er. »Deinetwegen versäum ich nicht das Abendbrot.«
Christoph stolperte hastig vor ihm her, um aus der Reichweite der Hände des Knechts zu bleiben. Allein die Vorstellung, daß der andere ihn packen und mit sich zerren konnte, ließ sein Herz rasen.
Der Essensdunst schlug den Eintretenden entgegen, ein Geruch nach saurem Kohl und Fett, Christoph würgte.
»Hast' ihn eingefangen?« Einer der Knechte schaute von dem vor ihm stehenden Napf auf.
Der Junge sah sich nach seinem Aufpasser um, der die Hand nach ihm ausstreckte, wohl um ihn vorwärts zu schubsen, auf die anderen zu. Voller Angst wich er aus, glitt aus dem Lichtschein der Öllampe, die den schmalen, langen Holztisch und die Knechte auf den rohen Bänken beleuchtete.
»Wo hast du ihn gefunden?« rief ein weiterer.
»Er kam gerade wieder über die Mauer, ihr wißt schon, wo.«
Einer beugte sich über den Tisch. »Wollte er denn nicht nach Hause?«
»Sicherlich, hat aber nichts genützt wegzurennen.«
Die Männer rutschten auf den Bänken näher zusammen, der letzte Sprecher blickte sich flüchtig nach dem Kind um, bevor er fortfuhr. »Ich hab's in der Küche gehört. Der Prior hat die ganze Familie fortgeschickt, keiner weiß wohin.«
»Und warum?«
»Haben wohl was zu vertuschen, die Mönche, ihr habt den Bengel doch schreien gehört, in der Nacht, als die päpstliche Kommission abgereist ist. Da ging etwas nicht mit rechten Dingen zu. Ist höhere Politik im Spiel, von der keiner was erfahren soll, nicht mal so ein Bauer, der vielleicht die Frage stellen könnte, was mit seinem Sohn im Kloster passiert ist.«
»Ach geh, die da droben am Wald sind doch dumm wie's Vieh.«
»Und wie's Vieh haben sie sie weggetrieben.«
»Gefällt mir gar nicht, daß sie uns den kleinen Teufelsbraten dagelassen haben, ist nicht ganz sauber, das Bürschchen, das sieht doch jeder.«
Daß Christoph nicht redete, fiel höchstens angenehm in einer Gesellschaft auf, in der Schweigen als Tugend galt und jedes unnütze Wort als Frevel. Er aß kaum etwas, tiefere Schatten erschienen unter Augen und Wangenknochen. Die Knechte befaßten sich wegen der umlaufenden Gerüchte nur widerwillig mit ihm, und den Zöglingen des Klosters begegnete er selten. Weil er weit unter ihnen stand, wurde er von ihnen nicht wahrgenommen. Nur Anselmus und der Medicus machten sich Sorgen. Was tut man mit einem, der weniger lebt, als vegetiert?
Im Gemüsegarten wies Anselmus den Jungen trotz seiner Schwäche an, die Pflöcke zu halten, die er zur Befestigung der Bretter um die kniehohen Beete in den Boden schlug. Christoph mußte umgraben, dreimal, bis die Krume genügend gewendet und durchlüftet war, danach hatte er Kannen mit Wasser zu schleppen, um Setzlinge zu gießen.
Wider Willen kam der Appetit. Christoph löffelte endlich so hungrig wie die anderen am Tisch den Gemüsebrei aus geschroteten Erbsen und Bohnen, den es oft als Beikost zum Brot gab und den er vorher nicht angerührt hatte. Außerdem stahl er noch Brot aus der Backstube und die ersten Erdbeeren vom Beet. Für Anselmus zählte vorerst nur, daß sich das Gesicht des Kindes allmählich rundete.
An einem Spätfrühlingstag führte er seinen Lehrling durch die vier Gärten des Klosters, um ihm deren Anlage, Nutzen und tiefere Bedeutung zu erläutern, denn er sollte begreifen lernen, daß hinter der äußeren Erscheinung unsichtbare Seinsweisen lagen.
Den Hortus, den Kohlgarten, in dem Gemüse für die Klosterküche angebaut wurde, kannte Christoph mittlerweile bis in den Winkel mit dem Brunnenbecken. Bevor sie die Umfriedung verließen, flog sein Blick zur Gartenmauer. Anselmus, der den Blick bemerkte, scheuchte seinen Schüler über den Torweg zum Wurzgarten, dem Kräutergarten. Er lag in der Nähe des Küchenhauses und war viel kleiner als der Kohlgarten.
Auch hier hielten Bretter die Beete in Form, auf denen eine Fülle unbekannter Gewächse wucherte. Manche standen schon in Blüte, Schwärme von Hummeln und Bienen taumelten wie betrunken umher, so daß Christoph bei ihrem eindringlichen Gesumm beklommen zumute wurde. Den tiefsten Ton erzeugte jedoch eine breit gebaute Gestalt, die sich gerade zwischen zwei Beetreihen bückte und im Aufrichten die beiden Besucher mit einem scharfen Blick bedachte, der sich rasch milderte, als Anselmus dem Küchenmeister seinen neuen Zögling vorstellte. Der Küchenbruder gehörte wie der Gärtner zu den älteren Mönchen, er stöhnte, als er das Kreuz durchdrückte, eine Hand an der schmerzenden Stelle, in der anderen einen Krautbusch.
»Ein so mageres Bürschchen? Der kann doch keinen Spaten heben, wozu brauchst du den?« Der Küchenmeister zwinkerte. »Das würd ich mir überlegen, ob ich den Hänfling was lehren wollte.«
Das Lernen, erklärte Anselmus ernst, solle dem Schüler die Unarten aus dem Kopf treiben und ihn Ehrfurcht vor der Arbeit und ihren Früchten lehren.
Christoph fielen die Erdbeeren ein, ihm wurde immer ungemütlicher, er wandte sich fluchtbereit zum Gartentor um, dabei entging ihm der nachsichtige Blick, den die beiden Mönche tauschten, das Funkeln in den Augen, das Zublinzeln.
»Kennst du diese Kräuter hier?« Der Küchenbruder tippte dem Jungen nachdrücklich auf die Schulter. Christoph sprang vor Schreck zwei Schritte zurück, die Augen in aufkommender Panik geweitet.
Der alte Mönch schüttelte sachte den Kopf. »Der ist ja nur ein (liegendes Hemd, der Junge.« Er hielt Christoph wie einer störrischen Ziege am ausgestreckten Arm die Kräuter entgegen und begann, den Strauß zu zerpflücken. »Schau her. Das ist Fenchel, das Kerbel, das Kümmel, gute, erprobte Kräutlein, die die Klosterkost verdaulicher machen. Sie tun dem Magen gut, verstehst du?« Er klopfte sich auf den kugeligen Wanst. »Das hier sind Dost und Beifuß, die wachsen noch nicht allzulang in unseren nördlichen Gärten, die haben wir aus den Ländern weit im Osten erhalten, von den Heiden.«
Christoph wagte sich einen halben Schritt näher und schaute mißtrauisch in das runde Mönchsgesicht, »Und das essen wir auch?« fragte er empört.
Anselmus nickte erheitert. Pilger, erklärte er, brächten die Samen der Gewächse im Gepäck mit, und durch die lange Wallfahrt würden die Kräuter vom heidnischen Zauber gereinigt. Der Küchenbruder guckte skeptisch. Anselmus holte weiter aus. Auch Kreuzritter, fernosterfahrene jüdische Händler, christliche Gesandtschaften an den muselmanischen Höfen in sagenhaften östlichen Reichen, mit denen die Christenheit einen schwunghaften Austausch von Waren und Wissen betrieb und ab und zu einen Krieg, sorgten nebenbei für die Bereicherung der Klostergärten.
Als sie den Wurzgarten verlassen wollten, hielt sie der Küchenbruder noch einmal auf. »Schick mir den Jungen gelegentlich, ich will sehen, daß ich ihm den Kittel von innen her stopf, sonst kommt mir noch meine Küche in Verruf.«
Der Herbularius, der Heilpflanzengarten, den Anselmus mit seinem Schüler als nächstes aufsuchte, roch nach Baldrian. Christophs Herz schlug plötzlich mit jedem Atemzug schneller, es überschlug sich stolpernd, es war dem Jungen nicht möglich, weiterzugehen, eine gespenstische Furcht lähmte ihn. Mit beiden Händen griff er sich an den Kopf, um eine Flut schrecklicher, wirbelnder Bilder abzuwehren und die Erinnerung an einen durchdringenden Schmerz. Er keuchte laut auf. Anselmus warf beunruhigt einen Blick auf das bleich gewordene Kindergesicht und führte den Jungen eilig weiter in den Pomarius, den Baumgarten.
Sprenkel von Licht musterten den seidenweichen Rasenteppich unter den Bäumen. Anselmus wies seinem Zögling bedächtig die lichten Reihen von Apfel, Birne und Aprikose, Pfirsich, Pflaume, Kirsche, Walnuß, Hasel und Quitte, Baumarten, die bereits zur Römerzeit den Weg nach Italien und später über die Alpen gefunden hatten.
Christoph starrte folgsam die Bäume an, nach dem Aufruhr in seinem Inneren hatte sich eine Art Leere oder Teilnahmslosigkeit eingestellt. In der Mitte des Gartens ragte ein mächtiges Balkenkreuz auf. Christoph erkannte die stumpfe Spitze, die er vor mehr als einem Jahr von der Mauer aus erspäht hatte und die die Reihen der Baumkronen durchbrach. Der Benediktiner war bereits auf ein Knie gesunken, der Junge blieb stehen, bis er mit einem scharfen Ruck an der Kutte herabgezwungen wurde.
»Das Kreuz Christi ist der erhabenste und heiligste Baum des Gartens, der Baum des Lebens, den Gott als Zeichen und Sinnbild der Auferstehung in den Garten gepflanzt hat. An ihm duften die Früchte des ewigen Heils. Das sollst du dir vor allem anderen merken«, erklärte Anselmus.
Ohne Empfindung schaute Christoph zu dem schmucklosen Kreuz empor.
»Siehst du diese Erhebungen im Gras?« Anselmus deutete auf flache Hügel, in die schmale Steinplatten mit Schriftzeichen eingelassen waren. »Es sind die Gräber unserer Brüder. Die Toten ruhen hier bis zum jüngsten Tag in der Hut des Kreuzes, auf das sie als Lebende ihre Hoffnung setzten.«
Christoph spähte über die Gräber hinweg, sein Blick erfaßte die Hecke, hinter der sein Peiniger über ihn hergefallen war. Er begann zu zittern, Anselmus bemerkte es nicht.
Der Gärtner hatte sich bei den Gartenbetrachtungen so verausgabt, daß er seinen Lehrling in den folgenden Tagen mehr durch Tun als Reden zu unterweisen suchte. Leider naschte Christoph weiter heimlich Erdbeeren, die Seelenspeise der Jungfrau Maria, wie Anselmus auf dem Rundgang mit einem mahnenden Blick auf seinen Schüler erwähnt hatte, und statt die erforderliche Strafpredigt nun doch zu halten, schickte er ihn ein paar Tage später in die Küche, um die Unart seines Zöglings auf indirektem Weg anzugehen.
Zögernd betrat der Junge das Küchenhaus. Die angrenzende Backstube kannte er von gelegentlichen kleinen Raubzügen, aber die große Küche hatte er wegen des Betriebs, der dort ständig herrschte, nicht in seine Beutegänge einbeziehen können. Ein mächtiges Feuer flackerte in der gewaltigen Kochstelle, riesige Töpfe, Pfannen, Schüsseln und allerhand eisernes und hölzernes gerät, dessen Zweck er nicht im entferntesten erraten konnte, hing an großen Haken. Vor Staunen stand ihm der Mund offen.
Mehrere Küchenhelfer eilten mit angespannten Gesichtern umher. Sie nahmen keine Notiz von dem Neuankömmling. Der Küchenmeister kam auf ihn zugewatschelt, sein rotes Gesicht glänzte vor Schweiß, und sein Bauch bebte bei jedem Schritt unter der Kutte. Mißtrauisch folgte der Junge seinem Wink bis zu einem langen Tisch mit Bänken davor. Er trat in die Bank, und schon drückte ihn der Küchenbruder mit einer Hand auf den Sitz hinunter. Mit einem Schreckenslaut sprang der Junge auf, es war eine Bewegung, die sich jeder Kontrolle des Willens entzog. Der Bruder stemmte beide Hände in die fetten Hüften und musterte das Kind, das bebend, mit gesenktem Kopf vor ihm stand.
»Daß dir die Knochen derart im Leib fliegen, ist ja krankhaft, und der Medicus in deinem Fall bin ich.« Der Küchenmeister schob den Kopf vor und spähte in das verschlossene Jungengesicht, bis Christoph langsam den Kopf hob und dem Blick des Mönchs begegnete. Der Bruder zwinkerte, als wäre ihm etwas ins Auge geraten.
»Ein Hemd bist du, hab ich Anselmus gesagt, aber so eins benötige ich gerade, so ein wendiges, aber kein windiges Bürschchen. Deshalb hab ich dich vom Bruder ausgeliehen. Du wirst schön brav im Refektorium den Mönchen aufwarten.« Der Bruder reckte mahnend einen Zeigefinger. »Damit du nicht nach den Speisen der Mönche gierst, denn das wäre eine Sünde, wirst du vorher hier essen, und zwar soviel, daß dir die Kutte nicht mehr flattert und du gerade recht für den Dienst zu gebrauchen bist.« Er hob die Stimme. »Also hock dich hin und iß.«
Christoph wartete nicht ab, daß der Mönch seinen Worten handgreiflich Nachdruck verschaffte. Zum Essen, einem in Kräutern und Butter geschmorten Bodenseefelchen, das wundersam und würzig auf der Zunge schmolz, schob ein Küchenhelfer einen Becher mit einer dunkelroten Flüssigkeit über den Tisch.
»Das ist Wein«, erklärte der Küchenmeister, »mit Sauerkirsche von Anselmus' Bäumen gefärbt, der macht gutes, kräftiges Blut. Daß du mir den Becher bis zur Neige leerst, oder du sollst mich doch noch kennenlernen.« Die fette Hand des Mönchs wedelte kurz, aber vielsagend vor den Augen des Essenden, der diesmal schon weniger entsetzt zurückwich.
Im Refektorium versah er den Dienst eines Mundschenks. Anfangs vermutete er, das sei eine Art Strafe, die ihm wegen kleinerer Vergehen wie dem Brotdiebstahl auferlegt wurde, bei dem er vielleicht doch ausgespäht worden war. Bald aber wischte der Trost, der in der üppigen neuen Kost lag, alle Grübeleien hinweg. Sorgsam, wie man es ihm gezeigt hatte, goß er bei den Mahlzeiten den rotgefärbten Wein in die Tonbecher der Mönche, ängstlich darauf bedacht, auch nicht einen Tropfen der kostbaren Flüssigkeit zu verschütten, die so wohlig den Magen erwärmte und für eine gewisse Zeit alle Ängste beschwichtigte.
Unauffällig und bescheiden bewegte sich Christoph zwischen den Mönchen, und doppelt vorsichtig, sobald er sich dem Kopf der Tafel näherte und damit in Sichtweite des Abttisches geriet. Die beiden Männer dort flößten ihm eine unbestimmte Furcht ein. Hin und wieder fing er einen wenig freundlichen Blick des Priors auf – der Abt dagegen bemerkte ihn nie. Christophs Hände, die den Weinkrug hielten, begannen zu zittern, und er beschleunigte seinen Schritt so weit, wie es möglich war, ohne besondere Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.
Ganz selbstverständlich lauschte er den Gesprächen der Brüder, und bald schon hörte er den Namen seines Peinigers, des Habichts: Fulco de Montferrat, Beauftragter des Papstes, Anwärter höherer kirchlicher Würden, vorerst noch zugehörig dem Benediktiner-Kloster San Salvi in Florenz. Von einer Säule gedeckt, spie Christoph heimlich aus, so oft Fulcos Name fiel.
4
Auf dem Rückweg vom Küchenhaus sah er sich eines Tages plötzlich von einer Gruppe von Klosterzöglingen umringt, die gelegentlich, wie er wußte, an der Küchentür um Leckereien bettelten. Er war den Schülern, die im Kloster eine ihrer adeligen Abstammung gemäße Erziehung genossen, bislang ausgewichen, wie er allen auswich, mit denen er es nicht unmittelbar zu tun haben mußte, hatte sie aber hin und wieder beobachtet. Vor allem der Anführer, Grazian, hatte es ihm angetan, sein Goldhaar leuchtete unter der Sonne auf wie ein kostbares Gespinst. Christoph hatte sich schon gefragt, ob es echtes Gold sei, was auf dem Haupt des Knaben wuchs, und ob aus dem Jungen einmal ein Heiliger werden würde, denn er konnte sich nicht denken, warum Gott ihn sonst so schön gestaltet hatte. Daß der junge Adlige das feinste Tuch trug und Lederschuhe, hielt er nur für angemessen und rechtens, ebenso, daß er selbst nur die grobe fransige Kutte besaß und ihm der Dreck zwischen den Zehen hervorquoll.
»Was ist denn das für einer?« fragte Grazian über Christophs Kopf hinweg. Christoph versuchte, ihn zu umgehen, aber einer der Schüler trat ihm jetzt in den Weg.
»Ein Mönch ist er nicht, Grazian, es fehlt die kahle Stelle auf dem Schädel.«
»Aber eine Kutte trägt er«, sagte ein anderer.
»Wird er von seinem ehrwürdigen Vater haben, ist eh zu groß für ihn. Wer ist es denn, verrätst du's uns? Und die liebe Frau Mutter wird eine Nonne sein«, ergänzte Grazian.
Die Schar johlte auf. Christoph starrte verständnislos Grazian an, trat unsicher zurück und versuchte, sich seitwärts davonzutrollen. Grazians Faust, gegen seine Brust gestemmt, hielt ihn auf. Die Berührung rann ihm wie Feuer über die Haut. Einen Augenblick erfaßte ihn eine Lähmung, er keuchte nach Atem, sah noch einmal ungläubig in das hochmütige, schöne Gesicht, dann flogen seine Fäuste vor. Mit einer Wucht, die sein Angreifer wohl nicht erwartet hatte, stieß er diesen so heftig von sich, daß Grazian rückwärts taumelte, bis ihn einer der anderen auffing. Christoph rannte davon, bevor ihn jemand aus der Schar aufhalten konnte. Ihr Gelächter verfolgte ihn.
Von dieser Begegnung an machten die Zöglinge um Grazian ein übermütiges Spiel daraus, Christoph aufzulauern, so daß er ständig auf der Hut sein mußte und sich überall umblickte auf seinen Gängen von einem Garten zum anderen und zwischen den Gebäuden des weitläufigen Klostergeländes.
In der Dunkelheit der Nächte steigerten sich die Ängste ins Unerträgliche. Christoph lag zusammengerollt auf seinem Strohsack, das Gesicht der Wand zugekehrt, das gleichmäßige Schnarchen der Knechte klang zu ihm herüber. Ganz allmählich aber entwickelten sich andere Gedanken und Bilder, füllten und dehnten die Augenblicke des Wachseins und verdrängten am Ende für kurze Zeit die Furcht. Ein Zufluchtsort. Ein Ort des Friedens und der Ruhe, der Schönheit, der Heiterkeit. Ganz zaghaft meldete sich eine Erinnerung, doch nie wollte sie sich zu einer Vorstellung verdichten, immer blieb sie vage. Mit ihr traten allerdings ein paar Worte aus dem Gedächtnis hervor: »Gott schuf gen Osten einen Garten in Eden.«
Der Satz warf Fragen auf, die er Anselmus nicht stellen mochte, um ihn nicht seine geheimen Gedanken wissen zu lassen; so wandte er sich an einen der gutmütigeren Knechte.
»Kennst du einen Ort namens Eden?«
»Eden?« Der Knecht kratzte sich am Kopf. »Nö, hier in der Gegend nicht, und was darüber hinaus liegt, weiß ich nicht, bin nie von hier weggekommen.«
»Und im Osten?« hakte Christoph verzweifelt nach.
»Bist du blöd? Im Osten sind Berge, das siehst du doch, und dahinter wieder welche, hab ich gehört. Aber das weißt du selbst, euer Hof lag dort in den Bergen.«
Christoph schlich eine Weile an der Klosterpforte herum und starrte auf die dunkle Front der bewaldeten Hänge, hinter der irgendwo ein unbekanntes, wunderbares Land ewigen Frühlings liegen mußte. Ganz in sich gekehrt, ging er zurück und versuchte mit aller Macht, das Sehnsuchtsbild in seinen Geist heraufzuzwingen. Unversehens überfielen ihn die Zöglinge wie ein Hornissenschwarm.
»Mönchskegel, Klosterbastard«, raunten sie ihm ins Ohr, ihn in engen Kreisen umrundend. Scheinbar unbeeindruckt, versuchte er, seinen Weg fortzusetzen, aber sie begannen, ihn zwischen sich zu puffen. Das ging ohne Gejohle in verhältnismäßiger Stille vor sich, nur mit halb unterdrücktem Prusten, und es lag vielleicht an dieser Gedämpftheit, daß auch Christoph nicht schrie, lediglich ein ersticktes Stöhnen entrang sich ihm. Längst waren die Stöße heftiger geworden, fühlbarer Schmerz war da und beschwor jenen anderen aus einer nur sehr notdürftig zugedeckten Erinnerung herauf. Sie lähmte ihn, machte ihn wehrlos, wie eine Strohpuppe flog der Junge hin und her.
Plötzlich blieb der Gegenstoß aus, Christoph brach halb betäubt in die Knie, dumpf drang ein mehrfaches Klatschen und Aufbrüllen an seine Ohren.
»Heh, heh, Bürschchen, habt ihr nicht zu studieren?« rief eine barsche Stimme. Aufschauend erkannte Christoph den Knecht, der zu Beginn seines Klosterlebens sein Bewacher gewesen war. Wie unbeteiligt beobachtete er, wie die Zöglinge davonliefen, einige, unter ihnen Grazian, hielten sich mit einer Hand Wange und Ohr. Noch immer nicht ganz das jähe Ende der Quälerei begreifend, kam Christoph auf die Füße und stolperte ein paar Schritte dem Knecht nach, der schon weiterging, sich aber beiläufig umdrehte.
»Hau ihnen was hinter die Löffel, wenn sie dir dumm kommen«, sagte er gutmütig.
Christoph schleppte sich in den nahen Baumgarten und übergab sich, als wolle sich sein Inneres nach außen stülpen. Er tappte ein Stück tiefer in den Garten, fiel in der Nähe des Kreuzes zwischen zwei Gräbern zu Boden und krallte die Hände in die Grasnarbe, bis er Erde spürte. Er zitterte lange am ganzen Leib.
Anselmus schickte ihn für eine Weile zu Bruder Konrad, dem Apotheker. Den Gärtner beunruhigte die Fahrigkeit, die er neuerdings an seinem Gartenhelfer bemerkte, und er hoffte, daß die Arbeit für die Apotheke, die außerordentliche Gewissenhaftigkeit verlangte, nicht nur das noch sehr oberflächliche Wissen des Jungen über Kräuter vertiefen, sondern seinen sonst recht anstelligen Schüler auch neue Ernsthaftigkeit lehren würde. Christoph folgte der Anweisung voller Mißtrauen, jede Änderung im festgelegten Tagesablauf schürte Ängste.
Er fürchtete, im Heilkräutergarten wieder vom Baldrianduft überwältigt zu werden, aber längst hatten andere Kräuter die Oberherrschaft gewonnen. Schon nach ein paar Tagen hatte ihn die Arbeit in dem stillen Garten, in dem er meist mit dem Bruder Apotheker allein war, in ihren Bann geschlagen. Die Pflanzen, eher bescheiden aussehend, schäumten über die Beete, einer Woge gleich, die sich an den Rändern des Gartengevierts brach, an schmalen Einfassungen voller üppig blühender Rosensträucher und schwelgerisch bunter Blumen.
Ein goldener Schimmer lag über dem Garten, denn die Kräuter waren von der Sonne in die Töne des frühen Herbstes umgefärbt worden, in helles Ocker, blasses Grün mit gelben Rispen, an denen die winzigen Perlen dunkler Samen hafteten.
Weich und warm strich der Wind über die Beete und über Christophs nackte Arme. Manchmal hockte der Junge still und selbstvergessen auf den Fersen zwischen hohen Kräuterbüschen und lauschte dem Geschwätz der Spatzen, dem Geraschel des Winds, der mit trockenen Samenhülsen spielte, beobachtete Lichtflecken zwischen den wippenden Stengeln und sah Spitzmäuse herumhuschen. Einmal setzte sich ein Falter auf seine Hand, kitzelte ihn mit den Spinnenbeinen und flog erst weg, als er niesen mußte. An solchen Tagen hätte er ewig bleiben mögen, aber das Abendkonzert der Grillen sagte ihm, daß er sich bald wieder vor den Klosterzöglingen und anderen Heimsuchungen vorsehen mußte.
Bruder Konrad erntete ganze Sträuße mal herb mal mild duftenden Krauts, ließ seinen neuen Helfer die Samen vom Grün trennen und bemerkte wohlgefällig die Geschicklichkeit der schmalen Kinderfinger. Nebenbei lernte Christoph, daß die hohlen Stengel des Knoblauchs gut gegen Beschwerden der Luftröhre seien und die sichelförmige Blüte der Braunelle gegen Schnittwunden.
»Similia similibus, Gleiches heilt man mit Gleichem«, erläuterte der Apotheker. »Bei solchen Erkenntnissen darfst du eines nie vergessen: die Pflanze ist ein Heilszeichen, in ihr tritt uns die Macht Gottes entgegen, sie ist ein Ebenbild des Schöpfers.«
Christoph schaute verwundert auf und vergaß die Scheu, mit der er Konrad bisher begegnet war. »Gilt das für alle Pflanzen?« fragte er.
Konrad geriet in Verlegenheit. »Sicher für alle in diesem Garten. Außerhalb herrscht die Wildnis, vor der du dich in acht nehmen mußt. Was dort wächst ist oft gefährlich, zumindest aber ungenießbar. Darum haben wir aus der Wildnis die Ordnung des Gartens geschaffen und nehmen dadurch Anteil an Gottes Schöpferwerk.«
Kräuter sortierend und für den Augenblick seinen Helfer vergessend, murmelte der Mönch: »Pulegium, Poleiminze, gegen Ungeziefer; sisimbria, Krauseminze, gegen Herzleiden, auch ataregia, das Bohnenkraut, ist gut für Herz und Magen.«
Christoph sprach gedankenlos die fremden Worte nach.
»Oho!« meinte Konrad. »So einer bist du. Nun, dann schau her: das ist ruta, die Raute, ihre Bitterstoffe sind gut für den Magen, menta ist die Pfefferminze, sie erfrischt und macht wohlgemut, salvia, der Salbei, reinigt die Wunden.«
»Wie sind die Pflanzen in den Garten gekommen?« fragte Christoph.
»Die meisten von ihnen, zum Beispiel alle diese Minzearten, stammen aus dem Osten, aber sie wachsen schon seit Jahrhunderten hier.«
Christoph starrte auf den Boden, als er seine nächste Frage stellte, seine Erregung verrieten nur die Füße, die Zehen krümmten sich angespannt. »Der Bruder Koch hat einmal von den Heidenländern gesprochen, aus denen Dost und Beifuß kommen, sind diese Kräuter auch von dort?«
»Die Heidenländer sind überall, im Norden, im Süden, im Osten. Nur der Westen ist ganz und gar christlich bis auf die sarazenischen Reiche in Spanien. Aber was diese Kräuter angeht, stammen die meisten tatsächlich aus den östlichen Ländern jenseits des Mittelmeers.«
»Gibt es dort auch Gärten?« Christoph fragte so beiläufig wie möglich.
Bruder Konrad seufzte. »Wenn man den Kreuzrittern glauben möchte, die Seltsames über diese östlichen Länder erzählen, die wunderbarsten.«
»Liegt einer davon in Eden?«
Bruder Konrad schüttelte den Kopf und gluckste vor Lachen.
Ehe Christoph diesem Kopfschütteln nachgehen konnte, hörten sie ein Husten hinter sich. Der Prior stand in der offenen Tür, die Stirn gerunzelt, eine Mahnung über das unziemliche Geschwätz und die Heiterkeit des Bruders stand ihm ins dürre Gesicht geschrieben. Die Mönche von Benediktbeuren bäten um Kreuzkümmel, teilte er dem Apotheker mit. Cuminum, dachte Christoph aufsässig. Den Benediktbeurern, fügte Melchior herablassend hinzu, sei die diesjährige Ernte verdorben.
Sobald die Aufmerksamkeit des Vorlesers, der auch für Ruhe zu sorgen hatte, nachließ, lief ein Murmeln um die schmalen eichenen Tische des Refektoriums, aus dem der Junge häufig »Osten« und »Kreuzzug« heraushörte. Seit der Bemerkung Konrads über die Kreuzritter, dachte er über mögliche Zusammenhänge nach.
Wenn sich die Gespräche der Mönche nicht um den Kreuzzug drehten, dann um die Abgaben für den Papst. Beim Geld angelangt, stritten sie über einen neuen Kirchenbau, der die schlichte Klosterkirche ersetzen sollte. Abt Bonifaz hielt sie, wie er einmal deutlich erklärte, der Bedeutung des Klosters nicht mehr für angemessen. Die Mönche in Cluny, führte er aus, ließen ihre neue Kirche auf einem Wald schlanker Säulen von unvorstellbarer Höhe aufragen und von Licht durchfluten.
Einer von den alten Mönchen hielt dagegen, das hieße Gott versuchen. »Ihr wißt wohl nicht, was passiert ist?« fuhr er fort. »Ihr hochmütiger Bau ist ihnen auf den Kopf gekommen, das hat sie wohl Demut gelehrt.«
»Du weißt nicht, was du redest«, fiel ein jüngerer Bruder ein. »Das Gewölbe steht längst wieder, fünf Jahre nach dem Zusammensturz ist es eingeweiht worden.«
Prior Melchior klopfte mit der Faust Ruhe heischend auf den Eichentisch.
Christoph interessierte die Klosterpolitik nicht, aber mit den Gesprächen über den Kreuzzug schlich sich der Osten immer heftiger als magisches, schillerndes Gebilde in seine Gedanken. Es mußte sich doch ein Weg dorthin finden lassen. Vorsichtig fragte er Bruder Konrad, was es denn mit dem Kreuzzug auf sich habe und warum er nach Osten führe.
»Der Kreuzzug ist der große Krieg, die Schlacht gegen den Antichrist am Ende der Zeiten, die das Reich Gottes auf Erden begründen soll. Gottes Reich kann nicht kommen, solange das Grab unseres Herrn in den Händen der Heiden ist, der Sarazenen, die die Pilger erschlagen und die heiligen Stätten entehren. Dieser Kreuzzug soll den Frieden auf Erden einläuten – den Frieden für alle Menschen, die unseres Glaubens sind. Das Heilige Land mit dem Grab Christi liegt von hier aus gesehen im Osten, aber auch im Süden, denn es ist heißer dort als hier.«
Die Richtungen verwirrten Christoph, trotzdem fragte er weiter. »Findet der Kreuzzug bald statt?«
»In Franken und auch im Norden unseres Landes sammeln sich schon die ersten Kreuzfahrerheere. Es kommt noch einmal eine päpstliche Delegation hier vorbei, die die Kreuzpredigt im Norden gehalten hat.«