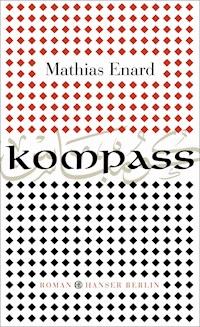Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser Berlin
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Der Goncourt-Preisträger Mathias Enard erzählt aus der Perspektive eines Scharfschützen über den Krieg und die Realität von Kriegsgewalt – eine mutige und radikale Geschichte.
Auf Konzentration kommt es an, auf Geduld und Atemkontrolle. An einem guten Tag reicht ihm ein einziger perfekter Schuss. Er ist zwanzig, der beste Scharfschütze der belagerten Stadt. Wenn er von seinem Posten auf dem Dach heruntersteigt, genießt er die Angst, die er verbreitet. Furchtlos ist nur Myrna, das Mädchen, das für seine demente Mutter sorgt – das er beschützen und besitzen will. Dies ist ein Roman über den Krieg aus der Perspektive eines Mörders, der sein Selbstwertgefühl aus der Eleganz seiner Treffer zieht. Kalt spricht der Erzähler von seinem Handwerk, dem Töten, und offenbart eine Wahrnehmung, in der die Verbindung zwischen gelungenem Schuss und ausgelöschtem Leben gekappt ist. Ein erbarmungsloser Text über die sich verselbständigende Realität von Kriegsgewalt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 256
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
Der Goncourt-Preisträger Mathias Enard erzählt aus der Perspektive eines Scharfschützen über den Krieg und die Realität von Kriegsgewalt — eine mutige und radikale Geschichte.Auf Konzentration kommt es an, auf Geduld und Atemkontrolle. An einem guten Tag reicht ihm ein einziger perfekter Schuss. Er ist zwanzig, der beste Scharfschütze der belagerten Stadt. Wenn er von seinem Posten auf dem Dach heruntersteigt, genießt er die Angst, die er verbreitet. Furchtlos ist nur Myrna, das Mädchen, das für seine demente Mutter sorgt — das er beschützen und besitzen will. Dies ist ein Roman über den Krieg aus der Perspektive eines Mörders, der sein Selbstwertgefühl aus der Eleganz seiner Treffer zieht. Kalt spricht der Erzähler von seinem Handwerk, dem Töten, und offenbart eine Wahrnehmung, in der die Verbindung zwischen gelungenem Schuss und ausgelöschtem Leben gekappt ist. Ein erbarmungsloser Text über die sich verselbständigende Realität von Kriegsgewalt.
Mathias Enard
Der perfekte Schuss
Roman
Aus dem Französischen von Sabine Müller
Hanser Berlin
Ich möchte, dass von meinem Leben kein Laut bleibt als nur das Lied eines Spähers, der sich die Erwartung durch Singen verkürzt. Unabhängig von dem, was eintrifft, ist es wunderbar, in der Erwartung zu leben.
André Breton, L’Amour fou, III.
Das Wichtigste ist der Atem.
Das ruhige und langsame Ein- und Ausatmen, die Geduld des Atems. Zuerst muss man auf seinen Körper hören, auf seinen Herzschlag, Arm und Hand ruhig halten. Das Gewehr muss zu einem Teil des eigenen Körpers werden, seine Verlängerung.
Selbst das Ziel ist untergeordnet, wichtig ist die eigene Person. Man muss sich um den Platz kümmern, ob man sich auf einem Dach oder hinter einem Fenster befindet, ist egal, man muss die Stellung beherrschen, sie ganz vereinnahmen. Nichts stört mehr als eine Katze, die plötzlich hinter einem vorbeistreicht, oder ein Vogel, der auffliegt. Man muss ganz bei sich sein, nirgendwo sonst, das Auge am Fernrohr, den stählernen Arm aufs Ziel gerichtet, bereit zu treffen. Von meinem Dach aus übersehe ich die Bürgersteige, spähe die Fenster aus, schaue den Leuten beim Leben zu. Mit einem Druck auf den Abzug bin ich bei ihnen. Es ist nicht einfach, im Gegenteil, es ist ein schwieriges Geschäft, das Präzision und Konzentration erfordert. Alle denken immer nur an den Schuss und was er bewirkt. Sie wissen nicht, dass ich ihren Herzschlag durch meinen gehört, dass ich jede Gefühlsregung ausgeschaltet habe, dass ich den Atem anhalte, unmittelbar bevor ich abdrücke, wie man so sagt, aber ich drücke nichts ab, im Gegenteil, ich entriegle einen Metallhahn, der schlägt auf ein Zündhütchen, das die Treibladung entzündet, die wiederum ein Projektil aus dem Lauf schleudert, das bis zu zwölfhundert Meter weit fliegt und jemanden tötet. Oder auch nicht. Manchmal geht der schönste aller Schüsse daneben, es gibt Unwägbarkeiten, Hindernisse, die sich zwischen den Schützen und das Ziel stellen; ein Windstoß kann unmerklich an der Waffe eines Scharfschützen rütteln, ein Geräusch auf der Straße kann ihn ablenken, eine Explosion oder ein Motorgeräusch ihn überraschen. Doch der Schuss selbst ist nie der Grund. Ich schieße nur, wenn ich sicher bin. Ich schieße wenig. An manchen Tagen schieße ich einen Vogel ab, nachdem ich ihn eine Stunde dabei beobachtet habe, wie er durch die Lüfte segelte, so lange brauche ich zur Vorbereitung, um seine Flugstrecken zu kennen, um zu verstehen, wie sich die Luftmasse unter seinen Flügeln bewegt, um seine Entfernung, seine Flugbahn einzuschätzen. Normalerweise ziele ich auf den Flügel und sehe zu, wie er trudelnd abstürzt, oder ich versuche ganz nahe an dem Vogel vorbeizuschießen, ohne ihn zu berühren, ein Streifschuss. Dann fällt er ebenfalls herab. Wenn sie hoch genug fliegen, bekommen einige die Kurve, bevor sie auf den Boden aufprallen, doch die meisten stehen unter Schock und zerschmettern. Das ist ein gutes Training. Niemand schießt so gut wie ich, weil ich wenig schieße. Nie mehr als zehn Patronen an einem Tag. Nicht, dass ich mir ein Limit gesetzt hätte. Ich schieße einfach nur, wenn ich sicher bin. Die ganze Arbeit liegt davor.
Keine Ahnung warum, aber ich erinnere mich an jeden meiner Schüsse. Ich verwechsle sie nicht, sie sind alle verschieden. Ich suche mir nur die schwierigen aus. Zu Beginn, als ich Anfänger war, habe ich mich aufgeführt wie alle anderen, aber damals ging es darum, meine Mittelmäßigkeit zu verbergen. Ich suche mir nur die schwierigen Schüsse aus, weil die Freude dann größer ist. Schützen, die das nicht begreifen und auf alles schießen, was sich bewegt, sind Idioten.
*
Mir kommt es vor, als wäre ich schon immer Scharfschütze gewesen, doch ich mache das erst seit knapp drei Jahren, und wenn ich an meine Anfänge denke, schäme ich mich. Man kann alles lernen. Mein erster Abschuss zu Beginn des Krieges war ein Mann, der ein Taxi steuerte. Ich meinte ihn getroffen zu haben, denn der Wagen fuhr geradewegs gegen eine Wand. Ich wartete für den Fall, dass der Fahrer aussteigen würde, ich zitterte, richtete mein Gewehr nach allen Seiten, um zu sehen, ob ihm jemand zu Hilfe käme, ballerte zwei Kugeln aufs Geratewohl in die Autotür links vorn, er stieg natürlich nicht aus und niemand näherte sich. Ich hatte Tränen in den Augen, ich wusste nicht, was ich tun sollte; wegen des Autodachs, das mir die Sicht versperrte, sah ich nicht einmal, ob der Mann blutete, und geriet auf meinem fünfhundert Meter entfernten Gebäude in Panik. Eine Wirkung des Zielfernrohrs. Ich hatte das Gefühl, bei ihm zu sein, und wusste nicht mehr, ob ich der Scharfschütze war oder derjenige, auf den geschossen wurde. Ich hatte Angst, klemmte hinter meinem Gewehr, als könnte es mir die Augen dafür öffnen. Erschwerend kam hinzu, dass rechts von dem Wagen ein ziemlich hohes Haus stand und mir den Blick auf die Fahrertür versperrte. Jemand kam plötzlich im Laufschritt auf meinen toten Winkel zugelaufen, ich schoss reflexhaft, weil sich etwas bewegte, verfehlte ihn natürlich und traf das Auto, denn ich hatte noch nicht begriffen, dass man beim Blick durch das Zielfernrohr schlecht einschätzen kann, wie weit die Dinge voneinander entfernt sind. Ich war gezwungen, nachzuladen, und verlor dabei die Szene aus den Augen; da ich nicht aufgepasst hatte, wohin ich gezielt hatte, brauchte ich eine Weile, bis ich in meiner Panik den Wagen zwischen den Häusern wiederfand. Ich schwitzte, es war heiß, Sommer, der Krieg hatte gerade angefangen, und weil mir der Schweiß von der Stirn rann, konnte ich nicht durchs Zielfernrohr blicken. Als ich die Stelle wiedergefunden hatte, wartete ich eine Viertelstunde, aber niemand kletterte auf der Beifahrerseite des Autos heraus. Ich war frustriert, ich wusste nicht, ob der Mann tot war, ob ich oder der Unfall ihn getötet hatte. In diesem Moment kam ich mir wie ein Feigling vor, denn ich hatte mir das schwierigste Ziel ausgesucht, einen zu drei Vierteln verdeckten Mann in einem fahrenden Auto. Eigentlich wollte ich ihm, glaube ich, eine Chance lassen. Aus Feigheit. Entweder schießt man oder man schießt nicht. Man muss sich entscheiden, sonst ist man ein Feigling. Aber das habe ich erst später begriffen.
*
Schweigend beobachte ich die Stadt. Man muss bis zum Äußersten gehen. Wenige können das. Sie gehen nur den halben Weg, manchmal ohne es zu wollen, weil es sie packt, wenn sie durch das Visier ihrer tödlichen Waffe blicken. Alle sehen das Blut und den Schmerz, ohne zu verstehen, dass es noch etwas anderes gibt, ein flirrendes Mysterium, etwas wie eine Schwelle, wie eine Hängebrücke, die leicht im Wind schaukelt. Dieser Moment gehört mir. Auf dieses Intervall zwischen dem Drücken des Abzugs und dem Auftreffen der Kugel arbeite ich hin. Unbeeindruckt verschwinde ich in der Distanz zwischen mir und dem anderen. Dieses Verschwinden erfüllt mich. Es ist ein irres Vergnügen, man muss seiner würdig sein, es herbeiführen können.
Immer wenn ich sie betrachtete, wusste ich, dass sie im Grunde Angst hatte. Sie sah nur, worauf der Schuss abzielte, den Tod und alles, was sich daran anschließt. Doch jeder stirbt, was kann ich dafür? Jetzt spüre ich ihren Puls nicht mehr so stark und nicht mehr so deutlich wie hinter meinem Zielfernrohr, ich bin nur an ihrem Körper, und sie entschwindet, ihr Gesicht, das viel zu nahe ist, löst sich beinahe auf. Die Spannung, die Kraft, die Begierde hinter der Waffe kann sie sich nicht vorstellen. Sie versteht es nicht. Vielleicht ist es das Los großer Künstler, unverstanden zu sein. Keine Ahnung.
Zu Beginn des Krieges hatte ich dieses russische Gewehr, das mir nicht richtig behagte, aber ein anderes war nicht aufzutreiben. Ich konnte noch nicht einmal richtig das Korn einstellen, selbst ein stehendes Ziel in hundert Metern Entfernung traf ich nur mit Mühe. Aber ich lerne schnell, also lernte ich, damit umzugehen. Ich habe bei diesem verdammten Gewehr vielleicht zweihundert Mal das Visier eingestellt, bevor ich es kapierte. Und dann haben sie mir nach zwei oder drei Monaten, als inzwischen überall gekämpft wurde und sie merkten, dass ich ein ausgezeichneter Schütze war, eine echte Waffe gegeben. Als Gegenleistung bat mich der Offizier, der sie mir brachte, jemanden zu töten, der seiner Frau nachstellte, einem fetten Weib, die keiner, der bei Verstand war, gewollt hätte. Ein guter Schuss, mit der alten Russin, denn das neue Gewehr war noch nicht eingeschossen. Ich habe ihn vor seiner Haustür mitten ins Herz getroffen, direkt unter der linken Schulter.
Damals waren meine einzigen Freunde, ihrer Bedeutung nach geordnet, mein Gewehr, das Meer und Zak. Stundenlang habe ich von meinem Dach aus das Meer betrachtet. Es hat mir immer gefallen, dabei bin ich keineswegs romantisch veranlagt. Das Meer wechselt die Farbe, es wogt oder ist reglos. Im ersten Kriegsjahr zum Beispiel hat es sich überhaupt nicht bewegt, kaum dass es sich ab und zu kräuselte. Es war den ganzen Tag über blendend blau, und nicht einmal nachts konnte man es hören. Einmal sind wir an den Felsen unterhalb des Leuchtturms baden gegangen, Zak und ich, bei Nacht, das Wasser war fast so warm wie die Luft. Wie in der Badewanne. In den Bergen fielen Bomben und wir waren im Wasser, machten den Toten Mann und genossen das Schauspiel. Wir blieben nicht lange im Wasser, weil wir Angst hatten, irrtümlich als nackte Idioten unter Beschuss zu geraten. Aber wir fühlten uns gut, als wir herauskamen, man konnte sich fast einbilden, es sei kühl. Danach sind wir an die Front zurückgekehrt und ich bin wieder auf das Dach geklettert. Ich war sozusagen den ganzen Sommer draußen, meine Mutter sah mich nur ein oder zwei Mal. Sie war schon halb verrückt, bekam gar nichts mehr auf die Reihe. Sie fragte mich bloß, ob es immer noch welche gebe, die man töten müsse. Die Nachbarin, die sich um sie kümmerte, hatte Angst vor mir, und das gefiel mir. Sie nannte mich einen Mörder. Damit sie den Mund hielt, genügte es, wenn ich ihr geradewegs in die Augen sah und dabei zweimal mit meinem Siegelring auf den Stahl meines Gewehres klopfte. Tak, tak. Schweig. Du hast keine Ahnung. Du brauchst mich, um dich zu verteidigen. Das sagte mein Gewehr. Du verachtest mich, aber du bist gezwungen, mich zu unterstützen. Es ist Krieg, muss ich dir das extra sagen? Wäre es dir lieber, wenn jemand anderes, ein Fremder, oben auf dem Dach säße und dich durch sein Zielfernrohr ansähe? Denk an mich als einen Schutzengel. Sie bekam immer mehr Angst. Sagte, sie habe gehört, man würde sogar auf die Kinder in den Schulhöfen schießen. »Ich nicht«, log ich. Ich weiß im Übrigen nicht, warum ich log. Aber es war zu Beginn des Krieges, und noch hatte niemand begriffen, dass sich alles endgültig verändert hatte.
Zak und ich hatten jedoch eine leise Ahnung. Besonders er. Er hatte sich kopfüber in den Krieg gestürzt wie ins Wasser, ohne zu zögern. Das musste man gesehen haben, Zak bei den Straßensperren, stolz wie ein Gockel. Mit überheblichem Blick stoppte er die Fahrzeuge durch einen Wink mit der Waffe; in der Hosentasche trug er stets eine Autoantenne bei sich, die er zur Peitsche auseinanderzog, um Widerspenstige zu züchtigen. Seine Angeberei, gegenüber Frauen vor allem, ging mir ein wenig auf die Nerven — sobald er eine stoppte, wurde er peinlich und plusterte sich auf wie ein Pfau oder ein Hahn. Für mich waren die Straßensperren echter Frondienst, ich kam nicht zum Schießen, war weitab vom Krieg. Klar, es war notwendig, wir mussten zeigen, dass wir, die Kämpfer, für Ordnung und Sicherheit sorgten. Aber es war ein riesiger Zeitverlust und aufreibend; in der prallen Sonne mitten im Verkehr zu stehen, zehrte an den Nerven, und wir haben es dann an einem armen Kerl ausgelassen, der keine Papiere hatte, ihn auf der Ladefläche eines Lastwagens verprügelt oder, wenn Zak einen guten Tag hatte, ihn als »Spion« mit einem Sack über dem Kopf auf eine Runde in einen Keller abgeführt, aus dem er nicht mehr auftauchte. Ich bewunderte Zaks gekonntes Vorgehen, ich war ein unbeleckter Anfänger, dem alles, was er sah, wie ein Kunststück vorkam. Er war vier Jahre älter als ich, da war das normal.
*
Am 7. August feierte ich meinen achtzehnten Geburtstag. Es gab einen Waffenstillstand, glaube ich, aber nicht für mich. Ich schoss etwas weniger, weil ich besser wurde, das war alles. Der Waffenstillstand, das wusste jeder, war sowieso ein Witz, man wollte nur Zeit gewinnen. Ich blieb auf meinem Dach. Nachts nahm ich eine Flasche Alkohol und ein Päckchen Zigaretten mit. Im Dunkeln schießt man selten, klar, aber ich sah die Umrisse der Kämpfer unter mir und ich bewachte die Stadt. Ich suchte nach den Schattengestalten.
Der frühe Morgen ist die beste Zeit. Das Licht ist perfekt, es blendet kaum, nichts spiegelt. Die Leute beginnen einen neuen Tag und sind nicht ganz so vorsichtig. Für einen oder zwei Momente vergessen sie, dass Teile ihrer Straße von unseren Gebäuden aus einsehbar sind. Im Morgengrauen hatte ich einige meiner besten Abschüsse. Die Frau zum Beispiel, die sich in ihrem schönen Kleid, einen Korb in der Hand, zu freuen schien, aus dem Haus zu gehen. Ich habe sie im Nacken getroffen, sie fiel auf der Stelle um wie eine Marionette, der alle Fäden gekappt wurden. Das war am Anfang, für die Leute war es noch ungewohnt. Mit der Zeit sind die Schüsse zur Normalität geworden, man wusste, wo man langgehen konnte, wo Gefahr lauerte. Ich hatte das Gefühl, als kontrollierte ich einen Teil der Stadt. Das war zugleich befriedigend und frustrierend, denn es wurde immer schwieriger, zum Schuss zu kommen. Deshalb musste ich mich von den Kameraden abkapseln und mehr Zeit mit Training verbringen. In gewisser Weise war das auch besser so, denn ich hatte langsam die Nase voll von den Straßensperren und den endlosen Kartenspielen im Kommandoposten. Der Offizier, der mir das Gewehr gegeben hatte, ließ mir freie Hand, die Kameraden stellten keine Fragen; Zak schaute ab und zu bei mir auf dem Dach vorbei, um mir ein Sandwich zu bringen oder einfach kurz zu quatschen. Er war ein wenig eifersüchtig, glaube ich, denn er war immer ein schlechter Schütze gewesen. Er war unfähig, aus fünfzig Metern ein feststehendes Ziel zu treffen. Sein Ding war der Nahkampf mit dem Messer oder den Fäusten. Wenn man ein guter Kämpfer sein will, muss man seine Stärken und seine Schwächen kennen. Zak war einer der Besten für den Hinterhalt. Alle bewunderten ihn.
*
Genau zu der Zeit, mitten im schönsten Sommer, schnappte meine Mutter endgültig über. Sie trat nackt auf den Balkon, schrie jede Nacht. Sie wusch sich nicht mehr, weil sie sich vor Wasser fürchtete. Die Nachbarin wollte nicht länger kommen, weil meine Mutter sie kratzte und ihr das Leben schwer machte. Jeden Abend räumte sie alle Möbel in der Wohnung vor die Eingangstür, erst schob sie die Kommode über die Kacheln, dann das Sofa, die Stühle. Einmal kam ich gegen Mitternacht nach Hause und war gezwungen, über den Balkon einzusteigen. Ihr Zustand verschlimmerte sich täglich. Sie konnte sich nicht einmal mehr selbstständig ernähren. Sie machte sehr merkwürdige Sachen, fegte zum Beispiel vier, fünf Stunden lang dasselbe Stück Kachelboden und folgte dabei den Motiven auf den Bodenplatten. Oder es fiel ihr ein, dass sie etwas kochen musste, und sie stellte lauter leere Töpfe aufs Feuer. Ich musste dem Lebensmittelhändler verbieten, ihr irgendetwas zu verkaufen, denn sie holte zum Beispiel fünf Kilo Linsen und setzte sie ohne Wasser auf, bis die vom Rauch und Gestank alarmierte Nachbarin herbeieilte. Ich überlegte, ob ich sie umbringen sollte, damit es ein Ende hatte, aber ich habe es nicht wirklich versucht. Man hätte sie in einem Heim unterbringen müssen, aber es war Krieg, da gab es mehr Irre denn je und keine Plätze.
So habe ich Myrna kennengelernt. Ich hatte sie schon gesehen, denn sie kam aus unserem Viertel, aber ich wusste nicht, wer sie war. Der Lebensmittelhändler gab mir den Rat:
»Du solltest jemanden zu dir nehmen, für deine Mutter. Jemanden, der die ganze Zeit über da ist, denn was sie treibt, endet irgendwann in einer Katastrophe.«
Ich hatte keine Ahnung, was er mit Katastrophe meinte, aber ich sagte:
»Ja, schon möglich. Aber ich wüsste keinen, der sich darauf einlassen würde. Sie ist verrückt, das wird kein Spaß. Und zahlen kann ich auch nicht viel.«
»Myrna vielleicht. Sie hat niemanden mehr. Sie sucht Arbeit.«
»Wer ist das?«
»Die Tochter des Elektrikers.«
Wie alle kannte ich die Geschichte des Elektrikers, aber ich wusste nicht, dass er eine Tochter hatte. Er war einige Wochen zuvor in seinem Geschäft von einer Mörsergranate weggepustet worden. Übrig geblieben war eine Mischung halb verkohlter Leichenteile, Radio- und Fernsehertrümmer.
»Ist sie denn nicht verheiratet?«
»Sie ist fünfzehn, höchstens.«
Anfangs war ich unschlüssig, denn über eine Fünfzehnjährige, die bei mir lebte und sich um meine Mutter kümmerte, würde sich das Viertel den Mund zerreißen. Doch zugleich fürchteten mich alle, weil sie wussten, dass ich bei den Kämpfern war. Zuerst habe ich die Sache mit Myrna auf sich beruhen lassen, mehr aus Trägheit als aus einem anderen Grund. Ich schaute drei- oder viermal am Tag zu Hause vorbei, um nach meiner Mutter zu sehen, das war alles. Ich wusste nicht, wie ich sie dazu bringen konnte, etwas zu essen. Sie magerte zusehends ab. Und weigerte sich, mit mir zu sprechen. Ich glaube, sie erinnerte sich nicht mehr richtig daran, wer ich war. Dazu muss man wissen, dass ich in dieser Zeit immer in einem khakibraunen Kampfanzug herumlief. Mit Patronengürtel und allem. Als Waffen hatte ich eine automatische Pistole und ein Messer bei mir. Es war besser, ständig bewaffnet zu sein, denn man wusste nie, was passieren würde. Und außerdem war es wie eine Uniform: Wer gut sichtbar eine Waffe trug, war Soldat. Die meisten meiner Mitkämpfer hatten eine Kalaschnikow, ich nicht. Zum einen fehlt ihr die Präzision, zum anderen verleiht einem ein Revolver Gewicht. Den Status eines Offiziers sozusagen. Das Problem bei meinem Gewehr: Zusammen mit dem Ständer, dem Visier und dem Fernglas ist es ziemlich sperrig.
Gegen Ende des Herbstes entschloss ich mich dann, jemanden zu suchen, der sich um meine Mutter kümmerte, weil ich zu eingespannt war. Die Kämpfe an der Front hatten wieder begonnen, besonders nachts, und es gab gute Schussmöglichkeiten. Ich hatte einen amerikanischen Mündungsfeuerdämpfer gefunden, der auf mein Gewehr passte, die Dunkelheit machte mich unsichtbar. Das ist schlecht für den Schuss, aber man schießt nachts nie in die Ferne. Ich hielt Ausschau nach Schatten, wartete ab, bis sie feuerten, und schaltete sie dann mit einem einzigen Schuss aus. Es ist verrückt, wie sehr ein Sturmgewehr aufleuchtet. Die Typen kapierten nichts, sie hielten sich im Dunkeln versteckt und wurden trotzdem niedergestreckt.
Tagsüber die Straßen, die Passanten, nachts die zerstörten und verlassenen Häuser, die Schatten. Ich hatte keine Zeit, zu Hause vorbeizugehen, fragte mich, was für ein Chaos ich bei meiner Rückkunft vorfinden würde. Wenn man eine körperlich und intellektuell anstrengende Arbeit verrichtet, bei der man die ganze Zeit unter Spannung steht, will man sich ausruhen, wenn man nach Hause kommt, und nicht erst gezwungen sein, die Torheiten einer Irren auszubügeln, die einen nur jedes zweite Mal wiedererkennt. Außerdem war mir natürlich klar, dass sie sich einsam fühlen musste und dass sich die Situation ohne jemanden zum Reden nur verschlimmern konnte. Insbesondere, weil die Nachbarn langsam genug von ihr hatten. Nach einer anstrengenden Woche (immer wieder Gewitter, wir waren die ganze Zeit halb nass) kam ich also nach Hause. Als ich fortgegangen war, hatte ich grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen, die Gasflasche abgedreht und abmontiert etc. Das Wasser stellte kein Problem dar, denn es kam nicht viel, und sie hatte eine Mordsangst davor. Ich komme also nach Hause, und niemand ist da. Ich weiß nicht warum, aber mein erster Gedanke war: Sie ist tot. Niemand war da, es war nicht besonders unordentlich, und ich dachte, sie sei in der Woche gestorben. Da ich wirklich erschöpft war, legte ich mich in voller Montur aufs Bett und schlief sofort ein. Was auch immer gerade bombardiert wurde, ich schlief. Gut zwölf Stunden später wachte ich auf. Ich hatte Hunger, deshalb ging ich raus, um etwas zu essen, und als ich beim Lebensmittelhändler vorbeikam, rief er mir zu:
»Hey, deine Mutter ist im Krankenhaus.«
»Ist sie tot?«, fragte ich.
»Was? Nein, nein, warum? Ich glaube, es geht ihr sehr gut. Frag deine Nachbarn.«
Das hatte mir gerade noch gefehlt. Ich sollte am selben Abend wieder auf dem Posten sein. Ich ging zur Einsatzleitung, um ihnen mitzuteilen, dass ich nicht arbeiten könnte, weil meine Mutter im Krankenhaus sei. Ich erkundigte mich bei den Nachbarn nach ihrem Verbleib — sie sahen mich an, als wäre ich ebenso verrückt wie sie —, dann ging ich sie abholen. Sie hatte natürlich nichts, der Arzt erklärte mir, sie leide unter wiederkehrenden Wahnvorstellungen und müsse daher Medikamente einnehmen, die sie beruhigen. Außerdem könne sie nicht allein bleiben, weil sie offensichtlich zu essen vergesse. Und da fiel mir diese Myrna ein, auf die mich der Krämer hingewiesen hatte. Das alles würde leider Geld kosten, aber ich brauchte Ruhe, um mich zu konzentrieren. Außerdem würde es angenehm sein, jemanden zu haben, der etwas kochte, wenn ich nach Hause kam. Seit der Krieg begonnen hatte, aß ich nur noch Sandwiches oder die Gerichte, die Freunde mitbrachten. Ich schaffte meine Mutter nach Hause, sie war völlig benebelt von den Medikamenten, die man ihr im Krankenhaus gegeben hatte, dann ging ich hinunter zu dem Lebensmittelhändler.
»So kann es nicht weitergehen«, sagte ich zu ihm, »ich brauche endlich jemanden, der bei ihr bleibt. Meinst du, diese Myrna würde es machen?«
»Kann sein. Ich werde sie fragen, wenn sie vorbeikommt. Ich schicke sie zu dir, wie lange bist du da?«
»Bis morgen früh.«
»Gut, ich sage ihr, sie soll heute Abend bei dir vorbeischauen.«
Ich erklärte den Nachbarn, dass ich mich um jemanden bemühte, der auf meine Mutter achtgab. Sie wirkten erleichtert: Sie heule jede Nacht, deshalb habe man sie ins Krankenhaus verfrachtet. »Als hätte man nicht so schon genug Probleme«, sagte eine Nachbarin.
Gegen sechs Uhr kam Myrna. Ich hatte mir nicht vorgestellt, dass sie so jung war. Sie sah aus wie ein Kind, doch sie schien nicht verloren oder schüchtern zu sein. Sie sah mir direkt in die Augen.
»Ich bin Myrna. Der Lebensmittelhändler von unten schickt mich.«
»Ja, ich weiß. Hat er dir gesagt, warum?«
»Er sagte, es geht darum, sich um eine kranke Dame zu kümmern.«
Ich erklärte ihr die Situation, dass ich zeitweise länger wegbleiben müsse und jemanden brauchte, der sich um die Wohnung und meine Mutter kümmerte, kochte und den Haushalt machte. Ich war offen zu ihr, sagte ihr, dass es kein Vergnügen sein würde, weil sie vollkommen übergeschnappt sei. Sie fragte, ob sie meine Mutter sehen könne, und ich führte sie zu ihrem Zimmer. Sie schlief.
»Sie sieht jung aus«, sagte Myrna.
Und dann sprachen wir über das Geld. Ich erklärte ihr, wie viel ich ihr in der Woche für die Einkäufe und alles geben könne. Sie überlegte einen Augenblick und sagte, sie wolle es erst einmal eine Woche versuchen, dann würde sie weitersehen.
»Einverstanden. Du kannst im dritten Zimmer wohnen.«
Das dritte Zimmer war das Zimmer meines Bruders, doch er ist vor langer Zeit ausgewandert und hat nie wieder etwas von sich hören lassen. Dann stellte ich Myrna den Nachbarn vor, die sie mitleidig ansahen, ich wusste nicht, ob wegen der Geschichte mit ihrem Vater oder weil sie bei mir bleiben würde. Vermutlich beides. Sie sagten ihr, sie könne bei ihnen vorbeikommen, wann immer sie wolle. Ich überlegte kurz, ob ich nicht sofort an die Front zurückkehren sollte, aber dann dachte ich, gut, in der ersten Nacht wäre es wohl besser, wenn ich dabliebe. Sie ging gleich los, um ihre Sachen zu holen, bevor es dunkel wurde, und kam mit einem kleinen Koffer zurück. Wir stellten uns auf den Balkon, es war schwül, wieder einmal lag ein Gewitter in der Luft; wir hörten die Bombardements. Ihr Haar war tiefbraun, ihr Teint matt. Sie hatte fast den Körper einer Frau und dazu das Lächeln eines Mädchens, ein nettes Gesicht. Vor allem schwatzte sie nicht viel. Sie schien mich zu mögen. Ich fragte sie, ob sie sich nicht fürchte, sie sah mich an und schüttelte den Kopf: Nein, sie hatte keine Angst, man sah es in ihren Augen. Wahrscheinlich waren alle anderen Hausbewohner im Treppenhaus, denn das Bombardement kam immer näher, wir aber standen auf dem Balkon, und ich versuchte herauszufinden, ob sie wirklich so furchtlos war. Nicht weit entfernt schlug eine Granate ein. Sie zuckte zusammen, die Explosion überraschte sie, aber sonst nichts. Gut, es war Zeit reinzugehen. Ich hatte das Badezimmer zum Schutzraum hergerichtet, denn es geht nach hinten raus, der Abstand zum Nebenhaus beträgt nur einen Meter, außerdem schützen es zwei Stockwerke darüber vor einem direkten Einschlag. Das Bad ist einigermaßen sicher, und gegen Granatsplitter hatte ich es mit Sandsäcken ausstaffiert, die ich von der Front geholt hatte. Ich zeigte ihr, wie man meine Mutter dorthin bugsierte. Sie war noch immer vollkommen benebelt von den Drogen und wurde nicht einmal wach. Inzwischen hagelte es um uns Bomben, bum, bum, bum; ich löschte die Gaslampe, nahm eine Kerze und wir saßen in unserem Versteck, während jeder Einschlag im Haus widerhallte. Myrna sagte nichts, die Kerze warf hübsche Schatten auf ihr Gesicht. Sie hatte keine Angst. Meine Mutter schlief auf dem Feldbett. Ich fragte Myrna, ob sie Hunger habe, und ging in die Küche, ohne ihre Antwort abzuwarten, um Brot und eine Dose Sardinen zu holen. Wir aßen fast wortlos, bei den Explosionen fuhr sie hoch, aber sie riss sich zusammen und aß weiter, vielleicht um mir zu zeigen, wie furchtlos sie war. Dann entfernte sich das Bombardement ein wenig, anscheinend war es genug für diesen Abend. Ich trat auf den Balkon, in der Ferne brannten zwei Autos, und das war alles. Die Bomben fielen jetzt weiter weg in Richtung Meer. Ich überlegte mir, dass es besser wäre, wenn sie diesen Abend mit meiner Mutter im Versteck schliefe, weil sie ein Kind war und ich die Verantwortung für sie hatte. Ich holte ihre Matratze, sagte zu ihr, dass sie diesen Abend besser im Badezimmer schlafen solle, und machte damit deutlich, dass sie bei mir nichts zu befürchten hatte, dann sah ich ihr beim Einschlafen zu. Ich blieb noch eine ganze Weile wach und ging zuletzt zum Schlafen in mein Zimmer. Ich war froh, dass sie da war.
*
Als ich am nächsten Morgen aufwachte, war sie schon lebhaft im Gespräch mit meiner Mutter. Jedenfalls redete meine Mutter wie immer allen möglichen Unsinn, und Myrna lachte und erledigte nebenher die Hausarbeit. Ich fragte sie, ob es gehe, sie sagte, ja, kein Problem: Ich ließ ihr Geld zum Einkaufen da, erklärte ihr, wie sie die Sandsäcke vor der Tür aufstapeln musste, falls es wieder losging, und dass sie, wenn das Viertel direkt unter schwerem Beschuss stand, mit meiner Mutter zu den Nachbarn ins Treppenhaus gehen solle. Verstehe, erwiderte sie. Ich würde versuchen, am Abend wieder vorbeizukommen, sagte ich und brach auf. Sei vorsichtig, meinte sie, und ich ging mit einem Augenzwinkern.
Ich kehrte an die Front zurück und bezog wieder Stellung hinter meiner improvisierten Schießscharte; ich musste einen Durchgang bewachen, der sich für einen Versuch feindlicher Infiltration eignete. Der Vormittag war ruhig, ich streckte eine Katze nieder, die auf einem Stahlbetonträger balancierte, und einen armen, alten Idioten, der hemdsärmelig auf unsere Linien zulief. Ich erschoss ihn, bevor er in seiner Dummheit verraten konnte, wo unsere Minen lagen.