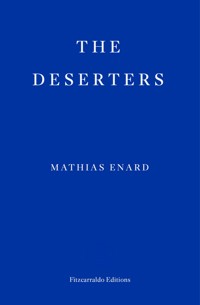13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: eBook Berlin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Francis Mirkovic, alias Yves Deroy, sitzt im Pendolino von Mailand nach Rom, inkognito und erster Klasse reisend, und über ihm, mit einer Handschelle an der Gepäckstange gesichert, ein Metallkoffer voller Dokumente und Fotos - der »Koffer voller Toten«. Er enthält die Listen von Kriegsverbrechern, Waffenhändlern und Terroristen, die Francis als Agent des französischen Geheimdienstes in den Konfliktzonen des Mittelmeerraums zusammengestellt hat und an den Vatikan verkaufen will, um ein neues Leben zu beginnen. Erschöpft von Alkohol und Amphetaminen lässt er seinen Erinnerungen freien Lauf - an die Entsetzlichkeiten des Balkankrieges, in die er zwei Jahre als Söldner verwickelt war, an die Freunde, die neben ihm starben, an die Menschen von Algier bis Jerusalem, die er ausspionierte, an die Frauen, die er liebte: Stéphanie, die kein Kind »mit einem Barbaren wie ihm« wollte, oder Sashka, die vielleicht noch in Rom auf ihn wartet. In einem einzigen Satz des symphonisch gestalteten inneren Monologs, im Stakkato des Nachtzugs, mäandernd, sich wiederholend, springt der Erzähler von Ereignis zu Ereignis - vom Blutbad der christlichen Phalange in Beirut 1982 zu Mussolinis Nordafrikakrieg, vom Den Haager Kriegsverbrecherprozess zu seinem Vater, der auf französischer Seite im Algerienkrieg folterte -, benennt die Gräuel aus der Geschichte und Gegenwart des Mittelmeers, die sich zu einem homerischen Fresko der Gewalt formen. Mit seinem Roman Zone erweist der junge Autor Énard einem Epos über den Krieg Reverenz, das zur Gründungsakte der europäischen Literatur wurde: Homers Ilias.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.berlinverlag.de
Für die Welt der »A«s
Übersetzung aus dem Französischenvon Holger Fock und Sabine Müller
ISBN 978-3-8270-7306-8Die Originalausgabe erschien 2008 unter dem TitelZone bei Actes Sud, Arles© Éditions Actes Sud, Arles 2008Deutschsprachige Ausgabe:© Bloomsbury Verlag GmbH, Berlin 2010, 2012Covergestaltung: Rothfos & Gabler, HamburgCovermotiv: plainpictureDatenkonvertierung: psb, Berlin
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Berlin Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Cover & Impressum
Vorspann
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
Danksagung
Vorspann
Und gingen hinunter zum Schiff,Kiel gegen Brecher gestellt, Bugspriet aufs heilige Meer,Und wir holten Segel und Rah an, auf jenem schwarzen Schiff,Schleppten Schafe an Bord, alsbald auch uns selber.
EZRA POUND[1]
Ich und Jerusalem: wie ein Blinder und ein BeinamputierterEr sieht für michBis zum Toten Meer, bis zum Ende aller Tage.Und ich habe es auf meinen SchulternUnd gehe blind umher in meiner Finsternis darunter.
JEHUDA AMICHAI[2]
I
alles ist schwieriger im Mannesalter, alles klingt falscher ein wenig metallisch wie das Geräusch zweier Bronzeschwerter die gegeneinanderschlagen, sie werfen uns auf uns selbst zurück ohne uns irgendeinen Ausweg zu lassen ein schönes Gefängnis ist das, man reist mit allerhand Zeug, einem Kind das man nicht getragen hat einem kleinen Stern aus böhmischem Kristall einem Talisman, entlang der Schneefelder die man schmelzen sieht nach der Umkehr des Golfstroms Präludium zur Eiszeit, Stalaktiten in Rom und Eisberge in Ägypten, in Mailand hört es nicht auf zu regnen, ich hatte das Flugzeug verpasst vor mir lagen eintausendfünfhundert Kilometer Zugfahrt jetzt sind es noch fünfhundert, heute Morgen glänzten die Alpen wie Messer, ich zitterte vor Erschöpfung auf meinem Sitzplatz und konnte kein Auge zutun, ich bin völlig zerschlagen wie ein Drogensüchtiger, im Zug habe ich ganz laut mit mir selber geredet, oder ganz leise, ich fühle mich uralt, ich möchte, dass der Zug weiterfährt weiterfährt dass er bis nach Istanbul oder Syrakus fährt dass er wenigstens bis zum Ende fährt dass er bis zum Ziel der Reise fahren kann ich dachte oh ich bin wirklich zu bedauern ich habe Mitleid mit mir bekommen in diesem Zug dessen Rhythmus einem zuverlässiger die Seele öffnet als ein Skalpell, ich lasse alles an mir vorbeirauschen alles flieht alles ist schwieriger in diesen Zeiten entlang der Bahngleise ich würde gerne einfach von einem Ort zum nächsten fahren wie es für einen Reisenden selbstverständlich ist gleich einem Blinden den man am Arm nimmt wenn er eine gefährliche Straße überquert, aber ich fahre nun einmal von Paris nach Rom, und im Mailänder Hauptbahnhof, in diesem Echnaton-Tempel für Lokomotiven, in dem trotz des Regens noch etwas Schnee liegt, drehe ich mich im Kreis, betrachte ich die riesigen ägyptischen Säulen, die die Decke stützen, sitze ich auf einer Caféterrasse mit Blick auf die Schienen wie andere mit Blick aufs Meer sitzen und trinke ein Gläschen aus Langeweile, es tut mir überhaupt nicht gut, für ein Besäufnis war es nicht der richtige Zeitpunkt, es gibt so viele Dinge, die einen vom Weg abbringen, irreführen, und dazu gehört auch der Alkohol, der tiefer in die Wunden schneidet, wenn man sich allein auf einem riesigen eiskalten Bahnhof befindet und nur noch ein Ziel kennt, das zugleich vor und hinter einem liegt: der Zug fährt nun mal nicht im Kreis, sondern von einem Punkt zum anderen, ich aber kreise im Orbit wie ein Gesteinsbrocken, ich fühlte mich wie ein nahezu schwereloser Stein, als mich der Mann auf dem Bahnsteig ansprach, ich weiß dass ich Verrückte und Gestörte anziehe, in solchen Zeiten verfangen sie sich gern in meinen Schwächen, finden sie in mir einen Spiegel oder einen Waffenbruder und he der ist echt verrückt Priester einer unbekannten Gottheit er trägt eine Narrenkappe und hält eine Schelle in der linken Hand, die rechte streckt er mir entgegen und schreit auf Italienisch: »ein letzter Handschlag noch, Kamerad, vor dem Weltuntergang«, ich wage es nicht einzuschlagen aus Angst, er könnte recht behalten, er dürfte ungefähr vierzig sein, nicht älter, und er hat den scharfen und inquisitorischen Blick der Irren, die dich löchern, weil sie für einen Augenblick einen Bruder in dir entdeckt haben, ich zögere angesichts der ausgestreckten Hand starr vor Entsetzen wegen dieses irren Lachens und antworte ihm »nein danke«, als ob er mir eine Zeitung verkaufen oder eine Kippe anbieten wollte, woraufhin der Verrückte mit seiner Schelle klingelt mit seiner tiefen Stimme in ein finsteres Lachen ausbricht und auf mich zeigt mit dem Finger der Hand die er mir entgegenstreckt, dann spuckt er aus, geht weiter und der Bahnsteig ist wie leergefegt von einer gewaltigen fast hoffnungslosen Einsamkeit, in diesem Augenblick gäbe ich alles für Arme oder Schultern, sogar den Zug der mich nach Rom bringt, auf alles verzichten würde ich, nur damit jemand hier in der Mitte des Bahnhofs erscheint, zwischen den Schatten, unter den Menschen ohne Menschen den Reisenden, die sich an ihre Handys und Koffer klammern, unter allen, die während des kurzen Abstechers, der sie von Milano Centrale nach Fossoli Bozen oder Triest bringen wird, verschwinden und ihre Körper aufgeben, es ist schon lange her, Gare de Lyon in Paris, da hat mir ein verrückter Mystiker ebenfalls den Weltuntergang verkündet und er hatte recht, ich hatte mich damals im Krieg in zwei Teile gespalten und war zerschellt wie ein winziger Meteorit, einer von denen die nicht einmal am Himmel leuchten, ein natürliches Geschoss, dessen Masse den Astronomen zufolge lächerlich gering ist, der Verrückte auf dem Mailänder Bahnhof erinnert mich an den sanften Irren von der Gare de Lyon, ein Heiliger, wer weiß, vielleicht war es derselbe Mann, vielleicht waren wir im selben Rhythmus aufgewachsen jeder für sich mit seinen jeweiligen Wahnvorstellungen, die auf Bahnsteig 14 des Mailänder Hauptbahnhofs wieder zusammenfinden, in einer Stadt mit dem Namen eines Raubvogels und eines spanischen Generals, die am Rand der Poebene liegt wie auf einem Firn, den die Alpen langsam erbrochen haben, deren Gipfel ich sah, Feuersteinklingen, die den Himmel aufschlitzen und den Ton zur Apokalypse angeben, bestätigt vom Narren mit der Schelle in diesem Heiligtum des Fortschritts, den die Stazione di Milano Centrale darstellt, die in der Zeit verloren ist wie ich hier in dieser eleganten Stadt mit einer Augenklappe wie Millán Astray, der einäugige General, ein Raubvogel, fiebrig, bereit, zitternde Körper in Stücke zu reißen, kaum dass sie wieder im Licht von Raub und Gefahr erschienen ist: Millán Astray hätte es gern gesehen, wenn Madrid zu einem neuen Rom geworden wäre, in jenem großen kriegerischen Präludium der 40er Jahre diente er seinem glatzköpfigen Idol dem iberischen Duce Franco, dieser einäugige und kriegslüsterne Offizier war Fremdenlegionär und als guter Kriegsprophet rief er Viva la muerte, und er hatte recht, noch in Polen würde man die Todesfuge spielen, würde sich eine riesige Welle von Leichen bilden deren Gischt schließlich in Triest oder Kroatien die Adriaküste umspülte: während sich die Reisenden auf dem Bahnsteig drängen um die Fahrt an das Ende der Welt anzutreten und in den Zug zu steigen, der sie geradewegs dorthin bringt, denke ich an Millán Astray und seine Kontroverse mit Unamuno, dem strengen Priester der Kultur, Unamuno war ein so klassischer und so erhabener Philosoph dass er das Blutbad nicht kommen sah, er konnte nicht zugeben, dass der einäugige General recht behalten würde, als er seinen Schäfchen Es lebe der Tod zurief, denn dieser Falke hatte gespürt (Tiere zittern vor dem Gewitter) dass Kadaver sprießen würden, dass der Tod einige Jahre aus dem Vollen schöpfen würde, bevor auch er in einem Zug endete, einem Zug zwischen Bozen und Birkenau, zwischen Triest und Klagenfurt oder zwischen Zagreb und Rom, wo die Zeit stehenblieb wie sie für mich auf diesem von Waggons, von fauchenden und keuchenden Triebwagen gesäumten Bahnsteig stehengeblieben ist, eine Pause zwischen zwei Toden, zwischen dem spanischen Soldaten und dem gleichnamigen Bahnhof, so vernichtend wie der Kriegsgott Ares persönlich – gedankenlos zünde ich mir eine letzte Zigarette an, ich muss mich auf die Zugfahrt, den Ortswechsel einstellen wie alle Reisenden, die den Bahnsteig des Milano Centrale abschreiten auf der Suche nach einer Liebe, einem Blick, einem Erlebnis, das sie aus dem endlosen Kreislauf, dem Tretrad herausholt, nach einer Begegnung, irgendeinem Ereignis, um sich selbst, dem Geschäft mit dem Leben, der Erinnerung an Aufruhr und Verbrechen zu entkommen, aber es ist doch komisch, dass genau in diesem Augenblick keine einzige Frau auf dem Bahnsteig steht, und so steige ich angetrieben vom Gedanken an Millán Astray und seine Augenklappe meinerseits in den italienischen Schnellzug ein der vor zehn Jahren noch der Gipfel des Fortschritts und der Technologie gewesen sein muss, weil seine Türen automatisch schlossen und er bei gerader Strecke und schönem Wetter schneller als zweihundert Stundenkilometer fuhr und heute, da wir dem Weltuntergang ein Stück näher gekommen sind, ist er nur noch ein Zug, so geht es mit allen Dingen, mit Zügen wie mit Autos, Umarmungen, Gesichtern, Körpern: wenn sie nach einigen Jahren erst einmal faulig oder rostig sind, erscheinen ihre Geschwindigkeit ihre Schönheit oder ihre Hässlichkeit ganz und gar lächerlich, über das Trittbrett trete ich in eine andere Welt, der Velours verdichtet alles, die Hitze ebenfalls, mit dem Besteigen des Waggons habe ich sogar den Winter hinter mir gelassen, es ist eine Zeitreise, heute ist kein Tag wie jeder andere, der 8. Dezember ist ein besonderer Tag der Tag der Unbefleckten Empfängnis und nachdem mir soeben ein Irrer den Weltuntergang verkündet hat verpasse ich nun die Moralpredigt des Papstes auf dem Spanischen Platz, ein letztes Mal hätte ich den Pontifex sehen können, den spirituellen Nachfolger des ersten Palästinenserführers, den einzigen, der irgendetwas erreicht haben soll, dabei war das keineswegs von vornherein ausgemacht für den abgebrannten, schmächtigen levantinischen Jammerlappen der zeit seines Lebens keine einzige Zeile niedergelegt hat, draußen auf dem Gleis neben uns ist ein Zug eingefahren und hinter der Fensterscheibe hat ein hübsches Mädchen etwas im Blick, ich glaube sie spricht mit jemandem, den ich nicht sehe, sie ist mir sehr nahe tatsächlich höchstens einen Meter von mir entfernt nur zwei ziemlich schmutzige Scheiben trennen uns ich muss stark sein ich darf nicht bei den Gesichtern junger Frauen verweilen ich muss mich wieder zusammennehmen Schwung holen für die verbleibenden Kilometer für die Leere danach und das Grauen der Welt ich ändere mein Leben wechsle den Beruf besser nicht darüber nachdenken, ich habe den kleinen Aktenkoffer auf die Ablage über meinem Sitz gelegt und unauffällig ans Gepäcknetz gekettet, besser wäre es für einen Augenblick die Augen zu schließen, aber auf dem Bahnsteig verfolgen Polizisten auf zweirädrigen Elektrowagen Marke Achilles oder Hektor ohne Pferde einen jungen Schwarzen, der zur Überraschung und Erregung der Reisenden Richtung Gleise flieht, die blauen Engel, vielleicht Verkünder der Apokalypse, reiten auf einem seltsamen Roller in stumpfem Himmelsblau, alle steigen aus um das Schauspiel zu genießen, der Sohn des Tydeus und Pallas Athene fallen über die Troer her, einige Dutzend Meter von mir entfernt Richtung Lokomotive holt einer der beiden Carabinieri den Fliehenden ein und schleudert den bereits gestellten Mann mit einem Schlag von seltener Wucht verstärkt noch durch die Geschwindigkeit seines Fahrzeugs gegen einen der Betonpfeiler in der Mitte des Bahnsteigs, der Flüchtling prallt auf die Säule, er schlägt mit dem Kopf gegen den Beton und stürzt, mitten im Bahnhof Milano Centrale fällt er gerade rechtzeitig auf den Bauch, damit der zweite Engel ihm aufs Kreuz springen und ihn niederzwingen kann, er hockt auf seinem Rücken wie ein Tierbändiger oder wie ein Bauer, der ein störrisches Tier fesselt, dann steigt er wieder auf sein Gefährt und zieht den strauchelnden Delinquenten unter dem bewundernden Gemurmel der Menge an einer Kette hinter sich her, eine antike Triumphszene, man führt die Besiegten in Ketten hinter den Kampfwagen herum, man zieht sie fort zu den bauchigen Schiffen, der Schwarze hat ein verquollenes Gesicht und seine Nase blutet, er geht erhobenen Hauptes, ein wenig ungläubig steigen alle wieder in den Zug ein, der Zwischenfall ist vorbei, nur wenige Minuten vor der Abfahrt hat die Justiz triumphiert, ich werfe einen Blick auf den Aktenkoffer, ich habe große Angst nicht einschlafen zu können, verfolgt zu werden, sobald ich döse in der Wachsamkeit nachlasse wird man sich in meinen Schlaf drängen oder unter meine Lider um sie aufzuschlagen wie man einen Faltstore oder einen venezianischen Vorhang einen Spaltbreit öffnet, an Venedig hatte ich schon lange nicht mehr gedacht, an das grüne Wasser bei der Zollspitze, an den Nebel auf den Zattere-Kais und an die Kälte, die einen packt, wenn man von den Fondamenta Nuove zum Friedhof von San Michele hinüberschaut, und seit meiner Rückkehr aus dem Krieg nicht mehr an die Ombras, die Schatten, wie die Gläschen Wein in Venedig heißen, die im Winter ab fünf Uhr nachmittags getrunken werden, und mir fallen wieder die slawischen Geiger ein, die für Japaner spielten, Franzosen in den schönsten Karnevalsmasken, und ein vermögender Friseur aus München, der einen Palast am Canale Grande erworben hatte, und mit einem Ruck fährt der Zug an ich lehne den Kopf zurück los geht’s noch gut fünfhundert Kilometer bis zum Weltende
II
ich lasse mich einlullen von der gleichmäßigen Abfolge der Vororte der Stadt mit dem Namen des spanischen Soldaten und des Raubvogels, den Vororten einer Stadt des Nordens wie es sie zuhauf gibt mit Mietshäusern um die Proletarier zusammenzupferchen, die Immigranten der sechziger Jahre, KZ-Atmosphäre in der Vertikalen, im paradoxen Gleichmaß der Bahnschwellen – ich bin in Venedig, in jenem winzigen feuchten Appartement, in dem es nur in der Küche Licht gab, der Boden fiel ab, beim Schlafen ragten die Füße aus dem Bett, was angeblich gut für den Kreislauf ist, es lag am Eingang des Ghettos gegenüber der Bäckerei vor der großen Synagoge wo ich gelegentlich Psalmen und Lieder hörte, manchmal rief der Name des Viertels, Ghetto Vecchio, Angst hervor, besonders nachts wenn alles verlassen und still war, wenn die eisige Bora wehte die direkt aus der Ukraine zu kommen schien nachdem sie Tschechen Ungarn und Österreicher hatte erstarren lassen, ich konnte in meinem Alten Ghetto nicht umhin an Łódź Kraków Saloniki und andere Ghettos zu denken, von denen nichts mehr übrig ist, an den Winter 1942, die Züge nach Treblinka, Bełżec und Sobibór verfolgten einen unweigerlich, 1993 einige Monate nach meinem eigenen Krieg und genau fünfzig Jahre nach der Vernichtung dachte ich in dem in Nebel und Kälte versunkenen venezianischen Ghetto an die deutsche Todesmaschinerie ohne zu wissen dass sich eines ihrer letzten Räder ganz in der Nähe gedreht hatte, nur wenige Kilometer von hier entfernt, doch wenn ich jetzt in der Benommenheit der Bahnfahrt wieder an Venedig denke dann vor allem wegen der Frau die mir dorthin nachgekommen war, an ihren Körper den sie mir so oft verweigerte und der mich zu langen manchmal bis zum Morgengrauen dauernden nächtlichen Wanderungen zwang, ich ging mit meiner schwarzen Kappe auf dem Kopf über den Campo di Mori, ich grüßte den heiligen Christophorus über dem Portal der Kirche Madonna dell’Orto, ich verirrte mich zwischen den wenigen modernen Gebäuden, die dort standen als hätte man sie absichtlich in versteckten Winkeln errichtet damit niemand sie sieht, als wären sie von der Lagune nicht genügend versteckt, und wie oft kam es vor, dass ich mich bei Tagesanbruch bei einem Kaffee mit den Lotsen und Schiffsführern der Vaporetti wiederfand für die ich nicht existierte, denn die Venezianer haben die atavistische Eigenschaft niemanden zu beachten der nicht zu ihnen gehört, Auswärtige nicht wahrzunehmen, sie verschwinden zu lassen, und diese souveräne Missachtung, diese sonderbare altmodische Erhabenheit des Hilfsbedürftigen, der die Hand, die ihn nährt, vollkommen übergeht, war nicht unangenehm, sondern im Gegenteil eine große Offenheit und Freiheit, fernab der kommerziellen Anbiederung die die ganze Welt heimgesucht hat, die ganze Welt außer Venedig wo man einen weiterhin übergeht und nicht beachtet als bräuchten sie einen dort nicht, als bräuchte der Gastwirt in Venedig keine Kundschaft, so reich wie er ist an seiner ganzen Stadt und so sicher und gewiss, dass an seinen Tischen, was auch immer geschieht, bald weniger abgefeimte Gäste sitzen würden, und das verleiht ihm eine furchterregende Überlegenheit über den Gast, die Überlegenheit des Geiers über das Aas, am Ende wird der Besucher ob mit oder ohne Lächeln immer gerupft, ausgenommen, wozu ihm etwas vormachen, sogar der Bäcker gegenüber von meiner Wohnung räumte ein ohne mit der Wimper zu zucken, dass sein Brot nicht besonders gut und sein Gebäck überteuert war, derselbe Bäcker sah mich monatelang jeden Tag jeden Tag ohne mir je zuzulächeln, seine Kraft lag in der Gewissheit, dass ich verschwinden würde, eines Tages würde ich Venedig und die Lagune verlassen, ob nach ein, zwei, drei oder zehn Jahren, er war von der Insel und ich nicht, und er erinnerte mich jeden Morgen daran, was heilsam war, ich brauchte mir keine Illusionen zu machen ich verkehrte nur mit Ausländern, Slawen, Palästinensern, Libanesen, Ghassan, Nayef, Khalil und sogar einem Syrer aus Damaskus, der eine Bar betrieb, in der sich Studenten und Emigranten trafen, er war ein ehemaliger Matrose, der bei einem Zwischenstopp desertiert war, ein ziemlich rauer Typ, den man nie mit dem Meer oder einem Schiff in Verbindung gebracht hätte, mit einem waschechten Bauernschädel, ich erinnere mich an seine riesigen, stark behaarten Ohren, er war sehr fromm, er betete, fastete und trank nie von dem Schnaps, den er seinen Kunden einschenkte, seine Schwäche waren Mädchen, vor allem Nutten, zu seiner Rechtfertigung sagte er immer, der Prophet habe hundert Frauen gehabt, er liebe nun mal Frauen und alles in allem sei das Herumhuren doch eine schöne Sünde, ich hingegen hurte nicht viel herum in Venedig, der Winter hörte nie auf, war nass und kalt, der Hurerei in der Tat nicht besonders zuträglich, mir fällt ein, dass ich in der ersten Nacht im Ghetto keine Bettdecke hatte und so sehr fror, dass ich mich in einen völlig verstaubten Orientteppich wickelte, vollständig angezogen und mit meinen Schuhen, weil mich der steife Bettvorleger wie ein Röhre umhüllte, die Füße aber nicht bedeckte, vor dem Einschlafen las ich Geschichten über Geisterschiffe von William Hope Hogdson wie ein verkrachter Fakir oder ein in seine Hängematte eingenähter Seemann, der darauf wartet dass man ihn dem Meer übergibt, fern jeder erotischen Atmosphäre, die manche Leute Venedig verleihen, ein Kerl, der eingewickelt wie eine bröselige und abgeraspelte Zigarre auf seinem eigenen Bett liegt, Latschen an, Kappe auf, warum ging die Heizung nicht, ich kann mich einfach nicht erinnern, in diesem Waggon sind jetzt aber bestimmt fünfundzwanzig Grad, ich habe zur selben Zeit wie der Fahrgast mir gegenüber meinen Pulli ausgezogen, er hat einen Schädel wie ein weißer Rapper aus New York und liest mit überheblichem Gesichtsausdruck Pronto, ich frage mich, was er mir verkünden wird, bestimmt nicht den Weltuntergang, eher das Zerwürfnis eines Schauspielerpärchens aus Hollywood oder die Überdosis Kokain eines dreißigjährigen italienischen Geschäftsmannes, des Neffen oder Enkels von Fiatchef Agnelli, ich kann seinen Vornamen auf der Titelseite lesen, Lupo, seltsam, ich muss mich irren, wie kann man Geschäftsmann sein und Wolf heißen, ich stelle ihn mir schön vor, glänzendes Haar, weiße Zähne, mit lebhaften und ein wenig geröteten Augen, bestimmt hat man ihn bewusstlos in einem Luxusappartement in Turin gefunden, vielleicht in Gesellschaft irgendeiner Halbweltdame, sein Lamborghini ist ordentlich vor dem Haus geparkt, mit wer weiß was mit einem bisschen Blut oder Galle am aufgeknöpften Armani-Hemd, ich ahne die Aufregung der Damen im Foyer, die in der Mehrzahl solche Zeitschriften lesen, mein Gott, dieser Wolf ist wirklich schön, wirklich reich, aus gutem Haus, was für ein trauriger Schlamassel, er hätte so viel Anstand besitzen können mit dreihundert Stundenkilometern gegen eine Absperrung zu prallen, einen Hubschrauber- oder einen Jet-Ski-Unfall zu haben, von einer Schraube seiner eigenen Yacht zerstückelt zu werden oder auch mit einer Kugel im Kopf zu enden, abgeknallt von einem eifersüchtigen Ehemann oder einem Sicario, einem Auftragskiller der Mafia, aber Drogen, Drogen, das ist, als hätte er sich die Syphilis geholt, es ist eine Schande, es ist unmöglich, ungerecht, für einen Moment wird mir dieser junge Wolf aus Turin beinahe sympathisch, der seine große Familie in Verruf bringt, ich hoffe, dass er vor dem Weltuntergang wieder aus dem Krankenhaus entlassen wird, mein Gegenüber hat eine herablassende und missbilligende Miene aufgesetzt, er schüttelt den Kopf und schnalzt dazu leise mit der Zunge, während draußen die Nacht anbricht, wir fahren durch die Ebene, die triste in Dunkelheit getauchte Ebene der Lombardei, die Dämmerung wird Gott sei Dank kurz sein die kahlen froststarren Bäume neben den Strommasten werden verschwinden bis man nur noch ihre Schatten wahrnimmt und vielleicht taucht der Mond ab und zu aus den Wolken auf um die Hügel vor Bologna zu bescheinen, dann gleiten wir weiter Richtung Südwesten durch die weichen Hügel der Toskana bis nach Florenz und anschließend in derselben Richtung bis nach Rom, noch fast fünf Stunden bis zum Bahnhof Roma Termini, bis zu den Kirchen, dem Papst und so weiter und so fort, dem ganzen heiligen römischen Firlefanz: Devotionalien und Krawatten, Weihrauchgefäße und Regenschirme, alles untergegangen zwischen Bernini-Brunnen und zwischen den Autos, wo auf modrigen Pflastersteinen und einem stinkenden Tiber Jungfrauen mit Kind, Bildnisse des heiligen Matthäus, Pietàs, Kreuzabnahmen, Mausoleen, Säulen, Carabinieri, Minister, Eroberer und der Lärm einer tausendfach wiederauferstandenen, von Wundbrand, Schönheit und Regen zerfressenen Stadt dahintreiben, die weniger an eine schöne Frau denn einen alten Gelehrten mit prächtigem Wissen erinnert, der sich gerne mal in seinem Sessel vergisst, das Leben verlässt ihn auf allen Wegen, er zittert, hustet, rezitiert die Georgica oder eine Ode von Horaz und macht sich dabei in die Hose, genauso leert sich Roms Innenstadt, keine Bewohner, keine Tante-Emma-Läden mehr, nur noch Klamotten und Klamottengeschäfte es ist zum Verrücktwerden, Milliarden von Hemden Hunderte von Milliarden von Pumps und Millionen von Krawatten von Schals, genug um damit den Petersdom zu bedecken, das Kolosseum einzuwickeln, genug um alles für ewig unter Nippes zu begraben, damit die Touristen in diesem riesigen religiösen Trödelladen herumstöbern können, in dem sie mit glänzenden Augen nach Fundstücken gieren, sieh mal, unter dem Pelzmantel habe ich eine herrliche Kirche von Borromini gefunden, hinter der Lodenjacke dort ein Deckengemälde der Brüder Carracci und in den schwarzen Lederstiefeln die Hörner des Moses von Michelangelo, würde man mich dort nicht erwarten, ich würde nie mehr dorthin zurückkehren, wäre im besten Mannesalter alles einfacher, hätte ich diese Reise nie angetreten, diesen letzten Koffer nie getragen, ist mir doch lieber meine gallische Loire als der lateinische Tiber, die Verse du Bellays[3], die ich in der Schule auswendig lernte, Glücklich wer wie Odysseus und so weiter, auch ich führe meine Klagen, Ungaretti nennt den Tiber[4] einen verhängnisvollen Fluss Ungaretti, geboren im ägyptischen Alexandria, wo er bis zwanzig lebte, bis er sich nach Rom einschiffte und sich später in Frankreich niederließ, Alexandria, es gibt nicht weit von hier ein Alessandria in Piemont, ich war nie dort, ich erinnere mich dass ich in Venedig in einem Reisebüro einmal nachfragte, ob es Schiffe nach Alexandria gebe und die Angestellte (eine blonde Venezianerin, im Mund eine Art Haarspange wie andere einen Zahnstocher) sah mich verdutzt an, aber nach Alexandria fährt doch ein Zug, und mit jenem spontanen Vertrauen, das man Fachkräften entgegenbringt hatte ich eine Sekunde lang einen Zug vor Augen, eine Herausforderung für die Geopolitik wie für den Verstand, der von Venedig über Triest Zagreb Belgrad Thessaloniki Istanbul Antiocha Aleppo Beirut Akkon und Port Said direkt nach Alexandria in Ägypten fuhr, und selbst als ich die Verwechslung mit Alessandria in Piemont schließlich bemerkt hatte, träumte ich noch von einem Zug, der alle Alexandrien miteinander verbinden würde, von einem Schienennetz zwischen Alessandria in Piemont Alexandretta in der Türkei Alexandria in Ägypten und Alexandria in Arachosien, dem vielleicht geheimnisvollsten Alexandrien irgendwo in Afghanistan fernab aller Schienenwege, der Zug würde Alexander-Express heißen und in dreizehn Tagen und ebenso vielen Nächten von Alexandria Eschatê in Tadschikistan nach Piemont fahren, dabei die Ränder Afrikas streifen, Alexandria in Ägypten noch eine verfallene Stadt im Niedergang der es nicht an Charme fehlt, wenn es regnet oder dunkel ist, ich erinnere mich, wir hatten dort ein Hotel an der Corniche, das erste Mal standen wir stundenlang auf dem Balkon und betrachteten das Mittelmeer, bis ein großer Betonbrocken wegbrach und um Haaresbreite einen Kerl unten auf der Terrasse erschlagen hätte, er hob kaum den Kopf, ein Ägypter ist es gewohnt, dass ihm fast jeden Tag der Himmel auf den Kopf fällt, damals schlief ich mit Marianne in einem Doppelzimmer, sie zog sich im Badezimmer aus, sie hatte einen Körper und ein Gesicht, dass einem das Herz blutete, und meines sehnte sich nach nichts anderem, im Geruch nach Regen und Meer von Alexandria berauschte ich mich an Mariannes Duft, unser Hotel war nicht das Cecil, unser Aufenthalt hatte nichts von Durell, damals hatte ich keine Ahnung von Büchern, weder von Ungaretti noch von Kavafis, diesem traurigen kleinen Angestellten einer der großen Banken, die es in Ramla gibt oder der Baumwollbörse, wenn er von der Arbeit kam setzte er sich in eine der riesigen Konditoreien, wo er von Marcus Antonius träumte, dem Verlierer von Actium, während er einem hüfteschwingenden arabischen Kellner zusah und den Sonnenuntergang über dem Mamelucken-Fort betrachtete, nachts sieht alles gleich aus, ich könnte in Alexandria sein in jenem Hotel an der Uferstraße, gegen das die Gischt spritzte wie der Regen jetzt meine Scheibe strichelt, es war trübe und es regnete, eine Nacht, und allmählich, fast im Schritttempo wie die italienische Lokomotive, kehre ich zurück zu Marianne in das eiskalte Hotel, wo wir vor Kälte schlotterten, ich schließe die Augen, um mich an diese Begegnung zu erinnern, an diesen Beischlaf den wir eher schnell und vulgär vollzogen, hat er überhaupt stattgefunden oder hat sie mir nur erlaubt, sie zu umarmen, ich glaube nicht, sie hatte ihren Pullover ihren Schal anbehalten, im Zimmer zog es gewaltig, aber am Morgen strahlte die Sonne das Meer war richtig blau Marianne fuhr schnell nach Kairo zurück, ich blieb noch ein paar Tage badete in der Stadt und im Alkohol, »Ricardo der echte Pastis von Alexandria«, ein grauenhafter ägyptischer Anislikör, den ich ohne Eis aus einem Plastikbecher trank, während ich das Meer betrachtete, eine glorreiche Einsamkeit, morgens einen Tee trinken in einer der Konditoreien am Bahnhof von Ramla, dazu ein Croissant von mindestens fünfhundert Gramm essen, der reinste Gips, und den scheppernden Straßenbahnen zuschauen aus einem Ledersessel, in dem einst vielleicht die müßigen Ärsche von Tsirkas, Kavafis und Ungaretti saßen, Gespenster in dieser von Armut zerfressenen Stadt, die mit dem Rücken zum Mittelmeer steht wie mit dem Rücken zur Wand, verdreckt und ungesund, sobald man die Stadtviertel im Zentrum verlässt, die schon schmutzig genug sind, ein hübscher Platz um unter der großen Wintersonne an einem vom Wind leergefegten Himmel bei frittiertem Fisch auf den Weltuntergang zu warten, es ist sehr heiß in diesem Waggon, ich werde gleich eindösen, fast schlafe ich schon gewiegt von Mariannes weißen Armen, ihr Gesicht verwandelt sich, wird vom Sonnenuntergang verzerrt, in die Länge gezogen von den Bäumen, die vorbeifliegen, ich bin nach Alexandria zurückgekehrt, ich bin häufig dorthin zurückgekehrt, und nicht nur im Traum, um mehr oder weniger geheime Geschäfte mit ägyptischen Generälen zum Abschluss zu bringen, deren Rang man nicht an der Zahl ihrer Sterne, sondern an der ihrer Mercedeslimousinen erkannte, Generälen die gegen den islamistischen Terrorismus kämpften, sich aber jeden Abend sorgfältig die Stirn mit Glaspapier abtupften, damit die Haut aussah, als wäre sie vom Gebetsteppich aufgeraut, bis sie davon eine Schwiele bekamen und noch frommer aussahen als ihre Gegner, in Ägypten ist immer alles maßlos, ich notierte Namen Adressen Netzwerke die Spur von Aktivisten, die aus Afghanistan oder dem Sudan gekommen waren, und die Offiziere, einer fetter als der andere, versahen jeden ihrer Sätze mit einem in sha’allah, allahu a’lam, la hawla, ausgerechnet sie, die mit derselben Hingabe in den Hinterhöfen der überfüllten Gefängnisse entlang des Niltals die Bärtigen folterten und erschossen, ich war tatsächlich in Alexandria, zweimal schaffte ich es sogar über das Meer anzureisen, im Sommer sorgte eine Fähre für eine Verbindung von Zypern aus, man konnte also mit dem Schiff von Beirut nach Alexandria reisen wenn man in Larnaka umstieg, ein Zwischenstopp, der keineswegs unangenehm und allemal praktischer war als alles andere für jemanden wie mich, der sensibles Material transportiert, zumal der Beiruter Flughafen von Syrern wimmelt, Marianne war natürlich schon lange nicht mehr dort, wenn die Landzunge von Ras et-Tin aus dem Morgendunst hervortrat, glaubte man die Stadt von hinten zu sehen, im Verborgenen, ungeschminkt, wie man im Morgengrauen eine nackte Frau im Badezimmer überrascht, und das Meer war so klar, dass man von der Reling aus die Quallen in der warmen See zählen konnte: bei jeder Fahrt dachte ich an Marianne, an das Aufblitzen ihrer Unterwäsche in dem eisigen Zimmer, die zwei Sekunden Stille beim Anblick ihrer nackten Beine am Bettrand, die sie allzu schnell unter der Bettdecke versteckt hatte, draußen tobte der Sturm, der Wind blies gegen die große ungeschützte Fensterfront, was hatten wir im selben Bett zu schaffen, als Spielball meiner Lust erblickte ich darin nur eine herausragende Gelegenheit, während sie, die zweifellos der Modernität huldigte, im Teilen des ärmlichen Lagers einen Akt der Unschuld sah gepaart mit Gefahr, der Wein, mit dem ich sie abgefüllt hatte, ein Rosé namens »Rubis d’Egypte«, blieb zusammen mit dem Ricardo meine alexandrinische Madeleine: zu Tisch mit Militärangehörigen oder hohen Polizeibeamten, die zum Frühstück Johnny Walker schlürften ohne ihre Sonnenbrillen abzunehmen, pichelte ich vor ihren entsetzten Augen, als hätte der Prophet nur britischen Whisky erlaubt, fröhlich mit kräftigen Schlucken den ägyptischen Rubin und »Omar Khayyam« zur Erinnerung an Marianne und ich kannte sogar einen Vertrauten des Präsidenten der Republik, der frittierte Barben spachtelte und einen single malt dazu trank, ein Symbol von Klasse und Macht, während er mir nebenbei in allen Einzelheiten vom Schicksal des einen oder anderen unter der Folter oder sonstigen Qualen Verstorbenen erzählte – ich habe keine Ahnung mehr, warum ich so selten nach Kairo kam, wir trafen uns immer in Alexandria oder am Rand der libyschen Wüste in Agami, vielleicht weil es Sommer war, im Winter war alles anders, im Winter 1998 wurde in der Hauptstadt, nahe dem Nil am Ufer von Garden City etwas Wichtiges ausgehandelt mit Geschäftsleuten, die den militanten griechischen Kommunisten aus den Romanen von Stratis Tsirkas ähnelten, großmäulige Redner von der Sorte die einen ebenso sicher einschläfern wie diese abendliche Zugfahrt, die vorsichtig und dennoch zuvorkommend sind, Salome beim Schlangentanz, weit entfernt von der üblichen Einäugigkeit bei Offizieren und Polizisten, Leute, die ihre verdunkelten Augengläser anhoben, um einen besser fixieren, einschätzen, ausloten zu können, während mich der Zug wiegt, mich einschläfert wie in Alexandria als ich beim Zählen der Atemzüge der unerreichbaren Marianne zitternd einschlief, jetzt zähle ich unwillkürlich, eine nach der anderen, die Erschütterungen des Zuges über den Schwellen, ich spüre meinen Körper auf dem Sitz, ägyptische, libanesische und saudische Geschäftsleute, alle an den besten britischen und amerikanischen Universitäten ausgebildet, unaufdringlich elegant, fern aller Klischees von den auffällig und schrill gekleideten Levantinern, weder dick noch als Beduinen verkleidet, sie sprachen bedächtig über die Sicherheit ihrer künftigen Investitionen, wie sie es nannten, von unseren illegalen Geschäften, von der Region, die sie the area nannten, »die Zone«, und von ihrer Sicherheit, ohne je das Wort »Waffe« oder das Wort »Öl« auszusprechen oder irgendein anderes Wort außer investment und safety zu benutzen, wie jetzt, da mich, zwischen Hund und Wolf sozusagen, die ermattete Landschaft hypnotisiert, fragte ich mich damals, wer von diesen korrekten Herren zu den Hunden und wer zu den Wölfen gehörte, ich sah, ich hörte meinen Chef, wie ich ihn nannte, ich hörte zu, wie mein Chef diese einnehmenden Räuber überzeugte, manche hatten Waffen an die bosnischen Kroaten verkauft, manche an die Muslime, andere nach Afrika, bevor sie zum Waffenschmuggel mit dem Irak übergingen – in jenem prunkvollen Hotel in Kairo nahmen die Herren der Zone an einer informellen Zusammenkunft teil, bei der wir sie davon überzeugen wollten mit uns ins Geschäft zu kommen, sie wurden über die Lage informiert, über die Unterstützung, die man ihnen bieten konnte, damit sie das irakische Öl, von dem sie ganze Tanker besaßen, zum Bestpreis auf den Markt bringen konnten, das schwarze Gold ist voluminös und schwimmt, die Syrer nahmen ihnen Unsummen ab für die Weiterleitung, als käme es direkt aus ihren versiegten Quellen am Euphrat, obwohl man es soeben erst in Latakia verschifft hatte, merkwürdiger Weg, die halbe Welt wollte Abertausende Tonnen von Rohöl absetzen, so viel, dass noch Jahre später französische Diplomaten aus Bagdad am helllichten Tag mit vielen Tausend Barrels Öl im Angebot in Paris herumspazierten, als handelte es sich um Marmeladengläser, das erinnerte mich an die Geschäfte der Blauhelme in Bosnien, die ihre Verpflegung, ihr Benzin verkauften und ihre gepanzerten Fahrzeuge als Taxis nach Split oder Zagreb vermieteten, als wäre es das Natürlichste der Welt, zufrieden ob des guten Gewissens und des Taschengelds, die diese Dienste ihnen einbrachten, und die sich gleichwohl über die Gefahr beklagten, während sie ganz wie unsere Businessmen aus der Zone nicht die Bedrohung hinter der ausgestreckten Hand erkannten, das tödliche Spiel, das sich in den Jahren danach vielfach abspielen würde, und natürlich ahnte ich nicht, dass mich das alles letztlich wie eine Kugel aus einem von den Bäumen der Lombardei schraffierten Lauf mit einhundertfünfzig Sachen durch die eisige Ebene nach Rom katapultieren würde, durch diese Ebene, die angefressen war vom lombardischen Sonnenuntergang, plötzlich erhellt durch den Bahnhof von Lodi: die Brücke von Lodi über die Adda kann nicht weit entfernt sein, auch er, Bonaparte, kämpfte hier auf seinem ersten Italienfeldzug, kurz bevor er nach Ägypten ging – Bonaparte mit Hannibal und Cäsar vielleicht der größte Soldat, den das Mittelmeer hervorgebracht hat, hier stellte der finstere, von Zeus geliebte Korse meine kroatischen Vorfahren, die am anderen Ufer der Adda unter den vor der Brücke gut postierten Österreichern dienten, zwölftausend Soldaten, viertausend Reiter mit ihren Kanonen, den schweren Gewehren mit endlos langen Bajonetten und der Marschmusik, Napoleon wirft sich selbst ins Getümmel, als ehemaliger Artillerist hilft er die Geschütze auszurichten, er ist bei seinen Männern, haucht ihnen Mut und Entschlossenheit ein wie Pallas Athene den Griechen, gegen alle Erwartung gelangen sie auf die andere Seite, sie nehmen im Sturmangriff eine Holzbrücke, auf der es Kugeln und Geschosse hagelt, auf dem Teppich der Gefährten, die im Takt der österreichischen Salven gefallen sind, feuert eine Kolonne von sechstausend Grenadieren, mitten auf der Brücke zögern sie und Lannes, der kleine Färber aus dem Gers, stürmt mit gezücktem Säbel voran brüllt an der Spitze seiner Männer landet am anderen Ufer vor den österreichischen Truppen, die von Panik erfasst werden, mit der Klinge bahnen sich die Franzosen eine Schneise durch die feindlichen Reihen, während die Kavallerie nach Überquerung einer Furt flussaufwärts die in völliger Auflösung begriffenen Kroaten niedermetzelt, zweitausend Tote und Verwundete, zweitausend innerhalb weniger Stunden gefallene Habsburger die am Flussufer liegen, zweitausend Leichen, die lombardische Bauern in jener Nacht vom 21. Floreal 1796, dem Jahr IV nach der Revolution, unter dem Stöhnen der Sterbenden und Verwundeten ausplündern und ihrer Wertgegenstände, Taufanhänger, silbernen oder emaillierten Tabakdosen berauben zweitausend Gespenster zweitausend Schatten wie die vielen Formen vor meinem Fenster, die Pappeln, die Fabrikschlote, wir fahren Richtung Po, die Landschaft verdüstert sich, am Tag nach der Schlacht an der Brücke von Lodi marschiert die Große Armee, die noch nicht so heißt, in Mailand ein, der »kleine Korporal« ist geboren, der Mythos auf den Weg gebracht, Bonaparte sollte sein Abenteuer bis nach Russland fortführen über die Zwischenstation Ägypten – zwei Jahre nach Lodi ging er in Alexandria an Land mit der Vision für Frankreich ein Reich wie das britische Indien zurechtzuzimmern, und die Toten lagen nicht mehr an der Böschung der Adda, sondern an den Wegen zu den Pyramiden: fünfzehntausend menschliche Kadaver und einige tausend Mamelucken-Rösser, die am Rand der Wüste verfaulten, dort wo heute Touristen dem Ansturm der Postkarten- und Andenkenhändler erliegen, machte das Gewimmel der Würmer auf den im Sand versickernden Blutlachen dem Wogen schwarzer Fliegenpfützen Platz, in Ägypten, wenige Kabellängen entfernt vom Fruchtbaren Tal, sind die Fliegen Legion auf den geschlachteten Kühen, die an Haken hingen in Markthallen, durch die sich ekelerregende Abflussrinnen zogen, in denen das Blut der geopferten Tiere geruhsam abfloss, es muss nach verwesendem Fleisch gerochen haben wie nach der Schlacht, die Fliegen gewinnen immer, sanft lehne ich meinen Kopf gegen das Fenster, ins Halbdunkel gekrümmt von der Geschwindigkeit, schläfrig gemacht von der Erinnerung an die glühende Hitze in Kairo, von den staubigen Mangobäumen, den formlos wuchernden Banyanbäumen, den baufälligen Gebäuden, den hellen Turbanen der Türsteher und den gekochten Saubohnen die den frühen Morgen genauso verpesteten wie die in der Sonne aufgehängten Tiere, zwei Schritte entfernt von der britischen Botschaft in der es in den 1940er Jahren von Spionen wimmelte wie heute von Kakerlaken hatte ich in einer namenlosen Pension im obersten Stockwerk eines Gebäudes, dessen Aufzugsschacht als Müllschlucker diente in dem sich bis zum Treppenabsatz des zweiten Stockwerks aufgerissene Matratzen und verrostete Fahrräder stapelten, ein Zimmer das durch ein Wunder einen kleinen Balkon besaß, und nachts, in der relativen Ruhe einer Stadt die niemals schläft, beobachtete ich das schwarze Band des nach Katzenwels riechenden Nils, das durchzogen wurde von den Lichterstreifen der neuen Oper auf der Insel Gezira, ein herrlicher Wels mit langen, leuchtenden Barteln, ich las Unregierbare Städte von Stratis Tsirkas ohne es richtig zu verstehen, ohne zwischen den Zeilen zu lesen und in den Schlichen der Schattengestalten meine eigene Vorgehensweise als internationaler Spitzel zu erkennen, so wie ich mich heute hier mit dem Aktenkoffer über mir bei über hundert Stundenkilometern reglos durch die Abenddämmerung fahren lasse vielleicht ohne das Spiel, in das ich verwickelt bin, wirklich zu durchschauen, ohne die Strippen zu kennen, an denen ich so gewiss hänge, wie dieser Zug mich nach Rom bringt, und in diesem behaglichen Fatalismus, in den Mattigkeit und Schlaflosigkeit einen treiben, verliert sich mein Blick zwischen der Dezembernacht und den Leuchtkäfern aus Reif, die der Zug manchmal an den kahlen Bäumen aufleuchten lässt, das Leben kann einem schlechten Reiseprospekt gleichen, Paris Zagreb Venedig Alexandria Triest Kairo Beirut Barcelona Algier Rom, oder einem Lehrbuch für Militärgeschichte mit Konflikten, Kriegen, meinem Krieg, dem des Duce, dem des einäugigen Fremdenlegionärs Millán Astray, oder lange zuvor dem Ersten Weltkrieg und weiter zurück bis zum Kampf ums Feuer, als guter Soldat traf ich heute Morgen in Paris pünktlich an der Gare de Lyon ein, was für ein merkwürdiger Einfall, musste ich mir am Telefon sagen lassen, was für ein merkwürdiger Einfall mit dem Zug zu kommen, ich nehme an, Sie haben Ihre Gründe, ich glaube, ich habe keine, ich habe nur das Flugzeug verpasst und im Zug nach Mailand – wie lange ist es her, dass ich Zug gefahren bin – habe ich einfach gedöst und vom Spanischen Bürgerkrieg und polnischen Ghettos geträumt, bestimmt hatte es etwas mit den Dokumenten in meinem Aktenkoffer zu tun, deren Druckertinte auf meinen Sitz geflossen und in meinen Schlaf eingedrungen sein muss, wenn es nicht gar Mariannes durchscheinende Finger mit den blauen Äderchen gewesen sind, an diesem Wendepunkt meines Lebens sitze ich, heute am 8. Dezember, zwischen zwei untergegangenen Städten und lasse meine Gedanken schweifen wie ein Tourist der auf Kreuzfahrt ist und, je nach Kurs des Schiffs, das endlose Mittelmeer an sich vorüberziehen lässt, gesäumt von Felsen und Bergen jenen Steinhaufen die auf ebenso viele Gräber Leichengruben Massengräber hinweisen auf eine neue Karte ein anderes Netz von Spuren Straßen Schienen Flüssen die nach wie vor vergessene verehrte anonyme oder in der großen Geschichtsrolle verzeichnete Leichen Überreste Bruchstücke Schreie Gebeine mit sich führen, ein ruchloses Pergament, das vergeblich den Marmor nachäfft und dem Revolverblatt ähnelt, das mein Gegenüber säuberlich gefaltet hat damit er es bequem lesen kann, die Überdosis Rauschgift des italienischen Geschäftsmannes, die nicht sehr skandalträchtigen Skandale von Schauspielerinnen und Schickeria, das Tun und Lassen Unbekannter, das sich in Wirklichkeit gar nicht so sehr vom Inhalt meines Koffers unterscheidet, von den Geheimnissen, die ich an ihre rechtmäßigen Eigentümer zurückverkaufen möchte, Früchte einer langen Untersuchung auf dem Umweg über meine Tätigkeit als internationaler Spitzel: im Winter 1998 eilte ich zwischen zwei Sitzungen bei klarer Luft durch die Innenstadt von Kairo, die im Winter vielleicht weniger staubig ist als im Sommer, vor allem aber ist die Hitze erträglich, die Ägypter sagen sogar, es sei kalt, ein seltsamer Gedanke in einer Stadt, in der die Temperatur nie unter zwanzig Grad sinkt, am Rand des dekadenten, ausgesprochen britischen und heruntergekommenen Stadtviertels Garden City, in dem mein Hotel lag, gab es auf der Qasr-el-Ayni-Avenue ein von Griechen geführtes Spirituosengeschäft, in das ich von Zeit zu Zeit ging um meinen Vorrat an Ricardo dem echten Pastis aus Alexandria aufzufüllen, da sie die Muslime nicht vor den Kopf stoßen wollten, sah man in ihrem Schaufenster nur Berge von blauen, rosaroten oder grünen Packungen Papiertaschentücher, während sich drinnen die alten Holzregale durchbogen unter den vielen Metaxas, Bordon’s Gins und J&C Whiskys »made in Arab Republic of Egypt«, aber zweifellos alle auf Basis desselben Alkohols hergestellt, von dem der überwiegende Teil anschließend zur Herstellung von Pflegeprodukten, zur Säuberung von Metallen oder zum Fensterputzen diente, Ägypter wagten sich hier nicht hinein, meine Offiziere tranken nur importierte, im duty-free erworbene Getränke, die griechischen Giftmischer dürften kaum zu Reichtum gekommen sein, tatsächlich verkauften sie vor allen Dingen Bier an Leute aus dem Viertel und ein wenig Anisschnaps an einfältige oder von den Etiketten belustigte Abenteurer, die Flaschen schlugen sie in die Seiten einer alte Ausgabe der Athener Ta Nea ein, stellten sie dann in eine rosafarbene Plastiktüte und verwendeten viel Sorgfalt darauf in blumigem Französisch zu erklären, dass man die Griffe besser nicht benutzte, immer ohne jedes Lächeln, was mich sofort an den Balkan und den alten Witz erinnerte, dem zufolge man ein Messer braucht, um einen Serben zum Lachen zu bringen, die Hellenen sind ohne jeden Zweifel vom Balkan, und sei es auch nur wegen ihres sparsamen Lächelns – bei den Griechen von der Qasr-el-Ayni-Avenue saß immer ein ziemlich alter Mann in der Ecke des Ladens auf einem Holzstuhl mit dem Bildnis von Kleopatra und unterhielt sich mit den Besitzern auf Französisch mit einem seltsamen Akzent, in der Hand hielt er ein mit Zeitungspapier umwickeltes Fläschchen Metaxa oder Cognac »Ami Martin« um sich auf diese Weise unauffällig und mit Methode zu betrinken während er mit ihnen plauderte, als ich ihn zum ersten Mal hörte schimpfte er ausgiebig, mit fünfundzwanzig Jahren Verspätung, auf Nasser und die Arabisten, wie er sich ausdrückte, Nasser war schon ziemlich lange tot und mit ihm der Panarabismus, zumindest fehlte nicht viel, es war sehr verwunderlich zu hören, wie dieser magere alte Trunkenbold mit dem mageren, von der Sonne Kairos gezeichneten Gesicht und in dem dunkelgrauen, für ihn viel zu großen Anzug, wie ein alles in allem Einheimischer den Vater der Nation an den Pranger stellte, er erinnerte mich an den Großvater meines Kriegsgefährten Vlaho, ein alter dalmatinischer Weinbauer, der fortwährend Tudjman verfluchte und ihn als einen bigotten Faschisten beschimpfte, weil er mal Partisan gewesen war und sich in der Schlacht an der Neretva mit Tito herumärgern musste, er beschimpfte uns ausgiebig als kleine Nazis und mit anderen Nettigkeiten, er musste zu jenen sieben oder neun Prozent der Bevölkerung gehört haben, die sich »Jugoslawen« nannten, und bestimmt war er der einzige Bauer, der zu dieser Fraktion gehörte, der einzige Bauer und der einzige Dalmater, und so fiel mir in dem griechischen Spirituosengeschäft in Kairo der alte Mann wieder ein, als ich diesen seltsamen Kerl sah, der Nasser ohne Umschweife als Dieb und Zuhälter bezeichnete, während er seinen Schnaps schlürfte, der ihn offensichtlich nicht blind, vielleicht aber verrückt gemacht hatte, er war Holländer, hieß Harmen Gerbens, war siebenundsiebzig Jahre alt und lebte seit 1947 in Ägypten, eine Bärennatur, unverwüstlich, sonst hätte er den Fusel nicht so lange überstanden, geboren 1921 in Groningen – vielleicht ist er jetzt, da ein paar Tropfen geschmolzenen Schnees Striche durch die Landschaft um Mailand hinter der Scheibe ziehen, schon tot, ob er wohl in seinem Bett krepiert ist, vom Tod überrascht, oder nach einem langen Todeskampf, einer Leberzirrhose oder einem Herzstillstand, könnte auch sein, dass ihn ein Taxi überfahren hat, als er die Qasr-el-Ayni-Avenue überquerte um zu seinen griechischen Freunden zu gelangen, wer weiß, vielleicht lebt er noch irgendwo in einem Altenheim oder noch immer in seiner riesigen, düsteren Wohnung in Garden City, wovon mochte er eigentlich gelebt haben, vom ägyptischen Staat bekam er eine kleine Rente als »Mechanik-Ingenieur«, eine anspruchsvolle Bezeichnung für jemanden, der 1943 als Mechaniker in die 4. SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Brigade »Nederland« eingetreten war, deren letzte Truppenteile sich im Mai 1945 westlich von Berlin den Amerikanern ergaben, nachdem sie zwei Jahre an verschiedenen Fronten gekämpft hatten und dem Kessel von Halbe entkommen waren, Gerbens ist redselig, in seiner leeren und düsteren Höhle im ersten Stockwerk eines baufälligen Hauses erzählt er mir an einem Nachmittag sein Leben, hauptsächlich versucht er mir zu erklären, warum Nasser ein Dreckskerl war – doch was erinnert mich in der Gegend von Lodi an den alten griesgrämigen Bataver, damals wusste ich noch nicht, dass die Brigade »Nederland« einige Monate in Kroatien eingesetzt worden war um nach dem Abfall Italiens im Herbst 1943 die Partisanen zu bekämpfen, vielleicht hatte er gegen Vlahos Großvater gekämpft, vielleicht, vielleicht denke ich im Moment der Entscheidung an Harmen, jetzt da ich selbst mich zu einem neuen Leben aufmache, wie er damals nach einem Jahr der Entbehrungen und der Schikanen in einem zerstörten, vom Krieg verheerten Land sein Glück woanders suchte und nach Ägypten kam über einen Cousin, der schon seit der Vorkriegszeit im Hafen von Alexandria arbeitete, heute, da Ägypten ein Bild der Armut abgibt, scheint der Gedanke seltsam, man könne als Vorarbeiter dorthin emigrieren und dadurch seine Lage verbessern, ich frage Harmen ob seine Vergangenheit bei der Waffen-SS etwas mit seinem Entschluss zu tun habe, er antwortet nein, oder doch, vielleicht, nach der Niederlage habe er einige Monate in einem Militärgefängnis verbracht, eigentlich war ich nur Mechaniker, sagte er, und kein Nazi, ich reparierte Raupenfahrzeuge und Lastwagen, dafür kriegt man nicht gerade das Ritterkreuz, oder?, ich erinnere mich nicht mehr, man ließ uns ziemlich schnell wieder laufen, es war das erste Mal, dass ich ins Gefängnis wanderte – drei Jahre schuftete er im Hafen von Alexandria, reparierte Kräne, hielt Gabelstapler und die ganze Maschinerie der Hafenanlagen instand, er hatte zwei Kinder, zwei Mädchen, mit einer Frau aus Groningen, anfangs gefiel es ihr gut in Ägypten, sagte er, anfangs, und ich denke an meine Mutter, auch sie war als Vertriebene fern ihrer Heimat aufgewachsen, die sie kaum kannte, mein Gegenüber mit der Pronto hat die Zeitschrift wieder zusammengefaltet, er steht auf und geht zur Bar oder zur Toilette, wer weiß, wo seine Eltern geboren sind, vielleicht waren sie in ihrer Jugend aus Neapel oder Lecce zugewandert um ihr Glück im reichen Norden zu versuchen, Harmen Gerbens dagegen wanderte in den reichen Süden aus – er kehrte Alexandria den Rücken für eine bessere Stelle in Helwan bei Kairo in einer nagelneuen Waffenfabrik, die Hakim-Gewehre produzierte, schwere 8-mm-Waffen, Nachbauten eines schwedischen Modells, Anlagen und Maschinen kamen direkt aus Malmö einschließlich der Ingenieure: ich verstand mich gut mit ihnen, erzählt Harmen, ich war für die Instandhaltung zuständig, das Hakim war ein wunderbares Gewehr, besser als das Original, fast ohne Rückstoß trotz der verheerenden Kraft der Mauser-Patronen, es überstand sogar Sand in der Mechanik des Hülsenauswurfs, ich war sehr stolz darauf es zu bauen – nach Nassers Revolution ging alles schief, meint Harmen, ich war der einzige Ausländer, der in der Fabrik blieb, alle gingen weg, Griechen, Italiener, Briten, und eines Tages brach der Krieg aus: Engländer, Franzosen und Israelis marschierten in Suez ein – am 31. Oktober 1956, einen Tag nach der Bombardierung des Flughafens, wurde ich wegen Spionage festgenommen und im »Ausländertrakt« des el-Qanater-Gefängnisses inhaftiert, Harmen bekam nie heraus, warum und wie oder für wen er angeblich Verrat begangen haben soll, Harmen Gerbens war bereits schwer betrunken, als er mir diese Geschichte erzählte, er sabberte ein wenig, der Tee blieb an seinem herabhängenden Schnurrbart hängen und tropfte von dort in die Mundwinkel, sein Akzent wurde immer kräftiger und sein Kinn zitterte ebenso sehr wie seine Hände während die untergehende Sonne die leere Wohnung in Dunkelheit tauchte, leer weil seine Frau und die beiden Töchter kurz nach seiner Verhaftung nach Holland »ausgewiesen« worden waren, nur der batavische Trinker Harmen Gerbens blieb acht Jahre im el-Qanater-Gefängnis, verlassen von Gott und seinem Konsulat, später erfuhr ich warum, acht Jahre im Ausländertrakt neben dem Kerker, in dem vierzig Jahre später meine Islamisten verfaulten, er war der ständige Mechaniker des Gefängnisdirektors, bei der bloßen Erwähnung seines Namens spuckt Gerbens aus, er kippt einen kräftigen Schluck in sein Teeglas stößt schreckliche niederländische Verwünschungen aus und ich frage mich ob sein Bericht der Wahrheit entspricht, ob es wohl möglich ist, dass dieser Mann aus unerfindlichen Gründen acht Jahre im Gefängnis saß, war er nicht einfach nur ein armer Kerl, ein alter Narr, dem die Einsamkeit und der Schnaps zusetzten – warum kehren Sie nicht nach Holland zurück, ich kann nicht, antwortet er, aber das geht Sie nichts an, ich widerspreche nicht, ich verabschiede mich von dem alten Säufer und als er mich zur Tür begleitet, hat er Tränen in den Augen – der Treppenschacht ist mit Abfall übersät, ich steige wieder hinunter in die rote Agonie der Kairoer Abende mit ihrem Mumienduft