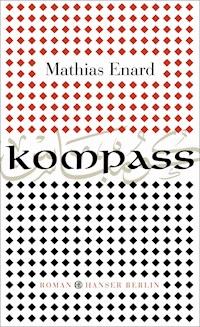Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
In seinem neuen Roman über unsterbliche Liebe, menschlichen Verrat und den Trost der Mathematik, verknüpft Goncourt-Preisträger Mathias Enard elegant Gegenwart und Geschichte.
September 2001, ein Kongress auf der Havel. Gewürdigt wird Paul Heudeber, Mathematiker, Kommunist und KZ-Überlebender, der spätestens seit seinem ungeklärten Tod Heiligenstatus genießt. Alle Blicke der Anwesenden wandern verstohlen zu Maja Scharnhorst, Pauls große Liebe, mit 83 faszinierend wie eh und je, auch sie eine Legende, die sich irgendwann für eine Karriere im Westen entschieden hat – ohne Paul. Als die Bilder der zerstörten Twin Towers die Festgesellschaft erreichen, nimmt die Veranstaltung eine ganz andere Wendung. Und es ist an Irina, der Tochter dieser überlebensgroßen Liebenden, die losen Fäden ihrer Geschichte zu entwirren und neu zu verflechten. Ein großer Roman über Widerstand, Liebe, Verrat und den Trost mathematischer Schönheit in einer von Gewalt erschütterten Welt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 285
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
In seinem neuen Roman über unsterbliche Liebe, menschlichen Verrat und den Trost der Mathematik, verknüpft Goncourt-Preisträger Mathias Enard elegant Gegenwart und Geschichte.September 2001, ein Kongress auf der Havel. Gewürdigt wird Paul Heudeber, Mathematiker, Kommunist und KZ-Überlebender, der spätestens seit seinem ungeklärten Tod Heiligenstatus genießt. Alle Blicke der Anwesenden wandern verstohlen zu Maja Scharnhorst, Pauls große Liebe, mit 83 faszinierend wie eh und je, auch sie eine Legende, die sich irgendwann für eine Karriere im Westen entschieden hat — ohne Paul. Als die Bilder der zerstörten Twin Towers die Festgesellschaft erreichen, nimmt die Veranstaltung eine ganz andere Wendung. Und es ist an Irina, der Tochter dieser überlebensgroßen Liebenden, die losen Fäden ihrer Geschichte zu entwirren und neu zu verflechten. Ein großer Roman über Widerstand, Liebe, Verrat und den Trost mathematischer Schönheit in einer von Gewalt erschütterten Welt.
Mathias Enard
Tanz des Verrats
Roman
Aus dem Französischen von Holger Fock und Sabine Müller
Hanser Berlin
Und ich drückte meine Wange, die nichts mehr kannte außer den Kuss des Gewehrkolbens, an ihre blühenden Wangen
Francis Jammes, Fünf Gebete für Kriegszeiten
I
Er hat seine Waffe weggelegt und sich mühsam von seinen Stiefeln befreit, zur Erschöpfung kommt jetzt auch noch ihr Geruch (Exkremente, ranziger Schweiß). Die Finger auf den zerfaserten Schnürsenkeln sind dürre Griffel, an manchen Stellen sind sie leicht versengt; die Fingernägel haben die Farbe der Treter, er wird den Dreck, Schlamm, getrocknetes Blut, mit der Messerspitze wegkratzen müssen, aber erst später, jetzt hat er nicht die Kraft dazu; zwei Zehen, Fleisch und Erde schauen aus der Socke hervor, dicke, fleckige Würmer, die aus einem dunklen, am Knöchel knotigen Stamm kriechen.
Plötzlich fragt er sich, wie jeden Morgen, wie jeden Abend, warum diese Galoschen nach Scheiße stinken, es ist unerklärlich,
du kannst sie noch so oft in den Pfützen ausspülen, die du unterwegs entdeckst, sie mit raschelnden Krautbüscheln abreiben, nichts hilft,
dabei gibt es hier nicht so viele Hunde oder wilde Tiere, nicht so viele in diesen Höhen, die von Steinen, Steineichen, Kiefern und Dornengestrüpp überzogen sind, auf denen der Regen einen dünnen, hellen Schlamm und den Geruch von Feuerstein zurücklässt, nicht den von Scheiße, und es fiele ihm leicht zu glauben, das ganze Land stinke vom Meer über die Hügel mit den Orangenplantagen und Olivenhainen bis hinauf in die entlegensten Winkel der Berge, dieser Berge, wäre es nicht er selbst, sein eigener Geruch, nicht der seiner Schuhe, aber das will er noch nicht einsehen, und so schleudert er die Latschen an den Rand des Steilhangs, der ihn davor bewahrt, von dem etwas höher entlang der Schlucht verlaufenden Pfad aus gesehen zu werden.
Er legt sich mit dem Rücken auf das blanke Geröll, seufzt, der Himmel spielt ins Blauviolette, das abendliche Licht erhellt von unten die schnellen Wolken darüber, ein Malgrund, eine Leinwand für ein Feuerwerk. Der Frühling steht bevor, und mit ihm kommt der Regen, oft gießt es in Sturzbächen und die Berge verwandeln sich in von Kugeln durchsiebte Kanister, noch aus der kleinsten Vertiefung sprudelt eine mächtige Quelle, während die Luft nach Thymian und Obstblüten riecht, weiße Flocken, die der Sturm mit dem Regen zwischen die Mäuerchen geweht hat. Es ginge mit dem Teufel zu, würde es jetzt zu regnen beginnen. Seine Stiefel würden allerdings sauber werden. Die Galoschen, der Drillich, die Socken, von denen er zwei Paar besitzt, die gleichermaßen steif, spröde, abgetragen sind. Mit dem Körper beginnt der Verrat,
seit wann hast du dich nicht mehr gewaschen?
vier Tage marschierst du schon die Grate entlang, um den Dörfern auszuweichen,
das letzte Wasser, mit dem du dich besprengt hast, roch nach Benzin und hinterließ einen Ölfilm auf der Haut,
von Reinheit bist du weit entfernt, bist ganz allein unter dem Himmel und schaust nach den Kometen.
Der Hunger zwingt ihn, aufzustehen und lustlos die letzten drei Hartkekse zu verschlingen, trockene braune Klumpen, wahrscheinlich eine Mischung aus Sägemehl und Knochenleim; einen Moment lang verflucht er den Krieg und die Soldaten,
du bist noch einer von ihnen, du trägst noch immer Waffen, Munition und Erinnerungsstücke aus dem Krieg,
du könntest das Gewehr und die Patronen irgendwo verstecken und Bettler werden, auch das Messer müsstest du liegenlassen, Bettler haben keine Dolche,
auch die Marschstiefel, die nach Scheiße riechen, und barfuß gehen,
auch die elende Joppe, und mit nacktem Oberkörper gehen,
nach dem Mahl leert er seine Feldflasche und pisst zum Spaß so weit wie möglich in Richtung Tal.
Er legt sich wieder hin, lehnt sich dieses Mal an die Felswand, den bauchigen Teil des Rucksacks unter seinem Kopf; im Schatten ist er nicht zu sehen, überlässt sich dem Ungeziefer (rote Spinnen, winzige Skorpione, Hundert- und Tausendfüßler mit Zähnen scharf wie Gewissensbisse), das auf seinem Oberkörper herumhüpfen, sich auf seinen fast kahlgeschorenen Schädel niederlassen, auf seinem Bart herumspazieren wird, der so stachelig ist wie ein Brombeerstrauch. Das Gewehr lehnt an ihm, Kolben unter der Achsel, Lauf zwischen den Füßen. Eingewickelt in ein Stück mit Teer imprägnierte Zeltbahn, die ihm als Decke und Dach dient.
Das Gebirge rauscht; über die Gipfel strömt ein wenig Wind, fällt ins Tal hinunter und vibriert zwischen den Sträuchern; die Schreie der Sterne sind eisig. Der Himmel ist jetzt wolkenlos, diese Nacht wird es nicht regnen.
Heiliger Schutzengel, behüte meine Seele und meinen Leib, vergib mir die Sünden, die ich heute begangen habe, und erlöse mich von den Taten meiner Feinde, trotz der Inbrunst des Gebets bleibt die Nacht ein gehetztes Raubtier voller Angst, ein Raubtier mit blutigem Atem, Mütter rennen durch Städte in Trümmern und schwenken die verstümmelten Leichen ihrer Kinder vor den räudigen Hyänen, die sie erst foltern, dann nackt und besudelt zurücklassen werden, nachdem sie ihnen die Brustwarzen vor den Augen ihrer zuvor mit dem Schlagstock vergewaltigten Brüder herausgebissen haben, Entsetzen liegt über dem Land, die Pest, der Hass und die Nacht, diese Nacht, die einen immer umgibt, bis man irgendwann zum Feigling, zum Verräter wird. Bis man flieht und desertiert. Wie lange wird er noch marschieren müssen? Die Grenze liegt einige Tagesmärsche entfernt von hier, hinter den Bergen, die bald zu Hügeln aus roter Erde werden, auf denen Olivenbäume stehen. Es wird schwierig werden, sich zu verstecken. Viele Dörfer, Städte, Bauern, Soldaten,
du kennst die Gegend
du bist hier zu Hause,
niemand wird einem Deserteur helfen,
morgen wirst du das Haus in den Bergen erreichen,
dort, in der Schutzhütte, wirst du einige Zeit Zuflucht finden,
deine Kindheit in der Hütte wird dich schützen,
die Erinnerungen daran werden dich wärmen,
manchmal überkommt dich der Schlaf so plötzlich wie die Kugel eines Heckenschützen.
II
Vor mehr als 20 Jahren, am 11. September 2001, auf der Havel bei Potsdam, an Bord eines Ausflugsdampfers, jenes kleinen Flussschiffes, das den schönen pompösen Namen Beethoven trug, schien der Sommer zu wanken.
Die Weiden waren noch immer grün, die Tage noch heiß, doch bevor die Sonne aufging, stieg ein eisiger Nebel vom Fluss auf, und von fern her, von der Ostsee kommend, zogen riesige Wolken über uns hinweg.
Am Montag hatte unser schwimmendes Hotel in aller Frühe Köpenick im Osten Berlins verlassen. Maja war noch immer rüstig, lebhaft. Um Bewegung zu haben, ging sie zwischen zwei Regengüssen aufs Oberdeck, unternahm einen Spaziergang zwischen Liegestühlen und Deckspielen. Bei unserer Ankunft war sie fasziniert von den grünen Kuppeln und der goldenen Spitze des Berliner Doms in der Ferne. Sie stelle sich vor, meinte sie, wie all die goldenen kleinen Engel aus ihrem steinernen Gefängnis kommen würden, um in einer Wolke von Akanthusblättern davonzufliegen, die die Sonne hochgeweht hat.
Das Spreewasser war mal dunkel- und mattblau, mal von rötlich schimmerndem Grün. In den Wochen zuvor war ganz Deutschland von Stürmen geschüttelt worden, deren Nachwehen bis hin zur Havel und zur Spree reichten, die im Spätsommer normalerweise eher niedrige Pegelstände hatten.
Wir glitten mit dem Schiff durch die Wirbel.
Ich erinnere mich an den Zufluss der Spree, die bewaldeten Inseln, das Salzlampenlicht, das die Wipfel der Schwarzpappeln sprenkelte, und die schlammigen Fluten des Landwehrkanals, die sich im Kielwasser des Schiffs mit dem öligen Wasser des Flusses mischten.
Maja und ich saßen, jede von uns in einem segeltuchbespannten Liegestuhl, auf dem hinteren Teil des Sonnendecks, genau genommen dem Achterdeck, und sahen zu, wie alles entschwand: Die Landschaft weitete sich, als würde das Schiff mit seinem Bug den grünen Blättervorhang weit öffnen.
Mit einigen Monaten Verspätung feierten wir das Jubiläum der Neugründung des Instituts durch Paul nach der Wende an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und ehrten zugleich den Gründer selbst. Genau genommen feierten wir das zwanzigjährige Jubiläum des Zentralinstituts für Mathematik an der Ostberliner Akademie der Wissenschaften 1981 und zugleich das Jubiläum der »Neugründung«. Vor allem ging es um die Würdigung von Pauls Arbeiten. Niemand fehlte, glaube ich — aus dem Osten waren alle Historikergrößen da, die neuen Institutsmitglieder ebenfalls, die Kollegen aus Berlin und auch von auswärts hatten fast alle ihr Kommen bestätigt. Manche, darunter Linden Pawley, Robert Kant und einige französische Forscher, waren sogar aus dem Ausland angereist. Der schwimmende Kongress fand unter dem Titel Paul-Heudeber-Tage statt, täglich waren zwei Panels vorgesehen, Zahlentheorie, Algebraische Topologie und eine Sitzung zur Geschichte der Mathematik, an der ich teilnehmen musste.
Nur Paul selbst fehlte.
Maja hatte gerade ihren dreiundachtzigsten Geburtstag gefeiert.
Maja trank literweise Tee.
Maja war fröhlich und traurig und schweigsam und redselig.
Wir wussten alle, dass sie hier an Bord der Beethoven, auf dem Kolloquium der Mathematiker, nichts zu tun hatte; wir wussten alle, dass sie hier unverzichtbar war.
Prof. Dr. Paul Heudeber
Elsa-Brändström-Str. 32
1100 Berlin Pankow
DDR
Maja Scharnhorst
Heussallee 33
5300 Bonn 1
Sonntag, den 1. September 1968
Maja Maja Maja
Halten wir fest, was wir haben: die nackte Liebe.
Sie ist gewachsen in Abwesenheit und Dunkelheit: Du fehlst mir, und das ist eine Quelle. Ein Körper, ein Ring — alles trägt Deinen Stempel, und nur Deinen. Deine Ferne bringt die Unendlichkeit näher. Du allein ermöglichst mir, mich vor der Zeit, vor dem Bösen, vor der Flut der Melancholie zu verkriechen. Wenn ich ihre Rufe höre, frage ich mich, was aus meiner Jugend geworden ist.
Ich stopfe mir die Ohren mit klugen Berechnungen zu.
Ich stürze mich Areale hinab, die noch niemand betreten hat.
Ich erinnere mich an den September 1938. Das Feuer schwelte im Eisen, unser Feuer in den Ketten.
Wir hielten stand im Angesicht der künftigen Ruinen.
Wir haben standgehalten, zusammengeschmiedet durch die Kraft der Erinnerung.
Wie wir heute in Angst und Hoffnung unerschrocken standhalten angesichts der Welt vor uns.
Irina ist gerade siebzehn Jahre alt geworden, kaum ein Wimpernschlag für einen Stern.
Ich kann es nicht erwarten, bis Ihr wieder hierherkommt.
Ich werde Zugeständnisse machen, ich werde Euch im Westen besuchen.
Ich habe Deinen schönen Beitrag über die Vorgänge in Prag in dieser schrecklichen Zeitung gelesen.
Unsere Auseinandersetzungen fehlen mir.
Dienstag reise ich nach Moskau zu einem Kongress.
Ich frage mich, was man dort über diese gefährlichen Zeiten denkt.
Moskau, mächtige Türme und Genossen.
Schreib mir.
Zu sagen, ich küsse Dich, ist eine Untertreibung.
Paul
Die meisten Zugreisenden sitzen lieber in Fahrtrichtung.
Ein Historiker ist ein Reisender, der sich dafür entscheidet, nicht in Fahrtrichtung zu sitzen.
Der Wissenschaftshistoriker ist ein Historiker, der, entgegen der Fahrtrichtung sitzend, nach hinten blickt und, anders als die meisten Historiker, nicht aus dem Fenster sieht.
Die Mathematikhistorikerin ist eine Wissenschaftshistorikerin, die, mit geschlossenen Augen entgegen der Fahrtrichtung sitzend, zu beweisen versucht, dass die Züge von Arabern erfunden worden sind.
Niemand hat gelacht.
Man muss dazusagen, dass ich die einzige Historikerin bei diesem Kolloquium war. Alle anderen waren Mathematiker, Mathematikerinnen, Physiker, Physikerinnen oder, noch schlimmer, Logiker. Alle, Frauen wie Männer, saßen in Fahrtrichtung. Hielten nach Neuerungen, Erfindungen, Entdeckungen Ausschau. Ich war die Einzige, die sich nicht so sehr für die glorreichen Beweise und Erfindungen von morgen interessierte, sondern für die süßen Mäander der Vergangenheit. Mäander der Vergangenheit, die ihr Licht bis in die fernsten Winkel der Zukunft werfen, doch während ich dort auf der Tagung sprach, spürte ich, dass die anwesenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler meinen Ausführungen über Nasiruddin Tusi und die irrationalen Zahlen nur aus Rücksichtnahme und einem dem Anlass geschuldeten Respekt vor mir und meiner Mutter lauschten, die trotz ihres hohen Alters zwischen zwei Spaziergängen an Deck kein einziges Wort eines Vortrags verpasste.
Auf die Idee zu diesem schwimmenden Kolloquium war Maja gekommen; ich meine mich zu erinnern, dass der Generalsekretär Jürgen Thiele für den Abschluss der Tagung, die ursprünglich im Berliner Institut stattfinden sollte, »einen Nachmittagsausflug auf der Spree oder der Havel« vorgeschlagen hatte; Maja schmollte, die Spree oder die Havel, das sei ja bestenfalls Berlin, schlimmstenfalls Brandenburg, warum nicht auf der Donau, und Jürgen Thiele sah sie mit großen Augen an, die Donau sei aber sehr weit weg, und ich stelle mir vor, wie Maja zu lachen begann, einverstanden, dann eben auf der Havel, aber nur, wenn das gesamte Kolloquium auf einem Schiff stattfindet, und Jürgen Thiele war in großer Verlegenheit (wie er mir später erzählte), denn er wollte meiner Mutter für diese Tage der Würdigung keine Bitte abschlagen, seine Mittel waren jedoch begrenzt — die Geschichte mit dem schwimmenden Kolloquium erschien ihm weiterhin absurd, die Laune einer alten Dame.
Zu seiner Überraschung erhielt Thiele jedoch einige Wochen vor der Veröffentlichung des Aufrufs zur Teilnahme an den Heudeber-Tagen zwei Briefe mit gleicher Post: In einem bot die Mathematische Fakultät der Universität Potsdam an, die Paul-Heudeber-Tage gemeinsam mit dem Institut auszurichten, mit dem anderen gewährte die Georg-Cantor-Vereinigung für die Veranstaltung des Kolloquiums eine hohe Subvention (ohne dass Thiele darum gebeten hätte), die es ermöglichen würde, das Kolloquium auf dem Wasser abzuhalten (was er stillschweigend nach wie vor für abwegig hielt).
Einige Jahre zuvor hatte Pauls tragischer Tod in der Wissenschaftsgemeinde große Bestürzung ausgelöst; alle waren der Einladung bereitwillig gefolgt, und obwohl die meisten Organisatoren (allen voran Jürgen Thiele, dachte ich) nicht wussten, was hinter Majas Wunsch steckte, wollte niemand sie enttäuschen. Die beiden Briefe kamen wie bestellt, und Jürgen wurde den Verdacht nicht los, sicher zu Recht, dass Maja zur Feder oder zum Telefon gegriffen hatte: Wenngleich sie sich seit den Bundestagswahlen 1998 theoretisch aus der Politik zurückgezogen hatte, besaß sie noch immer so viel Einfluss, den Geburtshelfern des Projekts »wohlwollende Aufmerksamkeit« zukommen zu lassen. Das Geld der Georg-Cantor-Vereinigung war willkommen; als Mitveranstalter setzte sich Jürgen Thiele mit der Universität Potsdam in Verbindung, die ihr zehnjähriges Bestehen feierte und bei ihrer Gründung von Paul unterstützt worden war: Viele der Mathematik Lehrenden waren seine Schüler gewesen.
Die Paul-Heudeber-Tage sollten demnach an Bord eines Haveldampfers stattfinden, dessen Konferenzraum groß genug wäre, um fünfzig Kongressteilnehmer aufzunehmen; die nicht aus Berlin stammenden Teilnehmer würden größtenteils in einem Hotel gegenüber der Pfaueninsel untergebracht werden, dessen Name an eine mittelalterliche Herberge oder einen Berggasthof erinnerte, Zur Weißen Eule, ein Gasthaus, von dem Maja mir bescheinigte, es existiere mindestens seit dem 16. Jahrhundert (ich fragte mich, woher sie wohl diese Gewissheit bezog), dessen aktuelles Gebäude — dorische Säulen, die einen monumentalen Balkon stützten, grüne Fensterläden, eine Fassade, umrankt von Kletterrosen wie im Märchen, die ihr mit zahllosen, fast schwarzroten Blüten ihre Wucht nahmen — Anfang des ersten Drittels des 19. Jahrhunderts von Karl Schinkel neu erbaut worden war. Die Weiße Eule lag mitten im Wald am Ufer des riesigen Sees, durch den die Havel floss. Nur die Key Speaker und die übrigen VIPs des Kolloquiums waren auf der Beethoven einquartiert, denn es gab nur wenige Kabinen; dafür standen die »Tagesfahrten« allen offen: am Mittwoch, dem eigentlichen Tag der Ehrung, an dem es um Pauls Arbeit gehen sollte, Potsdam-Elbe, dann zum Abschluss der Festlichkeiten am Donnerstag eine Fahrt Pfaueninsel-Köpenick über Spandau. Nur einige hochrangige Gäste waren sonntags angereist, um am Montag bei der Fahrt des Schiffs von Köpenick zur Anlegestelle nach Wannsee dabei zu sein und einen zusätzlichen Kreuzfahrttag durch Berlin einzulegen.
Jürgen Thiele war voller Empathie, Unordnung und gutem Willen. Er war zwar noch Generalsekretär des Instituts, nahm sich dieser Aufgabe aber nur aus Verbundenheit mit Paul an, dessen Schüler er dreißig Jahre zuvor gewesen war; er gab bereitwillig zu, dass er es leid sei, diese organisatorischen Dinge zu übernehmen, Veranstaltungen durchzuführen, Aufgaben zu verteilen — ein Weihnachtsessen auf die Beine zu stellen, löst Panik bei mir aus, gestand er. Und ein Kolloquium mit fünfzig Teilnehmern erst, nicht auszudenken! Die Universität Potsdam hatte ihm eine Mitorganisatorin zur Seite gestellt, eine junge Doktorandin der Zahlentheorie, Alma Sejdić, die mit ihrer Doktorarbeit eine logische Folge aus Pauls erster Vermutung beweisen wollte. Wie sich herausstellte, war diese Unterstützung ebenso fatal wie amüsant: Anstatt sich zu ergänzen, schienen diese beiden Kräfte sich entweder nutzlos zu vereinigen oder gegenseitig aufzuheben. Jedes Versäumnis wurde zweifach versäumt, jeder kleine Fehler doppelt begangen — immer im Gleichschwung wie bei einer Zeichnung mit zusammengebundenen Kugelschreibern: Parallelen, die sich trotz all ihrer Bemühungen nie treffen, von Euklid persönlich dazu verdammt.
Jürgen Thiele musste sein ganzes diplomatisches Geschick aufbringen, um die Universität Potsdam nicht zu verärgern, wo man nicht verstehen wollte, warum es nötig sein sollte, nur wenige Kilometer von ihren Räumlichkeiten entfernt Geld für ein luxuriöses Flusskreuzfahrtschiff auszugeben — doch Jürgen Thiele hatte die Subvention durch die Georg-Cantor-Vereinigung als Trumpf ausgespielt, und alle fanden die Idee eines schwimmenden Kongresses begeisternd.
Und so gingen Maja und ich nach diesem einige Monaten währenden Eiertanz am Montag, dem 10. September, wie vorgesehen in Köpenick an Bord, und mit uns Linden Pawley, dessen Flieger aus New York am selben Morgen in Tegel gelandet war, der unvermeidbare Robert Kant aus Cambridge und Jürgen Thiele — fünf Luxuskabinen standen uns zur Verfügung.
III
Seit seinem Aufbruch weckt ihn jeden Morgen kurz vor Sonnenaufgang die Kälte. Er zittert. Regt sich aber nicht, damit die Tautropfen, die schwarzen Perlen auf der Zeltbahn, nicht herabrieseln. Nachdem er sein Zelt zu einer kleinen Rinne zusammengefaltet hat, gelingt es ihm mit viel Geduld, seine Feldflasche um einige Zentiliter zu füllen und diesen eiskalten Morgenschweiß zu trinken, seine einzige Mahlzeit in der Frühe.
Sobald er seine störrischen Füße in die noch feuchten, schäbig grünen Strickschwämme gezwängt hat, macht er sich auf den Weg nach Norden, seinem Schicksal entgegen, die heillose Flucht und das Vergessen müssen ja benannt werden. Wieder einmal überlegt er, ob er das Gewehr aufgeben soll, es ist schwer und sein Riemen unbequem, zu kurz, seit er ihn abgeschnitten hat, um daraus einen Gürtel zu machen, mit diesem Messer, das noch immer so gut schneidet und zugleich Ausweis einer gefährlichen, von Blut berauschten Einsamkeit ist, er denkt nicht mehr nach, er marschiert schon, während die ersten Sonnenstrahlen die Schatten zwischen den Felsen absuchen. Von den Lichtpfeilen gekitzelt, schlagen die Spatzen, Grasmücken und Meisen mit den Flügeln und folgen dem langsam anhebenden Gesang des Morgens.
Er denkt so viel an die Vögel, ihre Gegenwart und ihr Gesang zehren an seinen Nerven, weil sie den Hunger in ihm schüren — es wäre so einfach, sich auf die Lauer zu legen, das Gewehr im Anschlag, die Nase im Wind, und zu warten, bis eines dieser Vögelchen sich verrät, es zu erlegen und dann zu essen, aber die Wucht der Kriegswaffe würde nichts als Federn übrig lassen, der Schuss würde in den Höhenlagen weithin widerhallen, und selbst wenn sich ein großer Fasan oder ein Rebhuhn in seine Schusslinie verirrte, müssten sie gekocht werden, doch er hat nicht vor, auf seinem Marsch lange Pausen einzulegen, sich durch Feuer oder Rauch in Gefahr zu bringen.
Er hat beschlossen, das Haus zu erreichen.
Selbst in einer mondlosen Nacht würdest du
die Hütte finden,
am Tag führt der Pfad zwischen Steineichen hindurch, die wegen der Trockenheit vereinzelt stehen; einige Mastixsträucher ducken sich zwischen den Felsen, verströmen, als er an ihnen vorbeimarschiert, den Duft einer Offizin, einer in Vergessenheit geratenen Apotheke; er sucht nach frischem, wildem Bohnenkraut, das im Frühling in den Bergen sprießt, um lange an einem Strauß zu kauen, der bitter, sauer, pfeffrig schmeckt — die Früchte der Erdbeerbäume haben, rot und rau, den Winter überdauert wie Weihnachtsschmuck, den man vergessen hat, sie schmecken schal wie alte Erdbeeren, es ist der fade Geschmack des Vergessens.
Diese Früchte sind winzige Gestirne, zum Greifen nahe Planeten, kleine, von Begierde und Hintergedanken errötete Monde, bei jedem Schritt entflammt die Sonne die Blütenblätter der Herlitzen, kein Laub überschattet ihr leuchtendes Gelb, an den noch nackten Zweigen erscheint wie von Zauberhand der erste Bruch mit dem Winter.
Vom eindringlichen Rauschen der Berge umgeben, marschiert er weiter wie der letzte Mensch,
beneidet die schwarzen Flecken am Himmel, Flugzeuge oder ferne Raubvögel.
Mit dem Hintern auf einem Stein — einem dieser aus der Erde ragenden blaugrauen Felsen, die ebenso glatt wie hart sind, sich in der Sonne schnell aufheizen und nach Metall und Feuerstein riechen — könnte man von Erinnerungen stumpfsinnig werden: Gab es ein erstes Beben, einen rauen Wind, die Voraussetzung für die Logik der Brutalität, ein dem Krieg vorausgehendes, brünstiges Röhren, dem man sich nicht entziehen kann? Nein, scheint ihm,
es hat dich einfach überrascht,
bald werden die schwarzen Nattern aus ihren Löchern kriechen und die Männchen werden sich auf die Suche nach Weibchen machen,
er schnürt seine Stiefel auf, öffnet die Schnallen und löst die Riemen. Die Abnutzung, das Wasser und die Kälte haben das Leder zerschlissen. Der Geruch nach Scheiße ist immer noch da. Seine Hände sind rau, die weißen Handteller mit dunkleren Schwielen übersät und hart geworden vom festen Griff, mit dem er die hölzernen Schäfte umklammert hat. Seine Finger haben Tabakflecken und enden in vergilbten Nägeln, auf denen dunkler Schmutz mäandert, an Daumen und Handgelenk sieht man die Adern; seine Wangen sind kratzig vom struppigen Bart, sein Haar klebt fettig am Kopf, ist vom getrockneten Blut zu stumpfen, dunklen Strähnen verklumpt,
du wirst das Haus vor Anbruch der Nacht erreichen,
das Haus, die Hütte, den Unterschlupf — ein Bild, das sich sehr tief in seinen Erinnerungen und Hoffnungen eingegraben hat. Der Cairn seiner Kindheit. Hoch genug in den Bergen, damit sich niemand dorthin verirrt. Gut genug versteckt in der Bergwelt, um sich dort verkriechen zu können. Eine Zeitlang. Ein Teil des Dachs ist vielleicht eingestürzt, die runden, noch glänzenden Zypressenbalken zwischen den ungleichen Steinen werden nicht mehr von Dachziegeln bedeckt sein. Die sehr niedrige Tür. Der Vorbau auf der Vorderseite, die Holzstreben, die an die Arme Gottvaters erinnern, die beiden Pfeiler aus schlecht behauenen Steinen, Säulen für den Tempel eines grobschlächtigen Gottes. Die Fassade aus unverputztem Bruchstein. Das Dach aus alten gelben Tonziegeln,
du wirst wie früher mit dem Messer Gesichter in die Balken schnitzen können,
du hast fürchterlichen Hunger,
du hast Hunger bis in die Haarwurzeln,
bei dem Gedanken an die kleine Feuerstelle unter dem Vorbau der Hütte und ein Hühnchen, das dort in der Glut brät, windet er sich vor Schmerz,
du hast Durst,
er leert seine blecherne Feldflasche. Die angenehme Märzsonne färbt sich orange. Vom Meer her weht ein Wind,
du kommst voran,
auch wenn man ein wenig taumelt, weil einem schwindelig ist, muss man vorankommen. Sobald Gedanken aufkommen, lässt er sie ziehen. Er verscheucht sie mit den Füßen, hält sie fern durch Marschieren. Er überträgt seine Gedanken auf seine Stiefel, so dass sie zwischen den Steinen zerstieben. Dann schweigt alles in ihm, bis der große Fixstern des Hungers zurückkehrt.
Die verräterische Illusion, der Duft des kommenden Frühlings.
Das Meer, das seine rötlich blaue Fläche weiß umsäumt.
So hoch in den Bergen ist das Meer nur eine bedrohliche Linie, ein Horizont des Schmerzes.
Seine fieberhafte Eile führt ihn immer weiter weg: Je länger er geht, desto weiter rückt das Haus in die Ferne.
Du knirschst zu laut,
du musst dich vor dem Geröllfeld oberhalb der Hütte in Acht nehmen,
und im Sonnenuntergang liegend nach unbekannten Bewegungen Ausschau halten — im Krieg ausgesetzte, verwilderte Hunde, Deserteure, Dorfbewohner, ferne Verwandte: alle fern ihrer Reliquien auf dem Weg in die Einsiedelei, um dem Leiden zu entkommen, um das lange Blutfasten zu beenden,
plötzlich raubt ihm der Frühling den Atem. Ein Frühling der Flügelschläge, der Felsblumen, der Dornensträucher, des weißen und blauen Rosmarins, des Surrens von Insektenflügeln — der Pfad, dem er folgte, ist einige Dutzend Meter zum Meer hin abgefallen; er schlüpft aus seiner schmutzstarrenden, von Schmiere und getrocknetem Blut besudelten Kleidung, steht mit nacktem Oberkörper in der Sonne, abwechselnd von der frischen Brise geleckt und von der kräftigen Strahlung geblendet, die auf seine Schultern brennt, auf die lange Narbe, die sich über seinen Rücken zieht, bis sie unter dem Rucksack verschwindet. Er hat genug von dem zu kurzen Schulterriemen, er hält seine Waffe wie ein Jäger, umschließt den Schaft mit der linken Hand, umklammert den Griff mit der rechten, wie man Geflügel am Hals packt, kraftvoll, aber lässig; der Verschluss ist unverriegelt, im Magazin sieht er das Messing einer Patronenhülse glänzen, einmal mehr möchte er sich den Unglücksbringer vom Hals schaffen,
er wiegt schwerer als ein Kind in deinen Armen,
du solltest ihn zurücklassen, ihn ein paar Stunden Fußmarsch entfernt von der Hütte in einem Wäldchen verstecken,
er spielt mit dem gut gefetteten Verschluss, unmöglich, die Waffe loszuwerden,
vor dir das Schicksal und all diese Dinge, die Scherben, die Spuren und das große Trauern um die Zukunft,
du wirst dich dem Willen Gottes fügen,
Gewalt oder Vergebung, ein Nichts, wie diese gelbe Spinne, die trotz ihrer Giftigkeit, trotz ihres todbringenden Stachels unter deinem Stiefel zerquetscht wird, alles, was man nicht über sich weiß, wir ächzen unter der Welt von gestern, wir ächzen unter unseren Fehlern, wir ächzen unter der Aussicht auf ein Morgen, Vater unser, unser täglich Vergessen gib uns heute auf all unseren Schritten, von denen wir zu viele machen und die, Meter für Meter, Weg für Weg, Pfad für Pfad, unsere Seele schleifen, diese plötzliche Ergriffenheit rührt von der Nähe des Dorfs her, das weiter unten — einen Tagesmarsch entfernt — auf halber Höhe des Hangs liegt, wo die Orangenbäume anfangen, sich über die Ebenen auszubreiten, wo die Olivenbäume auf den mit Steinmäuerchen abgesetzten Terrassen kaum noch zu sehen sind zwischen den Häusern und ihren sanften Bögen, den durchbrochenen Gewölben, zwischen den Mispeln, die jetzt so grün sind und deren Früchte im Juni orangebraun leuchten, zwischen den stattlichen, von den Jahren gebeugten Feigenbäumen, auf deren Früchten im Herbst die Insekten brummen, gebeugt wie das Weinspalier, das einst die Terrasse vor dem Haus des Vaters beschattet hat, wo ein berauschender Wein gekeltert wurde, trübe und rotviolett, der schnell auf der Zunge brannte — in den dunkelsten und kühlsten Verschlägen türmten sich grüne Korbflaschen, bis man sie im September für die neue Traubenlese reinigte, und mit einer stählernen Flaschenbürste die roten und schwarzen Tanninschlieren entfernte, die sich unter ihren gläsernen Schultern festgesetzt hatten,
du wirst dich verstecken müssen, bestimmt sucht man schon nach dir,
man darf niemandem begegnen, muss sich vor Mensch und Tier, vor Hund und Hirte verbergen, darf den eigenen Namen nicht aussprechen,
je näher deine Füße dich der Hütte, dem Haus in den Bergen bringen, desto gefährlicher wird es, im Dorf weiß sicher jeder Bescheid, die Gerüchte werden angeheizt wie der Krieg selbst, jeder weiß Bescheid oder glaubt zu wissen,
der Nachmittag schwillt an, beginnt zu glühen und mit ihm Durst und Hunger.
Im Schatten einer Steineiche macht er Rast. Setzt sich auf eine Wurzel. Die Sonne besprengt das Tal vor ihm. Er träumt von Regen. Noch einmal schüttelt er die Feldflasche über seiner Zunge aus. Er öffnet die Schnürsenkel, zögert, die Stiefel auszuziehen, er ist so müde, dass er sie nicht wieder anziehen wird, wenn er aus ihnen heraus ist. Der Geruch scheint für einen Moment verschwunden zu sein, kehrt aber unversehens noch stärker zurück,
du stinkst nach Blut und Scheiße,
du stinkst nach Schlaf und Hunger,
ein Kind könnte dich mit einem Faustschlag töten,
er zählt die Tage, seit er fort ist aus der Stadt. Seit seiner Flucht aus der Kaserne. Vier Tage, seit er das Fahrzeug die Schlucht hinabgestürzt hat,
fast hundert Kilometer hast du zu Fuß in den Bergen zurückgelegt,
die Wurzel der Steineiche unter deinem Hintern ist hart,
deine gebeugten Knie schmerzen,
er lehnt sich an den dunklen Stamm, streckt die Beine aus, die Augen auf das Tal (Mandelbäume, Haselsträucher, Kaktusfeigen) gerichtet, das er so gut kennt. Er hat diese Terrassen gepflügt, unter den Bäumen Unkraut gejätet, zahllose Steine entfernt. Er kennt diese Sonne, den Meeresstreifen hinter den Hügeln. Und die Angst, die er mit sich schleppt.
An der nächsten Kehre des Pfads, wenn das alte Rückhaltebecken des ausgetrockneten Bachs hinter ihm liegt, sind es noch zwei Stunden Fußmarsch bis zum Haus. Er wird es eine knappe Stunde vor Sonnenuntergang erreichen,
du weißt, wo du dich verstecken kannst,
hinter dem großen Felsen, um unbemerkt zu prüfen, ob sich jemand bei der Hütte herumtreibt. Du wirst hinter dem Felsen Ausschau halten. Die letzten Insekten in der Dämmerung beobachten. Den Vögeln und den Steinen in der Dämmerung lauschen.
Er zieht das Messer heraus. Die Klinge ist genauso grau wie blau. Er träumt von einem Hasen, der in Reichweite des Dolchs plötzlich aus einer Mulde springt. Er ritzt ein Kreuz in die Baumwurzel. Ein dünnes, kleines Kreuz. Ein Zeichen. Er wäre imstande, das warme Blut dieses Hasen zu trinken, wäre er vor ihm aufgesprungen,
du bist fiebrig wie dieser Landstrich in deiner Erinnerung,
seit Stunden sucht er nach einem Orangen- oder sogar Zitronenbaum, an dessen Ästen noch ein paar vergessene Früchte hängen. Vor der Hütte steht ein riesiger Zitronenbaum, den sein Großvater gepflanzt hatte und der Dutzende saftiger, gelber Früchte mit dicker Schale trägt (oder vielmehr trug, denn er hat ihn schon lange nicht mehr gesehen), die den Duft von Wäsche und Blumen an den Händen hinterlassen, den Geruch von Reinheit, und Reinheit gefällt dem Herrn,
dort steht auch ein Orangenbaum, aus dessen Blüten Kränze für Hochzeiten geflochten wurden,
unter allen Geschöpfen bist du das unreinste,
er findet die Kraft, um sich wieder auf den Weg zu machen, seine Knie sind wund, seine Schenkel hart wie Stein, die Füße aufgeschürft; der Krieg rückt immer weiter in die Ferne und sein Körper, der alte Mechanismus, den die Gewohnheit am Laufen hielt, zerfällt immer mehr. Beinahe schafft er die wenigen Kilometer nicht mehr, die ihn noch von der Hütte, dem Haus, den violetten Nebelschwaden und den Wolkenlöchern trennen. Tatsächlich trägt und führt ihn sein Gewehr, die übergroße Nadel eines magischen Kompasses, die Rute eines todbringenden Wünschelrutengängers,
du strauchelst, taumelst, machst zu viel Lärm,
er verscheucht die winzigen Fliegen, die ihn verfolgen und immer wieder einholen. Die Sonne verbrennt seine in der Kälte des Krieges empfindlich gewordene Haut, die Hitze hat die Eidechse wiederbelebt; alles in ihm ist Anspannung zwischen Angst und Erschöpfung.
Von seinen Schritten erschreckt (rollende Steine, vibrierende Äste, Flügelgeräusche) fliegt plötzlich nur wenige Meter von ihm entfernt eine Taube auf. Er schließt den Verschluss, um das Gewehr zu spannen, legt an — er schießt nicht,
du bist zu nah an den Dörfern, du darfst nicht die Aufmerksamkeit eines vorüberziehenden Schäfers erregen,
er sieht der Taube hinterher, die hinter einer Gruppe von Steineichen verschwindet und zu ihrem Gefährten zurückkehrt,
diese Vögel sind immer zu zweit unterwegs,
zusammen mit den Nachtigallen sind sie die Unzertrennlichen der Berge, die untrüglichen Boten des Frühlings. Er entsichert die Waffe. Wenn er oben auf dem Pass zwischen den beiden felsigen Hügeln ankommt, wird er die Hütte sehen. Er beobachtet, wie sich plötzlich graue Wolken über dem Horizont des Meeres zusammenballen. Eine Wolke verdeckt die Sonne. Der Wind verwandelt die Schweißtropfen auf seinen Schultern und seinem Oberkörper in eiskalte Nadeln. Er hatte vergessen, wie listig die Kälte ist — er zwingt sich zu einer Pause, um seine Jacke wieder anzuziehen, die steif geworden ist von all den Flüssigkeiten im Gewebe, imprägniert von Schmerz und Entsetzen,
du stinkst nach Schlachthof, das ist der Geruch, den du verströmst, der Geruch von Därmen und dem Wasserstrahl auf einem schmutzigen Fliesenboden,
ein roher Fleischgeruch,
er fährt sich mit der linken Hand übers Gesicht, sein Bart ist rau wie Baumrinde. Das Verschwinden der Sonne bedeutet, dass die Höhe zurückkommt und ebenso der Schatten: Er fröstelt. Etwas unterhalb von ihm steigt in seinem Rücken zwischen zwei Faltungen der Hügel ein watteartiger Dunst auf, ein weißer Nebel auf roter Erde, das Meer ist verschwunden. Das Stahlgrau nagt am Horizont. Er nimmt seine letzten Kräfte zusammen, um über die Steine zu steigen, die Hänge zu erklimmen. Der Pass heult, der Pass vereist ihm das Gesicht. Der Wind schlägt ihm entgegen, er zieht den Kopf ein, die Schultern zusammen. Er klammert sich an sein Gewehr und beugt sich nach vorn. Immer wieder um das Gleichgewicht kämpfend, gelangt er einige Dutzend Meter unterhalb des Passes in den Schutz eines Felsens. Er lehnt sich an ihn,
das Haus liegt unter dir auf der rechten Seite,
er mustert es, das mehr gelbe als rote Ziegeldach ist da, ein Pultdach, das am Berg lehnt, er kann den Vorbau erkennen, den kurzen Schornstein, die tragende Wand aus Bruchstein, Mäuerchen um den verlassenen Garten, kein Weidetier in Sicht, in der Ferne kreist ein Raubvogel, ein winziger, einsamer Fleck am milchig gewordenen Himmel, das eingezäunte Stück Land rechts des Gartens ist leer, der große Mandelbaum vor dem Haus trägt noch kein Laub, der Zitronenbaum ist grün, von diesem dunklen Immergrün der Zitruspflanzen, ein Grabesgrün mit einem gelben Funkeln im schwankenden Licht der abwesenden Sonne, aus dem Kamin steigt kein Rauch, in der Luft hängt der Geruch von Thymian und Schnee,
hättest du ein Fernglas, würdest du nach Spuren suchen,
nach Anzeichen dafür, ob jemand da ist, Hirten, Bauern, Flüchtlinge, Geschöpfe, Engel, Dämonen,
es gibt nur die kurze Ebene, die sich in Richtung Meer bricht wie eine Welle, man hört nur den Wind über die Mäuerchen streichen, mit dem Rücken am Fels, die Hände auf den Knien, das Gewehr zu seiner Rechten, den Rucksack zu seinen Füßen wie ein regloser Hund wartet er, wartet er, wie er es vorgesehen hat, bis die zwei Stunden vorüber sind, die bis zur dunklen Nacht noch bleiben, beruhigt durch die Hütte, durch die Zitronen am Zitronenbaum, durch den alten Orangenbaum hinter der Hütte, der neben dem Haselstrauch rechts von der Gartenmauer steht und für ihn nicht zu sehen ist,
von der plötzlichen Nähe der Kindheit aller Eile enthoben,
flügelschlagend,
rückwärts gewandt,
wartest du auf die Erscheinung, Herr, Dein Gesicht ist unsichtbar, wartest du auf Sirius, wartest du auf Orion, wartest du auf das Antlitz Unseres Herrn,
dein Hintern ist eiskalt von den Resten des Winters, denen das Gebirge stets Zuflucht gewährt,