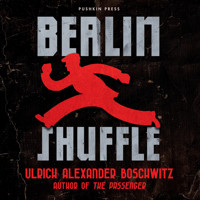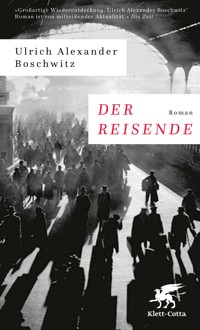
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Deutschland im November 1938. Otto Silbermanns Verwandte und Freunde sind verhaftet oder verschwunden. Er selbst versucht, unsichtbar zu bleiben, nimmt Zug um Zug, reist quer durchs Land. Inmitten des Ausnahmezustands. Er beobachtet die Gleichgültigkeit der Masse, das Mitleid einiger Weniger. Und auch die eigene Angst. »Ein wirklich bewegender, aber auch instruktiver Text. Ein großer Gewinn! Für einen Dreiundzwanzigjährigen ein ganz erstaunliches Werk.« Brigitte Kronauer Der jüdische Kaufmann Otto Silbermann, ein angesehenes Mitglied der Gesellschaft, wird in Folge der Novemberpogrome aus seiner Wohnung vertrieben und um sein Geschäft gebracht. Mit einer Aktentasche voll Geld, das er vor den Häschern des Naziregimes retten konnte, reist er ziellos umher. Zunächst glaubt er noch, ins Ausland fliehen zu können. Sein Versuch, illegal die Grenze zu überqueren, scheitert jedoch. Also nimmt er Zuflucht in der Reichsbahn, verbringt seine Tage in Zügen, auf Bahnsteigen, in Bahnhofsrestaurants. Er trifft auf Flüchtlinge und Nazis, auf gute wie auf schlechte Menschen. Noch nie hat man die Atmosphäre im Deutschland dieser Zeit auf so unmittelbare Weise nachempfinden können. Denn in den Gesprächen, die Silbermann führt und mithört, spiegelt sich eindrücklich die schreckenerregende Lebenswirklichkeit jener Tage.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 335
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Ulrich Alexander Boschwitz
Der Reisende
Roman
Herausgegeben und mit einem Nachwort versehenvon Peter Graf
Klett-Cotta
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
© 2018 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Cover: ANZINGER UND RASP Kommunikation GmbH, München
Unter Verwendung einer Fotografie von © Planet News Archive/SSPL/Getty Images
Datenkonvertierung: Dörlemann Satz, Lemförde
Printausgabe: ISBN978-3-608-98123-0
E-Book: ISBN 978-3-608-11011-1
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Editorische Notiz
Das diesem Buch zugrunde liegende Romantyposkript wurde ab November 1938 verfasst. Unmittelbar nach den Pogromen in Deutschland, mit denen die systematische Verfolgung der Juden begann.
Der Autor, damals gerade einmal 23 Jahre alt, war zu dem Zeitpunkt schon geflüchtet. In Luxemburg, und zum Teil wohl auch in Brüssel, schrieb er in nur wenigen Wochen den Roman über den jüdischen Kaufmann Otto Silbermann, der zuerst sein Hab und Gut, dann seine Würde und schließlich seinen Verstand verliert.
Über Umwege gelangte das mit einer Schreibmaschine auf Deutsch geschriebene Originaltyposkript in den 1960er Jahren nach Frankfurt am Main, wo es heute im Exilarchiv der Deutschen Nationalbibliothek verwahrt wird.
Hier erscheint es erstmals in deutscher Sprache. Da es die Umstände damals nicht zuließen, dass Ulrich Alexander Boschwitz sein Manuskript – wie üblich – gemeinsam mit einem Verlag, mit seinem Verleger oder einem Lektor überarbeiten konnte, wurde sein Manuskript nun, fast 80 Jahre nach seiner Fertigstellung, mit Zustimmung der Familie sorgsam editiert, um diesem ergreifenden und beeindruckenden Werk eine Form zu geben, die ihm gebührt.
Peter Graf, Berlin, Herbst 2017
Der Reisende
1. Kapitel
Becker erhob sich, stülpte die Zigarre in den Aschenbecher, knöpfte seine Jacke zu und legte dann mit einer behütenden Geste die rechte Hand auf Silbermanns Schulter. »Also mach’ es gut, Otto. Ich denke, dass ich morgen schon wieder in Berlin sein werde. Wenn etwas sein sollte, rufst du mich eben in Hamburg an.«
Silbermann nickte. »Tu’ mir einen einzigen Gefallen«, bat er, »und geh’ nicht wieder spielen, du hast zu viel Glück in der Liebe. Außerdem verlierst du … unser Geld.«
Becker lachte ärgerlich. »Warum sagst du nicht dein Geld?«, fragte er. »Habe ich etwa schon ein einziges Mal …?«
»Das nicht«, unterbrach ihn Silbermann hastig. »Es ist nur ein Scherz, das weißt du, aber dennoch: Du bist wirklich leichtsinnig. Wenn du einmal zu spielen anfängst, dann hörst du so schnell nicht wieder auf, und wenn du vorher noch diesen Scheck einkassiert hast …«
Silbermann brach den Satz ab und sprach in ruhigem Ton weiter.
»Ich habe volles Vertrauen zu dir. Schließlich bist du ja ein vernünftiger Mensch. Trotzdem ist es wirklich schade um jede Mark, die du am Spieltisch lässt. Es ist mir, da wir nun einmal Geschäftspartner sind, genauso unangenehm, wenn du dein Geld verlierst, als wenn es sich um meines handelte.«
Beckers breites und gutmütiges Gesicht, das sich für einen Augenblick in verdrossene Falten gelegt hatte, hellte sich auf.
»Wir brauchen uns doch nichts vorzumachen, Otto«, meinte er behaglich. »Wenn ich verliere, verlier’ ich natürlich dein Geld, denn ich besitze ja keins.« Er lachte glucksend.
»Wir sind Partner«, wiederholte Silbermann mit Nachdruck.
»Natürlich«, meinte Becker, wieder ernst werdend. »Und warum sprichst du dann mit mir so, als wenn ich noch dein Angestellter wäre?«
»Habe ich dich gekränkt?«, fragte Silbermann. In seinem Ton mischten sich leise Ironie und schwaches Erschrecken.
»Unsinn«, biederte Becker. »Alte Freunde wie wir! Drei Jahre Westfront, zwanzig Jahre Zusammenarbeit und Zusammenhalt – Kerl, du kannst mich nicht kränken, höchstens ein bisschen verärgern.«
Erneut legte er ihm die Hand auf die Schulter.
»Otto«, erklärte er mit markiger Stimme. »In diesen unsicheren Zeiten, in dieser unklaren Welt ist nur auf eines Verlass, und das ist Freundschaft, wahre Männerfreundschaft! Lass dir das gesagt sein, alter Junge, für mich bist du ein Mann – ein deutscher Mann, kein Jude.«
»Doch, doch, ich bin ein Jude«, sagte Silbermann, der Beckers Vorliebe für weniger taktvolle als kernige Worte kannte und befürchtete, jener möge über seine rauh-herzliche Art sich auszusprechen den Zug versäumen. Aber Becker hatte eine seiner Gefühlsminuten, und von der ließ er sich keine Sekunde abstreichen.
»Ich will dir noch etwas sagen«, verkündete er, ohne die Nervosität seines Freundes, dem er sein Herz schon allzu oft eröffnet hatte, zu beachten: »Ich bin ein Nationalsozialist. Weiß Gott, ich habe dir nie etwas vorgemacht. Wenn du ein Jude wärst wie andere Juden, eben ein richtiger Jude, dann wäre ich vielleicht dein Prokurist geblieben, dein Sozius wär’ ich nie geworden! Ich bin kein Renommiergoj, nie und nimmer bin ich das, aber du bist ein vertauschter Arier, das ist meine Überzeugung. Marne, Yser, Somme, wir beide, Kerl! Da soll mir noch einer erzählen, dass du …«
Silbermann sah sich nach dem Kellner um. »Gustav, du versäumst den Zug!«, unterbrach er den anderen.
»Der Zug ist mir ganz egal.« Becker setzte sich wieder. »Ich will noch ein Bier mit dir trinken«, erklärte er gerührt.
Silbermann schlug kurz mit der Faust auf den Tisch. »Sauf meinetwegen im Speisewagen weiter«, versetzte er gereizt. »Ich muss jetzt zur Verhandlung.«
Becker schnaufte gekränkt. »Wie du willst, Otto«, erwiderte er dann nachgiebig. »Wenn ich Antisemit wäre, dann würde ich mir diesen Leutnantston schwerlich bieten lassen. Überhaupt lasse ich ihn mir nicht bieten! Von niemandem! Außer von dir.«
Er stand abermals auf, nahm die Aktentasche vom Tisch und sagte lachend: »Und so was will nun ein Jude sein!« Er schüttelte mit gespielter Verwunderung den Kopf, nickte Silbermann noch einmal zu und verließ dann den Wartesaal der ersten Klasse.
Sein Freund sah ihm nach. Beunruhigt stellte Silbermann fest, dass Becker im Gehen leicht schwankte, gegen Tische stieß und sich hölzern aufrecht hielt, wie immer, wenn er ernsthaft betrunken war.
Es ist ihm nicht bekommen, dachte Silbermann. Er hätte Prokurist bleiben sollen. Als Prokurist war er zuverlässig, schweigsam und anständig, ein sehr guter Mitarbeiter. Aber sein Glück bekommt ihm nicht. Wenn er nur das Geschäft nicht zum Schluss noch verdirbt. Wenn er nur nicht spielen geht!
Silbermann runzelte die Stirn. »Das Glück hat ihn untüchtig gemacht«, murmelte er verdrossen.
Jetzt erst kam der Kellner, nach dem er vorhin vergeblich Ausschau gehalten hatte.
»Soll man hier eigentlich auf die Kellner oder auf die Züge warten?«, erkundigte sich Silbermann scharf, der einen Abscheu gegen alles hatte, was nach Schlamperei aussah, und dessen Stimmung wenig freundlich war.
»Entschuldigen Sie«, antwortete der Kellner, »in der zweiten Klasse glaubte ein Herr, einem Juden gegenüberzusitzen und beschwerte sich deshalb. Es war aber gar kein Jude, es war ein Südamerikaner, und weil ich etwas spanisch kann, hat man mich gerufen.«
»Es ist schon gut.«
Silbermann erhob sich. Sein Mund verengte sich zu einem Strich, und den Kellner traf ein strenger Blick aus seinen grauen Augen.
Der wiegelte ab. »Es war wirklich kein Jude«, versicherte er. Anscheinend hielt er seinen Gast für einen ganz besonders strammen Parteimann.
»Es interessiert mich nicht. Ist der Zug nach Hamburg schon abgefahren?«
Der Kellner sah nach der über dem Ausgang zu den Bahnsteigen hängenden Uhr.
»Neunzehn Uhr zwanzig«, dachte er laut, »der Zug nach Magdeburg fährt jetzt gerade ab. Der Zug nach Hamburg geht neunzehn Uhr vierundzwanzig. Wenn Sie sehr schnell machen, bekommen Sie ihn noch. Ich wünschte, ich könnte auch mal hinter einem Zug herlaufen, aber unsereiner …«
Er streifte mit der Serviette einige Brotkrümel vom Tischtuch.
»Das Beste wäre schon«, meinte er dann, das vorige Thema wieder aufnehmend, »wenn die Juden gelbe Streifen um den Arm tragen müssten. Dann kämen wenigstens keine Verwechslungen vor.«
Silbermann betrachtete ihn. »Sind Sie wirklich so grausam?«, fragte er leise und bereute seine Worte schon, während er sie aussprach.
Der Kellner sah ihn an, als habe er ihn nicht recht verstanden. Er wunderte sich offenbar, ohne indessen Verdacht zu schöpfen, denn Silbermann wies keines jener Merkmale auf, an denen man, nach der Lehre der Rassenforscher, den Juden erkennt.
»Mich geht das alles gar nichts an«, meinte der Mann endlich vorsichtig. »Aber für die anderen wäre es gut. Mein Schwager zum Beispiel sieht auch etwas jüdisch aus, dabei ist er natürlich ein Arier, doch das muss er nun alle Augenblicke erklären und nachweisen. Das kann man keinem Menschen auf die Dauer zumuten.«
»Nein, das kann man wohl nicht«, stimmte Silbermann zu. Dann zahlte er die Zeche und ging.
Unglaublich, dachte er, einfach unglaublich …
Nachdem er den Bahnhof verlassen hatte, stieg er in eine Taxe und fuhr nach Hause. Die Straßen waren voller Menschen, und er bemerkte viele Uniformen. Zeitungsverkäufer schrien ihre Blätter aus, und Silbermann hatte den Eindruck, als fänden sie reißenden Absatz. Einen Augenblick erwog er, ob er sich auch ein Journal kaufen sollte, sah indessen davon ab, da er glaubte, die vermutlich schlechten, mit einiger Sicherheit ihm feindlichen Nachrichten noch früh genug zu erfahren.
Nach kurzer Fahrt kam er vor dem Haus an, in dem er wohnte. Frau Friedrichs, die Gattin des Portiers, die sich auf der Treppe aufhielt, grüßte ihn höflich, und in gewisser Weise freute sich Silbermann über ihr unverändert gebliebenes Benehmen. Während er die mit einem roten Plüschläufer belegte Marmortreppe hinaufstieg, wurde ihm wieder – derartige Gedanken waren ihm in letzter Zeit zur Gewohnheit geworden – die offenbare Halbwirklichkeit seiner Existenz bewusst.
Ich lebe, als wäre ich kein Jude, wunderte er sich. In diesem Moment bin ich zwar ein bedrohter, doch noch vermögender und bislang unangetasteter Bürger. Wie kommt man eigentlich dazu? Man lebt in einer modernen Sechszimmerwohnung. Die Menschen sprechen mit einem und behandeln einen, als gehöre man völlig zu ihnen. Fast könnte man ein schlechtes Gewissen haben, und gleichzeitig möchte man die Wirklichkeit, das Jude- und seit gestern Anders-Sein, den Lügnern, die so tun, als wäre ich noch das, was ich gewesen bin, entschieden präsentieren. Was war ich? Nein, was bin ich? Was bin ich eigentlich? Ein Schimpfwort auf zwei Beinen, dem man es nicht ansieht, dass es ein Schimpfwort ist!
Ich habe keine Rechte mehr, nur aus Anstand oder aus Gewohnheit tun viele so, als hätte ich noch welche. Meine ganze Existenz beruht nur auf dem schlechten Gedächtnis derer, die sie an und für sich vernichten wollen. Man hat mich vergessen – ich bin schon degradiert, doch wurde die Degradierung noch nicht öffentlich vollzogen.
Silbermann zog den Hut und begrüßte die Geheimrätin Zänkel mit einem »Guten Tag, gnädige Frau«, als diese aus ihrer Tür trat.
»Wie geht es Ihnen?«, fragte sie liebenswürdig.
»Grundsätzlich gut. Und wie geht es Ihnen selbst?«
»Danke, zufriedenstellend. Wie es einer alten Frau eben geht.«
Sie reichte ihm zum Abschied die Hand.
»Es sind wohl schwere Zeiten für Sie«, meinte sie noch bedauernd, »schreckliche Zeiten …«
Silbermann begnügte sich mit einem aufmerksamen kleinen Lächeln, das ebenso vorsichtig wie nachdenklich, weder zustimmend noch ablehnend war. »Man hat uns eine sonderbare Rolle zugewiesen, grundsätzlich …«, sagte er endlich.
»Aber es sind doch auch große Zeiten«, tröstete sie ihn. »Man tut Ihnen wohl Unrecht, aber deswegen müssen Sie trotzdem gerecht denken und verständnisvoll.«
»Ist das nicht ein wenig viel verlangt, gnädige Frau?«, fragte Silbermann. »Übrigens denke ich gar nicht mehr. Ich habe es mir abgewöhnt. So erträgt man alles am besten.«
»Ihnen wird man niemals etwas tun«, versicherte sie und stampfte mit dem Schirm, den die rechte Hand fest umklammerte, resolut auf eine Treppenstufe, als wollte sie andeuten, dass sie es nicht zulassen werde, wenn man ihm zu nahe träte. Dann nickte sie ihm ermutigend zu und schritt an ihm vorüber.
In seiner Wohnung angekommen erkundigte sich Silbermann sogleich bei dem Mädchen, ob Herr Findler schon da sei. Sie bejahte und nachdem er eilig Hut und Mantel abgelegt hatte, trat er in das Herrenzimmer ein, in dem sein Besucher auf ihn wartete.
Theo Findler stand vor einem Bild und betrachtete es recht missmutig. Als er die Tür aufgehen hörte, drehte er sich hastig um und lächelte dem Eintretenden entgegen.
»Na?«, fragte er und legte die Stirn, wie immer, wenn er sprach, in tiefe und, wie er glaubte, bedeutsame Falten. »Wie geht es Ihnen denn, mein Lieber? Ich hatte schon befürchtet, Ihnen wäre etwas zugestoßen. Man kann ja nie wissen … Haben Sie sich mein letztes Angebot durch den Kopf gehen lassen? Wie geht es Ihrer Frau? Habe sie heute noch gar nicht gesehen. Becker ist also nach Hamburg gefahren.«
Findler holte tief Luft, denn er befand sich erst am Anfang seines Monologs.
»Ihr seid tüchtige Leute, ihr beiden! Von euch kann man lernen. Der Becker hat ein jüdisches Köppchen. Haha, der wird’s schon schaffen, der wird’s schon schaffen! Hätte mich an dem Geschäft ganz gerne beteiligt, aber zu spät ist zu spät, na … Wo haben Sie übrigens diese grauenhaften Bilder aufgetrieben? Ich verstehe das nicht, wie man sich so etwas hinhängen kann. Ist ja keine Ordnung drin in den Sachen, Sie oller Kulturbolschewist. Glauben Sie nur nicht, dass ich auch nur einen Tausendmarkschein auf mein letztes Gebot lege. Nie im Leben, kann ich gar nicht.
Sie halten mich für einen reichen Mann. Alle halten mich dafür. Wenn ich bloß wüsste, wie die Leute auf die Idee gekommen sind. Sogar die Steuern bin ich noch schuldig. Apropos Steuern, können Sie mir nicht einen tüchtigen Bücherrevisor beschaffen oder nachweisen? So ein bisschen versteh’ ich ja auch von der Sache, aber ich habe nicht die Zeit, mich richtig darum zu kümmern. Diese Steuern, diese gottverdammten Steuern. Soll ich denn alleine das ganze Deutsche Reich aushalten, sagen Sie mal? Na?
Sie sagen ja gar nichts. Was gibt’s? Haben Sie sich die Sache überlegt? Nehmen Sie die Offerte an? Also Ihre Frau muss etwas gegen mich haben. Sie lässt sich überhaupt nicht sehen. Verstehe das nicht. Nimmt sie mir übel, dass wir Sie neulich abends nicht gegrüßt haben? Aber Menschenskind, das konnten wir doch nicht! Das Lokal war voller Nazis! Meine Frau hat mir hinterher in den Ohren gelegen, wir hätten Sie grüßen sollen. Aber ich habe ihr gesagt, der Silbermann, der ist ein viel zu vernünftiger Mensch. Der sieht das schon ein, dass ich mich seinetwegen nicht kompromittieren kann. Na?
Also Silbermann, nun kommen Sie mal raus mit der Sprache. Wollen Sie das Haus verkaufen, oder wollen Sie nicht?«
Findler schien sich ausgesprochen zu haben, jedenfalls sah er Silbermann nun erwartungsvoll an. Sie nahmen am Rauchtisch Platz, aber Findler hatte sich wohl zu abrupt in den Sessel fallen lassen, jedenfalls rieb er sich mit schmerzvollem und außerordentlich konzentriertem Gesichtsausdruck die linke Hüfte.
»Neunzigtausend«, sagte Silbermann jetzt, ohne auf die verschiedenen Fragen und Bemerkungen zu reagieren, die der andere, wie er sehr wohl wusste, vornehmlich eingestreut hatte, um ihn zu verwirren. »Dreißigtausend bar, den Rest an zweiter Stelle hypothekarisch gesichert.«
Wie elektrisiert fuhr Findler hoch.
»Machen Sie doch keine Geschichten«, rief er, beinahe beleidigt. »Nun wollen wir endlich mal aufhören, uns Witze zu erzählen. Fünfzehntausend auf den Tisch des Hauses, hören Sie? So etwas, dreißigtausend Mark! Wissen Sie, wenn ich dreißigtausend Mark frei hätte, dann wüsste ich etwas Besseres damit anzufangen, als mir Ihr Haus zu kaufen. Dreißigtausend Mark!«
»Aber rechnen Sie sich nur einmal den Mietüberschuss aus. Da der Kaufpreis sowieso schon lächerlich ist, muss ich wenigstens eine anständige Anzahlung haben. Das Haus ist zweihunderttausend Mark wert, Sie kaufen es …«
»Wert, wert, wert«, unterbrach Findler. »Was meinen Sie, was ich wert bin? Es gibt nur keiner was für mich. Kein Mensch kann mich bezahlen, und gleichzeitig würde es keinem einfallen, auch nur einen Tausendmarkschein für mich auf den Tisch zu legen. Ich bin unverkäuflich. Ihr Haus ist es auch. Hahaha, Silbermann, in aller Freundschaft! Ich nehme Ihnen die Bude ab, wenn ich’s nicht mache, macht’s der Staat. Der gibt Ihnen keinen Sechser.«
Aus dem Nebenraum wurde das Klingeln des Telefons vernehmlich. Silbermann erwog einen Augenblick, ob er selber an den Apparat gehen sollte, sprang dann auf, entschuldigte sich bei Findler und verließ das Zimmer.
Ich werde wohl akzeptieren, dachte er, während er den Hörer abnahm. Im Grunde ist der Findler noch ein relativ anständiger Kerl.
»Hallo, wer ist dort?«
Das Fernamt meldete sich. »Bleiben Sie bitte am Telefon, Sie werden aus Paris verlangt«, sagte eine kühle Telefonistinnenstimme.
Silbermann zündete sich aufgeregt eine Zigarette an. »Elfriede«, rief er halblaut.
Seine Frau, die sich, wie er vermutete, im Salon aufgehalten hatte, kam, leise die Tür öffnend und hinter sich schließend, herein.
»Guten Tag, Elfriede«, begrüßte er sie, die Sprechkapsel des Hörers mit der Hand abdeckend, »ich bin erst vor fünf Minuten gekommen, Herr Findler ist da. Willst du nicht mit ihm sprechen?«
Sie war nahe herangekommen, und sie wechselten einen flüchtigen Kuss.
»Es ist Eduard«, flüsterte er, »der Anruf kommt mir sehr ungelegen. Bitte unterhalte dich mit Findler, sonst hört der zu. Es ist fast schon ein Verbrechen, mit Paris zu telefonieren.«
»Grüß’ Eduard schön«, bat sie. »Ich möchte ihm so gerne auch ein paar Worte sagen.«
»Ausgeschlossen«, wehrte er ab, »die Leitungen werden alle abgehört. Und du bist zu unvorsichtig, du würdest dich verplappern.«
»Aber ich werde doch wohl meinem Sohn guten Tag sagen können.«
»Das kannst du eben nicht. Versteh das doch bitte.«
Sie sah ihn flehend an. »Nur ein paar Worte«, sagte sie, »ich werde schon aufpassen.«
»Es geht nicht«, sagte er entschieden. »Hallo? Hallo … Eduard? Guten Tag, Eduard …« Seine Hand deutete beschwörend auf die Tür des Herrenzimmers.
Sie ging.
»Hör mal«, setzte Silbermann das Gespräch fort, »hast du die Erlaubnis für uns durchgesetzt?« Er sprach sehr langsam und bedachte jedes Wort, bevor er es sagte.
»Nein«, antwortete Eduard auf der anderen Seite. »Es ist außerordentlich schwer. Ihr könnt euch nicht darauf verlassen, dass ihr die Genehmigung bekommen werdet. Ich versuche alles, aber …«
Silbermann räusperte sich. Er meinte, energischer werden zu müssen.
»So geht das ja nicht«, sagte er. »Entweder bemühst du dich, oder du bemühst dich nicht! Dass die Angelegenheit einigermaßen wichtig ist, dürfte dir bekannt sein. Mit so flauen Tönen weiß ich nichts anzufangen.«
»Du überschätzt meine Möglichkeiten, Vater«, antwortete Eduard betroffen. »Noch vor einem halben Jahr wäre es viel leichter gewesen. Aber da wolltest du nicht. Das ist schließlich nicht meine Schuld.«
»Geht es darum, wer Schuld hat?«, fragte Silbermann wütend zurück. »Du sollst die Genehmigung besorgen. Auf deine Weisheiten kann ich recht gut verzichten.«
»Also hör mal, Vater«, empörte sich Eduard. »Du verlangst von mir, dass ich die Sterne vom Himmel hole, und schnauzt mich an, weil ich sie dir noch nicht geschickt habe! … Aber wie geht es euch? Wie geht es der Mutter? Grüße sie bitte schön von mir. Ich hätte sie sehr gerne gesprochen.«
»Beschaff’ schleunigst die Genehmigung«, sagte Silbermann noch einmal eindringlich. »Mehr verlange ich nicht! Die Mutter lässt dich herzlich grüßen. Sie kann leider jetzt nicht mit dir sprechen.«
»Nun, ich werde es schon schaffen«, antwortete Eduard. »Jedenfalls versuche ich alles.«
Silbermann hängte ein.
Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich etwas von meinem Sohn will, dachte er missvergnügt und enttäuscht. Er wird sicher versagen! Wenn ich einen Geschäftsfreund in Paris hätte, der würde mir die Einreisegenehmigung in ein paar Tagen verschaffen, aber Eduard … Von ihm kann ich das nicht verlangen. Er ist einfach nicht daran gewöhnt, etwas für uns zu tun. Wenn man so lange für jemanden da war, ist es für denjenigen sehr schwer, sich umzustellen. Eduard ist gewöhnt, dass ich ihm helfe, und nun verlange ich Hilfe von ihm. Diese neue Einteilung behagt ihm nicht!
Dann schüttelte Silbermann über seine Reflexionen beschämt den Kopf. Ich bin ungerecht, dachte er, und was schlimmer ist, sentimental.
Er kehrte in das Herrenzimmer zurück.
»Ich erkläre Ihrer Frau gerade«, begrüßte ihn Findler, »dass es sehr unvorsichtig von Ihnen ist, noch die alten Lokale zu besuchen. Wenn Sie einen Ihnen ungünstig gesinnten Bekannten treffen, so können Sie die größten Unannehmlichkeiten bekommen. Ihre Frau ist ja Arierin, Ihre Frau kann überall hingehen, aber Sie – weiß Gott, ich spreche in Ihrem Interesse und ohne die Umstände, die derartige Ratschläge notwendig machen, gutzuheißen. Am besten halten Sie sich zu Hause auf oder bei Bekannten. Zwar sieht Ihnen wirklich kein Mensch den Juden an, aber soll der Teufel wollen? Was macht übrigens der Sohnemann? Hat wohl rechtzeitig die Beine in die Hand genommen. Hahaha, drollige Zeiten. Na?«
»Hören Sie, Findler«, begann Silbermann nun, »ich lasse Ihnen das Haus für zwanzigtausend Mark Anzahlung, um endlich zu einem Abschluss zu kommen.«
»Reden Sie doch keinen Unsinn. Warum wollen Sie Ihren alten Findler hochnehmen? An der Grenze wird Ihnen das Geld sowieso abgenommen. Ihnen zum Gefallen würde ich vielleicht sogar noch ein paar Mark mehr zahlen, als mir die Bude eigentlich wert ist, aber um dem preußischen Staat einen Dienst zu erweisen, nee.«
»Ich habe vorläufig gar nicht die Absicht, Deutschland zu verlassen.«
»Ach Kinder, macht das doch, wie Ihr wollt. Ich gönne euch wirklich etwas Besseres als die gegenwärtigen Umstände. Das deutsche Volk wird mit Judenblut zusammengeklebt. Warum aber soll gerade mein Freund Silbermann zum Kleister werden? Das sehe ich nicht ein. Rette sich, wer kann. Versteh’ ich durchaus.«
»Begeht man nicht ein ungeheures Verbrechen an den Juden?«, fragte Frau Silbermann, der der Satz: »Das deutsche Volk wird mit Judenblut zusammengeklebt«, Grauen verursachte und die es sich noch nicht abgewöhnt hatte, in Ereignissen Moral zu suchen.
»Sicher«, meinte Findler trocken. »Es geschieht viel Böses in der Welt. Und auch manches Gute. Mal dem, mal jenem. Der eine ist schwindsüchtig, der andere ist Jude, und besonders große Pechvögel sind beides zugleich. So ist das nun mal. Was meinen Sie, was ich in meinem Leben für Pech gehabt habe? Da kann man nichts machen.«
»Dass Sie nicht übermäßig taktvoll sind, Herr Findler«, sagte Frau Silbermann empört, »das wusste ich, aber dass Sie innerlich so kalt sind und …«, sie verschluckte das Wort brutal, »… gleichgültig, das ist mir allerdings neu.«
Findler lächelte ungerührt. »Ich habe meine Frau lieb und mein Töchterchen. Mit der übrigen Menschheit stehe ich im Geschäftsverkehr. Da haben Sie mein ganzes Verhältnis zur Umwelt. Ich liebe die Juden nicht, ich hasse die Juden nicht. Sie sind mir gleichgültig, und als tüchtige Kaufleute bewundere ich sie. Wenn ihnen Unrecht angetan wird, so bedaure ich das, aber es wundert mich auch nicht. Das ist der Lauf der Welt. Die einen, die gerade dran sind, fallieren und die andern reüssieren.«
»Wenn Sie nun aber ein Jude wären?«
»Ich bin aber keiner! Ich habe mir abgewöhnt, mir den Kopf über Dinge zu zerbrechen, die sein könnten. Mir genügt schon das, was ist.«
»Denken Sie denn immer nur an sich? Können Sie die Tragödie anderer nicht mitfühlen?«
»Wer kümmert sich denn um mich, wenn ich Pech habe? Kein Deibel! Der Theo Findler hat niemanden außer dem Theo Findler. Die beiden müssen zusammenhalten, wie Pech und Schwefel. Haha.«
»Und Sie behaupten, Ihre Frau und Ihre Tochter zu lieben«, ereiferte sich Frau Silbermann immer mehr. »Wer so … tierisch gleichgültig ist, der kann auch nicht …«
»Hören Sie, gnädige Frau, das geht zu weit. Ich habe zwar ein solides Fell und kann eine Menge Spaß vertragen, doch beleidigen lasse ich mich nicht gerne!«
Frau Silbermann stand auf. »Sie entschuldigen mich«, verabschiedete sie sich frostig von Findler. Dann verließ sie das Zimmer.
»Gott, seid ihr feinfühlig«, lachte Findler, »mein Gott! Na, so ehrliche Kerle, wie ich einer bin, müssen sich viel gefallen lassen. Zurück zum Geschäft! Wie geht’s, wie steht’s? Na?«
Wieder klingelte das Telefon.
»Zwanzigtausend«, verlangte Silbermann, »den Rest an zweiter Stelle eingetragen.«
Die Tür öffnete sich, und Frau Silbermann bat ihren Mann ins Nebenzimmer, allem Anschein nach sehr aufgeregt. Der war von der neuerlichen Störung wenig erbaut. »Überlegen Sie es sich«, sagte er beim Verlassen des Raumes noch zu Findler.
»Was ist denn, Elfriede?«, fragte er seine Frau.
Sie wies auf das Telefon. »Deine Schwester ist am Apparat. Sprich du mit ihr. Sie wird dir alles erzählen …«
Er griff nach dem Hörer.
»Hilde?«
»Ja, ja?«, stammelte seine Schwester aufgeregt. »Günther ist verhaftet worden!«
Vor Überraschung wusste er nicht sogleich, was er sagen sollte. »Wieso denn?«, fragte er endlich. »Was war denn?«
»Es werden doch alle Juden verhaftet.«
Er zog einen Stuhl heran und setzte sich.
»Beruhige dich bitte, Hilde«, sagte er. »Das muss ein Irrtum sein. Erzähl’ mir alles noch einmal ganz in Ruhe …«
»Dafür ist keine Zeit. Ich habe dich nur angerufen, um dich zu warnen. In unserem Haus sind vier Männer verhaftet worden. Ach, wenn ich nur wüsste, was mit Günther geschieht.«
»Aber das kann doch nicht sein! Man holt doch keine unbescholtenen Menschen aus ihren Wohnungen heraus! Das kann man doch nicht!«
Er schwieg. Doch, kann man, dachte er dann, man kann.
»Soll ich zu dir kommen?«, fragte er nach einer Weile. »Oder willst du zu uns kommen?«
»Nein, ich verlasse die Wohnung nicht, ich bleibe hier. Und du solltest auch nicht kommen, es nützt nichts. Auf Wiedersehen, Otto.« Sie hängte ein.
Verstört sah sich Silbermann nach seiner Frau um.
»Du«, flüsterte er, »man verhaftet alle Juden! Vielleicht handelt es sich auch nur um eine vorübergehende Schreckmaßnahme. Der Günther ist jedenfalls verhaftet worden, aber das weißt du ja schon.«
Silbermann hielt kurz inne.
»Was sollen wir tun? Was hältst du für das Richtige, Elfriede? Soll ich hierbleiben? Vielleicht vergisst man mich ja. Ich bin noch niemals ernsthaft belästigt worden. Wenn nur der Becker da wäre. Der hat Parteibeziehungen kreuz und quer. Der könnte notfalls intervenieren. Wenn die Verhaftungen freilich von oben ausgehen, dann kann er auch nichts machen. Und bis er aus Hamburg zurückgekommen ist, kann man schon versehentlich totgeschlagen worden sein. Ach, Unsinn! Es wird mir schon nichts passieren. Im schlimmsten Fall rufst du einfach den Becker an und bittest ihn, er möchte sofort zurückkommen.«
»Vor einem halben Jahr hätten wir Deutschland noch verlassen können«, sagte seine Frau langsam. »Meinetwegen sind wir geblieben, weil ich mich nicht trennen konnte. Wenn dir jetzt etwas passiert, trage ich die Schuld. Du wolltest reisen, aber ich …«
»Ach was«, wehrte er ihre Selbstanklagen ab. »Niemand trägt Schuld. Hat der Mensch, der rechtzeitig eine kugelsichere Weste anzulegen vergaß, etwa Schuld, wenn er erschossen wird? Das ist doch alles Unsinn. Außerdem warst du mehr für die Abreise als ich. Wenn es nach dir gegangen wäre, wären wir schon weg. Du hättest dich leichter von deiner Familie getrennt als ich mich von meinen Geschäften. Aber es ging eben nicht. Das Warum und Wieso ist jetzt auch ganz gleichgültig.«
Er gab ihr einen Kuss, dann ging er zurück zu Herrn Findler. Er versuchte, so beherrscht und ruhig zu erscheinen wie zuvor, aber etwas an seinem Gesichtsausdruck, eine allzu große Spannung, ein krampfig wirkendes Lächeln, machte den anderen stutzig.
»Na, was gibt’s Neues?«, erkundigte sich Findler. »Schlechte Nachrichten?«
»Familienangelegenheiten«, antwortete Silbermann und setzte sich wieder zu ihm.
»So, so«, sagte Findler gedehnt, und seine Stirn legte sich noch mehr in Falten als gewöhnlich. »Na, sicher schlechte Nachrichten, was? Familiennachrichten sind immer schlecht. Ich kenne das.«
Silbermann öffnete die auf dem Tisch stehende Zigarettenschachtel. »Wollen wir wieder zum Geschäft kommen?«, fragte er so ruhig, wie es ihm möglich war.
»Nun ja«, entgegnete Findler, »es lockt mich eigentlich doch wenig. Ich weiß gar nicht, ob man überhaupt noch von Juden Grundbesitz erwerben darf. Keine Ahnung. Sie legen mich herein, bevor ich bis drei gezählt habe, wenn es nach Ihnen geht. Na?«
Dieses ewige, von Selbstzufriedenheit und fettem Frieden zeugende »Na« brachte Silbermann allmählich zur Verzweiflung.
»Wollen Sie das Haus kaufen, oder wollen Sie vom Hauskauf reden? Was wollen Sie?«
»Ach«, machte Findler jetzt und streckte sich in seinem Sessel. »Ich habe mir vorhin doch glatt die Hüfte verstaucht. Was sagen Sie dazu? Ja … Wollen wir nicht lieber abwarten, was für neue Verordnungen kommen? Mir ist das so zu riskant. Ich kauf ein Haus, und nachher bekomme ich es nicht. Mit euch Juden hat der Staat ja noch allerhand im Sinn.«
»Also fünfzehntausend!«
»Ich weiß nicht, Silbermann, ich habe tatsächlich keine Ahnung, ob ich das machen soll oder nicht. Wenn Sie wollen, warten wir erst einmal ein paar Wochen. Wenn nichts dazwischenkommt, kann ich das Haus dann ja immer noch kaufen. Ich muss auch unbedingt vorher mit meinem Advokaten sprechen.«
»Aber vor zehn Minuten …«
»Na, mir sind inzwischen Bedenken gekommen. Ich möchte auch nicht, dass Sie Unannehmlichkeiten haben, weil Sie Ihr Haus verkaufen. Vor allem aber möchte ich keine haben.«
»Um zum Ende zu kommen: Ich lasse Ihnen das Haus mit vierzehntausend Mark Anzahlung. Aber Sie müssen sich jetzt einverstanden erklären.«
»So? Ja … Lassen Sie uns morgen noch einmal darüber reden. Vierzehntausend Mark sind eine Stange Geld, das ist mal sicher! Ich bin kein Unmensch, ich will auch nichts geschenkt haben. Aber es stellt sich doch die Frage: Ist mir das Haus überhaupt vierzehntausend Mark Anzahlung wert? Abgesehen davon würde die Zahlung natürlich erst nach dem Notariatsakt und der grundbuchamtlichen Übertragung erfolgen. Und im Falle höherer Gewalt wäre der Abschluss selbstverständlich nichtig. Vierzehntausend Mark … Halten Sie es für ein gutes Geschäft für mich, wenn ich heute Abend hier auf shake hands mit Ihnen abschließe?«
»Sie wollten doch fünfzehntausend Mark anzahlen und jetzt überlegen Sie bei vierzehntausend?«
»Ich denke gerade, man könnte mit dem Geld auch andere Geschäfte machen, vielleicht bessere Geschäfte. Man muss schon immer selber sehen, wo man bleibt im Leben. Na?« Er seufzte behaglich.
Silbermann sprang auf.
»Auf Ihren Entschluss habe ich natürlich keinen Einfluss«, sagte er sehr ungehalten. »Aber da ich jetzt keine Zeit mehr habe, wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie ihn gleich fassen würden. Andernfalls betrachten Sie mein Angebot bitte als gegenstandslos. Ich weiß ja gar nicht, ob Sie überhaupt ein seriöses Kaufinteresse haben.«
»Seien Sie doch nicht so ungemütlich«, erwiderte Findler verdrossen. »Ich habe es schon immer gewusst: Ihr Juden taugt nicht einmal zum Handel, wenn ihr es mit den richtigen Leuten zu tun bekommt, na …«
Silbermann sah, wie sehr Findler seinen Wucherstolz genoss. Er hatte eine recht scharfe Entgegnung auf den Lippen, etwa des Inhalts, dass er, Silbermann, allerdings mit Erpressern nicht konkurrieren könne, auch gar nicht wolle, und dass er seine Geschäfte in anständiger Form abzuwickeln gewöhnt sei. Aber in mancherlei Lagen sei schließlich auch der phantasieloseste Gauner dem intelligentesten und anständigsten Menschen weit überlegen.
Doch er kam weder dazu, Findler die Grobheiten, die aus ihm hinausdrängten, an den Kopf zu werfen, noch, was wohl vernünftiger gewesen wäre, ihm in gemilderter Form zu antworten, denn nun schellte es plötzlich heftig an der Tür. Ohne das verwunderte Gesicht des Besuchers zu beachten oder auch nur ein Wort der Entschuldigung an ihn zu richten, hastete Silbermann aus dem Zimmer. Im Korridor begegnete er seiner Frau.
»Du musst fort«, flüsterte sie aufgeregt.
»Nein, nein, ich kann dich doch nicht allein lassen!«
Da er nicht wusste, was er unternehmen sollte, ging er in Richtung der Wohnungstür. Sie hielt ihn auf.
»Mir kann nichts passieren, wenn du fort bist«, versicherte sie, sich ihm in den Weg stellend. »Schlaf heute Nacht im Hotel. Mach nur rasch … geh …«
Er überlegte. Da klingelte es wieder, und Fäuste schlugen gegen die Tür.
»Aufmachen, Jude, aufmachen …«, brüllten mehrere Stimmen durcheinander. Silbermanns Unterkiefer klappte hinunter. Er blickte starr auf die Tür.
»Ich hol’ mir jetzt den Revolver«, sagte er fast unhörbar. »Den Ersten, der in meine Wohnung einbricht, den schieß ich über den Haufen! Niemand hat das Recht, hier einzudringen.«
Er wollte an seiner Frau vorbei, dem Schlafzimmer zu.
»Das wollen wir doch einmal sehen«, sagte er, »das wollen wir sehen …«
Wieder hämmerten Fäuste gegen die Tür, und die Klingel schrillte.
»Na?«, fragte Findler, der auf den Korridor getreten war, als er die Geräusche gehört hatte. »Was ist denn los? Das ist ja wirklich toll. Wenn die Brüder mich hier erwischen, halten sie mich in der ersten Begeisterung vielleicht auch für einen Juden und hauen mir die Zähne ein.«
Er strich mit der Hand zart über seinen Mund.
»Haben Sie keine Hintertür?«, fragte er dann Silbermann, der stehen geblieben war und ihn ansah, als erwarte er von ihm Rat und Hilfe. »Und Ihr verdammtes Haus können Sie einem anderen andrehen, Donnerwetter!«, setzte er noch hinzu.
»Ich hole meinen Revolver«, wiederholte Silbermann mechanisch, »und den Ersten, der in meine Wohnung einbricht, den schieß ich über den Haufen!«
»Na, na«, sagte Theo Findler beruhigend, »immer sachte. Gehen Sie man lieber. Ich werde mit den Leuten sprechen. Sehen Sie zu, dass Sie zur Hintertür hinauskommen. – Das Haus nehme ich für zehntausend. Einverstanden?«
»Sie sind … Schon gut, jawohl, ich bin einverstanden.«
»Also dann, machen Sie man zu! Ich brauche Sie noch lebendig für den Notar.«
»Geh schon!«, flehte seine Frau.
Es klingelte immer noch, und Silbermann wunderte sich, warum niemand die Tür eintrat.
»Und was wird aus meiner Frau?«, fragte er hilflos.
»Verlassen Sie sich nur auf mich«, sagte Findler mit breiter Brust. »Ich sorge für alles! Aber machen Sie jetzt, dass Sie wegkommen!«
»Wenn meiner Frau etwas passiert … bekommen Sie das Haus nicht!«
»Ja, ja, ja«, beschwichtigte ihn Findler, »aber wenn Sie jetzt nicht verschwinden, dann bringen Sie Ihre Frau und auch mich in Gefahr!«
Er zog sein Jackett glatt, strich sich mit der rechten Hand über die borstigen Haare, atmete tief ein und ging zur Tür.
»Na?«, fragte er dröhnend. »Was gibt’s denn?«
»Aufmachen, Jude!«
»Habt Ihr schon mal einen Amtswalter gesehen, der Jude ist?«, fragte Findler knorrig.
»Halts Maul, du Drecksau, mach auf!«
Findler drehte sich um, vergewisserte sich, dass Silbermann bereits mit Hut und Mantel den Korridor verlassen hatte, gab Frau Silbermann ein Zeichen, sich in einem der Zimmer zu verbergen, und brüllte dann: »Ich bin Parteimitglied!« Er riss die Tür auf. »Hier ist kein Jude!«, verkündete er.
Vor ihm standen sechs oder sieben junge Burschen. Einen Augenblick schüchterte sie seine machtvolle Erscheinung ein. Er fasste in die Brusttasche, um ihr sein Parteibuch zu entnehmen.
»Die Juden schwindeln alle«, sagte einer der vor ihm Stehenden. »Silbermann und Parteigenosse, jüdische Frechheit!«
»Ich bin ja nicht Silber…« Theo Findler sackte zusammen und fiel zu Boden. Einer der Burschen hatte ihm einen Tritt in den Unterleib versetzt.
2. Kapitel
Silbermann hastete die Hintertreppe hinunter. Unten werden sie wohl stehen und mir auflauern, dachte er. Ach, ich hätte doch bleiben sollen. Was wird nun mit Elfriede geschehen? Schon überlegte er, ob er nicht umkehren solle. Aber Findler ist ja da, beruhigte er sich dann. Wie gut das doch ist. Ein anständiger Kerl, trotz allem. Wäre ich oben geblieben, hätte ich ganz bestimmt etwas Verzweifeltes unternommen. Widerstand geleistet, vielleicht sogar wirklich geschossen, einfach weil man etwas tun muss. Man kann doch nicht alles mit sich geschehen lassen. Genützt hätte es nichts, nein, im Gegenteil. Das war pure Angst. Aus Angst hätte er geschossen, das wusste er jetzt. Er hatte Angst vor dem Konzentrationslager, dem Gefängnis – und vor dem Geprügeltwerden.
Menschenwürde, dachte er, man hat doch Menschenwürde, die darf man sich nicht nehmen lassen.
Sein Schritt stockte, denn unten sah er einen Mann stehen. Silbermann richtete sich auf und ging dann gemessenen Schritts dem Mann entgegen, der am Fuß der Treppe stand und eine Zigarette rauchte. Ruhig ertrug er den Blick des anderen. Als er bei ihm angekommen war, bat er um Feuer.
Der Mann griff in die Tasche, entnahm ihr ein Paket Streichhölzer, zündete eines der Hölzchen an und hielt es ihm hin.
»Bitte«, sagte er, dann erkundigte er sich: »Wohnen hier eigentlich viele Juden?«
»Keine Ahnung«, antwortete Silbermann, und es verwunderte ihn, wie gleichgültig er dabei klang. »Fragen Sie doch den Portier. Ich bin hier fremd.« Er hob den Arm zum Gruß: »Heil Hitler.«
Der andere erwiderte, und ohne aufgehalten zu werden schritt Silbermann an ihm vorbei. Jetzt nicht umdrehen, dachte er. Nicht zu schnell gehen, nicht zu langsam. Denn wer sich zu auffällig unauffällig benimmt, zu verdächtig unverdächtig, der … Ach Gott, was wollen die Leute eigentlich von mir?
Er hatte den Flur schon verlassen und überquerte den Hof. Im Gehen fasste er einmal nach seiner Nase. Wie wichtig du bist, dachte er. Von dir hängt es nun ab, ob man frei ist oder Gefangener, wie man lebt, ob man lebt. Wer Unglück mit dir hatte, den bringst du unter Umständen um.
Vor der Haustür traf er auf einen weiteren ihm verdächtig erscheinenden Mann. »Na«, sagte er forsch, unwillkürlich Theo Findler nachahmend, »worauf warten Sie denn, heh?«
Der Angesprochene fuhr zusammen und nahm unwillkürlich das an, was die Haltlosen Haltung nennen.
»Och«, sagte er dann vertraulich-respektvoll, »kleine Judenhatz.«
»Aha«, nahm Silbermann scheinbar teilnahmslos zur Kenntnis, dann ging er, die Hand lässig zum Gruß erhoben, auch an diesem Posten ohne aufgehalten zu werden vorbei. Auf der Straße angelangt, blieb er abwartend stehen. Was geschieht da oben?, überlegte er angstvoll. Wenn man das nur wüsste. Sie werden doch wohl nicht … Doch sie werden. Aber Findler ist ja da.
Plötzlich überkam ihn große Furcht. Die Leute konnten jeden Augenblick kommen, das Haus verlassen, ihn anhalten, einer der Wachtposten konnte nachträglich misstrauisch geworden sein. Er setzte sich wieder in Bewegung und ging immer schneller.
Eigenartig, dachte er, während er über den Fahrdamm lief, weil er glaubte, auf der anderen Straßenseite sicherer zu sein. Vor zehn Minuten ging es noch um mein Haus, einen Teil meines Vermögens. Jetzt geht es schon um meine Knochen. Wie schnell das geht. Mir ist der Krieg erklärt worden, mir persönlich. Das ist es. Eben ist mir nun endgültig und wirklich der Krieg erklärt worden, und jetzt bin ich allein – in Feindesland.
Wenn wenigstens der Becker hier wäre. Hoffentlich zerschlägt sich das Geschäft nicht. Das fehlte mir noch. Ich muss unbedingt das Geld frei haben. Hoffentlich verspielt es Becker nicht. Ach was, der ist schließlich immer noch der Einzige, auf den man sich verlassen kann. Und wenn er wirklich ein paar hundert Mark verspielt, was macht das schon? Jetzt geht es um Wichtigeres.
Aber Geld muss man haben, Geld ist Leben, besonders im Krieg. Ein Jude ohne Geld in Deutschland, das ist wie ein Tier im Käfig ohne Futter, etwas Hoffnungsloses.
Er kam an einer Telefonzelle vorbei, drehte dann um und ging zurück. Ich werde jetzt einfach anrufen, dachte er, dann weiß ich Bescheid.
Er war sehr froh über seinen Einfall, doch die Zelle war besetzt, und er musste einige Zeit warten. Die laute Stimme der Dame drang aus der Zelle zu ihm nach draußen, und er erfuhr von einem Pelzmantel, der repariert werden musste, von dem Film »Liebe im Süden« und von einem gewissen Hans, der eine Halsentzündung hatte.
Unruhig ging Silbermann auf und ab. Endlich klopfte er mahnend gegen die Glasscheibe. Die Dame wandte ihm ihr Gesicht zu, und es beeindruckte ihn immerhin stark genug, um ihr weitere fünf Minuten Sprechzeit zu gewähren, bevor er sich entschloss, abermals gegen die Scheibe zu klopfen.
Nun endlich stand ihm der Apparat zur Verfügung und er wählte hastig die Nummer seiner Wohnung. Es meldete sich niemand, und er versuchte noch zweimal, die Verbindung herzustellen, ohne aber Erfolg zu haben.
Findler wird noch verhandeln, beruhigte er sich und hängte ein. Diese Burschen sind schwer loszuwerden. Überhaupt war es eine Dummheit anzurufen, denn solange die Leute da sind, kann mir ja doch niemand etwas sagen. Er wählte die Nummer seines Rechtsanwalts.
Eine tränenerstickte weibliche Stimme meldete sich. »Die Herrschaften sind nicht da.«
»Wo ist der Doktor denn?«
»Ich weiß es nicht.« Kurzes Schweigen. »Er ist nicht da …«
»Ja, und wer sind Sie?«
»Ich bin das Dienstmädchen.«
»Dann bestellen Sie doch bitte Herrn Dr. Löwenstein, dass …«
»Rufen Sie lieber noch einmal an«, unterbrach ihn das Mädchen. »Es ist ganz unbestimmt, wann er wiederkommt.«
Silbermann hängte ein.
»Wenn sie den nicht auch abgeholt haben«, murmelte er, »dann weiß ich nicht.«
Er wählte die Nummer eines befreundeten jüdischen Kaufmanns, doch auch da meldete sich niemand.
Silbermanns Bestürzung wurde immer größer. Die Hilde hat recht gehabt, folgerte er, alle Juden sind verhaftet worden, vielleicht bin ich der Einzige, der ihnen entwischt ist.
Er rief bei seiner Schwester an.
»Hier ist Otto«, sagte er. »Ich spreche von einem Automaten aus. Bei mir …«
»Ich will nichts hören, Otto«, wehrte sie ab. »Unsere ganze Wohnung ist ein einziger Trümmerhaufen. Wenn ich nur dagewesen wäre. Meinetwegen hätten sie mich auch mitnehmen können. Jetzt sitz ich hier und denke, was ist aus Günther geworden? Einem sechsundfünfzigjährigen Mann, einem Sechsundfünfzigjährigen. Und er verträgt doch überhaupt keine Aufregungen. Das ist das Ende …«
»Aber man wird ihn doch wieder freilassen«, versuchte er, sie zu beruhigen. »Kann ich dir irgendwie helfen? Zu dir kommen möchte ich allerdings nicht gerne.« Es knackte in der Leitung. »Auf Wiedersehen«, rief er erschreckt. »Lass es dir recht, recht gutgehen. Du hörst von mir.«