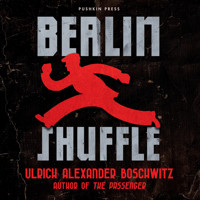9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Eine wahnsinnig packende Wiederentdeckung.« Hildegard Elisabeth Keller, SRF Nach der spektakulären literarischen Wiederentdeckung von »Der Reisende« erscheint nun auch der erste Roman von Ulrich Alexander Boschwitz zum ersten Mal auf Deutsch. Im Berlin der Zwanzigerjahre porträtiert »Menschen neben dem Leben« jene kleinen Leute, die nach Krieg und Weltwirtschaftskrise rein gar nichts mehr zu lachen haben und dennoch nicht aufhören, das Leben zu feiern. Leicht haben es die Protagonisten in Ulrich Alexander Boschwitz' Debütroman nicht. Sie sind die wahren Verlierer der Wirtschaftskrise: Kriegsheimkehrer, Bettler, Prostituierte, Verrückte. Doch abends zieht es sie alle in den Fröhlichen Waidmann. Die einen zum Trinken, die anderen zu Musik und Tanz. Sie treibt die Sehnsucht nach ein paar sorglosen Stunden, bevor sich der graue Alltag am nächsten Morgen wieder erhebt. Doch dann tanzt die Frau des blinden Sonnenbergs mit einem Mal mit Grissmann, der sich im Waidmann eine Frau angeln will und den Jähzorn des gehörnten Ehemanns unterschätzt. Und so nimmt das Verhängnis im Fröhlichen Waidmann seinen Lauf, bis sich neue Liebschaften gefunden haben, genügend Bier und Pfefferminzschnaps ausgeschenkt wurde und der nächste Morgen graut. Wie durch ein Brennglas seziert der zu diesem Zeitpunkt gerade mal zweiundzwanzigjährige Autor das Berliner Lumpenproletariat der Zwischenkriegsjahre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 323
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Ulrich Alexander Boschwitz
Menschen neben dem Leben
Roman
Herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Peter Graf
Klett-Cotta
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
© 2019, 2022 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Cover: ANZINGER UND RASP Kommunikation GmbH, München
unter Verwendung eines Fotos von © ullstein bild – Süddeutsche Zeitung Photo / Scherl
Datenkonvertierung: Dörlemann Satz, Lemförde
Printausgabe: ISBN 978-3-608-98473-6
E-Book: ISBN 978-3-608-19200-1
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
1. Kapitel
Walter Schreiber war ein gutmütiger Mensch. Sein ganzes Wesen strömte Jovialität und Verständnis aus. Er lebte, und er nahm dieses Recht nicht nur für sich alleine in Anspruch. Er gönnte auch anderen ihre Existenz, soweit sie nicht mit Gemüse handelten.
Sein Geschäft ging gut. Dabei lag Schreibers Gemüsekeller in einer ausgesprochenen Armeleutegegend. Die Mietskasernen der Umgebung waren vollgestopft mit Menschen, die sehr wenig verdienten, denn die Zeiten waren schlecht. Viele waren auf staatliche Unterstützung angewiesen und stempelten, wieder andere bekamen weder Unterstützung noch fanden sie Arbeit. Aber trotzdem brachten sie es fertig, genügend Geld aufzutreiben, um bei Walter Schreiber Kartoffeln und billiges Gemüse kaufen zu können. Auch in den schlechtesten Zeiten hat man sich noch nicht abgewöhnen können zu essen.
Walter Schreiber zerbrach sich nicht den Kopf darüber, wie sie es machten. Er stand, freundlich über sein breites, wohlwollendes Gesicht lächelnd, unten in seinem Keller und verkaufte. Seine Preise waren nicht höher als bei anderen, und Kredite gewährte er, das gebot ihm sein Sinn für Gerechtigkeit, grundsätzlich nicht.
»Was dem einen recht ist, ist dem anderen billig«, pflegte er zu sagen. »Da es unmöglich ist, zweihundert Menschen zu pumpen, pumpe ich gar keinem. Denn was der eine bekommt, kann ich dem anderen nicht abschlagen, und schlecht geht es allen, auch mir.«
Aber manchmal verschenkte er Dinge. Vor allem dann, wenn sie nicht mehr zu verkaufen waren. Bis in sein Quartier war bereits der Grundsatz der Qualität gedrungen, und obwohl die Menschen nicht allzu wählerisch waren, lehnten sie es doch ab, noch im Herbst die reichlich angekeimten Kartoffeln des Vorjahres zu kaufen. Wenn selbst der niedrigste Preis niemanden mehr zum Kauf verlockte, vermochte er sich auch so von der Ware zu trennen und verschenkte sie.
Schreibers Gemüsekeller, zu dem von der Straße eine Treppe herunterführte, war sehr geräumig und für seine Zwecke beinahe zu groß. Den Hauptraum hatte er, soweit es ihm möglich gewesen war, geschäftsmäßig ausgestattet. Er war gut beleuchtet, und die nackten Mauerwände hatte er mit Tapetenpapier beklebt. Gemüse, Obst und Kartoffelkiepen waren auf das Beste geordnet.
Vor ihm hatte ein Kohlenhändler beide Räume genutzt, doch der kleine Nebenkeller, der durch eine Tür und einige Treppenstufen mit dem Hauptraum verbunden war, stand bei Schreiber leer, auch weil er noch einen Meter tiefer lag und so feucht war, dass er für das Gemüsegeschäft absolut ungeeignet war. Er bewahrte hier nur alte Gemüsekörbe und Backobstkisten auf.
Jedes Mal, wenn er ihn betreten musste, empfand er ihn als regelrechtes Ärgernis. Nur ein kleiner Fensterschacht führte hinauf zur Straße und ließ durch das trübe gesprungene Glas ein hässliches Licht ein. Die Luft war so muffig und ungesund, dass er immer husten musste, wenn er, um einen Gegenstand zu holen, hineinging. Am liebsten hätte er den Raum, den ihm der Hauswirt quasi umsonst dazugegeben hatte, mit einer dicken Mauer von seinem Geschäft getrennt. Denn jeden Morgen dauerte es eine gewisse Zeit, bis die stickige Luft, die von dort über Nacht in den Hauptkeller eingedrungen war, auslüftete.
Schreiber stand vor seinem kleinen Pult, auf das er sehr stolz war, da es dem ganzen Geschäft eine ernste, kaufmännische Note gab, und rechnete zusammen. Es war zwei Uhr. Für eine kurze Zeitspanne war nichts zu tun, das Geschäft ruhte. Da hörte er jemanden die Treppe heruntersteigen. Er verließ das Pult und ging, sich geschäftig die Hände reibend, auf den mutmaßlichen Kunden zu.
Ein alter Mann betrat den Keller, und Schreiber betrachtete ihn erstaunt. Er war bei seinen Kunden keine große Eleganz gewohnt, aber dieser Mann war nicht bekleidet, sondern behangen. Um seine Schultern schlotterte ein viel zu weites Jackett. Die ehemals wohl amerikanisch geschnittene Sporthose, jetzt eine farblose Menge Stoff, war viel zu breit und verhüllte sackartig seine Beine. Der ehemalige Besitzer musste ein gut beleibter, großer Mann gewesen sein. Denn anders ließ sich die Differenz zwischen Träger und Getragenem nicht erklären. Dieser hier war klein, und wenn er ging, so hatte es den Anschein, als würde er einen Rock statt Hosen tragen. Der Schritt reichte ihm bis zu den Knien und die offensichtlich zu langen Hosenbeine waren so abgeschnitten worden, dass sich zahllose Fransen gebildet hatten. Dazu trug er einen Hut, der ihm recht gut passte und das Lächerliche und Vogelscheuchenartige seiner übrigen Erscheinung nur noch mehr hervorhob. Sein Gesicht war gelb und knochig. Mit matten Augen sah er sich in dem Raum um.
Schreiber war gespannt, wonach der Mann verlangen würde. Das Höchste der Gefühle sind ein paar Pfund Kartoffeln oder Mohrrüben, dachte er.
Der Alte ging auf ihn zu. »Guten Tag«, grüßte er. Seine Stimme klang undeutlich und außerordentlich gleichgültig. »Ich habe gehört, Sie haben hier einen Kellerraum frei. Ich möchte ihn vielleicht nehmen.«
Schreiber antwortete zunächst nicht. Er sah den Mann noch einmal eingehend an. Ein eigenartiger Kerl war das. Noch dazu fremd in der Gegend. Schreiber kannte die Leute aus der Nachbarschaft. Diesen Menschen hatte er nie zuvor gesehen.
»Von wem haben Sie das denn?«, fragte er wissbegierig.
»Weiß nicht mehr. Irgendeiner sagte es im Asyl, glaube ich. – Stimmt es denn nicht?« Erwartungsvoll sah ihn der Mann an.
Schreiber nickte bestätigend. »Doch, doch. Stimmt schon. Aber in den Raum werden Sie nicht einziehen können. Es ist ein schöner Geschäftskeller, aber wohnen kann man wohl nicht darin.«
»So, so«, der Mann trat noch einen Schritt näher. Schreiber bemerkte einen starken Fuselgeruch. »Na, ich will ihn mir mal ansehen. Wohnen will ich dort gar nicht. Nur schlafen. Er muss aber ganz billig sein.«
Schreiber dachte nach. Gott, wenn man noch ein paar Pfennige herausschlagen konnte. Warum nicht? Hoffentlich war der Mann ehrlich und brach nicht in seine Vorräte ein. Aber das würde sich schon verhindern lassen.
Zu seinem letzten Gedanken nickte er energisch mit dem Kopf. Dann sagte er: »Kommen Sie. Ich zeig ihn Ihnen.« Er ging auf den Nebenkeller zu, und der Alte – Schreiber schätzte ihn auf fünfundsechzig bis siebzig – trottete hinter ihm her.
Schreiber machte vor der schmutzigen, großen und mit Bandeisen zusammengehaltenen Türe halt, suchte in seinen Taschen nach dem Schlüssel und sagte, während er ihn zweimal im Schloss drehte, vorbereitend: »Es ist ein bisschen schlechte Luft drinnen.«
Der Alte reagierte nicht darauf. Jetzt, um die Mittagszeit, war der Keller von einem fahlen Licht erhellt. Beide stiegen die Stufen herunter, und ihnen schlug die modrig feuchte Luft entgegen. In einer Ecke lagen, zu einem Haufen zusammengeschichtet, Kiepen und Körbe.
Der Mann ging prüfend durch den Keller. Er schritt die Wände entlang, tastete sie ab, zwängte sich an den Körben vorbei und besichtigte alles mit großer Gründlichkeit. Schreiber wurde ungeduldig. Er stieg die Treppe halb wieder herauf, um in sein Geschäft zu spähen, aber es waren keine Kunden zu sehen.
»Na, wie gefällt er Ihnen?«, fragte er.
Der Mann hielt ihm statt einer Antwort die vom Berühren der Wände feucht gewordenen Hände hin.
»Ja, ja«, gab Schreiber bedauernd zu. »Ein wenig klamm ist er schon.«
»Was soll er denn kosten?«
Schreiber runzelte grüblerisch die Stirn. Endlich sagte er großzügig lächelnd und mit herablassendem Ton: »Ich will Ihnen den Keller für eine Mark fünfzig pro Woche lassen, das ist geschenkt billig.«
Der Alte erklärte sich einverstanden. Er kramte aus seiner Hose eine Handvoll kleiner und kleinster Geldmünzen und zählte sie auf.
Während Schreiber gewissenhaft nachrechnete, fragte er den Alten: »Wann kommen Sie?« Dieser nahm seinen Hut ab, senkte, wie zum Gruß, seinen glattpolierten Schädel und antwortete: »Ich heiße Fundholz. Emil Fundholz. Ich werde heute Abend kommen, zusammen mit Tönnchen und vielleicht auch Grissmann.«
Als er hörte, dass den Mann noch zwei andere begleiten sollten, machte Schreiber ein erstauntes Gesicht.
»Wenn Sie hier zu drei Personen wohnen wollen, ist es aber teurer als eine Mark und fünfzig.«
Er hatte noch nie irgendwelche Wohngelegenheiten vermietet. Aber wie somnambul ahnte er, was Vermieter in solchen Fällen zu sagen pflegten.
Der Alte schüttelte energisch den Kopf. »Nur ich und Tönnchen werden hier wohnen. Der Grissmann ist nur Besuch«, erklärte er.
Schreiber nahm das zur Kenntnis und notierte die Namen. »Aha, Grissmann ist nur Besuch. Aber für Tönnchen, oder wie der Mann heißt, muss eine Mark extra bezahlt werden.«
Der Alte hielt ihm seine geöffnete Hand hin. »Na dann geben Sie mir mein Geld wieder«, sagte er gleichmütig.
Schreiber hörte, wie ein Kunde sein Geschäft betrat. »Ich habe keine Zeit mehr«, sagte er vielbeschäftigt. »Aber ich will mal nicht so sein. Lassen wir es also dabei. Aber mehr als zwei dürfen hier nicht schlafen, sonst kostet es auf jeden Fall mehr. Wir wollen es so machen: Sie kommen abends immer um sieben Uhr, und dann schließe ich Sie in den Keller ein. Morgens komme ich um halb sechs aus der Markthalle und lasse Sie wieder raus.«
Diese Lösung war ihm soeben eingefallen, und er fand sie ausgezeichnet. So konnte er vermieten, ohne Angst haben zu müssen, dass man ihm abends den Keller leer stahl.
Fundholz folgte ihm undeutlich protestierend, aber Walter Schreiber bediente bereits überaus heiter eine Arbeiterfrau, die nach Kartoffeln, Mohrrüben und Suppenwürfeln verlangte. Fundholz stand abwartend dabei.
Die Frau musterte ihn erstaunt. »Schönes Wetter heute«, sagte sie.
Fundholz antwortete nicht und sah abwesend an ihr vorbei.
Walter Schreiber sprang ein und bestätigte. »Sehr schön sogar!« Er lachte der Frau zu und zwinkerte listig.
Fundholz schien das nicht zu bemerken und zog ein riesiges blau und grün gestreiftes Baumwolltuch aus seiner Hosentasche und schnaubte kräftig hinein. Die Frau bezahlte lachend und ging, während Walter Schreiber mit ärgerlich gerunzelter Stirn zu Fundholz sah. Was wollte der Mann noch? Dieser wandelnde Lumpensack vergrämte ihm am Ende noch die Kundschaft.
»Ja, das mit dem Einschließen um sieben Uhr, das geht nicht!« Fundholz sprach fester und entschlossener als vorhin. »Um elf Uhr können Sie uns einschließen, aber nicht um sieben!«
Schreiber sah ein, dass man erwachsene Männer nicht um sieben Uhr schlafen legen konnte und willigte ein: »Schön. Ich werde jeden Abend um zehn Uhr hier sein und euch reinlassen. Aber wenn ihr nicht pünktlich seid, könnt ihr im Tiergarten schlafen. Ich muss morgens früh raus und kann nicht noch den Portier für Nachtschwärmer spielen.«
Der Alte lachte meckernd. »Nachtschwärmer ist gut. Nachtschwärmer ist sehr gut.« Immer noch lachend, stieg er die Treppe des Kellers hinauf. Oben angekommen drehte er sich noch einmal um. »Also denn, um zehn Uhr heute Abend.«
Dann setzte er seinen Hut wieder auf und verschwand aus Schreibers Blickfeld.
2. Kapitel
Walter Schreiber wohnte nur wenige Häuser von seinem Gemüsekeller entfernt in einer Zweizimmerwohnung. Wenn es nicht gerade sehr kalt war oder regnete, stand er unten vor der Tür auf der Straße und rauchte. Er bekam leicht das Gefühl der Enge. Er hatte drei Kinder, das älteste war sieben Jahre alt, und sie lärmten furchtbar in der kleinen Wohnung.
Aber da er ein gutmütiger Mensch und zudem stolz darauf war, so lebendige Kinder zu haben, dachte er gar nicht daran, sie ernstlich daran zu hindern, sich auszutoben. Nur wenn er schlafen wollte, musste absolute Ruhe herrschen.
Seine Frau war schon seit längerer Zeit krank. Die Ärzte meinten Tuberkeln. Walter Schreiber gab nichts auf Ärzte und nichts auf Homöopathen. Er vertraute vielmehr seinem eigenen gesunden Menschenverstand und der von ihm ersonnenen Heilkunst. Und die besagte, dass seine Frau immer schwächlicher geworden war und sogar Blut zu husten begonnen hatte, weil sie nicht genug aß. Deshalb zwang er sie täglich, eine große Portion Fleisch zu vertilgen, denn Fleisch gab Kraft!
Einen Luxus, den er sich selbst nur selten leistete. Aber es war eigenartig. Sie wurde immer schwächer, fieberte stets, sobald sie gegessen hatte, und entwickelte eine wahre Abscheu vor Fleisch und Fett. Doch Walter Schreiber setzte immer wieder durch, dass sie das, was er für das beste Heilmittel hielt, auch tatsächlich zu sich nahm. Obwohl seine Frau wegen jedem Beefsteak einen Krach machte, als wollte er sie umbringen. Wo Fleisch doch so teuer war und er immer nur das Beste für sie besorgte.
Er verstand einfach nicht, wie seine Frau so töricht sein konnte und kein Fleisch essen mochte, während er selbst vorwiegend Gemüse, das er zum Einkaufspreis, also sehr billig, für seinen Privatbedarf rechnen konnte, verzehrte. Seine Frau wusste nicht, was für sie gut war. Ständig verlangte sie einen Arzt. Dabei bekam man für das, was ein Arzt kostete, zehn Beefsteaks, errechnete Schreiber nachdenklich, während er vor der Tür stand. Die Pfeife wollte heute nicht so recht schmecken. Aber das kam sicher auch daher, dass man sich ständig ärgern musste und zu unregelmäßig zog. – Die Menschen wissen alle gar nicht, was für sie gut ist, dachte er ungehalten.
Im Korridor stand, eng aneinandergedrückt, ein Liebespaar. Schreiber missbilligte das. In seiner Jugend war man besser erzogen gewesen. Außerdem kannte er das Mädchen. Es war Hilde Schultze aus dem vierten Stock. Früher hatte er das Mädchen ganz gut leiden mögen, doch sie war ihm gegenüber frech geworden, als er sie einmal aufmunternd in die Backen hatte kneifen wollen. Jetzt stand sie da mit einem Kerl. Da sah man, wohin das führte. Seine wohlwollende Zuneigung war abgewiesen worden, aber irgend so ein Lausejunge, der …
Aber es war ja schon zehn. Er musste den Strolchen aufschließen. Überhaupt. Was waren das für Kerle? Das musste man unbedingt feststellen. Eine Mark fünfzig war halb geschenkt. Wenn da tatsächlich jemand schlafen konnte, dann musste der Keller mehr wert sein als eine Mark fünfzig.
Er schlenderte zu seinem Geschäft. Schon von Weitem sah er drei Leute davor stehen. Einer war außerordentlich dick. Ein richtiges Bierfass von einem Mann. Das war wohl der Kerl, den der Alte vorhin Tönnchen genannt hatte. Schreiber trat an die Gruppe heran, und der Dicke lachte ihm entgegen. Er war nicht dick im eigentlichen Sinne, nicht einfach nur wohlbeleibt. Er war aufgetrieben, regelrecht aufgeschwemmt. Der Stoff der Jacke spannte sich über seinen fetten Armen, als seien es zwei Würste. Die Hände waren klein und schwabbelig.
Im Lichte der Straßenlaterne kam Schreiber das Lachen des Mannes direkt unheimlich vor. Er war ein nüchterner Mensch und glaubte weder an Gespenster noch an Erscheinungen, aber jetzt lief ihm ein kalter Schauer den Rücken herunter. Das bewegungslose Lachen schien sich in das Gesicht des Dicken eingeschnitten zu haben, die glanzlosen Augen versanken hinter Fettpolstern, und der ganze Kopf des Mannes glänzte speckig, was seinen Zügen zusätzlich etwas Ungefähres und Schwammiges verlieh.
Tönnchen hielt ihm die Hand entgegen. Walter Schreiber drückte sie, aber die feuchte, massige Hand glitt wie von selbst aus seinem Griff. Schreiber wischte sich die seinige an der Hose ab, während Tönnchen unaufhörlich weiterlächelte. Endlich kam Schreiber die Erleuchtung. Idiotisch war der Kerl. Nachdem er für das vorher nicht Fassbare eine Erklärung gefunden hatte, war er besserer Stimmung.
Der alte Fundholz lehnte an der Mauer und verfolgte uninteressiert das Geschehen. Weder hatte er Tönnchen vorgestellt, noch sonst irgendein Lebenszeichen von sich gegeben, doch Schreiber war beruhigt. Ein Idiot und noch dazu ein ungefährlicher, dann war ja alles in Ordnung. Jetzt wollte er sich den Grissmann mal näher ansehen. Der stand einige Meter von ihm entfernt und machte keinerlei Anstalten näher zu kommen.
Walter Schreiber öffnete den Keller. Bin doch gespannt, dachte er, ob der Kerl hier auch wohnen will. Er machte Licht. »Bitte«, forderte er die Männer auf, und Tönnchen ging grinsend voraus, während sich Fundholz an Grissman wandte: »Kommste mit?«
»Ich mag nicht«, antwortete Grissmann, und ohne sonst noch etwas zu sagen, ging er davon.
Komische Käuze, wunderte sich Walter Schreiber. Anscheinend alle drei übergeschnappt. Dieses Ich mag nicht hatte beinahe weinerlich geklungen, so als ob ein Kind nicht essen wollte oder sonstwie bockig war, dabei war der Grissmann doch ein ausgewachsener und stattlicher Bursche.
Fundholz folgte dem Dicken, und kurz darauf hörte Schreiber aus dem Keller zunächst ein Kichern, gefolgt von einem klatschenden Geräusch. Eilig stieg er den anderen nach. Tönnchen hatte aus einer Kiepe einen Apfel genommen und angebissen. Den hielt Fundholz nun Schreiber entgegen. »Er ist verrückt, aber harmlos verrückt«, sagte er ernst.
Schreiber sah den Apfel an. »Das ist ein Gravensteiner, das Pfund zu fünfundvierzig Pfennig. Fünfzehn Pfennig kostet der Apfel!«
Fundholz wühlte in seiner Tasche. »Hier«, er überreichte Schreiber das Geld und hielt mit der anderen Hand Tönnchens Arm zurück.
Schreiber dankte. Er war gewohnt, auch mit kleinen Beträgen zu rechnen. Und er wollte sich das Geschehene für die Zukunft merken und seine Lehre daraus ziehen. Von nun an würde er stets vor den Strolchen, wie er die beiden bei sich nur noch nannte, in den Keller gehen. Misstrauisch taxierte er sie. Aber sie schienen nichts eingesteckt zu haben. Jedenfalls hatte Schreiber den Eindruck, dass ihre Taschen nicht voller aussahen als zuvor. Er griff großmütig in die Backobstkiste und gab dem Dicken eine Handvoll Backpflaumen. Dann schloss er die Tür auf. »Vorsicht«, warnte er.
Fundholz stieg zuerst herunter. Tönnchen trottete, trotz der Ohrfeigen, die er wohl vorhin bekommen hatte, grinsend hinterher.
»Gib mir den Apfel wieder«, bat er mit heller Stimme, die gut zu seiner Gesamterscheinung passte, bevor er sich die Backpflaumen in den Mund schob.
Der Alte hielt ihm wortlos den Gravensteiner hin.
»Gute Nacht«, verabschiedete sich Schreiber höflich. Dann schloss er umständlich und vorsichtig den Nebenkeller ab. Die beiden hörten ihn noch im Gemüsekeller hin- und hergehen, an Körben rücken und endlich die obere Tür zuschlagen.
Fundholz steckte ein Streichholz an und sah sich um. Ein Lichtschimmer fiel auf Tönnchens grinsendes Gesicht, aber Fundholz ärgerte sich nicht über Tönnchens Dauergrinsen. Er war überhaupt längst über eine Regung wie Ärger hinaus, und auf dem besten Wege, vollkommen abgestumpft zu werden. Die Vergangenheit lag wie ein Traum hinter ihm, und die Zukunft war nebelhaft, ungewiss und ziemlich uninteressant.
Es hatte mal eine Zeit gegeben – sie lag so fern, dass er manchmal glaubte, sie sich einzubilden –, in welcher er Bettlern gegeben hatte. Einst hatte er Geld verdient, ein Heim und eine Frau gehabt. Seitdem waren Tausende von Tagen vergangen, an denen er gebettelt hatte, und Tausende von Nächten, in denen er in Asylen, auf Bänken oder in Kellern hatte schlafen müssen. Das Leben, das wirkliche, zivilisierte, menschliche Leben, lag seit mehr als zehn Jahren hinter ihm und so lange er leben würde, würde er weiter betteln müssen.
Tönnchen zog einige Kiepen aus dem Stapel und probierte, wie es sich darauf sitzen ließ. Sie knackten und gaben unter seinem Gewicht nach. Erschrocken sprang er auf.
Fundholz kümmerte sich nicht um ihn. Er zog seine Jacke aus und breitete das mitgebrachte Zeitungspapier, vorsichtig die Blätter neben- und übereinanderlegend, an einer der trockensten Stellen des Kellers aus, um sich ein Lager einzurichten, aber die Feuchtigkeit schlug sofort durch und das Papier wurde nass. Er ließ es liegen und nahm nun seinerseits Körbe und Kiepen herunter und schichtete sie mit dem Boden nach oben auf.
Drei oder vier ineinandergestülpte Körbe waren schon ganz haltbar, stellte er fest. Also drapierte er auf diese Weise ein Dutzend Kiepen, die auf der einen Seite von der Kellerwand und auf der anderen von Kisten gesichert wurden. Dann legte er sich hin und balancierte vorsichtig das Gewicht aus. Da er einen leisen Schlaf hatte, brauchte er nicht zu befürchten, dass die Pyramide unter ihm zusammenkrachte.
Tönnchen sah ihm verständnislos zu, und als Fundholz das letzte Streichholz ausgeblasen hatte, meldete er sich.
»Tönnchen will auch schlafen«, erklärte er.
Schimpfend machte Fundholz ein neues Streichholz an. »Morgen werde ich Decken besorgen«, sagte er, »leg dich jetzt irgendwie hin. Ich will meine Ruhe haben.«
Tönnchen gehorchte. Er legte sich auf den Boden, sprang aber gleich wieder auf. »Kalt und nass!«, verkündete er.
Fundholz stieg von seinen Körben herunter. »Mach nicht so viel Krach!« Wieder steckte er ein Zündholz an und baute dem Dicken murrend ein ähnliches, nur stabileres Lager.
Ohne zu danken, legte sich Tönnchen hin, und bald darauf schliefen beide ein.
Fundholz wachte auf, als Tönnchen röchelnd schnarchte, und, wohl von einer Angstvorstellung gequält, im Schlaf wimmerte.
Eines Tages hatte er Tönnchen in einem Hof angetroffen und sich seiner angenommen. Schmutzig, stinkend und in Kleiderfetzen gehüllt, gegen die Fundholz’ eigene Lumpen geradezu prächtig aussahen, hatte der Fettkoloss vor ihm gestanden und lächelnd in einem Müllkasten herumgestochert. So etwas Verkommenes wie Tönnchen hatte er nie zuvor gesehen. Und nachdem dieser ihn angesprochen hatte: »Ich bin Tönnchen! Hast du was zu essen?«, und ihn aus unbekannter Ursache stark anzuheimeln schien, hatte er ihm ein paar Brote geschenkt, die er gerade irgendwo erhalten hatte.
Der Dicke war auf ihn zugestürzt und hatte sie gierig heruntergeschlungen. Seitdem lief er hinter Fundholz her wie ein Hund hinter seinem Herrn und war für nichts zu gebrauchen. Tönnchen konnte nicht einmal betteln. Wenn die Leute die Tür aufmachten und ihn idiotisch lächelnd dastehen sahen, knallten sie sie entsetzt wieder zu. Nur durch einige Faustschläge hatte der Alte ihn dazu bringen können, an einem anderen Ort auf ihn zu warten. Und weil Fundholz den Dicken nicht mehr loswurde – ernstlich hatte er es allerdings auch nie versucht –, ernährte Fundholz Tönnchen seither mit und erbettelte ihm ein paar Kleidungsstücke.
Fundholz war beim Betteln oder Fechten, wie man das Betteln in Fachkreisen nannte, weit erfolgreicher. Sein Anblick war zwar auch nicht gerade erfreulich, wurde aber durch die Armesündermiene, mit der er um eine kleine Gabe bat, und sein Alter wettgemacht. Fundholz war sich darüber im Klaren, dass Tönnchen an sich in ein Irrenhaus gehörte, und aus dessen verworrenen Reden hatte er auch entnehmen können, dass er früher in Herzberge, der größten Berliner Irrenanstalt, gewesen war. Aber er brachte es nicht fertig, den Dicken irgendwo stehen zu lassen oder gar der Polizei zu übergeben.
Fundholz selbst lebte in einem ständigen Kleinkrieg mit dieser Behörde. Man wollte ihn, so vermutete er nicht zu Unrecht, ins Arbeitshaus sperren oder sonstwie festhalten. Mehrere Male hatte man ihn bereits wegen Landstreicherei und anderen Gesetzesübertretungen ins Gefängnis gesperrt. Aber Fundholz war ein Mensch, der trotz allem die Freiheit der Gefängnishaft vorzog. Manchmal aß er zwar tagelang nichts außer trockenem Brot, doch zog er diese schmale Kost immer noch dem Gefängnisessen vor, auch wenn ihm jenes vorzüglich geschmeckt hatte. Im Gefängnis bekam er immer das Gefühl, schwermütig werden zu müssen. Ihm fehlte die Bewegungsfreiheit, denn in den zurückliegenden zehn Jahren war ihm das Laufen zur Lebensgewohnheit geworden. Er durchquerte alle Stadtteile. Überall hatte er schon gebettelt, überall schon geschlafen. Mit aller Zähigkeit klammerte er sich an die Freiheit, sich selbstbestimmt zu bewegen.
Und genau so, wie er ohne Freiheit nicht leben konnte, verstand er, dass Tönnchen um nichts in der Welt nach Herzberge zurückgehen wollte. Obwohl er seinerseits keinen Wert auf die Gesellschaft des Dicken legte, wusste er gleichzeitig, dass er sich nicht von ihm loslösen durfte, auch wenn Tönnchen ein Schmarotzer, und zwar ein Schmarotzer mit einem gewaltigen Appetit war. Selbst wenn Fundholz ihm den Löwenanteil dessen gab, was er bekam, erwischte er den Dicken immer wieder dabei, wie er die Müllkästen durchwühlte. Fundholz tat das nie. Er hatte von seinen besseren Zeiten gewisse Hemmungsreste zurückbehalten. Er stahl nicht, und er aß keine Abfälle. Das waren die letzten Überbleibsel seiner ehemaligen Weltanschauung. Und seit er Grissmann kennengelernt hatte, hatte sich seine Situation sogar wieder verbessert.
Erst vor Kurzem war der Mann an ihn herangetreten und hatte gefragt, ob er sich drei Mark verdienen wolle. Fundholz hatte ihn erstaunt angesehen, denn drei Mark waren ein Vermögen für ihn.
Auch Grissmann war schlecht gekleidet. Der etwa Dreißigjährige trug eine Schlägermütze und hatte ein eingefallenes graues Gesicht, doch im Vergleich zu Fundholz wirkte er geradezu prunkhaft. Fundholz hatte den Eindruck gehabt, es bei Grissmann mit einem sehr fahrigen und furchtsamen Menschen zu tun zu haben. Seine Augen waren bei ihrer ersten Begegnung unruhig hin und her gewandert, dann hatte er ihn kurz angestarrt, um gleich danach wieder die Straße ängstlich mit Blicken abzutasten. Dennoch hatte sich Fundholz sofort bereit erklärt, die drei Mark zu verdienen, woraufhin ihm Grissmann ein Paket übergeben hatte.
»Da ist ein Anzug drin. Gehen Sie damit zu dem Altkleiderhändler da drüben und verkaufen Sie ihn. Ich warte hier. Bringen Sie das Geld danach zu mir, dann geb’ ich Ihnen den versprochenen Taler ab.«
Ohne weitere Rückfragen hatte Fundholz den Anzug in das Geschäft getragen.
Nachdem der Inhaber des Unternehmens das Kleidungsstück, begleitet von vielen Kommentaren über die Wertlosigkeit alter Kleider im Allgemeinen und dieses Anzugs im Speziellen, begutachtet und Fundholz milde gefragt hatte: »Was soll man dafür noch geben?«, hatte Fundholz, der noch nie mit alten Kleidern gehandelt hatte und auch keine Wertmaßstäbe dafür besaß, verlegen mit den Achseln gezuckt, worauf ihm der Händler gönnerhaft fünf Mark in die Hand gedrückt hatte.
Fundholz war das viel vorgekommen. Fünf Mark waren immerhin fünf Mark. Grissmann hatte diese Ansicht allerdings nicht geteilt und ihm statt drei Mark, was ja auch, wie Fundholz eingesehen hatte, zu viel gewesen wäre, nur zwei Mark gegeben.
Nach Abschluss des Geschäftes hatten sie schließlich noch ein Glas Bier zusammen getrunken. Bei Tönnchen waren es natürlich zwei gewesen, aber da Grissmann sie bezahlt hatte, war es Fundholz gleich gewesen. Als sie sich gegenseitig vorgestellt und miteinander etwas wärmer geworden waren, hatte Fundholz noch erfahren, dass Grissmann arbeitslos war, irgendwo eine Schlafstelle hatte und sich darüber hinaus, so wie Tönnchen und er auch, den ganzen Tag in der Stadt herumtrieb.
Obwohl Grissmann ein junger Mensch war, schien er keine Bekannten zu haben. Fundholz spürte, dass sich Grissmann ihm anschließen wollte. Der Alte war davon wenig erbaut. Es störte ihn, sprechen zu müssen. Sprechen hing mit Denken zusammen, und er wollte nicht denken. Er hatte sich abgewöhnt, Gedanken zu haben oder Probleme auszuspinnen. Er lebte sehr primitiv. Essen, Geld für Schnaps, ein Platz zum Schlafen. Mehr kümmerte ihn nicht.
Er sprach nur bei seinen Bittgängen, und auch dann nur wenig. Seine Kleidung war beredt genug.
Zwar gab es Leute, die von vorneherein in jedem Bettler einen verkappten reichen Mann sahen und deshalb grundsätzlich nichts gaben, oder aber um nichts geben zu brauchen, diesen Grundsatz hatten, aber im Allgemeinen waren vor allem die ärmeren Leute verständnisvoll, und hungern hatte der Alte noch nie gemusst.
Glücklicherweise hatte sich herausgestellt, dass Grissmann auch nicht viel redete. In gewisser Beziehung ähnelte er sogar Tönnchen, auch wenn er nicht so kindisch war. Stattdessen war er furchtsam.
Fundholz wälzte sich unruhig auf seinem Lager hin und her. Er konnte nicht wieder einschlafen. Die Luft war verbraucht und stickig, und der Dicke wimmerte im Schlaf, als wollte ihn jemand umbringen.
Der Alte suchte in seiner Tasche nach etwas Rauchbarem. Er fand einen Zigarrenstummel, einen schönen, fast fingerlangen Zigarrenstummel, und begann zu rauchen. Nach einigen Minuten fühlte er die Müdigkeit zurückkommen. Er drückte den Stummel aus und steckte ihn in die Tasche. Bald darauf schlief er wieder ein.
3. Kapitel
Grissmann hätte sich den Keller ganz gerne angesehen. Aber zuletzt hatte er es sich dann doch anders überlegt. An so einem Keller war schließlich nichts zu sehen, und man konnte das gelegentlich immer noch tun. Außerdem war das jetzt nicht wichtig.
Stattdessen irrte Grissmann ruhelos durch die Stadt.
Schon seit langer Zeit war er arbeitslos. Früher war er Straßenbahnschaffner gewesen. Doch dann hatte man ihn entlassen, weil bei einer Kontrolle Geld gefehlt hatte. Zwanzig Mark, und er hatte keine befriedigende Auskunft über den Verbleib des Geldes geben können und sich so verlegen und kläglich verteidigt, dass niemand bezweifelte, dass er es unterschlagen hatte.
Wegen zwanzig Mark machte man keinen Menschen fürs Leben unglücklich, deshalb hatte die Gesellschaft auf eine Anzeige verzichtet. Doch man entließ ihn, und zwar fristlos, nachdem man ihm großzügigerweise, ohne dass eine Verpflichtung hierzu bestanden hätte, noch das Geld ausgehändigt hatte, das er bei einer regulären Kündigung bis zur Entlassung verdient hätte.
Tatsächlich hatte Grissmann die zwanzig Mark verloren. Er war kein sehr aufmerksamer Mensch. Vielleicht hatte er jemandem zu viel Geld herausgegeben, vielleicht hatte man ihn bestohlen. Er wusste es selbst nicht.
Er wurde arbeitslos im ungünstigsten Moment.
Von Amerika waren neue Ideen nach Europa gelangt. Sie bestanden im Wesentlichen darin, dass man die menschliche Arbeitskraft durch sinnreiche Systeme auf ein Mindestmaß beschränkte und an ihrer statt Maschinen überall dort einsetzte, wo sich Verwendungsmöglichkeiten boten. Man nannte das Rationalisierung.
Maschinen besitzen entschieden gewisse Vorteile. So haben sie, anders als der Mensch, keinen Eigenwillen, keinen Funken Individualität. Sie streiken nicht, und wenn doch, so nur einzeln, aber nie kollektiv, wie es die Arbeiter tun, wenn sie Druck auf den Fabrikbesitzer ausüben wollen, um die Löhne zu halten oder zu erhöhen. Wenn Maschinen streiken, so liegt das an Defekten, die beseitigt werden können.
Menschen hingegen stellen Ansprüche an das Leben, und sie wollen mitverdienen, wenn der Fabrikant verdient. Sie haben politische Ansichten und verfechten sie auch. Und diese Ansichten stimmen sehr häufig nicht mit denen ihrer Arbeitgeber überein.
Also kaufte man Maschinen. Wo früher zehn Buchhalter gearbeitet hatten, standen nun zwei Buchungsmaschinen, die von zwei oder drei Leuten bedient werden konnten. Wo ehemals Hunderte von Arbeitern tätig gewesen waren, genügten nun einige vierzig. Man hatte ja Maschinen. Alle Probleme schienen sich herrlich lösen zu lassen. Man musste nur noch den maschinellen Menschen erschaffen, um zukünftig ganz ohne Arbeiter fabrizieren zu können.
Die Schnelligkeit der Arbeit wurde in den großen Werken von Fließbändern bestimmt. Das hässliche System der Antreiberei durch die Meister konnte damit fallen gelassen werden. Es genügte, das Fließband etwas schneller einzustellen, damit jeder entsprechend arbeitete. Wer nicht mitkam, wurde entlassen.
Und die Arbeitslosen übten durch ihre bloße Existenz einen starken Druck aus auf ihre Kollegen, die in den Stellungen verblieben waren. Wer mochte da noch streiken? Wer mochte noch Ansprüche stellen?
Jeder wusste: Will ich nicht, dann wollen andere, und jeder wollte schließlich.
Der günstige Moment war endlich gekommen. Nach den Gesetzen des freien Wettbewerbs regelte die Nachfrage das Angebot. Die Nachfrage nach Arbeitskräften war gering, aber das Angebot sehr groß, also konnte man die Löhne senken.
Und die, die noch Arbeit hatten, mussten für ihre erwerbslosen Kollegen mitbezahlen. Die Abzüge stiegen, und der Lohn wurde nochmal kleiner. Auch die Streikfähigkeit der Arbeiter war vernichtet, der Streikwille ebenso. Soweit stimmte die Rechnung.
Aber nun stellte sich heraus, dass man sich trotz allem verrechnet hatte. Man hatte zwar den arbeitnehmenden Menschen durch die Maschine an die Wand gedrückt, aber jetzt konnte der Mensch nichts mehr kaufen. Weder Anzüge noch Kleider. Es war ihm gänzlich unmöglich gemacht worden, sich irgendeinen Luxus zu leisten. Er schrumpfte ein. Und obwohl seine Bedürfnisse die gleichen geblieben waren, fehlte es an Mitteln, sie zu befriedigen.
Maschinen hatten nicht genügend Bedürfnisse, um den menschlichen Käufer zu ersetzen. Gewiss, sie gingen entzwei. Neue Industrien zur Herstellung von Maschinen und zur Herstellung der Maschinen für die Herstellung von Maschinen waren entstanden. Aber auch diese Fabriken waren nach den modernsten Gesichtspunkten der Rationalisierung aufgebaut worden.
Der Kleiderstofffabrikant, der schmunzelnd ein Drittel seiner Belegschaft entlassen hatte und dank der neuen Maschinen mit dem verbleibenden Rest das Doppelte an Ware hatte produzieren können, merkte mit einem Mal bestürzt, dass der Bedarf geringer geworden war. Das hieß, der Bedarf war schon da, aber es fehlte an Geld. Es waren ja alle arbeitslos.
Von diesen Zusammenhängen hatte Grissmann keine Ahnung. Er schob sein Unglück auf die Sache mit den zwanzig Mark, und dass er keine Arbeit fand, lag wohl an seiner Unzulänglichkeit, denn Grissmann war seit jeher von der eigenen Zweitklassigkeit überzeugt.
Sein Vater hatte ihm das beigebracht. Der große stämmige Mann mit dem aufgedunsenen Gesicht hatte schon in früher Jugend mit dem Trinken angefangen. Er war erst Ziehmann, später Droschkenkutscher gewesen und hatte aus Neigung Bier und alle anderen harmloseren Getränke abgelehnt und nur noch Schnaps getrunken, und zwar mehr, als für ihn gut gewesen war.
Als Ziehmann bezeichnete man in früherer Zeit die Leute, deren Beruf es war, Umzüge durchzuführen. Heute wie damals verfügen diese Menschen über außergewöhnliche Körperkräfte und eine große Verbundenheit zu Flaschenbier. Wenn die schwere Arbeit getan ist, brennt den Leuten die Kehle. Für gewöhnlich bekommen sie ein Trinkgeld und vertrinken es anschließend und häufig noch mehr.
Der alte Grissmann aber hatte nicht nur getrunken, wenn er durstig gewesen war, sondern er hatte getrunken, um sich Durst zu machen. Und weil Bier ihn nicht mehr in Rauschzustände zu versetzen vermocht hatte, hatte er Schnaps gesoffen. Und nachdem der Schnaps seine Gesundheit und Kraft unterhöhlt hatte, hatte er den Beruf wechseln müssen und war zur Droschke gegangen.
Immerhin hatte seine Kraft noch ausgereicht, um jedes Mal, wenn er guter Stimmung gewesen war, seine Frau und seinen Sohn Fritz zu verprügeln.
Fritz war klein, und der alte Grissmann hatte seinen zwergenhaften und schwächlichen Sohn deshalb stark zu prügeln versucht, aber es war ihm nicht gelungen. Dann war seine Frau gestorben und Grissmann senior kurze Zeit später wegen einer Rauferei im Gefängnis gelandet.
Fritz war in ein Waisenhaus gekommen. Er blieb ein schwächlicher, ängstlicher Mensch. Er hatte keinen Mut und empfand diesen Mangel als quälend. Im Heim hatte er zunächst versucht, ihn sich durch Grausamkeiten zu beweisen. Er hatte Fliegen die Beine einzeln ausgerissen und kleinere Jungs verdroschen, aber das hatte ihn nicht mutiger werden lassen. Und weil im Heim alle gegen ihn Stellung bezogen hatten und seine Grausamkeiten gewöhnlich mit Prügel geendet hatten, die er einstecken musste, war er nur noch furchtsamer geworden.
Grissmann litt an Schlaflosigkeit. Tagsüber hatte er keine Beschäftigung, und nachts war er nicht müde und konnte nicht schlafen. Er hatte zwar eine Schlafstelle, aber im selben Zimmer schliefen auch zwei andere junge Männer. Sie schnarchten, wenn sie schliefen, und sie verspotteten ihn, wenn sie wach waren.
Auch sie waren arbeitslos. Aber instinktiv hatten sie in ihm ein Wesen entdeckt, das noch schlechter dran war als sie selbst. Einen Menschen mit inneren Defekten. Grissmann fürchtete sich vor ihnen, und sie hatten seine Furcht freudig registriert.
Beide waren jünger als er, fühlten sich ihm aber weit überlegen. Sie waren vom Leben hart angefasst worden und fassten nun ihrerseits hart an; ihre Späße waren brutal und selten lustig.
Er war unschlüssig, was er anfangen sollte. Nach Hause gehen wollte er noch nicht. In eine Kneipe zu gehen, hatte er aber auch keine große Lust. Er war nicht gerne unter Menschen. Vor allem wenn es viele waren, beunruhigten ihn Menschen stets etwas.
Als er auf der Friedrichstraße anlangte, ging er, langsamer werdend und sich dicht an den Häusern haltend, die belebte Straße hinunter. Er passierte den Stadtbahnbogen. Hier war weniger Betrieb, nur aus einem Kino strömten Menschen. Er ging wieder schneller. Hinter dem Kino lagen ausschließlich Lokale und kleinere Vergnügungsstätten, Musik drang durch die offenstehenden Türen auf die Straße. Grissmann ging immer weiter. Der Untergrundbahnhof mit dem leuchtenden U lag bereits hinter ihm.
Er verlangsamte sein Tempo. Was wollte er eigentlich hier draußen? Er wusste es selber nicht.
Zwei Straßenmädchen gingen mit wiegenden Schritten an ihm vorbei. Sie waren beide nicht mehr jung. Dick lag die Schminke auf ihren Gesichtern, ihre Röcke waren kurz und ließen die Waden sehen. Sie trugen Schuhe mit sehr hohen Absätzen und helle fleischfarbene Strümpfe. Ihre Stimmen klangen zu ihm zurück. Sie sprachen über Wohnungseinrichtungen. »Ich habe ein billigeres Schlafzimmer bei Wertheim geseh’n«, hörte er die eine sagen.
Beide schwenkten ihre Handtaschen und sahen sich auf der Suche nach Kundschaft interessiert nach allen Seiten um.
Grissmann ging ihnen nach.
Sie hörten seine Schritte hinter sich und wandten gleichzeitig die Köpfe. Aber der Anblick eines mit einem alten Anzug bekleideten Arbeitslosen schien ihnen keine Geschäftsmöglichkeit zu verheißen.
Gewohnheitsmäßig hatten beide beim Umdrehen entgegenkommend gelächelt; in dem Moment aber, als sie Grissmann entdeckten, strichen sie dieses Lächeln wieder aus ihren Gesichtern.
Er bekam einen roten Kopf. Sogar die, dachte er, halten sich für was Besseres.
Schneller gehend überholte er die beiden. Als er an ihnen vorbeikam, erfasste ihn plötzlich ein ganz sinnloser Hass. Man müsste ihnen ein Messer in den Rücken jagen, dachte er. Zwei-, dreimal wiederholte er mit einer gewissen Freude diesen Gedanken. Dann dachte er an etwas anderes und lief weiter planlos durch die Stadt.
Erst gegen ein Uhr nachts kam er an seiner Schlafstelle an. Er schlich leise in sein Zimmer, zog sich fast geräuschlos aus und stieg ins Bett.
Erschrocken fuhr er wieder hoch. Er lag auf etwas Weichem. Er fasste mit der Hand hin und hob ein graues, totes Tier hoch. Es war eine Ratte.
Mit einem unartikulierten Wutschrei stürzte er sich auf den ihm Zunächstliegenden. Immer noch schreiend, schlug er ihm die Ratte um die Ohren.
Der wachte auf und setzte sich zur Wehr. Aber er kam gegen Grissmann nicht an. Selten hatte Grissmann über derartige Kräfte verfügt. Wie ein Tobsüchtiger schlug er den anderen immer wieder mit der geballten Faust ins Gesicht. Dann griff er die Ratte erneut und versuchte, dem anderen den Kopf des Tieres in den Mund zu pressen.
Da sprang der Dritte seinem Freund zu Hilfe, und zusammen überwältigten sie Grissmann. Sie schlugen noch auf ihn ein, als er schon besinnungslos war. Dann warfen sie ihn auf sein Bett.
»Das war doch nur ein Scherz!«, sagte einer von ihnen grollend.
Sie legten sich wieder hin. Aber beide wussten, dass sie Grissmann kein weiteres Mal reizen würden.
»Der ist im Stande und schneidet einem noch die Gurgel ab«, sagte der Jüngere vor dem Einschlafen, nicht ohne gewisse Anerkennung.
4. Kapitel
Walter Schreiber schloss seinen Keller auf.
Bin doch neugierig, wie die zwei Strolche die Nacht verbracht haben, dachte er. Puh, nicht für die Welt möchte ich in dem Loch schlafen.
Er machte die Tür weit auf, um frische Luft hereinzulassen. Schreiber schnüffelte. Hatten die etwa geraucht? Anschließend schloss er den kleinen Keller auf. Beide schliefen noch, und sie waren so dreist gewesen, seine Kiepen als Unterlage zu benutzen.
Fundholz erwachte zuerst. Er machte ein mürrisches Gesicht, stieg von seinem Lager herunter und reckte sich verschlafen; dann stieß er Tönnchen an.
Der blinzelte und sagte: »Ich esse keine Kohlrüben! Nein, ich esse sie nicht!«
Tönnchen hatte von Herzberge geträumt. Wieder hatte man ihn in der Irrenanstalt zwingen wollen, Kohlrüben zu essen. Kohlrüben war das einzige Gericht, das er verabscheute und von Herzen hasste. Er hatte oft solche Träume. Immer wollte man ihn veranlassen, Kohlrüben zu essen. Man stopfte sie ihm förmlich in den Mund. Berge von Kohlrüben!
Verstört sah er sich um. Aber da war nur Fundholz, der zu ihm sagte: »Los mach zu! Wir müssen gehen.«
Tönnchen stand auf.
Fundholz wandte sich an Walter Schreiber. »Können wir die Kiepen so stehen lassen? Auf dem Fußboden kann man nicht schlafen. Es ist viel zu nass!«