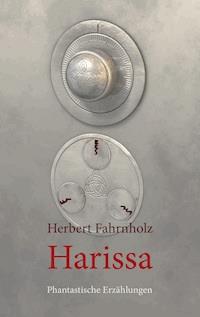Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Ein Software-Entwickler im besten Alter erwacht in einer fremden Wohnung im gebrechlichen Körper eines alten Mannes, dessen Leben von Bevormundung und fortschreitender Entmündigung geprägt ist; - ein verzweifelter Mann verkauft in einer ausweglos scheinenden Lage seinen Körper an ein dubioses Team von Extrem-Medizinern, die ihm eine zweite Identität implantieren wollen; - ein Mann wird nur aufgrund seines Namens zum Zielobjekt von Anhängern einer kruden Verschwörungstheorie, die ihn beschuldigen, einen Geheimbund anzuführen, der die Menschheit in ihre Anfänge zurückwerfen will; - der Tester eines neu entwickelten Smart-Hauses muss erkennen, dass man die zunehmend intelligenter werdenden Dinge seiner Einrichtung nicht unterschätzen und schon gar nicht verärgern sollte. Diese Geschichten mit ihren oft eigenwilligen Akteuren spielen meist in Welten, die knapp neben der unseren liegen, aber nicht weniger strengen Gesetzen gehorchen und die unsere Gewissheiten mitunter bis zur Kenntlichkeit verbiegen. Spannend und bildkräftig erzählt ist diese Sammlung von Stories gute Unterhaltung ohne Reue für alle, die sich beim Lesen gern zum Mit- und Weiterdenken anregen lassen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 442
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Buch
Ein Software-Entwickler im besten Alter erwacht in einer fremden Wohnung im gebrechlichen Körper eines alten Mannes, dessen Leben von Bevormundung und fortschreitender Entmündigung geprägt ist;
ein verzweifelter Mann verkauft in einer ausweglos scheinenden Lage seinen Körper an ein dubioses Team von Extrem-Medizinern, die ihm eine zweite Identität implantieren wollen;
ein Mann wird nur aufgrund seines Namens zum Zielobjekt von Anhängern einer kruden Verschwörungstheorie, die ihn beschuldigen, einen Geheimbund anzuführen, der die Menschheit in ihre Anfänge zurückwerfen will;
der Tester eines neu entwickelten Smart-Hauses muss erkennen, dass man die zunehmend intelligenter werdenden Dinge seiner Einrichtung nicht unterschätzen und schon gar nicht verärgern sollte.
Diese Geschichten mit ihren oft eigenwilligen Akteuren spielen meist in Welten, die knapp neben der unseren liegen, aber nicht weniger strengen Gesetzen gehorchen und die unsere Gewissheiten mitunter bis zur Kenntlichkeit verbiegen. Spannend und bildkräftig erzählt ist diese Sammlung von Stories Unterhaltung ohne Reue für alle, die sich beim Lesen gern zum Mit- und Weiterdenken anregen lassen.
Der Autor
Herbert F. E. Fahrnholz, 1949 in Regensburg geboren, absolvierte nach dem Abitur ein Psychologiestudium und war einige Jahre als Berater und Therapeut tätig. Anfang der Achtziger widmete er sich als bildender Künstler der Objekt-Kunst, Fotografie und Druckgrafik, ab Mitte der Neunziger bevorzugt dem neuen Medium Computergrafik.
Seit 2015 veröffentlicht er Phantastische Prosa, meist in der Form von pointierten Kurzgeschichten, die zwischen Science-Fiction, Krimi und Horror angesiedelt sind und die er gerne mit eigenen Illustrationen ausstattet.
INHALT
Der Rote Tom
Vierzig Tonnen Tod
Die Zerrbrücke
Die Silberschnur
Dinge die denken
Kleine Brötchen
Roter Mastix
Der Endzeit-Verwalter
Mathieu
Der Eiermann
FutureMedic
Dämmeröl
Der Rote Tom
Will man einen Menschen töten, so ist dabei das Wichtigste die bedingungslose Entschlossenheit. Jedes Zögern oder Überlegen, jeder Funke von Mitleid, jeder Rest Skrupel, jeder noch so kurze Moment der Unsicherheit kann dazu führen, dass das Ziel dem Angriff entgeht, die Gelegenheit verstreicht und sich womöglich keine weitere mehr ergibt.
Das fühlte sich an wie eine echte Erkenntnis, gewonnen aus leidvoller eigener Erfahrung. Nur, woraus, aus welchen Ereignissen, welchem finsteren Vorhaben sollte er, Dermot Dill, diese Lehre wohl gezogen haben? Selbst nach strengster Gewissenserforschung konnte er reinen Herzens von sich sagen, noch nie anderen Menschen ernsthaft den Tod gewünscht zu haben.
Ganz kurz vielleicht, vorübergehend in einer jähzornigen Aufwallung, das ja, aber solche Momente waren flüchtig, vergingen ebenso schnell wie der Schmerz, der sie meist verursachte, und hätten niemals ausgereicht, ihn eine Mordtat wirklich ausführen zu lassen.
Woher also kam diese erschreckend lebendige Erkenntnis von der Schädlichkeit des Zögerns beim Töten?
Hing das zusammen mit den seltsamen Absencen, die ihn immer wieder befielen wie narkoleptische Attacken, unvorhersehbar und unwiderstehlich? Die sich oft auch mit normalen Schlafphasen überschnitten, pathologischer Schlaf im normalen also, wie in einem Schlaflabor an der Universität zur Überraschung aller beteiligten Mediziner, Biologen und Psychologen festgestellt worden war.
Einerseits war das ein Glück für ihn, weil dann diese Episoden ja nicht auffielen und ihm sozial und beruflich nicht schadeten, ein Glück zudem auch deshalb, weil sie ihn nicht akut gefährdeten, wenn sie ihn in Situationen antrafen, die seine ganze Aufmerksamkeit und Konzentration erforderten. Andererseits wirkte aber der stark gestörte Schlaf sich sehr ungünstig auf seinen körperlich-seelischen Allgemeinzustand aus und sorgte dafür, dass er häufig gereizt war und aufbrausend, fahrig, unkonzentriert, und nicht zu hundert Prozent funktionstüchtig.
Das allerdings schadete ihm sozial und beruflich dann doch hin und wieder.
Er fühlte sich müde und erschöpft.
Wenn er seine momentane Verfassung in Betracht zog, war es gut möglich, dass ihn in der Nacht wieder so ein unheimlicher Zustand erwischt hatte. Diese Phasen waren ihm nun seit einer Weile bekannt, wenn auch nicht gerade vertraut.
Neu und irritierend war es dabei allerdings, anschließend mit einem Gedanken im Kopf aufzuwachen, der offensichtich keinerlei Zusammenhang mit seinem Leben hatte, einem Fremdkörper, der in ihm herumspukte, ohne einen Hinweis darauf zu geben, woher er kam.
Dermot Dill war in der Tat kein geeignetes Gefäß für mörderische Gedanken.
Er war nun dreiundvierzig und geschieden von einer enttäuschten Frau, die für die gemeinsame Tochter das Sorgerecht erstritten hatte, und er war kaum weniger durchschnittlich als Herr Mustermann. Das einzige Ungewöhnliche an ihm war sein Beruf, der trotz seiner Exotik seinem innersten Wesenskern entsprach, falls es so etwas gibt. Dermot war Tierpräparator, ein Metier, das er sich selbst beigebracht hatte, denn eine Lehrstelle beim einzigen zoologischen Präparator in der ganzen Stadt war seinerzeit angeblich nicht vakant gewesen.
Die Frage, warum Dermot sich in Wirklichkeit dort nie um einen Ausbildungsplatz beworben hatte, lässt sich nicht eindeutig beantworten. War es ein Problem mit Autoritäten, das ihn beträchtliche autodidaktische Mühen einer auf Strenge und Unterordnung basierenden, dafür aber grundsoliden Ausbildung vorziehen ließ, war es seine Schüchternheit, die er oft hinter unverschämtem Gehabe verbarg, oder die Tatsache, dass der Laden in einem piekfeinen Viertel der Stadt lag, in dem er sich fehl am Platz fühlte? Vermutlich war es all das zusammen.
Zweifel an seiner Berufswahl waren es jedenfalls nicht.
Der Gedanke, toten Tieren wieder Leben einzuhauchen, indem man sie kunstvoll aufbereitet in einer natürlichen Pose sozusagen für die Ewigkeit einfror, hatte ihn schon als Kind gepackt und nie wieder losgelassen.
Zuweilen empfand er sogar immer noch dieses Gefühl des Triumphs über den Tod, wenn er die Freude in den Gesichtern der Menschen sah, deren geliebte, aus dem Dasein geschiedene Haustiere er wieder grandios lebensnah auf ein Kissen, ein Brett oder einen Ast gezaubert hatte.
Weit weniger erfreuten ihn Jäger, die die Köpfe selbsterlegter Rehböcke oder Hirsche präpariert haben wollten, aber von denen verirrte sich bald keiner mehr in sein Geschäft, nachdem sich herumgesprochen hatte, dass Trophäen-Präparate von Dill oft sehr traurig und manchmal sogar unerträglich vorwurfsvoll von der Wand blickten, je nachdem, wie der betreffende Waidmann sich über das Ende seines Opfers geäußert hatte. Mit den Jahren hatte sich auf diese Weise eine Aufteilung des Marktes herausgebildet: Die entschlafenen Haustiere wurden von Dermot Dill wieder zum Leben erweckt, die bedauernswerte Jagdbeute aber von den blasierten Ausstopfern im Nobelviertel.
Dermot war damit zufrieden, die Konkurrenz, der er ja immerhin das Geschäft mit den Kuscheltieren abgenommen hatte, allerdings weniger. Man intrigierte gegen ihn, wo es nur ging, hetzte ihm die Gewerbeaufsicht auf den Hals, fuhr aufwendige Kampagnen mit zweifelhafter vergleichender Werbung gegen ihn, oder schwärzte ihn beim Finanzamt an.
Bislang war freilich alles ohne jeden Erfolg geblieben, denn in seinem Segment lieferte Dermot hervorragende Arbeit ab, liebevoll mit viel Herz angefertigt, und dazu noch unschlagbar preiswert.
Was die von ihm geschaffenen Exemplare so unübertroffen lebensecht machte, waren die Augen. Üblicherweise ersetzte man diese durch Glasaugen, die zwar qualitativ hochwertig und in langer handwerklicher Tradition hergestellt waren, aber dennoch meist einen zu harten Glanz aufwiesen und den Eindruck störten, man habe da ein lebendes Wesen vor sich.
Dermot dagegen nahm immer die echten Augen, erhielt sie, selbst wenn sie bereits etwas getrübt waren, durch eine Prozedur, die sein Geheimnis blieb.
Eigentlich hatte Dermot also gute Gründe, zufrieden zu sein, wäre da nicht dieser infame Angriff des Todes gewesen, den er jeden Tag in die Schranken wies, und der ihn nun heimtückisch und rachsüchtig durch die Hintertür, nein, eher durch eine Katzenklappe in der Hintertür angriff, durch einen obskuren Schlaf im Schlaf.
Am Abend eines schier endlos scheinenden, vom nächtlichen Stress geprägten Tages ging er zu Bett, wo er tief und traumlos zu schlummern hoffte, die Erwartung neuer Heimsuchungen aber nicht gänzlich abstreifen konnte.
Red Tom trennte mit einem raschen und kundigen Schnitt eine Ohrmuschel vom aschfahlen, haarlosen Kopf des Toten.
Die Wunde blutete kaum, weil das Herz des Mannes nicht mehr schlug und kein Druck mehr auf den Adern war.
»Zu komisch, wie der Mulack um Gnade gebettelt hat«, lachte sein Jagdgefährte Spalter, »als ob das schon jemals einem geholfen hätte.« Er spuckte verächtlich aus. »Das Gesindel hat keine Würde und keinen Stolz!«, befand er.
Red Tom brummte zustimmend, aber ein wenig verdrießlich, weil der Spalter für seinen Geschmack schon wieder viel zu viel redete und platte Selbstverständlichkeiten absonderte.
Er fädelte den bleichen Knorpel auf ein Lederband, das um seinen Hals hing und an dem schon etwa zwei Dutzend andere Ohren hingen, alle blass-fahlgrau, aber unterschiedlich in Form und Größe. Er betrachtete nachdenklich den leblosen Körper auf dem mit Moos und Wickerbeeren bedeckten Waldboden, dann bückte er sich erneut, schälte mit dem Messer behutsam ein Auge aus dem einohrigen Schädel und schnitt sorgsam den Sehnerv durch. Dann ließ er die gallertige Beute in ein metallenes, mit einer zähen Flüssigkeit gefülltes Rohr gleiten, das er seitlich an seinem Gürtel trug.
Spalter nickte wissend. »Für deine Sammlung, he? Warum denn immer nur eines?«
Der Rote Tom zuckte die Schultern. »Es werden so schnell zu viele«, brummte er, »und die Vögel wollen ja auch noch was abhaben. Vögel lieben Augen.«
Der Axtmann nickte wieder verständnissinnig.
»Deine Sammlung«, blieb er beim Thema, »gespenstisch, wie lebendig die Augen einen so ansehen aus ihren Gläsern. Wie machst du das nur, dass sie nicht trübe werden und verrotten, bis du mal wieder heimkommst? Was für Zeug ist das in dem Rohr?«
Red Tom ignorierte die Frage. Wenn das so weiterging und er sich mit dem Spalter auf eine längere Unterhaltung einließ, würde unweigerlich früher oder später wieder die Frage kommen, ob auch er manchmal schlecht schlafen könne, weil er so viele getötet habe. Beim Spalter war das offenbar so. Bei ihm nicht. Herrje! Leben ist das allerhöchste Gut, und es dem Menschen zu nehmen deshalb das schlimmste Verbrechen! Was für ein unrettbar optimistischer Narr musste man sein, um so etwas zu behaupten, wo es doch in Wahrheit meist nur das Abkürzen einer sinn- und ziellosen Quälerei war. Oft barmherzig, nur selten zu früh, und niemals grausamer als das, was die ersparte Zeit noch bereitgehalten hätte an erlesenen Qualen für die nur scheinbar armen Opfer. So und nicht anders dachte er darüber. Sollte er deshalb schlecht schlafen? Unsinn. Eher schlief er gelegentlich viel zu tief.
Ein großer Vogel mit zwei Köpfen und von ungewisser dunkler Färbung glitt lautlos heran und landete auf der Leiche des Mulacken, wo er wenig später von einem zweiten, beinahe identisch aussehenden Exemplar besucht wurde, mit dem er sich nun um das übrige Auge balgte. Tom wartete etwas, bis Ocul die Frage, wer zuerst fressen durfte, geklärt und sich seinen Teil genommen hatte. Dann pfiff er kurz und scharf durch die Zähne: »Hierher, Ocul!«
Der Spalter tat es Tom gleich und rief seinen Opteryx Jicho zu sich. Die zwei majestätischen Vögel schwebten gehorsam heran und jeder nahm seinen Platz auf der Schulter seines Herrn ein. Die Sonne rötete schon die Ränder der tiefhängenden Wolken. Zeit, sich nach einem geeigneten, sicheren Platz für das Nachtlager umzusehen.
Sie machten sich nicht die Mühe, die Leiche des Mulacken zu vergraben. Sollte er der Natur etwas zurückgeben, indem er allen interessierten Geschöpfen als Nahrung oder Nisthöhle diente. So war er am Ende doch noch zu etwas gut gewesen.
Zu mehr bringen wir es doch alle nicht, dachte Red Tom.
Und der hier hatte es nun hinter sich.
Gefolgt vom Spalter schritt er dann kräftig aus und machte sich hinter der sinkenden Sonne her auf den Weg in Richtung Osten, wo er nur zwei Monddurchgänge entfernt Fort Balthus wusste, in dem er seine Kette einlösen würde.
»Bedauere«, sagte Dermot zu dem Mann in der olivfarbenen Kluft mit den vielen Taschen, der ihm stolz einen großen Hecht präsentierte. »Für so etwas gehen sie besser zu Sebaldus im siebten Bezirk. Die machen auch Fische. Speziell Rotwild, aber auch Fische.«
Angler, das ging nun gar nicht. Die waren für ihn vom allerselben Schlag wie die Jäger, die immer die Hirschköpfe anschleppten. Hatten was von einer Spinne. Saßen stundenlang da und warteten auf den richtigen Moment, um sich ihre Beute zu schnappen. Und am schlimmsten waren die, die Fisch oder Wild noch nicht einmal aßen, sondern die Tiere einfach nur an der Wand haben wollten. Denen hatten die Spinnen noch was voraus. Nein danke, kein Interesse, mit denen ins Geschäft zu kommen.
Aber der Mann mit dem Hecht ließ sich nicht abweisen.
»Bei denen war ich schon«, knurrte er. »Wissen Sie, was diese Halsabschneider für so einen nehmen?«
Er knallte Dermot den Hecht auf den Ladentisch. »Ist ja ein ganz netter Fisch, aber doch bestimmt nicht Moby Dick!«
»So sieht er nicht aus«, pflichtete ihm Dermot bei. »Aber er ist auch kein kleiner Fisch. Ich kenne die Preise. Sie entscheiden, was der Bursche Ihnen wert ist.«
Der Angler kratzte sich am Kinn und man konnte ihm ansehen, dass er schärfer nachdachte als das Rasiermesser sein konnte, mit dem er mutmaßlich seinen stoppeligen Bart bearbeitete.
»Hab schon größere an Land gezogen«, sagte er, »viel größere. Aber irgendwie mag ich den Kleinen. Hat so eine böses Gesicht.
Aber wenn Sie ihn nicht machen wollen, dann muss ich ihn eben wegwerfen. Oder besser noch, werfen Sie ihn weg. Ich brings nicht übers Herz.«
Und bevor Dermot noch protestieren konnte, war er schon raus aus dem Laden. ›Verduftet‹ wie man so sagt, was man von seinem Fisch leider nicht behaupten konnte. Demzufolge, was da Dermots Nase kitzelte, war es in der Tat an der Zeit, dass man ihm eine Behandlung angedeihen ließ, die den schon recht strengen Geruch stoppte.
Er seufzte. Nein, auch er würde es sicher nicht übers Herz bringen, den Hecht einfach in die Tonne zu werfen. Wenn er ihn so ansah, das mit dem bösen Gesicht stimmte wirklich.
Vielleicht ließ sich das noch etwas mehr herausarbeiten.
Dann ab auf ein schönes Brett mit ihm und eine Inschrift dazu: KEINE FISCHE!
Das wäre dann wieder mal ein Null-Job, der nichts einbrachte.
Aber es gab noch eine überlegenswerte Alternative dazu, nämlich den bösen Burschen gründlich zu säubern und auszunehmen, das Fleisch von den Gräten abzulösen und eine feine Suppe daraus zu zaubern. Dermot lief das Wasser im Mund zusammen und während er noch über ein gutes Rezept nachdachte, klingelte schon wieder die Ladentür.
Diesmal war es keiner, der gern Kunde sein wollte, sondern ein Vollidiot, der ihn ausrauben wollte. Ihn ausrauben! Als ob er der König Midas des Viertels sei, dem alles zu Gold wurde, was er berührte.
Der Räuber fuchtelte mit etwas herum, das wie eine Makarow aussah, vielleicht aber auch nur eine Nachbildung war, aber für Dermot spielte das ohnehin keine Rolle.
Seine Kasse war leer bis auf eine ormesische Lewonze, die etwa soviel wert war wie ein Hosenknopf.
»Gib mir alles, was du in der Kasse hast!«, forderte der Gauner, der sich noch nicht einmal die Mühe gemacht hatte, sein Gesicht zu verbergen, vermutlich, weil er nicht aus der Gegend war. Sonst hätte er ja auch gewusst, dass Dermot, der schon dreimal überfallen worden war, nie etwas in der Kasse hatte, noch nicht einmal Wechselgeld.
Dermot ließ also mit Geklingel die Geldschublade herausfahren und gab dem Räuber grinsend die Lewonze.
»Das ist nicht witzig!«, brüllte der, »gib mir alles! Alles, was drin ist.«
Dermot nahm die ganze Lade heraus und zeigte ihm die gähnende Leere.
»Du hast alles«, stellte er sachlich fest. »Mehr ist nicht drin.«
»Mach keine Mätzchen!«, schrie der Enttäuschte nun wütend und fuchtelte wild mit seiner vermutlich harmlosen Knarre herum, »dann mach eben den Tresor auf! Du hast doch sicher einen Tresor!?«
Aber Dermot schüttelte nur den Kopf.
»Kein Tresor«, verkündete er gereizt. Zum Glück hatte er in der Nacht ziemlich gut geschlafen und war deshalb für seine Verhältnisse recht ruhig und gefasst geblieben. Bis jetzt.
»Wieso halten immer alle einen Tierpräparator für unermesslich reich?«
Der Räuber hielt nun den Zeitpunkt für gekommen, an dem er seinen Forderungen doch ein wenig mehr Nachdruck verleihen sollte, und er fing an, im Laden herumzuballern.
Die Knarre war also doch echt. Und sie richtete Schaden an. Schaden, der den Überfallenen mehr schmerzte als jeder Geldbetrag, den er hätte verlieren können.
Die erste Kugel schlug noch harmlos in der Wand ein.
Aber schon die zweite zerfetzte ein Amselmännchen, an das Dermot einige persönliche Erinnerungen hatte, und die dritte riß Minka, seiner dreifarbigen Glückskatze, die er im letzten Sommer nach ihrem Tod unter einem Auto aufwendig wiederhergestellt hatte, die schwarze Vorderpfote ab.
»Hör doch auf damit, Mann!«, rief Dermot, »ich gebe dir einen Scheck!«, aber das ernst gemeinte Angebot löste nur weitere Schüsse aus, und der allerschlimmste Treffer davon zerstörte eins von Minkas so überaus lebendig glänzenden Augen.
Das war zuviel.
Damit war dieser Verbrecher einen Schritt zu weit gegangen. Dermot packte den Fisch, der immer noch auf dem Ladentisch lag, am Schwanz, schwang ihn wie ein Schwert und stürmte auf den Schützen zu, bedingungslos dazu bereit, ihm damit den Schädel zu spalten.
Natürlich konnte man keinen mit einem Hecht ernsthaft verletzen, aber der Räuber sah die wilde, archaische Entschlossenheit und den absoluten Vernichtungswillen in Dermots Gesicht, ließ erschrocken die Pistole fallen und floh, von Panik ergriffen und begleitet vom wilden Gebimmel der Türglocke, aus dem unheimlichen Laden.
Als im Westen die Sonne hinter den Hügeln aufging, schlief Red Tom entgegen seinem üblichen Rhythmus noch tief und fest. Spalter hatte das schon mehrmals bei ihm gesehen, aber noch nie hatte der Jäger dabei derart tief entrückt gewirkt, beinahe so bewusstlos wie seinerzeit Hunter Rory Claybean, nachdem ein Blitz ihn gestreift und niedergestreckt hatte.
Der Spalter erinnerte sich noch gut an die zu einem unförmigen Eisenklumpen geschmolzene Gürtelschnalle und an die Stiefel mit den abgerissenen Sohlen, in deren verschmorten Resten qualmende schwarze Füße steckten.
Spalter suchte die kleine Lichtung ab und sah, dass Toms Ocul mit dem Kopf nach unten wie eine Fledermaus am Schlafast hing, ein derart untypisches Verhalten, dass auch sein Jicho so sehr erschrak, dass er ungerufen angeschwebt kam und auf seiner Schulter ein klagendes Krächzen aus den Kehlen beider Köpfe hören ließ.
Irgendwo in der Nähe knackte ein brechender Zweig.
Der Spalter nahm den Opteryx von seiner Schulter und warf ihn von der Faust ab hoch in die Luft. Der Vogel zog in der Lichtung enge Kreise und schraubte sich immer höher, über die höchsten Wipfel hinaus, bis er eine Luftströmung fand, in die er sich hineinhängen konnte, um bewegungslos auf der Stelle zu schweben.
Der Rote Tom schlief noch immer wie ein Toter.
Der Spalter schloss die Augen und empfing die Rundumsicht, die ihm die vier überscharfen Vogelaugen sandten. Vom Norden her schlich ein Trupp Mulacken vorsichtig in seine Richtung. Spalter zählte mindestens fünf. Einer der kahlen Fahlen entdeckte soeben den guten Jicho hoch oben in der Luft und zeigte mit dem Finger auf ihn.
Die Grenzgänger versuchten hastig, Deckung zu nehmen, doch den Augen des Opteryx konnten sie im lichten Hochwald nicht entkommen. Aber sie waren jetzt gewarnt, denn weil sie Jicho gesehen hatten, wussten sie, dass einer oder mehrere Jäger in der Nähe waren. Und Red Tom war weggetreten und konnte ihm nicht helfen, wenn es zum Kampf kommen sollte. Er alleine würde den zwar sicher nicht beginnen, aber Mulacken griffen auch ab und zu von sich aus an. Besonders wenn sie merkten, dass sie in der Überzahl waren, wurde da ein Jäger schnell zur Beute. Sie überwältigten ihn mit vereinten Kräften und zogen ihm bei lebendigem Leib die Haut ab, so hieß es.
Spalter hatte dergleichen zwar noch nie mit eigenen Augen gesehen, wurde aber nun dennoch nervös, denn der Trupp steuerte direkt auf ihn zu. Gleich musste der Vorderste der Mulacken durchs Gebüsch brechen, das die Lichtung umgab, und auf den freien Flecken hinaustreten, wo der schlafende Tom und er gut zu sehen waren.
Er kappte die Verbindung zu Jicho, nahm die schwere Axt von der Schulter und wandte sich der Stelle zu, an der die Fahlen erscheinen mussten. Breitbeinig stellte er sich auf, die langstielige Axt in beiden Fäusten und drohende, wilde Blicke um sich werfend.
Die Kerle waren jedoch schlauer, als er gedacht hatte, denn nur ein einziger Mulack kam genau dort aus dem Wald, wo er es erwartet hatte. Die vier anderen verteilten sich vermutlich grade im Schutz der Büsche rund um die Lichtung und kreisten ihn ein, um ihn dann von allen Seiten zugleich anzugreifen.
Die Lage war kritisch.
Mit zwei oder auch drei Männern konnte er fertig werden, solange er sie alle im Auge hatte. Aber fünf, die planvoll und taktisch geschickt angriffen, würden ihn ziemlich sicher erledigen. Als er schon nicht mehr damit rechnete und seine Optionen für einen strategischen Rückzug abschätzte, sah er, dass Ocul nun wieder richtig auf dem Ast saß und sich soeben duckte, um abzufliegen.
Tom wurde so plötzlich wach wie eine Mantis zupackte.
Er sah den einzelnen Mulacken, der mit einer Stachelkeule herumfuchtelte, und sah, wie der Spalter abwehrbereit mit der Axt in den Händen den Waldrand absuchte.
Sofort erfasste er die Situation, spannte blitzschnell den Langbogen und jagte einen Pfeil durch den Hals des Kahlen mit der Keule, der lautlos umkippte.
Es war, als sei Tom schon kampfbereit erwacht. Unbegreiflich, wie er so schnell so viel Adrenalin durch seinen Körper hatte pumpen können. Nun ließ er den Bogen fallen und sprang mit der langen Klinge in der Hand dem Spalter bei, stellte sich mit ihm Rücken an Rücken auf, bereit, jedem Angreifer zu zeigen, warum man ihn Red Tom nannte, den Roten Tom, der sehr schnell rot sah und dann ebenso schnell Ströme von rotem Blut fließen lassen konnte.
Einige lange Minuten geschah nichts.
Dann verband der Spalter sich mit Jicho, der immer noch hoch über der Lichtung schwebte, und suchte die Umgebung ab.
Die restlichen vier Mulacken machten sich eilig in die Richtung davon, aus der sie gekommen waren.
Offenbar hatte sie Toms Berserker-Auftritt und die Aussicht, zu viert gegen gleich zwei grimmige Hunter bestehen zu müssen, vom geplanten Kampf Abstand nehmen lassen.
»Sie hauen ab«, sagte der Spalter erleichtert, und fragte dann vorwurfsvoll: »Wo zur Hölle warst du denn so lange? Hat dein Geist sich im Schlaf verirrt und nicht mehr zurückgefunden?«
»Wir brechen auf«, antwortete Red Tom und ignorierte die Frage, so wie er es fast immer mit Spalters Fragen tat. »Hier in der Nähe gibt es einen See. Da sollten wir uns etwas Feines fangen, ich bin hungrig.«
»Seit wann magst du denn Fisch?«, wunderte sich der Gefährte,
»nennst sie doch sonst nur glitschiges Schuppenzeug!«, aber Tom schwieg, und so brachen sie auf, so eilig, dass der blutige Jäger vergaß, sich Ohr und Auge des Toten zu holen.
Der kuriose Vorfall mit dem bewaffneten Räuber, den er nur mit einem stinkenden Hecht in die Flucht geschlagen hatte, sprach sich schnell herum und veränderte im Viertel die Sicht auf Dermot Dill beträchtlich.
War er bisher nur für verschroben, zuweilen auch für grob und launisch gehalten worden, vermisste man ganz plötzlich den weichen Kern, den man immer unter der rauen Schale vermutet hatte. Teils bewunderte man ihn jetzt, teils hatte man etwas Angst vor ihm, in jedem Fall aber respektierte man ihn nun und nahm ihn ernst.
Nicht wenige meinten aber auch, er wirke auf sie zunehmend fremd, verändert, so als stünde er nicht mehr mit beiden Beinen auf dem Boden, und er selbst, wäre jemand mutig genug gewesen, ihm das zu sagen, hätte dem nicht widersprochen.
Denn das traf es genau, wie er sich fühlte: Gespalten und von Impulsen gelenkt, die er nicht als seine eigenen empfand. War denn das noch er selbst, mit seiner Sammlung pazifistischer Ansichten? Eines nämlich war gewiss: Hätte er statt eines Fischs ein Schwert in der Hand gehabt oder eine Machete, er hätte sie wohl nicht weniger entschlossen geschwungen.
War er etwa friedliebend nur aus Feigheit gewesen, weil er den Konflikt scheute, weil er Angst hatte vor der Auseinandersetzung, dem Streit, dem Kampf?
Er fand den Wirbel lästig, den seine Heldentat, die er gar nicht als solche empfand, vorübergehend entfacht hatte, und es kam ihm so vor, als müsse nun er die Folgen von etwas ertragen, das er gar nicht selbst, sondern ein ganz anderer verursacht hatte.
Besonders ödeten ihn gute Tipps an, wie er mehr aus sich und seinem Geschäft machen könnte, die er nun gelegentlich bekam. Der gute Rat des Vertreters einer Lokalzeitung etwa, der ihn dazu gebracht hatte, seine ›Waffe‹, den bewussten Hecht also, den er gut eingepackt in der Gefriertruhe hatte verschwinden lassen, für ein Foto wieder hervorzuholen und sich damit in dümmlicher Siegerpose zu präsentieren. Diesen ›prächtigen Raubfisch mit dem herrlich bösen Blick‹ solle er doch präparieren, riet ihm der Journalist, und dann an zentraler Stelle in seinem Schaufenster zeigen, vielleicht sogar verbunden mit einer Namensänderung für den Laden. Nicht mehr nur einfach und bescheiden ›Tierpräparator Dermot Dill - Spezialität Haustiere«, sondern weit effektvoller ›Der tolle Hecht‹ könnte dann sein Geschäft heißen, was sich sowohl auf den Fisch beziehen, darüber hinaus aber auch als humorvolle Anspielung auf den Inhaber des Geschäfts verstehen ließe. Aus so einer Sache könne, nein müsse man doch einfach mehr machen, als sie nur einzufrieren.
Dermot hörte sich das alles an, mürrisch aber noch höflich, sagte Jaja und gab dem Mann recht, um ihn schnell wieder loszuwerden. Was sein Geschäft betraf, so war ihm gerade ein wenig die Freude an seiner Profession abhanden gekommen, und es gab ihm nicht mehr so viel wie früher, dahingeschiedenen Haustieren zu einem zweiten Leben zu verhelfen, um damit ihre Besitzer glücklich zu machen. Und ein Fisch im Fenster, das zog doch schon wieder die falschen Kunden an.
Er legte den gefroren Hecht schnell wieder aufs Eis, sobald der angeblich so auf sein Wohl bedachte eitle Tippgeber, der früher in der Werbung gearbeitet hatte, wieder aus dem Laden verschwunden war.
Alles in allem war das für Dermot eine harte Zeit, und er war froh darüber, dass sich die Wellen seines Ruhms bald glätteten, um sich dann erneut zu kräuseln und andere Helden nass zu machen, die das vielleicht mehr schätzten oder brauchten als er. Manchmal wünschte er sich jetzt auszusteigen, ein freies und wildes Leben zu führen, schrankenlos, skrupellos, und nur den eigenen Gesetzen gehorchend.
Aber wo konnte man das noch in dieser Welt, wo es überall nur Regeln, Zertifikate, Urkunden und eine restlos aufgeteilte Zivilisation zu geben schien?
Noch dazu beschränkten auch die Anfälle seine Möglichkeiten, diese narkoleptischen Attacken, die nun häufiger und länger auftraten, wiederholt auch außerhalb der Schlafphasen.
So also war Dermots Befinden, so fremd und entwurzelt fühlte er sich, als er eines Abends, etwa zwei Wochen nach dem unglückseligen Überfall, die Tür zu seinem Laden absperrte.
Da sauste etwas großes Dunkles an seinem Kopf vorbei, verfehlte so knapp sein Ohr, dass es darin rauschte wie bei einer Sturmböe, und knallte dann mit der vollen Wucht seiner hohen Geschwindigkeit gegen die dicke, bruchsichere Glasscheibe der Ladentür. Fiel schlaff aufs Pflaster und blieb dort reglos liegen.
Dermot bückte sich und hob das Etwas an einer Flügelspitze hoch. Es war ein seltsamer Vogel, etwa so groß wie ein Habicht, von nicht genauer bestimmbarer, dunkler Färbung, auf dessen gedrungenem Rumpf zwei Köpfe saßen. Einer der Köpfe hing schlaff nach unten, vermutlich der, mit dem das Tier gegen die Scheibe geprallt war. Der andere bewegte sich noch und brachte ein heiseres Krächzen hervor, bevor auch ihm das Leben entwich. Aus einer Wunde, deren Wundkanal in der Brust begann, dann den Körper durchquerte und auf dem Rücken wieder austrat, tropfte Blut aufs Pflaster.
Dermot, der gelegentlich auch Präparate für die zoologische Sammlung des neuen Naturkundemuseums anfertigte, deren Konservator eine hohe Meinung von seiner Kunst hatte, waren schon viele animalische Kuriositäten untergekommen, aber er hatte noch nie ein Tier gesehen, das sich mit diesem Exemplar vergleichen ließ.
Was war das, und was war ihm wohl zugestoßen?
Die beiden Köpfe sahen nicht aus wie eine Missbildung, die meist funktionslos waren und oft sogar hinderlich. Vielmehr schienen beide voll beweglich gewesen zu sein, wirkten elegant geformt und aerodynamisch gut angepasst. Zweifellos war das Tier ein sehr guter Flieger gewesen, denn die ausgebreiteten Schwingen wiesen eine Spannweite von gut über einem Meter auf. Der enge Wundkanal, beim Einschlag vorne kaum größer als hinten beim Austritt, war vermutlich von einem sehr spitzen Geschoss mit großer Durchschlagskraft verursacht worden, wahrscheinlich einem Pfeil, denn ein stumpfes Projektil hätte den ganzen Vogel komplett zerfetzt.
Ein zweiköpfiger Greifvogel, getötet von einem Pfeil.
Wie überaus fremdartig! Und doch auf eine rätselhafte Weise vertraut. Dermot kämpfte mit den Tränen, ohne wirklich zu wissen, was diese große Traurigkeit in ihm hervorrief.
Er sperrte den Laden wieder auf, legte den toten Vogel behutsam, ja fast zärtlich auf den Arbeitstisch im Hinterzimmer und machte sich sofort an die Arbeit, dem toten Wesen, das ihm wie ein Bote aus einer anderen Welt erschienen war, ein zweites Leben einzuhauchen, ruhiger und beschaulicher sicher als das erste, als wunderbar lebensechte Momentaufnahme einer phantastischen Kreatur.
Lange, sehr lange hatte der Spalter darum gekämpft, Red Tom bei seinen Jagden begleiten zu dürfen, denn der grimmige, erbarmungslose Mann galt bei den Huntern als der Größte ihrer Zunft. Keiner hatte mehr Mulacken getötet und mehr Ohren eingelöst als er, höchstens noch Stauffer, eine andere Legende, doch der war nun schon seit fast zehn Umläufen tot. Unter den Lebenden aber war Red Tom die unbestrittene Nummer eins.
In der Nähe Toms hatte der Spalter sich stets sicher und gut gedeckt gefühlt, einen besseren Jagdgefährten konnte man nicht finden, und nie hätte er gedacht, es könnte eines Tages so weit kommen, dass er Tom von sich aus verließ.
Und doch geschah es, fünf Zyklen nach dessen verspätetem, zum Glück gerade noch rechtzeitigen Erwachen beim Angriff der Mulacken. Dieser Vorfall hatte Spalter zutiefst erschreckt, war aber nur der Anfang gewesen, der Anfang einer Reihe von nächtlichen Reisen, die der Geist des mächtigen Tom jetzt unternahm und sich dabei wiederholt verirrte. Immer häufiger hing Ocul nun umgedreht im Baum, ein sicheres Zeichen, dass es kein normaler Schlaf war, der sich da des Unbezwingbaren bemächtigt hatte.
Kein Zweifel, dieser Mann war nicht mehr ganz der alte, und der Spalter fühlte sich mit ihm nicht mehr sicher. Er fürchtete um sein Leben, hier in der gefährlichen Zone, wo man auf Schritt und Tritt Feinde traf. Zeit also, sich aufzumachen in ruhigere Gefilde, wollte er nicht bald an der Seite eines Schlafenden den Tod finden.
Da Tom aber, einmal aufgewacht, immer noch ein mächtiger Kämpfer war, zudem gelegentlich impulsiv und aufbrausend, wagte der Spalter nicht, mit ihm zu reden über seine Absicht, sich von ihm zu trennen. Es verstieß gegen den Kodex, einen Gefährten in den Wäldern des nördlichen Grenzgebiets alleine zu lassen. Denn dort war es nicht geheuer, es wimmelte von Mulacken und kein Hunter sollte nur auf sich selbst gestellt allein dort herumstreifen, erhöhte das doch die Chancen, hinterrücks getötet zu werden, beträchtlich.
Also verließ der Spalter den Roten Tom lieber heimlich, als dessen Geist wieder einmal umherirrte und damit zu rechnen war, dass er so bald nicht zurück sein würde. Jicho auf der Schulter, den Sack mit seinen Vorräten auf dem Rücken und die Axt kampfbereit in den Händen machte er sich auf den Weg, ohne sich noch einmal nach dem wie bewusstlos schlafenden Kameraden umzudrehen.
Er ließ Jicho nicht aufsteigen und entfernte sich im nahen, dichten Niederholz von Tom, damit dieser ihn nicht finden könnte, sollte er doch unerwartet schnell zu sich kommen. Zwar riskierte er damit, ohne Vorwarnung auf Mulacken zu stoßen, doch das nahm er in Kauf, viel lieber jedenfalls als die Möglichkeit, vom zornigen Tom aufgespürt und vom Spalter zum Gespaltenen zu werden.
In sicherer Entfernung wollte er dann versuchen, möglichst bald ruhige Gebiete zu erreichen, in denen es nur Wildschweine, Hirsche und Hasen gab, und nicht das Wild, das er hier gejagt hatte, das kahle und fahle, das manchmal auch schnell den Spieß umdrehen und den Jäger zur Strecke bringen konnte.
Als sein Geist wieder in seinen Körper zurückgekehrt war, später noch sogar als der Spalter zu hoffen gewagt hatte, brauchte Red Tom eine Weile, um zu begreifen, was geschehen war. Auch wenn er oft grob und gefühllos wirkte, war er dennoch kein unsensibler Mann und hatte schon gespürt, was den Gefährten beschäftigt hatte.
Wie auch nicht, dieses ganze Geschehen, das ihm vorkam, als würde er von einem immer schneller sich drehenden Strudel hineingesaugt in fremde, trübe Gewässer, diese Abstürze, die er nicht beeinflussen konnte, beunruhigten auch ihn. Dass der Spalter sich bei ihm nicht mehr wohl fühlte, konnte er verstehen, aber dass er so weit gehen würde, ihn im Stich zu lassen, das hätte er dann doch nicht erwartet. Was wollte er denn nun tun? Kein anderer Hunter würde ihn doch je wieder als Gefährten akzeptieren nach solch einem Verrat! Wie unsicher musste er sich mit ihm gefühlt haben, dass er die Ächtung dem Ausharren bei ihm vorgezogen hatte!
Nach diesem ersten Erstaunen aber stieg in Tom die kochend rote Wut hoch, und wäre der Verräter greifbar gewesen, hätte er ihn gewiss in tausend kleine Stücke zerhackt.
Als er sich wieder beruhigt hatte, schickte er Ocul hoch, blickte durch seine Augen und durchmusterte die Umgebung im weitesten Umkreis, der für sie möglich war, und ihre Reichweite war groß, größer als die meisten Hunter sie mit der Hilfe ihrer Augenvögel erreichen konnten, größer auch als die von Spalter und seinem Jicho.
Trotzdem konnte er nichts mehr entdecken, zu weit entfernt waren die beiden wohl schon, zu viel Zeit hatte ihnen zur Verfügung gestanden, sich zu davonzumachen, und wenn sie sich durchs Niederholz bewegt hatten, was sehr wahrscheinlich war, hätte er auch schon früher keine Spur mehr von den beiden entdecken können.
Zum Glück konnte er aber auch keine Mulacken in seiner Nähe ausmachen. Denen kamen die seltenen, vereinzelten Jäger immer für einen Überfall gerade recht, und sie schienen sie zu riechen, denn über Augenvögel geboten sie nicht, hatten dafür aber selber so geschärfte Sinne wie Wildtiere.
Irgendwo in der Nähe mussten auch immer noch die Mulacken sein, von denen er bereits einen erledigt hatte bei dem Versuch, den Spalter und ihn einzukreisen. Er war jetzt sehr gefährdet, das wusste er, viel mehr, als er es jemals gewesen war in der ganzen Zeit, die er nun schon als Hunter unterwegs war. Vor allem im Schlaf war er jetzt sehr verletzlich ohne Begleiter, wenn sein Geist so lange herumirrte und den Körper mied.
Er schwor sich, größte Vorsicht walten zu lassen, um es bis ins Fort zu schaffen, das immer noch fast eine Mondpassage entfernt war. Dort konnte er dann einen neuen Gefährten rekrutieren, einen besseren, der sich dem Kodex ernsthaft verpflichtet fühlte. Er würde diesen Verrat überleben, und dann würde er Spalter zu finden wissen, und wenn er sich in ein Mauseloch verkröche. Schon um ihn zu bestrafen, würde er am Leben bleiben. Solange er noch den fabelhaften Ocul hatte, war er nicht zu besiegen. Der treue Vogel würde über ihn wachen und ihn bei Gefahr rechtzeitig wecken.
Er packte seine Sachen in den Tragesack, nahm seine Waffen auf und zog los in Richtung Fort Balthus.
Einige Zyklen lang kam er gut voran.
Ocul kreiste im Wind über den Wipfeln, warnte ihn, wenn er etwas entdeckte, das Gefahr bedeuten konnte und erkundete den Weg, der vor ihnen lag.
Doch dann geschah etwas Schreckliches und Unwahrscheinliches zugleich.
Sie stießen auf Blasrohr-Mulacken, Pfeilspucker, wie die Hunter sie verächtlich nannten, denn die meist kurzgewachsenen Fahlen bliesen aus dem Hinterhalt kleine, aber ungemein spitze und harte Pfeile durch gut zwei Meter lange Rohre des Holzschilf. Die kleinen Geschosse trafen tödlich genau und hatten enorme Durchschlagskraft, denn die Pfeilspucker verfügten über außerordentlich kräftige Lungen.
Obwohl die Hunter sie als feige Lauertöter verachteten, die nicht wagten, sich im offenen Kampf zu stellen, waren sie der einzige Mulackenstamm, den sie wirklich fürchteten und mit dem sie einen Zusammenstoß vermieden, wann immer es ging. Leider waren Pfeilspucker selbst von den Augenvögeln nur sehr schwer zu entdecken, da sie oft stundenlang regungslos in ihrer Deckung auf eine günstige Gelegenheit zuzuschlagen warteten. Dann konnte sie sogar ein so scharfsichtiger Opteryx wie Ocul nicht aufspüren. Und einige der treuen, doppelköpfigen Späher waren aus diesem Grund schon von einem Pfeil durchbohrt worden.
So nahe beim Fort allerdings, wie Tom inzwischen war, stieß man gewöhnlich nie auf Blasrohr-Mulacken, denn das war den feigen Kalkratten zu riskant. Was diesen speziellen Trupp dazu bewegt hatte, ihrer grundsätzlichen Hasenfüßigkeit untreu zu werden, konnte er nur raten. Ein neuer Anführer vielleicht, noch jung und darauf versessen, sich zu beweisen? Eine Vermutung, mehr nicht.
Man muss davon ausgehen, dass Ocul die im Gebüsch lauernden, zum Himmel hin gut gedeckten Mulacken nicht sah, und auch nicht den auf ihn zurasenden kleinen Pfeil.
Alles, was er mitbekam, war wohl der heftige Schlag gegen die gefiederte Brust, vielleicht spürte er auch noch kurz, ganz kurz, den brennenden Schmerz am Rücken, genau zwischen den ausgebreiteten Schwingen, wo das mit so viel Druck beschleunigte, spitze Geschoss wieder austrat.
Aber so schmal der Grat zwischen Leben und Tod auch gewesen sein mochte, dem treuen Tier gelang es noch, seinen Herrn zu warnen, bevor es die Schwelle überschritt und kreisend wie eine herbstliche Ahornnase tot zur Erde herabstürzte.
Die Pfeilspucker durchsuchten gründlich das Gebiet, in dem sie seinen leblosen Körper vermuteten, sahen in und hinter jedem Busch nach, drehten jeden Stein um und schauten auch in die Bäume, falls er in einem davon hängengeblieben sein sollte. Aber sie fanden nichts, zu ihrer großen Enttäuschung, denn sie hängten gern die erlegten Augenvögel in die Giebel ihrer Langhäuser, und es bedeutete Ruhm und Ehre, wenn dort Trophäen von den Dienern der verhassten Jäger im Wind schaukelten.
Wären sie ganze Kerle gewesen wie die Hunter, hätten sie sich nun aufgemacht, um den Jäger zu suchen, der über den erlegten Augenvogel geboten hatte, hätten ihn aufgespürt und mit vereinten Kräften niedergemacht.
Aber sie waren Mulacken, Blasrohr-Mulacken obendrein, und folglich von weit weniger draufgängerischer Natur.
Also nahmen sie wieder Deckung und warteten, denn früher oder später würde der Herr des Vogels auftauchen und seinerseits nach dem Vermissten suchen. Vielleicht fand ja der ihn, umso besser, dann würden sie ihn doch noch bekommen, nachdem sie den nun so gut wie blinden Mann erledigt hatten, der zudem noch ganz allein unterwegs war, wie die Spuren verrieten, die er in den vergangenen Tagen hinterlassen hatte.
Red Tom war gewarnt und wusste, dass er nun extrem vorsichtig sein musste, wollte er nicht bald dem treuen Ocul nachfolgen. Dessen Tod hatte er nicht nur geahnt, sondern gespürt am eigenen Leib. Ein brennender Schmerz hatte ihm fast die Brust zerrissen. Die mentale Verbindung zwischen ihm und dem Opteryx war sehr eng gewesen, und jetzt spürte er den Verlust als Leere, die viel schlimmer war als der kurze Schmerz, den er miterlitten hatte, als der Vogel getroffen worden war.
Pfeilspucker mussten das gewesen sein, die Ocul vom Himmel geholt hatten, feige und hinterhältig, wie es ihre Art war. Noch nie war er so aufgewühlt gewesen, noch nie von so unbändiger Wut besessen. An den eigenen Därmen aufgehängt wollte er die feige Brut sehen, gepfählt durch ihre stumpfen Blasrohre, die ihre häßlichen kleinen Körper weit überragten.
Seine blinde Wut also muss es gewesen sein, die ihm das klare Denken trübte, sodass die überhebliche Geringschätzung seiner Feinde ihn schließlich zu Fall brachte. Wie oft hatte er Unerfahreneren gepredigt, es sei gefährlich, den Gegner zu unterschätzen, und nun schenkte er seiner eigenen Weisheit kein Gehör.
So nahm er also an, die Pfeilspucker seien nach der Ermordung Oculs nun auf der Flucht, von panischer Angst vor der Rache des mächtigen Jägers getrieben, völlig kopflos und nur darauf bedacht, sich möglichst schnell möglichst weit vom Ort ihrer schändlichen Tat zu entfernen.
Dabei hätte ihm doch auffallen müssen, dass dieser Trupp Pfeilspucker-Mulacken etwas anders war als er ihn einschätzte, mutiger nämlich, denn er hatte sich ja näher ans Fort herangewagt, als diese Horden es gewöhnlich taten. Und wenn sie offenbar schon mutiger waren als Tom es glaubte, vielleicht waren sie ja dann auch taktisch geschickter, als er ihnen das zutraute? Doch so klar dachte Red Tom nicht.
Nach Rache und Vergeltung dürstend rückte er ohne große Vorsicht zu dem Waldstück vor, in dem er den toten Ocul vermutete. Wenn er ihn gefunden und angemessen geehrt hatte, wollte er den Spuren seiner Mörder folgen und sie mit einem grausamen Tod bestrafen. Aber was er in dem fraglichen Gebiet fand, war nicht des Vogels durchbohrter Körper.
Es war sein eigenes Ende.
Man darf vermuten, dass Tom der Rote, der gefürchtete, legendäre Jäger, die im Gebüsch lauernden Pfeilspucker nicht sah, und auch nicht die kleinen Pfeile, die auf ihn zugerast kamen. Drei davon trafen, einer in die Brust, unterhalb der Rippenbögen, ein weiterer ein wenig tiefer, wo die Leber saß, und einer durchschlug mit furchtbarer Wucht und harter Spitze Toms Stirn, drang ins Gehirn vor und wurde erst vom Hinterhauptsbein gestoppt.
Der große, sich unbesiegbar wähnende Rote Tom war sofort tot. Sein Geist verließ ihn, und hinter ihm fiel die Tür ins Schloss.
Nie wieder würde er in dieses Haus, das nun verfiel, zurückkehren können. So irrte er eine Weile umher, wie er es gewohnt war, bis er endlich weiter in das Land zog, aus dem noch keiner wiedergekommen war.
Als die Mulacken merkten, dass es der große, der schreckliche Rote Tom war, den sie getötet hatten, schnitten sie ihm den Kopf ab, eine Sitte, der sie eigentlich schon seit Generationen nicht mehr anhingen, um den Schädel zu präparieren und ihn zusammen mit der Ohrenkette als Glücksbringer in den Giebel ihres Langhauses zu hängen, wenn sie schon den Augenvogel nicht hatten finden können, der noch viel kostbarer war.
Alle anderen Überreste des unerbittlichen, grausamen Feindes ließen sie liegen, damit er der Natur etwas zurückgeben konnte.
Der doppelköpfige Vogel, der gegen seine Tür geflogen war, wurde Dermot Dills Glanzstück. Er wirkte so lebensecht, dass er beinahe versucht hätte, ihn zu füttern. Er war sehr stolz auf seine Arbeit und wollte sie gern der Welt zeigen, aber wenn er sie im Fenster ausgestellt hätte, würde man ihn vielleicht für einen dieser unseriösen Scherzbolde gehalten haben, die präparierten Eichhörnchen die Flügel oder Schnäbel von Enten anhefteten, oder auch Hasen kleine Hörner verpassten, um Leichtgläubigen dann für diese vorgeblich echten Fabelwesen Geld aus der Tasche zu ziehen.
Er überlegte, ob er das Präparat dem Konservator der zoologischen Sammlung im Naturkundemuseum zeigen sollte, fürchtete aber, von ihm getadelt zu werden, weil er ihm den ungewöhnlichen Vogel nicht sofort und unbehandelt überlassen hatte, damit er ihn nach allen Regeln der Kunst wissenschaftlich exakt untersuchen und studieren konnte. Nein, besser nicht aus purer Eitelkeit riskieren, von ihm keine Aufträge mehr zu bekommen, denn mittlerweile hing er doch wieder sehr an seiner Profession. Zudem hatte er das irritierende Gefühl, diese ganze Sache sei doch eher etwas Persönliches.
Also hängte er sein Meisterstück schließlich an die Wand seiner
Werkstatt, die nur er allein betreten durfte.
Wenig später hatte er seinen letzten Tiefschlafanfall.
Es war eine seiner schwersten Episoden dieser Art überhaupt, und diesmal kam sie nicht im Schlaf. Sie überraschte ihn zum ungünstigsten Zeitpunkt, und hätte beinahe eine nicht nur sein eigenes Leben bedrohende Katastrophe ausgelöst.
Im hinteren Bereich seines Ladens hatte er sich neben der Werkstatt auch eine kleine Küche eingerichtet, in der er sich Essen warm machen oder Kaffee kochen konnte. Dazu verwendete er einen uralten Camping-Gaskocher, der den aktuellen Sicherheitsbestimmungen nicht mehr genügte, ihm aber ungefährlich erschien.
Die narkoleptische Attacke kam, als er am Mittag den Knebelschalter für die Gaszufuhr aufdrehte, um den Kocher in Betrieb zu nehmen und sich eine Suppe aufzuwärmen. Dermot sank in sich zusammen als hätte man einen Roboter abgeschaltet. Das Propangas strömte aus und füllte den Raum langsam von unten nach oben.
Für den auf dem Fußboden Liegenden war das sehr gefährlich.
Der Tiefschlaf konnte von Bewusstlosigkeit und sogar Koma abgelöst werden, wenn er zuviel von dem Gas einatmete.
Wenn dann zu dem brisanten Gemisch aus Gas und Luft noch ein kleiner Funke dazukam, konnte er eine Explosion auslösen, das ganze Haus zum Einsturz bringen und einigen Menschen, darunter auch Dermot, das Leben kosten.
So hätte es geschehen können, wenn alles schiefgelaufen wäre, was nur schieflaufen konnte.
Aber es kam zum Glück anders, denn Dermot hatte die fast leere Gasflasche noch nicht gegen die schon bereitstehende volle ausgewechselt, so wie er es sich für den Vormittag vorgenommen hatte. Denn da war der dunkle, zweiköpfige Vogel plötzlich von der Wand gefallen. Vermutlich war das große Stück etwas zu schwer gewesen für die Dübel, die in der bröseligen Altbauwand nur schlecht hielten.
Und so hatte er sich derart lange damit abgemüht, seinem Prachtstück wieder zu einem sicheren Halt zu verhelfen, dass für den Austausch der Flaschen keine Zeit mehr geblieben war.
Dermot war nicht besonders religiös oder esoterisch eingestellt, doch als er wieder erwachte, hatte er das Gefühl, vom Hauch einer weit entfernten, fremden und rauen Welt umweht zu werden. Irgendwoher wusste er, dass soeben etwas Bedeutendes geschehen war, etwas Endgültiges, ohne die geringste Ahnung zu haben, was es gewesen sein konnte. Er sprach nicht darüber, mit niemandem, denn er hätte es nur schwer beschreiben und noch viel weniger erklären können. Obwohl diese kritische Episode gerade noch einmal gut ausgegangen war, befürchtete er eine Zeit lang, es würden nun weitere, immer gefährlichere und schwerere folgen.
Verständlich, denn da wusste er ja noch nicht, dass dieser mit viel Glück oder auch jenseitiger Hilfe überstandene Anfall sein letzter gewesen sein sollte. Doch als die Attacken ausblieben, über Tage, Wochen und sogar Monate hinweg, kam eines Tages für ihn der Punkt, an dem er davon überzeugt war, der Spuk sei nun wohl endgültig vorbei.
Was ihm da widerfahren war, wusste er nicht, und kein Arzt oder Psychologe konnte ihm, dessen war er sich ganz sicher, eine Erklärung anbieten, die ihm noch besser gefallen hätte als seine tiefe Überzeugung, in ihm hätten sich zwei fremde Welten berührt, mehr noch, sie seien sich zu nahe gekommen, näher als beiden gut tat.
Was in der anderen passiert war, würde er nie erfahren, aber, soviel ahnte oder glaubte er, das Schicksal hatte dort wohl hart zugeschlagen, und er, er war noch einmal mit dem Schrecken davongekommen.
Damit gab er sich zufrieden, vergaß die Sache über die Jahre und für den zweiköpfigen Vogel an der Wand seiner Werkstatt fand er eine Erklärung, die in seine Welt passte.
Vierzig Tonnen Tod
Ayden Zech war ein hagerer und eher wortkarger Mensch, den nur die allergönnerhaftesten Greise noch herablassend ›junger Mann‹ genannt hätten. Welcher Profession er nachging konnte man nur schwer erraten, so stark unterschied er sich vom üblichen Bild, das man sich gemeinhin so von einem Journalisten machte, denn dass er ein guter Zuhörer war, merkte man erst, nachdem man länger mit ihm geredet hatte und sich nach diesem Gespräch endlich einmal wirklich verstanden fühlte.
Seine Spezialität waren kluge, gut recherchierte Hintergrundgeschichten auf hohem Niveau über Leute, die im Zentrum des öffentlichen Interesses standen, aus welchem Grund auch immer. Allerdings mied er gern solche, die um jeden Preis dorthin wollten, oder die sich bereits länger im Licht voyeuristischer Neugierde sonnten, und er bevorzugte jene, die eher zufällig ins Visier medialer Beobachtung geraten waren, ohne Absicht und ohne eigenes Zutun.
Früher, am Anfang seiner Karriere, hatte er sich gelegentlich auch mit dem Typ Nummer eins befassen müssen, wobei ihm sehr schnell klar geworden war, dass der andere fast immer wesentlich interessanter war. Was vermutlich daran lag, dass die spannenderen Leute nicht immer ein bestimmtes Bild von sich abliefern wollten und deshalb auch nicht ständig versuchten, sich dazu passend zu präsentieren.
Dass der neueste Gegenstand seines Interesses, falls man einen Menschen so nennen durfte, ihn solcherart langweilen würde, konnte allerdings mit einiger Sicherheit ausgeschlossen werden, obwohl der Mann prominent war, und in breiten Schichten der Gesellschaft durchaus kein Unbekannter. Jedoch war er tot, erst vor Kurzem verschieden, und es waren die näheren Umstände seines plötzlichen Todes, die sowohl großes mediales Aufsehen als auch Zechs Aufmerksamkeit so sehr erregt hatten, dass er bei Carl Unger anfragte, ob er an einer Hintergrundstory über Sero Kampp interessiert sei, der vor Kurzem so ungewöhnlich spektakulär das Zeitliche gesegnet hatte.
Unger war Verleger und Chefredakteur des Wochenmagazins NACHHALL, das mitunter auch Nachrufe und gute Background-Stories brachte, und klar wollte der etwas, keine Frage bei einer solchen Geschichte.
Recherchen im Netz ergaben, dass Sero Kampp mit großer Wahrscheinlichkeit der erste Mensch überhaupt war, der durch den direkten Treffer eines Meteoriten getötet worden war.
Und was war das für ein Brocken! Ein über zwei Meter langer Klumpen aus purem Eisen, mit angeschmolzener, schwarz glänzender Oberfläche und, welche Ironie, von kosmischen Kräften modelliert wie ein Körperformsarg, dem Fachmann auch als italienischer Sarg bekannt, hatte erst das Dach und dann die Decke des Erdgeschoßes durchschlagen, den Pechvogel, der in seinem Bett lag und schlief, zerschmettert und im Keller der geräumigen, zweigeschoßigen Villa unter sich begraben.
Nach einem Milliarden von Kilometern langen Flug durch das Sonnensystem war er in die Erdatmosphäre eingedrungen und hatte, glühend und fauchend, dem Leben eines Menschen ein spektakuläres Ende gesetzt.
Zech hatte die freigegebenen Fotos vom Ort des Einschlags gesehen, und er musste zugeben, dass es wirklich schwer war, an einen Zufallstreffer zu glauben. Zu sehr sah alles danach aus, als habe es ein Gott, das Universum oder das Schicksal, wie immer man die lenkende höhere Macht nennen wollte, sehr persönlich gemeint und den Mann gezielt und mit voller Absicht erschlagen. Was mochte er wohl getan haben, um ein Eingreifen von solch archaischer, alttestamentarischer Wucht herauszufordern? Die Vermutungen und Spekulationen darüber sprudelten schon reichlich aus den üblichen Quellen und riefen laut nach seriöser Recherche und Richtigstellung. Und das möglichst schnell, wie der alte Hase Unger betonte, solange das vom Himmel gestürzte Eisentrumm und die ungeborgene Leiche darunter noch warm waren, und damit immerhin das Interesse an diesem Fall noch am Leben.
Als Zech in die Sache einstieg, merkte er schnell, dass er nicht der Einzige war, der da versuchte, etwas abseits vom üblichen journalistischen Tagesgeschäft Tiefschürfendes über das Todesopfer in Erfahrung zu bringen.
Und leider auch nicht der erste.
Unger, stets allwissend was sein Business betraf, steckte ihm mit provozierendem Grinsen, dass bereits Ugo Gretzky und Jazna Jarma an dieser Sache dran waren. Zech kannte die beiden ganz gut persönlich und schätzte sie als Menschen und Kollegen, besonders Jazna, während Ugo ihm einen Hauch zu narzisstisch und zu überdreht war, obwohl auch er hervorragend recherchierte Artikel abgeliefert hatte, wie etwa den über Gennadi Rŭbsam, den umstrittenen Genschneider.
Zech verabscheute Konkurrenz-Situationen wie diese, die ihn dazu zwangen, sich etwas Besonderes einfallen zu lassen, das die gewiss fundierten und informativen Beiträge der anderen noch ein wenig übertraf, wobei immer die Gefahr bestand, die Grenze zum billigen Sensations-Journalismus zu überschreiten. Viel lieber hätte er in aller Ruhe und Stille das Psychogramm eine Mannes verfasst, der seine Umgebung zu begeistern und zu faszinieren verstand, erfolgreich in seinem Metier agierte, gleichzeitig aber auch oft mit seinen Ideen polarisierte, und der noch bei seiner Mutter wohnte, im selben Zimmer wie schon als kleines Kind.
Wobei dieser Raum freilich bereits damals schon kein übliches Kinderzimmer gewesen war, mit seinen über hundert Quadratmetern und den wertvollen Louis-quatorze-Möbeln, in deren Mitte er aufwuchs wie ein Prinz.
Was machte es aus einem Menschen, auf diese Art groß zu werden? Mit einem eigenen Butler und einem Hauslehrer, der nach Beendigung der Schulzeit durch einen Privatsekretär ersetzt wurde, welcher dem Studenten Kampp die Referate und die einzureichenden Probearbeiten tippte?
Wie es schien, kümmerte dieser Mann sich immer noch um alles Wichtige, auch und gerade um das Unangenehme, so wie jetzt um sämtliche Dinge, die durch den unerwarteten Tod seines Herrn anfielen. Selbst den seltenen Spezialkran hatte er organisiert, der den geschätzt vierzig Tonnen schweren Eisensarg aus dem All anheben sollte, damit das, was von Kampp übriggeblieben war, mit angemessener Pietät aufgesammelt und eingeäschert werden konnte, hermetisch abgeschirmt vor den neugierigen Augen der Öffentlichkeit.
Auch um alle Termine, die zu machen waren, kümmerte sich der Mann, der Tangens Holm hieß und sogar einen Doktortitel besaß. Er hielt den Kontakt zu den Medien, wimmelte ab, wen er als nicht passend empfand und ließ nur jene zu, die er für annehmbar und seriös hielt.
So jedenfalls legte sich Ayden Zech das zurecht, als Holm ihn höflich angehört, auf einige seiner bekannteren Essays angesprochen und ihn dann zu einem medialen Sammeltermin eingeladen hatte, einer Art Pressekonferenz auf dem Gelände, das die Villa der Kampps umgab.
Das war nicht das, was Zech sich erhofft hatte. Viel zu offiziell und zu öffentlich, zu wenig vertraulich und im Grunde durch einen Volontär zu erledigen. Trotz allem, vielleicht konnte er ja bei dieser Massenveranstaltung herausfinden, wie er weiter vorgehen und sich wie ein Wurm durch die harte, glatte Schale der Frucht beißen konnte, um näher an den Kern heranzukommen.
Der Info-Termin, der den Eingeladenen auch die Gelegenheit bieten sollte, Fragen zu stellen, fand regen Zulauf. Der Fall war also, ganz nach Ungers Geschmack, noch warm, denn die Tagespresse hatte zwar groß aufgemacht darüber berichtet, aber vieles war noch offengeblieben, das mit wilden Spekulationen und mit mehr oder weniger passendem Material aus den untersten Schubladen aufgefüllt worden war. Diesen medialen Auswüchsen sollte hier nun offenbar entgegengewirkt werden, zumindest ließ das, was Holm so ankündigte, das vermuten.