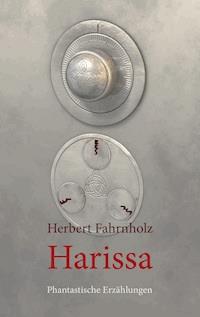1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Ein Soap-Darsteller, der aus seiner Serie herausgeschrieben wurde, landet in einem demütigenden und perfiden Zweitverwertungs-Event - der Designer einer hochautomatisierten kommerziellen Haftanstalt wird zum Gefangenen seiner eigenen Einrichtung - bei einem Cyborg, halb menschlich halb mechatronisch, gerät immer mehr die Abstimmung seiner Komponenten aus dem Gleichgewicht - eine verunglückte junge Frau, der uralten keltischen Zeitreisetechnik des Stromwanderns mächtig, erweitert mit der Hilfe eines aufgeklärten Traumatherapeuten ihre Möglichkeiten - der altgediente Bildauswerter einer aufstrebenden Sicherheitsfirma erlebt einen personalisierten Countdown, von dem er lange nicht weiß, ob er real ist und was an seinem Ende stehen wird, sollte er nicht nur einer berufsbedingten Paranoia entsprungen sein... Spannungsgeladene Szenarien, ungewöhnliche Akteure und bizarre Schauplätze: Bildreich und lebendig erzählt, lassen die Geschichten dieser Sammlung den Leser oft nachdenklich, aber immer auch gut unterhalten zurück.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 472
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Das Buch
Ein Soap-Darsteller, der aus seiner Serie herausgeschrieben wurde, landet in einem demütigenden und perfiden Zweitverwertungs-Event;
der Designer einer hochautomatisierten kommerziellen Haftanstalt wird zum Gefangenen seiner eigenen Einrichtung;
bei einem Cyborg, halb menschlich halb mechatronisch, gerät immer mehr die Abstimmung seiner Komponenten aus dem Gleichgewicht;
eine verunglückte junge Frau, der uralten keltischen Zeitreisetechnik des Stromwanderns mächtig, erweitert mit der Hilfe eines aufgeklärten Traumatherapeuten ihre Möglichkeiten;
der altgediente Bildauswerter einer aufstrebenden Sicherheitsfirma erlebt einen personalisierten Countdown, von dem er lange nicht weiß, ob er real ist und was an seinem Ende stehen wird, sollte er nicht nur einer berufsbedingten Paranoia entsprungen sein…
Spannungsgeladene Szenarien, ungewöhnliche Akteure und bizarre Schauplätze: Bildreich und lebendig erzählt, lassen die Geschichten dieser Sammlung den Leser oft nachdenklich, aber immer auch gut unterhalten zurück.
Der Autor
Herbert Fahrnholz wurde 1949 in Regensburg geboren und studierte nach dem Abitur Psychologie. Ab Beginn der achtziger Jahre war er als bildender Künstler in den Bereichen Fotografie und Objektkunst, sowie Druck- und Computergrafik tätig.
Seit 2013 schreibt er Gedichte, Kurzgeschichten und Romane, die er mit eigenen Illustrationen ausstattet. Die zwölf Erzählungen des hier vorliegenden Bandes entstanden in den Jahren 2016 und 2018.
INHALT
CRABs
Das Oktopus-Gen
Zweite Chance für den Biber
Fluchtpunkt
105 oder die Liebe zum Kind
Die Friedenskatze
Die bessere Hälfte
Stromwanderer
Die Schlange des Gilgamesch
Countdown
Der letzte Lurch
Eine enttäuschende Apokalypse
CRABs
Der handtellergroße Körper der metallenen Kreatur drehte sich planlos im Kreis. Acht lange Beine trommelten einen chaotischen Rhythmus auf den harten Asphaltstreifen, der sich zwischen all den Gras- und Moosflächen, die ihn umgaben, beharrlich seine graue Glätte bewahrt hatte.
Am Rumpf der stählernen Krabbe blinkten zwei blaue Lichter eine einfache, periodische Zeichenfolge, als ob ein Signalcode abgesetzt würde.
Nur wenig später lief ein zweites Exemplar schnell und geschickt über den aufgerissenen, krümeligen Boden und näherte sich dem orientierungslosen Artgenossen.
Vorsichtig kam es heran und betastete sein immer noch kreisendes Gegenstück behutsam mit den Greifscheren.
Die blinkenden Lichter auf dem Körper der defekten robotischen Krabbe erloschen. Sie stellte ihre Drehbewegungen ein, wandte sich unverzüglich dem Helfer zu und schoss, ohne einen Augenblick zu zögern, aus der Vorderseite ihres Kopfes einen scharf gebündelten roten Strahl auf ihn ab.
Die Samariter-Krabbe wurde zwischen den gestielten Augen an der Stirn getroffen. Ein Dampfwölkchen stieg auf und ein Tropfen geschmolzenes Metall fiel auf den asphaltierten Flecken.
Dem abgeschossenen Exemplar knickten die Beine ein.
Es sackte in sich zusammen und bewegte sich nicht mehr.
Der Schütze begann abermals zu rotieren und zu blinken.
Doch diesmal kam kein hilfsbereiter Artgenosse, sondern ein mittelgroßer, hagerer Mann, dessen jugendliche Bewegungen nicht so recht zu seinem alten, vom Wetter gegerbten Gesicht passten. Er trug eine mit Fransen verzierte, ärmellose Weste aus speckigem Wildleder über einem rotkarierten Baumwollhemd, dazu eine grüne Latzhose wie ein Gärtner, auf dem Kopf einen schwarzen Zylinder und an den Füßen merkwürdige verspiegelte Stiefel, die ihm fast bis an die Knie reichten.
Die metallene Krabbe versuchte, sich in eine günstige Schussposition zu bringen, aber der seltsam Gekleidete war schneller, richtete seinerseits ein kleines schwarzes Kästchen auf den zielsuchenden Gliederfüßer und drückte auf einen Knopf.
Sofort knickte der Schütze ein, dem Vorbild des eben von ihm erlegten Exemplars folgend, und blieb regungslos neben seinem Opfer liegen.
Der Mann sammelte die beiden Stahlkrebse auf und verstaute sie behutsam in einem braunen Lederrucksack, der über seiner Schulter hing.
»Ab in die Werkstatt mit euch beiden«, kommentierte er laut.
»Ihr benehmt euch ja schon wie Menschen.«
Dann stapfte er durch den ungezügelten Wildwuchs zu den siebenstöckigen, verfallenden Wohnblöcken, die rundum aus dem Dickicht aufragten.
Die ›Verbotene Zone‹ lag im Norden der riesigen Stadt und war nicht schon immer verboten gewesen.
Vor dreissig Jahren war sie nur ein hoffnungslos tristes, heruntergekommenes Viertel am Stadtrand, beherrscht von uniformen Wohnschachteln, die alle sieben Stockwerke hatten und fünf Treppenhäuser, über die man in jeweils genau siebzig trostlose, aber gerade noch bezahlbare Wohneinheiten gelangen konnte.
Jede der Betonschachteln war in einem anderen Farbton gestrichen, damit man sie auseinanderhalten konnte.
Aber es wäre im Grunde genommen egal gewesen, in welche dieser Behausungen man gegangen wäre, denn dort herrschte überall dasselbe Elend und dieselbe Abgestumpftheit, überall vegetierten da die Bewohner eher wie Pflanzen, als dass sie wie Menschen lebten. Solange man sie gut feucht hielt, mit mehr oder weniger verdünnten alkoholischen Lösungen und sie genügend Licht aus ihren Fernsehgeräten abbekamen, konnten sie dort Wurzeln schlagen und sich vermehren und dabei helfen, die Kassen gieriger Hedgefonds zu füllen, die diese Gebäude, mit hämischer Ironie auch ›Sozialbauten‹ genannt, für einen Pappenstiel erworben hatten.
Es erfüllte für sich alleine schon den Tatbestand von Körperverletzung und seelischer Grausamkeit, Menschen in dieser Umgebung wohnen und dafür auch noch bezahlen zu lassen.
Aber solange das pure physische Überleben dort noch möglich war, kam natürlich niemand auf solche Gedanken.
Gesperrt wurde das Viertel erst, als diese Möglichkeit, buchstäblich explosionsartig, vom einen zum anderen Moment verpuffte und dort alles radioaktiv verseucht wurde.
Urheber dieser Verstrahlung war ein junger Mann gewesen, der, aufgewachsen im trostlosen Umfeld dieses Stadtbezirks, verzweifelt versucht hatte, seinem Leben am äußersten Rand der Gesellschaft einen Sinn zu geben.
Rekrutiert als Kämpfer für einen archaischen Gottesstaat war der Extremist auf ein überraschend modernes, aber auch recht kompliziertes Kampfmittel verfallen und hatte sich am Bau einer radiologischen Waffe versucht.
Leider waren die einschlägigen Anleitungen aus dem Netz sehr ungenau und fehlerhaft gewesen, sodass dem Krieger seine schmutzige Bombe eines schönen Nachmittags um die Ohren geflogen war.
Der Bastler starb dabei wie gewünscht den Märtyrertod und in der zitronengelb gestrichenen Wohnschachtel kamen weitere fünf Menschen durch die Explosion ums Leben.
Das war schlimm; noch weit schlimmer aber war es, dass durch die Detonation Kobalt 60 freigesetzt wurde, das vermutlich aus schlecht gesichertem Gerät für die medizinische Strahlentherapie stammte. Wie der tote Bombenbauer an dieses stark radioaktive und hochgefährliche Material gekommen war, konnte nie zufriedenstellend geklärt werden. Aber man hielt es für wahrscheinlich, dass er, wäre er nicht durch die Explosion gestorben, den Emissionen der schwer zu handhabenden Gammastrahlen-Quelle alleine erlegen wäre.
Natürlich bemerkte man die Katastrophe nicht sofort, und so kam es zu schweren Verstrahlungen rund um den Wohnblock, der zu großen Teilen zerstört worden war.
Sanitäter, Polizisten und Feuerwehrleute waren als Erste betroffen und viele von ihnen klagten bald über Kopfschmerzen und Übelkeit oder erbrachen Blut.
Bis man die Gefahr erkannte, an solchen Symptomen und an der auffallend großen Zahl von Bleiplatten, die am Unfallort verstreut waren, vergingen mehrere Stunden.
Dann endlich wurden Strahlungsmessungen durchgeführt, die eine sofortige Evakuierung und weiträumige Sperrung des Viertels zur Folge hatten.
Die Bewohner durften nur mitnehmen, was in einen einzigen Koffer passte und man versprach ihnen, dass sie nach drei Tagen zurückkehren könnten.
Aber aus den Tagen wurden Wochen und den Leuten aus der Zone wurde langsam klar, dass sie wohl nie mehr zurückkehren würden. Und dass sie alles, was sie in der Zone an Besitz hatten zurücklassen müssen, endgültig vergessen konnten. Das waren keine großen Reichtümer, aber doch vieles, woran sie gehangen hatten und das für sie, wie es so schön hieß, von ›sentimentalem Wert‹ war.
Nach und nach wurden sie aus den Notunterkünften heraus auf andere Viertel an anderen Stadträndern verteilt, die ebenso hässlich, ebenso verwahrlost und ebenso deprimierend waren wie jenes, das nun zur ›Verbotenen Zone‹ geworden war.
Manche der gesichtslosen Blöcke, die sie nun bezogen, gehörten sogar denselben Investmentfonds. Wie sollten sie sich da nicht schnell wieder zuhause fühlen in ihrer neuen Umgebung?
Nur die entstandene Tabuzone selbst machte Probleme, denn es versuchten immer wieder Waghalsige, dort einzudringen.
Entweder waren es ehemalige Bewohner, die noch Habseligkeiten aus ihren Behausungen holen wollten, oder es waren Plünderer mit ganz ähnlichen Absichten. Aber auch Jugendliche in Abenteuerlaune, für die das alles ein spannendes Spiel war, oder einfach nur Neugierige, die sehen wollten, wie es dort jetzt aussah, ließen sich alles Mögliche einfallen, um die anfangs noch unzureichenden und lückenhaften Absperrungen zu überwinden. Dass ihnen dort in der Zone wirklich Gefahr drohte, glaubten sie nicht; hatten doch Magistrat und Regierung ihr Bestes getan, um eine Massenpanik zu vermeiden und alles so weit heruntergespielt, dass sich nun keiner mehr ernsthaft bedroht fühlte. Um ihrem Erfolg wieder etwas entgegenzuwirken, veröffentlichten die amtlichen Stellen eine Auswahl von schockierenden Bildern Strahlengeschädigter, die nun schon sichtbare Folgen in Form von Verbrennungen der Haut, großen offenen Wunden und Haarausfall aufwiesen. Neben der Polizei postierte man noch zusätzlich Soldaten an den Zonenrändern, die dort so lange Wache schoben, bis die Bauarbeiten an der geplanten hermetischen Abriegelung beendet waren. Das zog sich hin, denn man hatte es mit einem Gebiet von 700 Metern Radius rund um den Ausgangspunkte der Kontamination zu tun, einer Mauer also von reichlich vier Kilometern Länge, die eine Fläche von anderthalb Quadratkilometern umschloss.
Aber nach zwei Jahren intensiver Bautätigkeit, die durch diverse Sonderauflagen zum Schutz der Arbeiter erschwert worden war, ließ der Magistrat stolz verkünden, das Projekt sei nun abgeschlossen. Das Militär wurde wegbeordert und widmete sich wieder seiner Kernkompetenz, dem Töten von Menschen in weit entfernten Gebieten, und fortan patroullierten nur mehr lokale Polizeistreifen locker an der neuen Mauer, von der man annahm, sie reiche dazu aus, die Zone komplett abzuschotten.
»Immer dasselbe. Das Modul für Beuteschema und Raumorientierung ist durchgeschmort. War womöglich keine so geniale Idee, das miteinander auf ein einziges Bauteil zu packen, Herr Cheftechnicus. Die MBR geben jetzt so nach und nach alle den Geist auf.«
Der Mann mit dem gegerbten Gesicht sah vom Stereomikroskop auf und öffnete eine Schublade. Er holte eine Schachtel heraus und entnahm ihr mit einer Pinzette aus Kunststoff ein zuckerwürfelgroßes, graues Teil mit einer Unmenge von Drahtfüßchen an der Unterseite, die es wie elektronisches Ungeziefer aussehen ließen. Dann beugte er sich wieder über die Vergrößerungsoptik und machte sich daran, die defekte Schaltung auszutauschen.
»Das gibt eine Menge Arbeit in nächster Zeit«, stellte er fest, nahm den vielbeinigen Stahlkrebs vom Objektträger und sandte ihm mit dem schwarzen Kästchen ein Signal. Die Roboter-Krabbe erwachte blinkend zu neuem Leben, lief auf dem Tisch vor und zurück und aktualisierte ihre Positionbestimmung.
Unterdessen holte ihr Wartungstechniker aus einem Käfig eine graue, ein wenig räudig wirkende Maus und setzte sie auf den Tisch. Blitzschnell wandte sich der Krebs ihr zu und nahm sie ins Visier.
Die Maus fiepte ängstlich.
Die Krabbe schoss einen roten Laserstrahl ab, der den Nager exakt zwischen die schwarzen Knopfaugen traf.
»Bah, stinkt das immer! Aber seis drum, brav gemacht, Cindy.«
Der Mann packte den kopflosen Mäusekörper am Schwanz, trat mit seinem verspiegelten Stiefel auf das Pedal eines Treteimers und warf den qualmenden Torso in den Blechbehälter.
Er schaltete die Krabbe wieder ab und überprüfte mit einem langen, stiftförmigen Instrument die Akkus.
»Reicht noch bis zum Abend«, diagnostizierte er und legte Cindy beiseite.
Dann holte er aus seinem Rucksack die andere Robo-Krabbe, die ein kleines Loch mit geschmolzenen Rändern im Kopf hatte und drehte sie abschätzend zwischen den Fingern.
»Aber das hier sieht übel aus. Wird wohl eine etwas größere Operation werden, Harry. Cindy hat dich voll erwischt. Nimms ihr nicht übel, Alter, sie war krank.«
Er legte Harry auf den Objektträger des Mikroskops mit der Doppeloptik und blickte durch die Okulare.
»Du meine Güte«, sagte er beeindruckt, »da brauchen wir ja wohl einen komplett neuen Kopf. Wie kann sie das nur? Ne richtige Furie, das alte Mädchen.«
Kopfschüttelnd machte er sich daran, den getroffenen Krebs zu zerlegen.
Man muss dem Magistrat zugute halten, dass es keinerlei Erfahrungen mit der Isolierung einzelner Wohngebiete einer Großstadt gab. Bisher hatte man nur ganze Ortschaften oder Areale rund um ein Kernkraftwerk abgeriegelt, einmal sogar eine ganze kleine Stadt mit fünfzigtausend Einwohnern.
Aber natürlich wollte man nicht wegen eines verseuchten Randgebiets die riesige Mega-Millionenstadt aufgeben und so versuchte man sich an der Premiere der Abschottung eines verstrahlten Teilgebiets und machte dabei zwangsläufig auch einige Fehler.
Zum Beispiel bemerkte man erst sehr spät, genauer gesagt etwa zehn Jahre nach Fertigstellung der Mauer, dass die neu errichtete Barriere nicht so undurchlässig war, wie die massive, vier Meter hohe Bauweise rein optisch glauben machen wollte.
Je mehr nämlich die Natur die verstrahlte Zone wieder in Besitz nahm, je mehr es dort grünte und sprießte, desto mehr Getier tauchte auf und siedelte sich dort an. Es überschritt die Grenzen aber nur allzu oft auch wieder in Richtung der daran angrenzenden, dicht bewohnten Viertel, in denen eine Vielzahl von verstrahlten Insekten, Vögeln und kleinen Nagern nun für Aufregung sorgten. Dabei schienen die Tierchen selbst die Strahlung erstaunlich gut wegzustecken, waren aber nun zu unkontrollierten, mobilen Quellen harter Strahlung geworden.
Sogar radioaktive Waschbären waren schon gesichtet und von verängstigten Anwohnern erlegt worden. Irgendwie hatten sie die offenbar nicht an allen Stellen gleich undurchlässige Mauer überwinden können, waren dann aber lieber auf ein Gebiet übergewechselt, in dem die Mülltonnen regelmäßig neu befüllt wurden.
Diese Durchlässigkeit war sehr unerfreulich, denn nichts, was einmal in der Zone gewesen war, sollte diese so einfach wieder verlassen und andere Stadtteile verunreinigen können.
Selbst wenn man davon ausgehen konnte, dass das Ausmaß der Kontamination, die auf diese Weise verursacht wurde, eher gering war, so blieb doch die Angst und Verunsicherung der Nachbarschaft, die sich leicht zur Panik aufschaukeln konnte und schon allein deshalb sehr ernst genommen werden musste.
Am leichtesten überwanden die Einzäunung natürlich Tiere, die fliegen konnten, wie Vögel, Fledermäuse oder ungezählte Insektenarten. Sie kamen und gingen, wie es ihnen beliebte.
Um dem ein Ende zu bereiten, errichtete man auf der Mauer zusätzlich eine engmaschige, an die hundert Meter senkrecht nach oben reichende energetische Abschirmung, in deren Schlingen die grenzüberschreitenden Luftikusse hängen blieben und gegrillt wurden. An manchen Tagen, vor allem an den warmen, trieben nun stakkatoartiges Geknatter und ein brenzliger Gestank aus der Richtung der Sperrzone über die Stadt.
Auch den leichtsinnigen Aktionen einiger unbelehrbarer Zweibeiner, die ab und zu mit langen Leitern die Mauer überwinden wollten, war damit ein wirksamer Riegel vorgeschoben.
Der Schild wirkte auf sie zwar nicht tödlich, aber äußerst abschreckend, denn er verursachte versengtes Fleisch und scheußlich schmerzende Wunden, die nur schwer verheilten.
Man schien also nun alles wieder im Griff zu haben und in der Stadt gewöhnte man sich allmählich an das Leben mit der Verbotenen Zone.
Mittlerweile war auch allen klar, dass die Zone noch für sehr lange Zeit unbewohnbar sein würde, wobei die Schätzungen stark schwankten, zwischen fünfzig und fünfhundert Jahren.
Aber man machte sich im Magistrat darüber keine größeren Sorgen mehr, sondern hielt die Gefahr, die vom verstrahlten Areal ausging, auch über einen längeren Zeitraum hinweg für verwaltbar.
Auf einer ausgebleichten Klappliege, die er von einem der maroden Südbalkone des ehemals olivgrünen Plattenbaus requiriert hatte, lag der Ranger und sah in den hohen Frühsommerhimmel. Die warme, klare Luft auf dem Flachdach, das üppig mit krautigem Pfeifengras, dichten Lavendelpolstern und Thymiansträuchern bedeckt war, wurde vom starken Aroma der Wildkräuter gewürzt.
Neben ihm, auf dem stahlverstärkten Dachhaus, ragte der zwanzig Meter hohe Sendemast empor, über den er und die Robo-Krabben mit der Außenwelt verbunden waren.
Das furchendurchzogene Gesicht des Rangers wirkte entspannt.
Er hatte die verspiegelten Stiefel ausgezogen und genoss den leichten, kühlen Windhauch, der um seine nackten Füße strich.
Weiße Kondensstreifen aus allen Richtungen linierten das wolkenlose, tiefe Blau.
Die winzigen Flugzeugsilhouetten, an ihrer Spitze kaum zu erkennen, verrieten sich nur gelegentlich durch glitzernde Reflektionen auf den Metallrümpfen, wenn die Einfallswinkel der Sonnenstrahlen von Turbulenzen etwas verschoben wurden.
Scheinbar ähnlich klein, doch sehr viele Etagen tiefer, in einer Höhe von etwa zweihundert Metern, schwebten die Kameradrohnen, die das Gebiet aus der Luft mit leistungsfähiger, hochauflösender Optik überwachten. Selbst sehr kleine Objekte, die nicht größer waren als eine Maus, konnten die Hitec-Geräte damit noch entdecken.
Die zahlreichen Bussarde, Sperber und Falken, die über ihnen in der Thermik kreisten, standen ihnen darin in nichts nach.
Ihren überscharfen Augen entging nicht die kleinste Bewegung am Boden und immer wieder setzte einer der eleganten Vögel zum Sturzflug an und schoß mit rasender Geschwindigkeit dem Erdboden entgegen, um sich aus dem Überangebot an kleinen Nagern ein besonders saftiges Exemplar zu greifen.
Aus dieser Höhe war es für sie ein Leichtes, in die Zone einzudringen und sie hatten lange schon gelernt, diese auch wieder durch steilen, senkrechten Flug nach oben zu verlassen, um nicht im hundert Meter hohen Energieschirm hängenzubleiben und gegrillt zu werden.
So genossen sie das Schlaraffenland und die Köstlichkeiten, die unter ihnen wie auf einem riesigen Teller von anderthalb Kilometern Radius angerichtet waren.
Vom nahen Abschnitt der Mauer, nur einige Dutzend Meter vom schmutzig grünen Gebäude am Rand der Zone entfernt, hörte der Ranger wieder das Knistern und Bruzzeln eines Tierkörpers, der in den Schirm geraten war. Dem Geräusch nach war es ein etwas größerer Vogel, eine Amsel vielleicht, vermutlich ein Jungvogel, dem nachlässige Eltern noch nicht beigebracht hatten, wie man den unsichtbaren, tödlichen Zaun vermied.
Das ferne, monotone Rauschen der Großstadt wirkte einschläfernd auf den Ranger. Als ihm eben schon die Lider zufallen wollten, ließen ihn die trommelnden Geräusche eines schnellen Staksens vieler Beine auf hartem Stahlbeton wieder hochschrecken.
Er setzte sich auf und sah sich um.
Eine Krabbe bahnte sich einen Weg durch die bewachsenen Risse und blinkte hektisch, während sie, womit auch immer, pfeifende und quietschende Geräusche absonderte, als sei sie ein naher Verwandter von R2D2.
»Was ist los, Lefty?«, fragte der Ranger erstaunt. Er zog seine Füße auf die Liege hoch, angelte sich die Stiefel und streifte sie über die nackten Füße.
»Was machst du denn hier oben? Ist irgendwas passiert?«
Der Krebs blinkte und piepste wieder, als gäbe er eine Antwort, aber der Ranger verstand nur so viel, dass etwas Ungewöhnliches geschehen sein musste oder immer noch im Gang war.
»Na, dann zeig mir mal, was dich so aufregt«, sagte er, stemmte sich aus dem bequemen Campingmöbel hoch, hängte sich den Rucksack um und ging dann erwartungsvoll hinter der mit flinkem Klappern vorauseilenden Krabbeneinheit her, die immer wieder die gestielten Augen mit den optischen Sensoren rotieren ließ, um sich zu vergewissern, dass er ihr auch folgte.
Natürlich war, wie vorausschauende Kritiker warnten, die man wie gewöhnlich zunächst als negativ denkende Pessimisten abtat, nun keineswegs schon in allen wichtigen Fragen vorgesorgt worden.
Beispielsweise hatten diese notorischen Miesmacher schon früh vor der Ratten- und Mäuseplage gewarnt, die in und an der Zone bald um sich griff.
Es erwies sich nämlich als unmöglich, die Kanalisation, die die Sperrzone über tausende kleiner Röhren und Schächte mit dem Netz der restlichen Stadt verband, gänzlich zu kontrollieren oder gar abzuriegeln.
Außerhalb, aber auch innerhalb des Mauerrings gab es bald nach der Installation der energetischen Abschirmung ein grosses, verlockendes Angebot an gegrilltem Kleintier-Aas, speziell Vögeln und gerösteten Insekten, das für großen Zuspruch aus der ganzen Nachbarschaft sorgte.
Es entwickelte sich ein reger kleiner Grenzverkehr von Mäusen und Ratten, in geringerem Maß auch von Marderartigen, wie Steinmarder, Iltis oder Wiesel, die ungeachtet der Mauer und des Schirms nach Belieben zwischen der Zone und den angrenzenden Gebieten hin und her wechselten.
Etwas eingedämmt wurde diese Plage zwar von einer wachsenden Zahl stets hungriger Greifvögel, die diese neue Nahrungsquelle intensiv nutzten. Auch einige andere Tierarten, natürliche Fressfeinde der Nager wie Igel, von denen es noch kleine, in der Zone heimische Populationen gab, bedienten sich da gerne, ebenso wie ein paar verwilderte Katzen.
Diese Nachkommen von damals zurückgelassenen Haustieren waren allerdings gerade am Aussterben, weil die wenigen verbliebenen, unkastrierten Kater nicht für genügend Nachwuchs hatten sorgen können und die wenigen Jungen zudem häufig steril waren.
Hunde gab es übrigens in der ganzen Zone gar nicht mehr; die allermeisten waren bei der Evakuierung von ihren Herrchen und Frauchen mitgenommen worden, sah man in ihnen doch eher Familienangehörige als Haustiere und die wenigen Streuner waren inzwischen alle eingegangen.
So viel war klar: Man konnte keinesfalls darauf hoffen, das freie Flottieren verstrahlter Tiere durch die Kanalisation würde sich auf natürliche Weise von selbst regulieren.
Wie aber sollte man hier effektiv von außen eingreifen?
Es ergab sich, dass genau zu dieser Zeit eine Entwicklung der Firma MOBILE AUTONOMOUS ROBOTIC SYSTEMS, kurz MARS, in die Testphase eintrat.
Die Firma entwickelte im Auftrag des Energiekonzerns NEPCO (NUCLEAR ELECTRIC POWER COMPANY) universell einsetzbare Automaten für den Rückbau von Kernkraftwerken, die sich aber auch für die heiklen Aufräumarbeiten nach einem atomaren Super-GAU eignen würden.
Die Katastrophe in der Verbotenen Zone hatte nach Ansicht von MARS ein ideales Testgebiet für ihre Räumeinheiten geschaffen. Es handelte sich bei diesen Geräten um autonom operierende Oktopod-Läufer mit Greifzangen, stabile achtbeinige Laufroboter anpassbarer Größe für unwegsames Gelände, die sie COMMMUNICATIVE ROBOTIC AUTONOMOUS BASIC, kurz CRAB nannten.
Die CRABs waren mit energiereichen roten Lasern ausgerüstet, die sie befähigten, große Trümmerstücke in kleinere Trümmerstücke zu zerteilen und dann, wo nötig, im Team zu einem Sammelplatz neben dem beschädigten Gebäude zu bringen.
Außerdem konnten sie mit ihnen Angriffe von Ratten oder Raubvögeln abwehren und sie verfügten über ein integriertes Beuteschema, das ihnen sagte, was sie abschießen durften, ja sogar sollten, und was nicht, z.B. andere, teure Krabben-Einheiten. Und selbstverständlich, gemäß dem ersten der bekannten und bewährten drei Asimovschen Robotergesetze, auch keine Menschen.
Diese oberste Maxime war ihnen sogar noch zusätzlich auf der Hauptplatine in den BIOS-Chip eingebrannt.
Für den Test hatten MARS und NEPCO die Größe der einzelnen Units auf die einer kräftigen Holzfällerhand festgelegt, zum einen aus Kostengründen, zum anderen, weil bei den in der Zone anfallenden Arbeiten in einem Langzeitversuch keine größeren Dimensionen für notwendig erachtet wurden.
Der Rückbau eines Kernkraftwerks, wo meterdicke Betonarmierungen und Bleiabschirmungen zu zerlegen waren, würde natürlich Einheiten bis zur Größe eines Kleinwagens und darüber hinaus erfordern, aber Mechanik und Elektronik dieser Super-CRABs würden sich nicht grundsätzlich von der ihrer kleineren Verwandten unterscheiden. Sie würden wesentlich kräftiger sein, über größere Tragkraft verfügen und energiereichere Laser erhalten, aber ihre wesentlichen Funktionen und die organisatorischen und logistischen Strukturen ihres konzertierten Einsatzes im Team würden sich ebenso gut auch mit kleineren Modellen erproben lassen.
Wegen der bekannt guten Kontakte von MARS und NEPCO zu Regierung und Magistrat konnte es nicht überraschen, dass der Testeinsatz der CRABs in der Zone als innovatives Projekt von großem Nutzen gefeiert wurde und schnell beschlossene Sache war. Der Zonen-Nachbarschaft verkaufte man den Testeinsatz aber vor allem als Jagd auf die gefährlichen Ratten und Mäuse durch robotische Kammerjäger und punktete damit, flankiert durch lobende Medien-Kampagnen, bei der Bevölkerung.
So setzte nur wenig später ein Trupp von bleibemantelten MARS-Männern zweihundert CRABs am äußeren Rand der Sperrzone aus, von denen fünfzig sich sofort über das ganze Gebiet verteilten, permanent die Strahlung maßen und die Werte über den neuen Sendemast nach draußen funkten.
Den Mast hatten MARS-Techniker auf dem Flachdach eines fleckig-olivgrünen, siebenstöckigen Plattenbaus an der Peripherie errichtet.
Der Bau repräsentierte einen dort etwas weniger häufig anzutreffenden Gebäudetyp, der neben Wohnungen auch Büro- und Ladeneinheiten beherbergt hatte.
Die anderen CRABs sammelten sich, der Quelle der höchsten Strahlungsemission folgend, beim Ursprung der Verseuchung, dem durch die Explosion beschädigten schmutzig-zitronengelben Plattenbau im Mittelpunkt der Zone. Dort begannen sie unverzüglich mit dem Zerteilen, dem Klassifizieren und dem Abtransport strahlender Überreste, für die sie Halden mit drei unterschiedlichen Kontaminations-Stufen anlegten.
»Hier muss es sein«, behauptete die drahtige Siebzehnjährige, ohne sonderlich überzeugend den Eindruck zu vermitteln, dass sie es wirklich wusste.
»Herrje, Senza«, maulte das andere Mädchen, das jünger aussah, aber genauso mager war, und kein bisschen weniger verdreckt als die Angesprochene.
»Das hört sich nicht grade an, als wärst du dir sicher.«
Zweifelnd sah sie nach oben.
Die enge Röhre war im Durchmesser grade eben noch weit genug, um unterernährte Straßen-Kids ihres Kalibers durchschlüpfen zu lassen wie eine Kugel durch den Lauf.
Die eiserne Leiter an der Wand begann in Griffhöhe ihrer ausgestreckten Arme, wenn sie sich auf die Zehenspitzen stellte, und endete etwa vier Meter höher unter einem runden, eisernen Deckel. Durch zwei kleine Löcher in der Abdeckplatte fiel Licht in eng gebündelten Strahlen auf ihren lilaweißblonden, wirren Haarschopf.
»Und wie sollen wir da bloß hochkommen?«
Senza seufzte.
»Das hat man davon, wenn man Kinder mitnimmt«, lästerte sie. »Ich mach dir die Räuberleiter, Kleines. Und dass wir hier richtig sind, weiß ich so sicher, wie man eben sein kann, wenn einem ein zugedröhnter Freak den Weg erklärt hat.«
» … und man selber mindestens genauso hackedicht war wie er«, ergänzte Minx trocken und knipste die Taschenlampe an und aus. »Wenn wir nicht richtig am Rand rauskommen, sondern zu weit innen, dann kanns das für uns gewesen sein, hab ich mir sagen lassen. Nur einmal kurz die Rübe rausgestreckt und wir besehn uns den Hanf von unten.«
Senza zuckte mit den schmalen Schultern.
»Wenn schon«, spielte sie vor der Jüngeren wieder die Coole.
»Was haben wir schon zu verlieren? Draußen können wir nicht bleiben. Sie haben unsere Scans für die Gesichtserkennung und wir sind zur Fahndung ausgeschrieben. Ich sage nicht, dass du schuld bist. Aber so ist es nun mal. Draußen haben sie uns schneller, als wir ›Scheißbullen‹ sagen können und dann gehts ab mit uns ins Erziehungslager. Aber ohne mich. Dann lieber krepiert. Wenn ich merke, dass wir zu weit drin sind, dann lauf ich schnell noch weiter rein, bis zu dem Haus mit dem Loch in der Mitte. Kann man ja wohl gar nicht verfehlen. Da hock ich mich dann hin und in ein paar Stunden bin ich hinüber.«
Minx war den Tränen nah.
»Könnten wir denn nicht auch im Kanal leben, so wie Meik? Er sagt, es gibt Tausende, die da leben, allein oder in kleinen Gruppen. Wär doch vielleicht gar nicht mal so schlecht.«
Senza schüttelte energisch den Kopf. »Ohne mich, Kleines. Ich brauch Sonne. Ich bin kein Vampir oder sowas. Wir müssen doch was essen und trinken. Meik sagt, dass sie manchmal dort Ratten fressen oder Mäuse und das dreckige Wasser saufen, das da in den Rinnen fließt. In der Zone, wenn wir Glück haben und richtig rauskommen, sind Läden und Supermärkte. Da gibt es Konserven und Getränke, einfach auf Selbstbedienung und wir können in einer richtigen Wohnung wohnen und in richtigen Betten schlafen, wenn wir wollen jeden Tag woanders.
Wenn wir immer schön am Rand bleiben, haben wir dort ein Leben wie die reichen Kids und die da draußen können uns mal, der Teufel soll sie alle holen!«
Sie holte tief Luft und keuchte, weil sie sich so in Rage geredet hatte, dass darüber das Luftholen zu kurz gekommen war.
Die Augen von Minx glänzten immer noch verdächtig feucht.
»Ja, aber die Krebse«, sagte sie leise. »Ich hab Angst vor diesen Roboter-Krebsen. Die schießen mit Lasern, sagt Meik.«
»Die sind nur für kleine Tiere gefährlich«, beschwichtigte Senza. »Nur für die ganze Brut aus der Kanalisation. Haben sie immer wieder gesagt. Höchstens kleine Vögel jagen die noch.
Die machen nix anderes wie Katzen, und vor denen hast du doch auch keine Angst, oder?«
Minx schüttelte jetzt tapfer den Kopf.
»Ich komm ja mit, Senza«, bekräftigte sie. »Ich hab ja gesagt, dass ich mitkomm. Ich will doch bei dir sein. Ich will immer bei dir sein. Wenn du mich nur wieder so schön streichelst.«
Sie legte ihre Arme um den Hals der Freundin und küsste sie auf den Mund.
Senza ließ es geschehen.
»Aber natürlich, Kleines«, flüsterte sie. »Alles wird gut, du wirst schon sehen.«
Ein paar Jahre nach der Auswilderung der CRAB-Population häuften sich die Probleme in der Zone erneut.
Zwar waren die CRABs autonom und mobil. Sie konnten ihre Akkus selbständig an den Dockingstationen im Erdgeschoß des olivgrünen Baus wieder aufladen und sogar Soft- und Firmware-Updates konnten ihnen auf diesem Weg aufgespielt werden. Für kleinere Hilfen, etwa wenn eine Einheit auf dem Rücken lag oder sich irgendwo verheddert hatte und sich nicht aus eigener Kraft weiterhelfen konnte, hatten die CRABs die Möglichkeit, Notsignale zu senden. Diese Signale aktivierten bei anderen Exemplaren, die sich in der Nähe aufhielten, den ›Samariter-Modus‹ der sie dazu veranlasste, zum Sender zu eilen und im Rahmen ihrer Möglichkeiten Hilfe zu leisten.
Aber trotz solcher ausgeklügelten Funktionen gab es immer höhere Ausfallquoten. Häufig versagte das interne Beuteschema und die CRABs schossen sich mit den Lasern gegenseitig ab oder sie blieben sogar, ohne jede erkennbare Ursache, plötzlich als Totalausfall liegen, vor allem in der inneren Zone.
Ziemlich sicher lag das an der hohen Strahlung, denn im Firmenlabor hatten die Krabben über wesentlich längere Zeiträume hinweg einwandfrei funktioniert.
Bald wurde klar, dass wohl regelmäßige Wartung notwendig war, eine Aufgabe, die permanente menschliche Anwesenheit in der Zone voraussetzte.
Nicht die einzige Aufgabe übrigens, die sich stellte, auch der Sender musste ab und zu überprüft und nachjustiert werden, tote Tiere waren wegen der starken Geruchsbelästigung und ihrer magnetischen Anziehungskraft auf Mäuse und Ratten einzusammeln, auf geeignete Weise zu entsorgen, und noch einiges andere mehr.
Kurz, man brauchte so etwas wie einen Zonen-Ranger, der dort alles instandhielt und sich um die auftretenden Probleme kümmerte.
Wo aber fand man jemanden, der dazu bereit gewesen wäre, sich immer wieder, oder noch besser permanent, solch hohen Strahlendosen auszusetzen, wie sie in der inneren Zweihundert-Meter-Kernzone auftraten, aber auch noch im mittleren Ring, der sich bis zu einem Radius von fünfhundert Metern um das immer noch hochaktive Strahlungszentrum herum ausdehnte?
Die Lösung, die den damit befassten Behörden einfiel, die MARS von dem Wartungsproblem unterrichtet hatte, war so typisch obrigkeitsstaatlich und autoritär, dass sie keinen überraschen konnte, der schon eine Zeit lang in der Stadt lebte.
Man bot Strafgefangenen, die in den Todeszellen von St. Victor saßen, die Chance, sich freiwillig für den Posten eines Rangers in der Verbotenen Zone zu melden.
Und siehe da, nicht wenige konnten sich mit der Aussicht anfreunden, in einem verfallenden, menschenleeren, nur von kranken Tieren und reparaturbedürftigen Roboterkrebsen besiedelten Gebiet zu leben, um dort langsam als medizinischer Selbstversorger an der Strahlenkrankheit zu krepieren.
Diese Perspektive erschien manchen immer noch erträglicher als die Gewissheit, eines schönen Morgens abgeholt und auf den Elektrischen Stuhl geschnallt zu werden, den alle dort den ›Schwarzen Raucher‹ nannten, weil die Delinquenten manchmal zu qualmen und zu brennen anfingen, bevor sie nach langem und qualvollem Todeskampf in die Zinkwanne gelegt wurden.
Einer dieser Freiwilligen also, der am geeignetsten erschien, erhielt bei MARS einen Crashkurs in der Wartung der CRABs, ebenso wie in den diversen anderen Tätigkeiten, die man von ihm erwartete.
Dann stattete man ihn mit improvisierter, beinahe schon grotesk anmutender Schutzkleidung aus, nicht etwa aus Menschenfreundlichkeit - schließlich war er ja ein zum Tode verurteilter Schwerverbrecher - sondern damit er wenigstens ein paar Wochen lang seine für das Projekt so wichtige Tätigkeit würde ausüben können.
Mit einem Helm, ähnlich dem eines Tiefseetauchers, einem langen Blei-Poncho und schweren bleiplattierten Stiefeln versehen, wurde er über den einzigen noch passierbaren, scharf bewachten Zugang durch die Kanalisation ins Sperrgebiet verbracht. Aber die Kamerakopter, welche die Zone aus der Luft überwachten, lieferten von seinen Aktivitäten überaus enttäuschende Bilder. Der gepanzerte ›Liquidator‹, wie er im allgemeinen Jargon genannt wurde, der Mühe hatte, sich vor lauter Blei überhaupt noch zu bewegen, das seinen Körper trotzdem nur lückenhaft schützte, dachte gar nicht daran, nun pflichtgemäß die liegengebliebenen CRABs in der Kernzone einzusammeln.
Stattdessen verschwand er in der olivgrünen Mietskaserne am äußeren, schon strahlungsarmen Rand der Zone, seiner Operationsbasis mit der Werkstätte und den Dockingstationen für die Krabben und legte, wie man vermuten durfte, erst einmal das ganze schwere Zeug ab, um sich dann zu entspannen.
Und er entspannte sich sehr lange.
Er missachtete auch die Anweisung, sich jeden Abend um achtzehn Uhr dreissig zum Rapport zu melden und einige simple medizinische Vitalparameter wie Blutdruck, Körpertemperatur und Atemfrequenz, die er an sich messen sollte, dem neu eingestellten medizinischen Personal im MARS-Labor zu übermitteln. Warum sollte er auch, er hatte sich ja keiner Gefahr ausgesetzt und nichts getan, worüber eine Berichterstattung von Interesse gewesen wäre.
Trotz eingehender Belehrung über die möglichen Folgen seines subversiven Treibens und darauf gegründeter scharfer Ermahnungen, die man ihm per Telescriptor in die Basis sandte, kam er auch in den folgenden Tagen seinen Pflichten nicht nach.
Also entzog man ihm die Essens- und Getränkerationen, die ihm sonst täglich am Morgen durch den Kanalgang geschickt wurden und hoffte, ihn auf diese Weise weichzukochen.
Er zeigte sich allerdings wenig beeindruckt.
Dafür sah man ihn mit einem dicken Hammer in der Hand einen Supermarkt im nächsten Gebäude, einem moosgrünen Plattenbau, aufsuchen, den er bald darauf mit einem Karton, randvoll gefüllt mit Konserven und Flaschen, wieder verließ.
Dabei winkte er fröhlich den Drohnen hoch über seinem Kopf zu.
Bei MARS beriet die Projektleitung hinter verschlossenen Türen über das weitere Vorgehen und fasste dann, wie später durchsickerte, den Beschluss, diesen Fall einer ›diskreten internen Lösung‹ zuzuführen, um möglichst wenig Aufsehen in der Öffentlichkeit zu erregen, die damals noch gierig auf Schauergeschichten aus der Verbotenen Zone lauerte.
Und wirklich gelang es ihnen, über dieses Kapitel der CRAB-Testphase einen so dichten Mantel des Schweigens zu breiten, dass bis heute kein einziger Medienbericht zu finden ist, der etwas Licht in die Sache gebracht oder wenigstens auf die Existenz der informationellen Dunkelwolke hingewiesen hätte, die damals über der Zone hing.
Der Krebs, den der Ranger Lefty genannt hatte, eilte geschickt die Treppenstufen hinunter. Er driftete dabei immer wieder zur linken Seite hin ab und musste sich wieder neu ausrichten, was er jedoch so schnell erledigt bekam, dass er sein Tempo kaum verringern musste.
Der Linksdrall wurde von einem leicht lädierten Bein auf der linken Körperseite bewirkt, das der Ranger nicht ersetzt hatte, weil er Eigenheiten, die grundlegende Funktionen nicht gravierend einschränkten, bei den CRABs schätzte. Sie verliehen den Exemplaren Individualität und halfen ihm dabei, sie auseinanderzuhalten.
Im Lauf der Jahre, die er nun schon zusammen mit den Hitec-Geräten verbracht hatte, war bei ihm eine Beziehung zu den hochfunktionellen Maschinen gewachsen, die durchaus persönliche Züge trug. Er konnte sie alle unterscheiden und hatte allen Namen gegeben, die manchmal ihre Eigenheiten reflektierten, manchmal aber auch nur einer spontanen Eingebung folgend von ihm vergeben worden waren.
Unten, an der Schwelle zur Außentreppe, wartete Lefty vor dem Ausgang, dessen Tür entfernt worden war, damit die CRABs jederzeit zu ihren Dockingstationen gelangen konnten, die hier im Erdgeschoß untergebracht waren.
Wieder gab er einige Quietschgeräusche von sich und rannte dann draußen unter dem Vordach die flache Rampe hinunter, die der Ranger regelmäßig vom Unkraut befreite, um den abends einpassierenden und am Morgen wieder ausrückenden Exemplaren den Weg freizuhalten.
Zielstrebig richtete Lefty sich nach der Mauer hin aus, die gut fünfzig Meter entfernt aufragte und bahnte sich einen Weg durch Gestrüpp und Buschwerk, das Pflaster und Asphalt immer weiter aufbrach und überzog. Aus dem offenen Seitenfenster eines vom Rost roten Fahrzeugs mit platten Reifen, schräg voraus, wuchs ein Haselnuss-Strauch.
Nach etwa der Hälfte der Distanz bis zum Bollwerk, über dem es immer wieder aufblitzte, wenn Insekten in den summenden Schirm gerieten, wendete er sich nach links und lief auf eine Gruppe höherer Bäume zu, die noch aus der Vor-Zonenzeit stammten und nun zu einem kleinen Wäldchen herangewachsen waren.
Der Ranger folgte dem geschäftig vorauseilenden Lefty bis zum Rand der Baumgruppe, teilte die Zweige einiger mannshoher Büsche und dann war plötzlich klar, warum ihn die Krabbe hierher geführt hatte, die sich nun, mission completed, seitlich durch die Büsche entfernte.
Auf dem bemoosten Boden in einigen Metern Entfernung saßen zwei Menschen in schmutziger, abgerissener Bekleidung, junge Mädchen offenbar, beide mit kurzem Haarschopf.
Die eine, so etwas wie lilablond und vermutlich die Jüngere, hatte Tränen in den Augen und unterhalb des hochgerollten Hosenbeins ein sauber gestanztes Loch in der Wade.
Sie schluchzte und schniefte ein wenig, während die Göre mit dem schwarzen Haarschopf ihr die Hand hielt und ihr mit der anderen tröstend die dreckfleckige, strichweise durch ihre Tränen gereinigte Wange tätschelte.
Vor den beiden lag bewegungslos eine Krabbe.
Sie lag da ziemlich flach und einige Beine standen in unpassenden Winkeln von ihrem Körper weg, während mindestens zwei andere abgeknickt waren. Die blauen Lichter am Rumpf blinkten noch einmal kurz und erloschen dann.
Als die beiden den Ranger erblickten, klammerten sie sich aneinander fest.
In ihren Gesichtern stand Angst.
Angst, ausgelöst durch das wutverzerrte Gesicht des seltsamen Mannes, der sie mit zornig blitzenden Augen fixierte.
»Wer zum Teufel seid ihr, und wie kommt ihr hierher?«, blaffte er die Mädchen an. »Und was habt ihr mit Billy gemacht?«
Nach dem Fiasko mit dem Todeskandidaten kam man bei MARS zu der Einsicht, weitere Experimente mit Leuten, die nichts mehr zu verlieren hatten, seien nicht erfolgversprechend, bedankte sich bei den Behörden und überließ die übrigen, tief enttäuschten Bewerber wieder dem Schwarzen Raucher, der ihnen von Gerichts wegen zugedacht war.
Man suchte nach besseren Lösungen und befand sich dabei gerade in einer ersten Brainstorming-Phase, als eines Abends ein hochrangiger Funktionär von NEPCO mit dem CRAB-Projektleiter zum Essen ging und diesem dabei diskret einen höchst inoffiziellen Vorschlag auf dem kurzen Dienstweg unterbreitete. Über ähnliche Kontakte wie den beschriebenen war es natürlich schon bis zu NEPCO durchgedrungen, dass es bei MARS gerade etwas klemmte, was die Wartung der Räumeinheiten anbelangte.
Da wurden beim Atomstrom-Erzeuger nämlich gerade wieder die Folgen eines peinlichen Vorfalls virulent, der sich bereits ein Jahr vor der Explosion der Schmutzigen Bombe in der Vorstadt ereignet hatte und den man glücklicherweise aus den Medien hatte heraushalten können. In einem NEPCO-Kernkraftwerk war es damals zur Verstrahlung einer Mitarbeiterin gekommen, die zu allem Überfluss auch noch schwanger gewesen war.
In der zwanzigsten Woche, wo man ihr keine großzügig honorierte Abtreibung mehr anbieten konnte. Genauer gesagt wurde ihr diese zwar angeboten, von ihr aber empört zurückgewiesen.
Man ging von einer Äquivalentdosis von 1,8 Sievert (Sv) aus.
Die Frau wurde dekontaminiert und unverzüglich in die gut ausgestattete Betriebs-Klinik eingeliefert, wo man sie mit Jodtabletten und Vitaminpräparaten versorgte und die hämatologischen Schäden durch Bluttransfusionen behandelte.
Da sich aufgrund des geschwächten Immunsystems Anzeichen einer Sepsis zeigten, entschloss man sich trotz der Schwangerschaft zu einer Therapie mit hochriskanten Antibiotika und hoffte im Stillen, der Körper der Frau würde den Fötus, den man für ernsthaft geschädigt hielt, abstoßen.
So hätte man ihm ein traurige Zukunft mit schwersten Behinderungen erspart und wenigstens die Mutter gerettet.
Tatsächlich kam es bei der Frau zwei Wochen später zu einer Frühgeburt. Das Kind, ein Junge, schien jedoch wider alle Erwartungen gesund und lebensfähig, ja sogar erstaunlich gut entwickelt zu sein, wies keine sichtbaren Mängel auf und zeigte auch keine organischen Fehlbildungen oder Dysfunktionen, wie gründliche Untersuchungen ergaben.
Der Mutter allerdings ging es immer schlechter.
Vierzehn Tage nach der Geburt des Jungen erlag sie einem eigentlich banalen Infekt.
Offenbar gab es keine Angehörigen, die unbequeme Fragen hätten stellen können. Die Personalakte der Frau zeigte, dass sie ihren Vater schon als Kind verloren hatte. Ihre Mutter war vor drei Jahren einem Krebsleiden erlegen und ein älterer Bruder war bei einem Segeltörn verschollen und inzwischen für tot erklärt worden.
Der Vater des Neugeborenen konnte nicht ermittelt werden.
Dies alles nur, um zu erklären, wie mit dem Waisenkind verfahren wurde. Ihn einer staatlichen Fürsorgeeinrichtung zu überantworten, hätte mit Sicherheit unangenehme Fragen nach sich gezogen. Also vertraute man ihn einem kinderlosen Paar an, das sich jahrelang schon vergeblich bemüht hatte, eigene Nachkommen zu zeugen oder, nachdem ihre Bemühungen wegen beiderseitiger verminderter Fertilität erfolglos geblieben waren, doch wenigstens ein Kind zu adoptieren.
Beide arbeiteten praktischerweise in demselben NEPCO-Kraftwerk, in dem sich auch der Unfall zugetragen hatte.
Das Kind hatte zu dieser Zeit immer noch keinen Namen und wurde von den Krankenschwestern der Betriebsklinik etwas flapsig ›kleiner Strahlemann‹ genannt.
Die überglücklichen, frischgebackenen Eltern gaben ihm nun den Nachnamen des Mannes, der auch Familienname sein sollte, ›Korilenko‹, und verpassten ihm dazu den Vornamen ›Theodor‹, das Gottesgeschenk.
Diese Namenswahl war zwar, berücksichte man die Gefühlslage der beiden, gut nachvollziehbar, implizierte aber, der Strahlentod der leiblichen Mutter sei ein Werk göttlicher Vorsehung, ja sogar Gnade gewesen, was nun wiederum den sonst nicht zimperlichen, aber religiös vorbelasteten Krankenschwestern unpassend erschien.
Sonst aber war nun alles in bester Ordnung, denn es blieb ja jetzt NEPCO-intern.
Der Kleine konnte in die betriebseigene Kinderkrippe gebracht werden, später in den Firmenkindergarten gehen und schließlich die NEPCO-Schule besuchen, die hervorragend qualifizierte Privatlehrer beschäftigte und mit jeder staatlichen Schule locker mithalten konnte.
Und das Geschenk Gottes machte sich gut.
Theo zeigte besonderes Interesse und Verständnis für mechanische und elektronische Zusammenhänge, sodass man ihn in den Schulferien Kurse besuchen ließ, die ihn auf eine Ausbildung zum Robotronik-Ingenieur vorbereiten sollten.
Dabei hatte man natürlich an MARS als Ausbilder gedacht.
Welche Firma wäre besser geeignet gewesen? Die Energieerzeuger redeten bei allen Entscheidungen, die Theo betrafen, immer noch ein gewichtiges Wort mit, denn zum einen war da immer noch das Vertuschungsinteresse für den jetzt schon fast zwanzig Jahre zurückliegenden Störfall mit Todesfolge, zum anderen kam man für seine Ausbildung auf und seine Eltern standen bei ihnen in Lohn und Brot.
Last, not least aber wollte man Theodor auch deshalb im Auge behalten, weil man an ihm ein konkretes Forschungsinteresse hatte, was die ungewöhnlich große Strahlungs-Resistenz betraf, die bei ihm festgestellt worden war.
Hatte schon die hohe Dosis, die er noch im Mutterleib abbekommen hatte, bei ihm wenig mehr bewirkt als höchstens einen Entwicklungsschub, so zeigte sich durch einen weiteren geringfügigen Störfall, bei dem Theodor im Alter von zwölf Jahren bei einem Besuch im AKW erneut erhöhter Strahlung ausgesetzt wurde, wiederum seine geringe Empfindlichkeit.
Bei der anschließenden Blutuntersuchung fand man ein hochwirksames Zell-Antioxidans von besonderer Form in hoher Konzentration vor. Da man derartige Peptide auch aus Untersuchungen an Vögeln kannte, die sich einem Leben in radioaktiv verseuchten Gebieten erstaunlich gut angepasst hatten, vermutete man schnell einen Zusammenhang zwischen dem vermehrten Auftreten dieser Eiweißgruppen und einer gesteigerten Strahlungstoleranz.
Aber wie sollte man das überprüfen?
Theo gezielt einer im Normalfall schädlichen Strahlungsdosis auszusetzen und dann die Folgen zu untersuchen, wäre hochgradig unethisch gewesen und kam für die Ärzte, die zu dieser Zeit im NEPCO-Klinikum mit der Sache betraut waren, nicht infrage. Sie fertigten daher nur einen Bericht an und legten ihn zu Theos Akten.
Einige Jahre später, ziemlich genau zu dem Zeitpunkt, als MARS erste Schwierigkeiten mit den CRABs bekam und Theo gerade die Schule abgeschlossen hatte, fiel der Bericht einigen anderen Ärzten, die die alten abgelöst hatten, in die Hände.
Sie waren clever, hatten weniger Skrupel und witterten schnell ihre Chance, womöglich mit der Entwicklung eines vorbeugenden Mittels gegen die Strahlenkrankheit ein milliardenschweres Projekt an Land zu ziehen.
Sie erstatteten an höherer Stelle Bericht und erbaten sich die Erlaubnis für geeignete Versuche mit oder an Theo.
So war die ganze Geschichte schließlich bei dem hochrangigen NEPCO-Funktionär gelandet, kurz bevor er mit dem CRAB-Projektleiter essen ging.
Die beiden einigten sich zwischen Suppe und Rindfleisch auf den zeitlich unbegrenzten Einsatz des jungen Theodor, der sich nun auch für MARS und NEPCO als Geschenk Gottes erwies, als Ranger in der Verbotenen Zone.
Während das verletzte Mädchen zu weinen begann, funkelte das andere den Ranger nun zornig an.
»Falls du mit ›Billy‹ das blöde Blechvieh da meinst, da bin ich draufgesprungen. Damit!«
Sie streckte die dürren Beine aus und präsentierte die schweren Boots, die an Spitze und Absatz mit Eisen beschlagen waren.
Böse musterte sie den Ranger von oben bis unten.
»Dein Billy hat uns nämlich angegriffen! Einfach so. Vielleicht siehst du ja das Loch da im Bein von der Kleinen. Und wer bist du eigentlich? Der Herr der Schrottkrebse?«
»Ich bin hier Ranger in der Verbotenen Zone«, antwortete der Gescholtene und focht mit sich einen harten Kampf um die Wiedergewinnung seiner Selbstbeherrschung aus.
Er kniete sich neben dem arg lädierten Billy nieder, drehte ihn um und untersuchte ihn eingehend, während Senza die schniefende Minx tröstete.
»Ranger in der Verbotenen Zone, die übrigens nicht nur aus Jux ›Verbotene‹ Zone heißt«, legte er dann nach. »Wie seid ihr hier hereingekommen?«
»Kannst Du Dich irgendwie ausweisen, Ranger?«, fragte Senza, die automatisch in die Regularien des Umgangs mit Obrigkeiten verfiel, die sie von ihrem Leben auf der Straße her gewohnt war. Man wurde angemacht, fragte nach einem Ausweis, bekam eine aufs Maul und wurde dann irgendwohin gebracht, wo sich jemand um einen kümmerte, irgendwie.
So lief das draußen.
Senza, in der Annahme, dass nun der Punkt mit der Maulschelle dran war, verbarg ihr Gesicht vorsorglich in der Ellbogenbeuge, aber der Ranger, der keine wirklich handfeste Obrigkeit war, sah sie nur verdutzt an.
»Ausweis? Was redest du da für einen Quatsch?«
Er nahm seinen Lederrucksack von der Schulter und entnahm ihm einen offenbar schweren Kasten im Format eines tausendseitigen Fantasywälzers.
Mit dem Kasten in der Hand näherte er sich den beiden Mädchen, die sich aneinander festklammerten und offenbar damit rechneten, er würde ihnen nun das Teil um die Ohren zimmern.
Kopfschüttelnd kauerte er sich neben den verängstigten, aber keineswegs in ihr Schicksal ergebenen Küken nieder. Er legte den Kasten ab und öffnete ihn. Er war mit Bleiplatten ausgekleidet.
»Lass mal dein Bein sehen«, forderte er Minx auf. »Das muss verarztet werden.«
Minx sah unsicher erst ihn und dann Senza an.
Senza spürte, dass von dem seltsamen Mann keine Gefahr mehr drohte und nickte ihr aufmunternd zu.
Minx streckte dem Ranger mit schmerzverzerrtem Gesicht das Bein entgegen.
»Mein Name ist Theo. Theodor Korilenko«, stellte der sich etwas steif vor und entnahm seinem Medizinkasten eine kleine Einwegspritze. »Antibiotikum«, erklärte er kurz, als Minx zurückzuckte. »Damit sich das nicht entzündet. Wirst du gar nicht spüren.«
Abschließend wickelte er eine weiße, elastische Binde um das dünne Bein. »Meine Güte«, sagte er und umfasste den Knöchel unterhalb des Verbands mit Daumen und Mittelfinger. »Ihr seid ja nur noch Haut und Knochen.«
Seine Stimme klang betroffen und besorgt. »Geben euch eure Eltern denn nichts zu essen?«
»Eltern?«, fragte Senza, irritiert von so viel Weltfremdheit. »Ich erinnere mich noch schwach an meine Mutter, der sie mich weggenommen und ins Heim gesteckt haben. Minx hier ist vor zweieinhalb Jahren von zuhause weggelaufen. Und hat echt keine Sehnsucht nach einer Begegnung mit ihren Alten.«
Theo schluckte. »Ich wäre froh, ich könnte meine noch einmal sehen«, sagte er leise.
Schnell drückte er ein gelbes Dragee aus einer Blisterfolie und reichte es Minx auf der flachen Hand.
»Gegen die Schmerzen. Mir ist das alles selber auch schon mal passiert. Ich weiß, wie weh das tut.«
Er setzte sich auf den Boden und zog seinen rechten Stiefel aus.
Unter der heruntergezogenen grünen Socke sah man eine runde, vernarbte Stelle knapp oberhalb der Ferse.
»Danach haben sie mir die verspiegelten Stiefel gegeben.«
»Danke«, sagte Minx, die jetzt Zutrauen zum Ranger gefasst hatte, mit schwacher Stimme. »Die Krabben sind böse.«
Theo lachte. »Oh nein, sie sind nicht böse. Nur manchmal ein wenig krank. Ich bin hier, um ihnen zu helfen.«
»Ich habe noch nie etwas davon gehört, dass es hier drinnen einen Ranger gibt.«
Senzas Stimme klang fragend, hatte aber auch immer noch einen misstrauischen Unterton.
Theo zuckte mit den Schultern.
»Darüber weiß ich nichts. Ich bekomme nicht viel mit von dem, was draußen passiert. Sie haben hier fast alles abgeschaltet und ich lebe schon sehr lange hier in der Zone. Soweit man das ›leben‹ nennen kann.«
Er packte den Medizinkasten zusammen und steckte ihn wieder zurück in den Rucksack.
Den geplätteten Billy legte er sorgsam und vorsichtig dazu.
Draußen, in der hellen Sonne vor dem kleinen Waldstück, stürzte in rasendem Fall ein Sperber auf den Boden herab. Mit einigen kraftvollen Schnabelhieben gab er seinem Opfer den Rest. Dann startete er mit ihm wieder senkrecht in die Luft und gewann rasch an Höhe.
»Ich muss euch noch einmal fragen, wie ihr hier hereingekommen seid«, sagte Theo dann, und sein altes Gesicht wirkte beunruhigt.
Senza zeigte mit dem Daumen über die Schulter nach hinten, wo das Wäldchen noch etwas dichter wurde. Theo ging ein Stück in die angezeigte Richtung. In einiger Entfernung lag dort ein runder, eiserner Kanaldeckel inmitten einer bewachsenen Struktur, die einmal eine Straßenkreuzung gewesen sein mochte.
»Durch den Kanal also«, stellte er fest, als er beim Loch angelangt in die Tiefe sah. »Meine Güte. Um da durchzuschlüpfen hätten sie auch nicht ein einziges Gramm mehr auf den Rippen haben dürfen.«
Er packte den Deckel mit seinen kräftigen Händen und legte ihn vorsichtig wieder auf die dunkel gähnende Öffnung.
»Das war unglaubliches Glück, das ihr da hattet«, erklärte er dann den beiden zerknirschten Eindringlingen, als er wieder bei ihnen war.
»Erstens gibt es hier fast keine Strahlung mehr und zweitens habt ihr eine der ganz wenigen Stellen erwischt, wo euch die Kameras nicht sehen können.«
Er warf einen kurzen Blick auf Minx mit ihrem Verband.
»Ihr werdet wohl ein paar Tage hier bleiben müssen. Solange das Bein nicht verheilt ist, schafft sie es auf diesem Weg nicht wieder zurück. Wenn ich es richtig verstanden habe, wird euch wohl draußen keiner so schnell vermissen.«
Die Mädchen schüttelten eifrig die Köpfe.
»Ich muss euch hier zurücklassen, bis es dunkel wird. Nachts ist es hier draußen so finster wie in einem Kohlensack. Dann werden die Kamerakopter blind und gehen runter. Bis dahin rührt ihr euch hier am Besten nicht von der Stelle. Wenn es so weit ist, komme ich und hole euch.«
»Nein, nein, bitte nicht!«, protestierte Minx panisch. »Was ist, wenn wieder eine kranke Krabbe kommt?«
Der Ranger überlegte kurz. Senza sah, wie es in seinem Gesicht arbeitete. Dann schien er einen Entschluss gefasst zu haben und reichte Minx ein kleines schwarzes Kästchen, das er aus seiner Hosentasche holte.
»Wenn eine dich angreift, zielst du einfach mit dem Kästchen auf sie und drückst den Knopf. Dann bleibt sie liegen wie vom Blitz getroffen.«
Minx strahlte. »Ist sie dann tot?«
»Nein, nur bewusstlos. Ich kann sie dann einsammeln und wieder gesund machen.«
Aus der Richtung der Mauer kam eine Salve knatternder Geräusche, als habe ein ganzer Insektenschwarm Bekanntschaft mit dem Schirm gemacht. Der Ranger wandte sich zum Gehen.
»Ich komme also wieder, wenn es dunkel ist und bringe euch von hier weg. Keine Angst, wenn es dämmert, laufen alle Krabben in das grüne Haus dort drüben und docken an ihren Ladestationen an. Dann gibt es hier nur noch Ratten und Mäuse. Aber die sind dick und satt und tun euch nichts.«
Die Mädchen nickten und sahen ihm nach, bis er hinter Gestrüpp und Büschen verschwunden war.
»Netter Kerl«, sagte Senza. »So nett wie dieser Theo war schon lange keiner mehr zu uns, nicht wahr, Minx? Und das, obwohl ich seinen Billy kaputtgemacht habe.«
Die Kleine nickte und hielt stolz das Kästchen in der Hand.
»Ja«, sagte sie schlicht, »und er wollte nicht mal, dass wirs ihm machen sollen, obwohl es hier keiner sehen kann. Aber vielleicht findet er uns einfach zu hässlich. Zu dünn sind wir ihm, glaub ich.«
Wie erwartet, zierten sich Theos Eltern zuerst ein wenig, ihn ziehen zu lassen. Aber als NEPCO die beiden mit einer saftigen Gehaltserhöhung unter Druck setzte und ansonsten unmissverständlich klar machte, dass die Sache mit oder ohne ihre Zustimmung genau so und nicht anders laufen würde, gaben sie nach und verabschiedeten sich von ihm unter Tränen, denn ihnen war klar, dass es ein Abschied für immer sein würde.
Theo selbst war kaum Zwanzig und sah die Sache als Wende in seinem Leben an.
Was ja auch nicht ganz falsch war.
Als er zu einem Gespräch in die Personalabteilung von NEPCO eingeladen wurde, fühlte er sich geehrt. Als man ihm eröffnete, er sei ein äußerst bemerkenswerter Mensch, ungewöhnlich resistent gegen schädliche Strahlung, erfüllte ihn diese Mitteilung mit Stolz. Und als man ihm erklärte, im Interesse der Allgemeinheit sei es seine moralische Pflicht, sich ganz der Forschung zur Verfügung zu stellen, verspürte er einen feierlichen und ernsten Drang in sich, der großen Verantwortung, die da auf ihm ruhte, gerecht zu werden.
So packte er seine Koffer, schloß noch ein letztes Mal seine Eltern in die Arme, die er immer noch für seine leiblichen hielt und stieg in den Wagen, den NEPCO ihm geschickt hatte, um ihn abzuholen und zu den besagten ehrgeizigen neuen Ärzten des Firmenklinikums zu bringen.
Dort absolvierte er eine so unglaubliche Menge an Untersuchungen und Tests, nicht alle angenehm und manche sogar auch durchaus schmerzhaft, dass er nach einer Woche Intensiv-Diagnostik erste Ermüdungserscheinungen zeigte und kurz davor war, seinen Entschluss zur Mitarbeit noch einmal zu überdenken.
Doch wie der Zufall so spielt, wurde ihm genau zu diesem Zeitpunkt Nelly Frigg als Betreuerin zugeteilt, eine überaus attraktive Ärztin Mitte dreißig, die es verstand, den unerfahrenen jungen Mann mit viel Geschick und Routine bei der Stange zu halten. Nicht zuletzt durch intime Vergünstigungen, die sie ihm in fein dosierter Steigerung zukommen ließ. Sie wies ihn ein in die Bedienung der komplizierten Selbstdiagnose-Automaten, die jeden Abend hunderte von Meßwerten aus dem Sperrgebiet nach draußen senden sollten.
Sie unterrichtete ihn im Gebrauch des Erste-Hilfe-Kastens, mit dessen Inhalt er kleinere Unfälle und Verletzungen bei sich selbst behandeln konnte.
Und sie erklärte ihm lange und geduldig die Zielsetzung und Wichtigkeit des Experiments, für das er sich da zur Verfügung gestellt hatte.
Als er in den medizinischen Fragen fit genug war, überstellte man ihn an MARS, damit er dort die Wartung der CRABs lernen sollte und dazu noch einige andere Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten, etwa an der Übertragungstechnik.
Er war äußerst wissbegierig und lernte noch schneller als vorher, da er nun in seinem eigentlichen Interessengebiet geschult wurde.
Zudem hielt Nelly den Kontakt zu ihm aufrecht und besuchte ihn ab und zu. Wenn man es unvoreingenommen sah eigentlich immer dann, wenn er sich eine Belohnung verdient hatte.
Aber zu solcher Distanz war Theo natürlich nicht fähig.
Er glaubte ehrlich und wahrhaftig daran, Nelly sei die große Liebe seines Lebens, und auf eine tragische Art und Weise hatte er damit sogar recht, würde doch allen Planungen zufolge nach Nelly keine zweite mehr kommen.
Anhand einer holografischen 3D-Projektion lernte er, sich in der Verbotenen Zone zu orientieren, erfuhr alles über die Flora und Fauna, die er dort antreffen würde und übte unter psychologischer Anleitung einige Wochen lang Strategien gegen Einsamkeit und Langeweile ein. Diese Zeit empfand er als sehr belastend, weil sie ein striktes Kontaktverbot mit Nelly einschloss.
Aber er überstand auch diese Prüfung und dann war es eines Morgens so weit: Durch den streng kontrollierten Zugang in der Kanalisation brachte man ihn im Untergrund der Zone zu einem breiten Ausstieg, der schon gefährlich nahe an der inneren Zweihundert-Meter-Kernzone lag.
Die Wachen in ihren Schutzanzügen, die ihn begleitet hatten, wünschten ihm Glück und kehrten eilig wieder zurück zum Ausgangspunkt des unterirdischen Ganges, der direkt vor der Mauer an die Oberfläche führte.
Theo hörte noch, wie die Tritte ihrer schweren Bleischuhe allmählich verhallten, dann stieg er nach oben und sein neues Leben in der Zone begann.
Von Billys acht Beinen waren sechs nicht mehr brauchbar.
Keine Chance, sie noch irgendwie zu reparieren. Nur ein kompletter Austausch kam da infrage. Im Grunde war das eine recht einfache Angelegenheit und natürlich stand ihm auch eine große Menge an Ersatzbeinen zur Verfügung, denn es kam immer wieder vor, dass ein Bein eingeklemmt und beschädigt wurde, sei es bei den Räumarbeiten oder beim Durchqueren von unwegsamem Gelände.
Aber der Ranger hatte über die Reparaturen, die er durchführte, genau zu berichten. Draußen wussten sie, dass der Krebs mit der Seriennummer 28a/176, von ihm ›Billy‹ genannt, heute im Wäldchen an einer Stelle, die sie nicht einsehen konnten, liegen geblieben war.
Wenn er nun beim Rapport angab, an ihm sechs Beine ersetzt zu haben, würden sie wissen wollen, wie es zu diesem schwerwiegenden Schaden gekommen war. Dann hatte er nur zwei Optionen: Die Wahrheit oder eine glaubhafte Geschichte.
Die Situation war neu. Seit dem Bau der energetischen Barriere war kein Mensch mehr in die Zone gelangt, der nicht dort hingehörte. Er war sicher, dass weder NEPCO noch MARS die Sache gefallen würde. Beide würden darauf dringen, dass die Eindringlinge so schnell wie möglich das Sperrgebiet wieder verließen und sie würden ganz genau wissen wollen, wie sie da hatten hineinkommen können, damit sie diesen Zugang für immer verschließen konnten.
Vermutlich würden sie vorschlagen, die Mädchen provisorisch abgeschirmt über den Kanalzugang nahe der gefährlichen Kernzone bis ans Außentor zu bringen und sie dort den Sicherheitskräften zu übergeben.
Er sah schon die anklagenden Augen der mageren Straßenkinder vor sich, die ihn vorwurfsvoll anschauten, während die Security sie in Empfang nahm und abführte, um sie der Polizei zu übergeben.
Theo seufzte und machte sich daran, Billys Beine zu ersetzen.
Ein ums andere Mal wurde das leise Rauschen der Klimaanlage übertönt durch das harte Klickgeräusch, mit dem die Präzisionsstecker der Hydraulikleitungen seitlich am Korpus einrasteten. Als der Austausch abgeschlossen war, versuchte er, Billy mit einem schwachen Stromstoß wieder Leben einzuhauchen, aber die Operation Frankenstein zeigte keine Wirkung.
Der Automat blieb bewegungslos liegen. Da war wohl noch viel mehr beschädigt, als auf den ersten Blick zu sehen war.
Der Ranger entfernte eine schwarze Metallabdeckung an der Unterseite des Korpus, legte Billy auf den Objektträger des binokularen Stereomikroskops und fokussierte auf die Hauptplatine. Lange studierte er die Schaltungen, aber seine Aufmerksamkeit konzentrierte sich immer wieder auf den Chip mit dem BIOS.
Irgendetwas war da anders, als er es kannte. Der Chip unterschied sich offenbar von denen der anderen CRABs. Man musste sehr genau hinsehen, um es zu bemerken, aber er war sicher, dass er sich nicht irrte.
Beunruhigt und irritiert schaute er auf die große Analoguhr an der Wand.
Kurz vor achtzehn Uhr. Um achtzehn Uhr dreissig war der tägliche Rapport fällig und für die Ermittlung aller Parameter, für die NEPCO sich interessierte, brauchte er eine halbe Stunde.