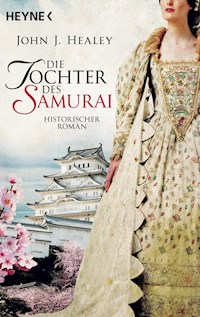9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Samurai-Saga
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Im Jahre 1614 segelte eine Delegation von Samurai-Kriegern und Händlern von Japan nach Spanien. Es waren die ersten Japaner, die europäischen Boden betraten. Vor diesem Hintergrund erzählt John Healey die Geschichte des jungen Kriegers Shiro, der von der Erblinie seines Vaters, des mächtigen Fürsten Date Masamune, ausgeschlossen wird.
Als Bastard soll Shiro, in den Künsten der Samurai bewandert, eine Handelsdelegation begleiten, die den langen Seeweg nach Spanien auf sich nimmt. Für Shiro beginnt eine schicksalhafte Reise, die ihn zwischen die Ränkespiele zweier spanischer Adelsfamilien führt. Von seinen eigenen Leuten verstoßen, verliebt Shiro sich in die schöne und eigenwillige Guada, die einem Edelmann versprochen ist. Zwischen den zwei so fremden Kulturen beginnt eine große und tragische Liebe …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 325
Ähnliche
Das Buch
Im Jahre 1614 segelte eine Delegation von Samurai-Kriegern und Händlern von Japan nach Spanien. Es waren die ersten Japaner, die europäischen Boden betraten. Vor diesem Hintergrund erzählt John Healey die Geschichte des jungen Kriegers Shiro, der von der Erblinie seines Vaters, des mächtigen Fürsten Date Masamune, ausgeschlossen wird.
Als Bastard soll Shiro, in den Künsten der Samurai bewandert, eine Handelsdelegation begleiten, die den langen Seeweg nach Spanien auf sich nimmt. Für Shiro beginnt eine schicksalhafte Reise, die ihn zwischen die Ränkespiele zweier spanischer Adelsfamilien führt. Von seinen eigenen Leuten verstoßen, verliebt Shiro sich in die schöne und eigenwillige Guada, die einem Edelmann versprochen ist. Zwischen den zwei so fremden Kulturen beginnt eine große und tragische Liebe …
Zum Autor
Der Amerikaner John Healey arbeitet als Schriftsteller, Dokumentarfilmer und Drehbuchautor. Seit Jahren pendelt der passionierte Historikforscher zwischen Amerika und Spanien. Er schreibt regelmäßig für El País in Madrid und ist ein tiefer Kenner der spanischen Kultur.
John Healey
DER SAMURAI VON SEVILLA
Roman
Aus dem Amerikanischen von Stefan Lux
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Vollständige deutsche Erstausgabe 02/2018
Copyright © 2016 by John Healey
Copyright © 2018 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Petra Bradatsch
Umschlagillustration: Rumberg Design
unter Verwendung des Originalumschlags von
© Calderón Studio
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN: 978-3-641-21057-1V001
www.heyne.de
Für Soledad
TEIL EINS
Kapitel 1
In dem ein Eid geleistet und ein Schwert empfangen wird
Denen, die für ihn kämpften, und denen, die vor seinem Schwert flohen, war der Herrscher und Begründer von Sendai, Date Masamune, als Dokuganrya, als Einäugiger Drache bekannt. Seine Kriegsrüstung war schwarz, der Helm mit einem goldenen Ornament in Form der zunehmenden Mondsichel verziert. Schlachtenruhm und weise Herrschaft machten ihn zu einem gefürchteten, aber auch geliebten Fürsten.
Als Masamunes Schwester Mizuki sechzehn wurde, heiratete sie einen Krieger aus guter Familie, der an der Seite ihres Bruders kämpfte. Bereits mit achtzehn jedoch war sie eine kinderlose Witwe. In ihrem einundzwanzigsten Lebensjahr wurde sie die Geliebte des wichtigsten Beraters ihres Bruders, Katakura Kojuro, und empfing einen Sohn. Nach dessen Geburt bat sie ihren Bruder, dem Kind einen Namen zu geben, und Date Masamune nannte ihn Shiro. Wie sein Großvater väterlicherseits, ein Mönch, der zum Samurai geworden war, hatte der Junge sechs Finger an seiner rechten Hand. Es war ein hoffnungsvolles Omen und ein praktischer Vorteil beim Schwertkampf.
Mizukis Geliebter Katakura Kojuro lebte mit seiner Frau und seiner Familie auf dem Gelände der Burg Shiroishi, die ihm von Date Masamune anvertraut worden war. Nach Shiros Geburt ließ Kojuros Frau ihrem Mann wegen des Bastards keine Ruhe und drängte ihn, das Verhältnis mit seiner Geliebten Mizuki zu beenden, die den Jungen daraufhin bei Date Masamune, seiner Frau und seinen Kindern in den Mauern der wesentlich größeren Burg Sendai aufzog. Mizuki war groß und gertenschlank, und ihr Sohn Shiro entwickelte sich zu einem hochgewachsenen, gut aussehenden und edel proportionierten Jungen.
In seinem dreizehnten Lebensjahr wurde Shiro zum Samurai, und der Herr rief ihn zu sich in seinen privaten Garten. Der Junge war nie zuvor dort gewesen. Die Kiesel im Garten waren in Perfektion geharkt, und über allem hing der Duft von feuchter Kiefer und Zeder. Er fand Date Masamune auf breiten, dunklen Bodenbrettern kniend, die so gründlich poliert waren, dass er sein eigenes Spiegelbild erkennen konnte. An den Seiten standen Papiertafeln mit tiefrot bemalten Rändern.
»Deine Mutter Mizuki ist meine einzige Schwester«, erklärte der Fürst. »Doch diese Burg und mein Name müssen an meine Söhne weitergegeben werden. Mizuki wiederum ist nicht mit deinem Vater verheiratet, sodass dessen Burg und Name an seine leiblichen Söhne gehen. Du bist von beiden Namen ausgeschlossen.«
Shiro versuchte, nicht auf die Narbe an der Stelle zu achten, wo das linke Auge seines Herrn gewesen war. In einer Schlacht ausgehöhlt, war die Stelle vor vielen Jahren zugenäht worden, und mit der Zeit hatte die Narbe die Gestalt eines geäderten Sterns angenommen.
»Doch du trägst das Blut meines Vaters in deinen Adern«, fuhr der Herr fort. »Und mein Blut fließt in dir. Du hast mir bis zum heutigen Tag Gefolgschaft geschworen und wirst nun dem Pfad des Kriegers folgen. Sag mir, dass du weißt, dass dies alles der Wahrheit entspricht.«
Sie knieten nebeneinander einem Felsbrocken gegenüber, in dessen Spalten Moos wuchs. Der Brocken lehnte an einem kleinwüchsigen Akamatsu-Baum.
»Ich weiß, dass all dies der Wahrheit entspricht, mein Herr.«
Solange Date Masamune weitersprach, hielt er das Auge auf den Stein gerichtet, ohne den Jungen auch nur ein einziges Mal anzuschauen. Und nach der Ansprache des Fürsten, das war dem Jungen klar, wurde von ihm erwartet aufzustehen und den Garten zu verlassen.
»Trotz allem bist du ein Prinz«, fuhr der Herr fort. »Du wirst wie ein Sohn für mich sein, und wo immer du hingehst, werde ich mit dir sein. Und wenn dich jemand verhöhnt, wird es sein, als verhöhnte er mich. Solange du unser Kriegerleben führst, wird es dir und deinen Nachkommen niemals an etwas fehlen. Hinter mir liegt das Schwert, das ich in der Schlacht von Odawara geführt habe. Mein Name und mein Siegel sind hineingeätzt, und jetzt gehört es dir.«
Masamune senkte den Kopf. Shiro stand auf, nahm das Schwert und hob es zum Kopf. Dann trat er einen Schritt zurück und streckte die Waffe vor sich aus. Als er an den Wachen vorbeiging, verbeugten sie sich vor ihm, denn sie hatten gehört, was der Herr gesagt hatte. Masamune blieb eine weitere halbe Stunde und betrachtete die Rinde des Baums und die feuchte Stelle, an welcher der Stein den Boden berührte.
Kapitel 2
In dem eine Geliebte enttarnt wird
María Luisa Benavides Fernández de Córdoba y de la Cerda war eine direkte Nachfahrin von Isabel de la Cerda und Bernardo Bearne, Conde von Medinaceli. Die Eltern des kleinen Mädchens, Sevillanos mit einem Palast in der Stadt und zahlreichen Landgütern, konnten sich seit der Herrschaft Alfonsos des Weisen auf königliches Blut berufen.
Trotz des energischen Protests des Familiengeistlichen ließ María Luisas Vater Don Rodrigo das Mädchen im stinkenden Wasser des Flusses Guadalquivir taufen. Ihre Mutter, Doña Inmaculada Gúzman de la Cerda, die an der exzentrischen Geste ihres Mannes Gefallen fand, begann ihre Tochter »Guada« zu nennen. Dies führte zu Verwirrung, als das Kind im Alter von zwölf Jahren eine Zeit lang am Hof Philipps III. in Madrid wohnte. Sie verbrachte dort viel Zeit mit ihrer Cousine Guadalupe Medina. Guadalupe, die das kürzere »Lupe« verabscheute, bestand nun darauf, ebenfalls Guada genannt zu werden, und zwang die Höflinge so, die jungen Damen mit ihrem kompletten Namen anzusprechen. Doch hinter deren Rücken nannten sie María Luisa »Guada die Schöne«.
Rodrigos Sohn, ebenfalls Rodrigo genannt, entwickelte schon früh einen Hang zu anderen Jungen. Regelmäßige Schläge und eine von seinem Vater bezahlte Geliebte blieben ohne Wirkung. Als der Junge später fürs Priesteramt zugelassen wurde, fiel Guada die alleinige Verantwortung für die Fortführung der Familie zu, denn Doña Inmaculada weigerte sich, weitere Kinder zu bekommen.
Kurz nach dem Eintritt in ihr fünfzehntes Lebensjahr wurde Guadas Verlobung mit einem entfernten Cousin verkündet, dem Herzog von Denia, dessen Besitz das ohnehin stattliche Familienvermögen verdreifachte. Er hieß Julián und war zwei Jahre älter als sie. Sie fand den Jungen gut aussehend und kultiviert. Ihrer Mutter berichtete sie, dass ihr prometido eine »poetische Veranlagung« besäße. Wenn sie auf den Gartenwegen des Klosters San Geronimo in Madrid unter Kastanienbäumen spazierten, durch die Rosengärten von »La Moratalla« schlenderten, dem Landgut ihrer Großtante bei Palma del Río, oder am Strand von Sanlúcar de Barrameda im Schatten saßen, hielten die beiden Jugendlichen ihre Triebe für Liebe.
Eines Tages begann sich Guada zu fragen, ob sie Kinder haben wollte, und sie vertraute ihre Gedanken der Mutter an. »Ich weiß, wie es abläuft«, sagte Guada. »Ich habe die Hunde an den Mauern des Alcázar beobachtet und unsere eigenen Pferde hier im Gehege. Außerdem habe ich meinen Bruder baden sehen und mich selbst gründlich untersucht.«
»Was kann ich dir dann noch erzählen, Kind?«
Sie saßen im Zimmer ihrer Mutter in einer Finca der Familie in der Nähe von Carmona. Von ihren Plätzen aus konnten sie die wogenden Felder frischen Grüns sehen. Sie waren derart unüberschaubar, dass sie sich in ein weites grünes Meer verwandelten, sobald Guada die Augen ein Stück zusammenkniff. Hinter Doña Inmaculada stand die maurische Frau von der anderen Straßenseite, die ihr jeden Morgen die Haare kämmte und kaum ein Wort castellano sprach.
»Ich weiß, wie es abläuft«, wiederholte Guada. »Aber mir sind die einzelnen Schritte nicht klar. Wie es im Einzelnen vor sich geht.«
»Unter den Augen Gottes«, sagte ihre Mutter und beugte den Kopf bei jedem einzelnen Strich des breiten Elfenbeinkamms, »weiß der Körper, was zu tun ist. Es gibt nichts zu lernen. Es mag unangenehm sein, wie die meisten anderen Körperfunktionen auch, aber es ist eine natürliche Sache.«
»Es ist unangenehm?«
»Nicht, wenn dein Ehemann behutsam vorgeht.«
»War Vater nicht behutsam?«
»Frauen unseres Standes haben keine Freude daran, Kind. Auch wenn es beim niederen Volk angeblich anders ist.«
»Du hast meine Frage nicht beantwortet.«
»Dein Vater hat viele Eigenschaften, aber Behutsamkeit gehört nicht dazu. Ich war so jung wie du und wusste noch weit weniger. Dein Vater war nervös und trotz seines ganzen Geredes noch unerfahren. Er folgte der Leidenschaft des Verlangens, ich der des Gehorchens.«
»Und dabei blieb es?«
»Wir haben nie darüber gesprochen. Und seit deiner Geburt teilen wir das Bett nicht mehr. Wie wir beide wissen, findet dein Vater diese Art von Gesellschaft anderswo.«
Guada fühlte sich nach diesem Gespräch eher bekümmert als beruhigt. Sie hatte gehofft, ihre Mutter würde ihr gut zureden und ihre Ängste mit dem andalusischen Esprit beschwichtigen, für den sie bekannt war. Stattdessen waren Inmaculadas ansonsten kaum spürbare nördliche Wurzeln mit der Härte kastilischen Stahls zutage getreten.
Zurück in Sevilla, erhielt Doña Inmaculada Besuch von ihrer älteren Tante Doña Soledad Medina y Pérez Guzman de la Cerda, die als Gastgeschenk mit dem neuesten Klatsch aufwartete, der beide Frauen in helle Aufregung versetzte. Am nächsten Morgen, nach der Frühmesse, spürte Inmaculada ihren Ehemann auf, der tags darauf nach Madrid reisen wollte. Er saß in seinem Arbeitszimmer und gönnte sich ein Glas bernsteinfarbenen Manzanilla-Sherry.
»Ich muss mit dir über eine äußerst dringende Angelegenheit sprechen«, sagte sie und schaute ihm direkt ins Gesicht.
»Dann sprich«, sagte Don Rodrigo, der nur halb zuhörte und mit einer Klage über irgendeinen Streit unter den Dienstboten oder ein neues körperliches Leiden seiner Gattin rechnete. Seit dem Ende ihrer ehelichen Beziehungen waren Krankheiten und Unwohlsein bei ihr zu einer Art Besessenheit geworden, die ihn ermüdete. Während sie sprach, betrachtete er den mit seinem Wappen verzierten Ring am Mittelfinger seiner rechten Hand.
Überraschenderweise fragte Inmaculada: »Was hältst du von Don Julián?«
»In welcher Hinsicht?«
»In jeder Hinsicht«, entgegnete sie, was ihn noch mehr überraschte.
»Warum?«
»Ich habe gehört, er hätte eine Geliebte. Der Junge ist siebzehn und hat eine Geliebte, die doppelt so alt und außerdem seine eigene Tante ist.«
»Welche Tante?«, fragte er und löste den Blick vom Ring mit einem Gefühl, als verabschiede er sich gerade von jeglicher Aussicht auf ein glückliches Leben. Denn seine Intuition hatte die Antwort auf die Frage bereits erfasst. Er starrte hinab auf die großen Terrakottafliesen, deren fleckiger, verbrannter Farbton ihn an Sizilien erinnerte.
»Marta Vélez«, erwiderte sie.
»Das kann nicht sein«, sagte er und wusste doch, dass sie recht haben konnte.
»Genauso habe ich auch reagiert, aber Soledad ist sich ihrer Sache sicher.«
»Ich bezweifle es ernsthaft.«
»Martas beide Söhne sind tot. Ihr abscheulicher Ehemann hält sich fern und schlachtet Wild in Asturien. Sie ist noch immer attraktiv. Julián sieht gut aus. Und hinsichtlich des Blutes ist sie nur seine Halbtante. Offenbar übernachtet er oft bei ihr in Madrid, und zwar nicht in getrennten Zimmern.«
Im Bett mit Marta Vélez brachte Rodrigo vier Tage später das Thema zur Sprache.
»Wer um Himmels willen hat dir so etwas erzählt?«, fragte Marta und schloss ihr Negligé vor seinen mit einem Mal unwürdigen Augen.
»Also leugnest du es nicht.«
»Solch schmutzigen Klatsch werde ich erst gar nicht zur Kenntnis nehmen.«
»Weil es wahr ist.«
»Wie kannst du es wagen?«
Am nächsten Tag besuchte Don Rodrigo am Hof seinen Kindheitsfreund Don Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, den Herzog von Lerma. Rodrigo war ein spanischer Grande. Die Sandovals, ebenfalls aus Sevilla, aber von niedrigerem Adel, mussten für ihr Geld arbeiten und intrigieren. Der Herzog hatte sich einen Platz im Leben von Philipp III. erobert, als dieser noch ein junger Prinz gewesen war. Nun zog er im Königreich die Fäden, wodurch er für sich und seine Familie ein enormes Vermögen anhäufte. Doch die eine Sache, die er wollte und die er trotz all seiner Macht und all seinem Ehrgeiz nicht haben konnte, war das, was Rodrigo schon durch Geburt in die Wiege gelegt worden war. Die beiden kamen miteinander aus und benutzten sich gegenseitig. Wenige wagten es, Rodrigo in die Quere zu kommen, weil sie fürchteten, den Herzog von Lerma gegen sich aufzubringen. Der Herzog seinerseits warf gern den Namen seines aristokratischen Freundes in die Runde und gab sich den Anschein, selbst zu dessen illustrer Klasse zu zählen.
Sofern der Herzog von Lerma überhaupt über irgendeine maskuline Ausstrahlung verfügte, verdankte sich dieses Charisma seiner Macht. Und doch hielt er sich für attraktiv und kannte viele Frauen, die ihm bereitwillig zustimmten. Seine Räume im Königlichen Palast trennten die Säle und Zimmer, die den Adligen offen standen, von denen, die dem König und seiner Familie vorbehalten waren. Während er seinem Freund zuhörte, betrachtete er sich in einem großen venezianischen Spiegel. Die Krone hatte ihn als Geschenk des Kardinalbischofs von Sabina erhalten, von Scipione Borghese, dem Bruder des Papstes. Sein Schreibtisch, einfach, aber massiv, stammte aus einer geplünderten Synagoge in Toledo. Don Rodrigo stand an einem der Fenster und starrte hinaus auf den umschlossenen Garten, in dessen Mitte ein Priester an einem Springbrunnen in seinem Brevier las.
»Sie leugnet es«, sagte Rodrigo. »Aber ich wusste in dem Moment genau, dass sie lügt.«
»Hast du ihr diese Neuigkeit überbracht, bevor oder nachdem du dich mit ihr amüsiert hattest?«
»Vorher.«
»Was letztlich bedeutet, dass du ohne dein Amüsement auskommen musstest, oder?«
»Es geht um eine ernste Angelegenheit.«
»Unsinn.«
»Der Junge steht vor der Hochzeit mit meiner Tochter.«
»Was erwartest du von mir? Dass ich Marta Vélez vor die Inquisition zerre? Welches Verbrechen hat sie begangen? Welche Ketzerei kann man ihr vorwerfen? Sie genießt das Ansehen des Königs, wird von ihrem Esel von Ehemann vernachlässigt und hat ihre Söhne verloren. Wahrscheinlich ist sie einfach vernarrt in den Jungen. Du solltest dankbar sein.«
»Dankbar?«
Der Herzog begann zu lachen.
»Du machst dich über mich lustig«, stellte Rodrigo verärgert fest. »Vielleicht ist sie auch unschuldig und sagt die Wahrheit.«
»Das hoffe ich wirklich nicht«, erklärte der Herzog.
»Wie kannst du so etwas sagen?«
»Die Sache ist einfach zu köstlich.«
»Ihr, mein Herr, seid ein abscheulicher Mann.«
»Und du bist ein wütender Mann, weil du glaubst, deine Geliebte und dein zukünftiger Schwiegersohn setzen dir Hörner auf. Du musst den Neuigkeiten mit Gelassenheit begegnen, sogar mit Humor, mit einer Spur dieses Mitgefühls, das du bei mir immer vermisst. Sicher hört der Junge auf, sie zu besuchen, sobald er verheiratet ist. Dann hast du sie wieder ganz für dich allein.«
Kapitel 3
In dem Shiro Yokiko begegnet und der Zweck einer Reise erklärt wird
Auf Drängen des Herrn hatte Shiro bereits in jungem Alter Umgang mit den Barbaren. Er wurde nach Edo geschickt, um von dem englischen Seemann und Navigator William Adams zu lernen, der – zum großen Verdruss der portugiesischen Jesuiten – vom Shōgun Tokugawa Ieyasu vor der Exekution bewahrt worden war. Zu der Zeit, als Shiro bei ihm arbeitete, hatte sich Adams bereits japanische Kleidung und Gebräuche zu eigen gemacht. Er brachte dem Jungen neben den Grundlagen der Astronomie, Geometrie und Kartographie auch das Segeln bei, außerdem lehrte er den jungen Samurai, Englisch zu sprechen und zu lesen. Sein ehemaliger Mannschaftsgenosse von der schiffbrüchigen Liefde, der niederländische Zimmermann Pieter Janszoon, unterrichtete Shiro in der Holzbearbeitung und der Konstruktion von Schiffen. Ein Franziskanerbruder aus Sevilla, Luis Sotelo, der unter dem Schutz des Herrn Date Masamune persönlich stand, brachte dem Jungen Latein, Griechisch und Spanisch bei. Die Begegnung mit den Kulturen und Sprachen seiner Lehrer – der Engländer war zurückhaltend, praktisch und melancholisch, der Spanier extrovertiert, intrigant und opportunistisch – erweiterten Shiros Verständnis der Welt auf eine Art und Weise, die ihm eine Sonderstellung unter seinen Samurai-Brüdern verlieh.
Die Portugiesen und später die Spanier hatten versucht, ihre Religion ins Königreich zu exportieren. In den südlichen Shōgunaten bewirkten die Jesuiten viele Bekehrungen. Shiro und die anderen Samurai fanden den fremden Glauben ermüdend, arrogant und merkwürdig verworren. Doch manche Japaner hörten auf die Missionare, und einige noch klügere, wie der Shōgun Tokugawa Ieyasu und der Herr Date Masamune, liehen den Predigten zumindest für eine Weile ihr Ohr, wobei sie andere Interessen im Hinterkopf hatten. Ein mächtiges Erdbeben hatte nämlich Gebiete verwüstet, die eine Schlüsselstellung für den Binnenhandel einnahmen, sodass neue Märkte erschlossen werden mussten. Nachdem er von den Reichtümern Spaniens und Italiens erfahren hatte, stellte Date Masamune Pater Sotelo unter seinen Schutz und erlaubte ihm in begrenztem Umfang das Predigen. Wenn der Preis für den Handel mit derart mächtigen Barbaren darin bestand, ihre Religion zarte Wurzeln in seine geliebte Erde treiben zu lassen, dann sollte es eben so sein. Er beschloss, es auf den Versuch ankommen zu lassen und zu beobachten, wie die Dinge sich entwickeln würden. Seine Schlachten waren geschlagen. Seine Feldzüge waren erfolgreich gewesen. Seine Burg war vollendet. Er musste nichts mehr beweisen.
Der heranwachsende Shiro dachte häufig über derlei Dinge nach. Er hatte von der Geschichte der sechsundzwanzig Christen gehört, die 1597 gekreuzigt und mit Lanzen durchstoßen worden waren, darunter einige Japaner. Man hatte sie wegen der Sturheit ihres Glaubens lächerlich gemacht und sie wie verirrte Schweine durch die Stadt getrieben, sie verhöhnt und auf dem Weg nach Nagasaki mit Steinen beworfen. Nachdem man sie an Kreuze gebunden und getötet hatte, waren die Leichen der Barbaren geöffnet und untersucht worden. Zur Bestürzung aller Anwesenden war es eindeutig, dass sich ihr Inneres in nichts von dem des vornehmsten Samurai unterschied.
Der japanische Begriff für alle, die in einem anderen Land geboren worden waren, lautete nanban. Doch von William Adams und Pater Sotelo hatte er gelernt, dass die dahinterliegende Vorstellung universell war. Das englische Wort barbarian und das spanische bárbaro stammten vom lateinischen barbaria ab, mit dem das fremde Land bezeichnet wurde, und vom griechischen barbaroi, das »alle, die keine Griechen sind« bedeutete. Dies war verwirrend für Shiro. Offenbar hegten andere Rassen in anderen Ländern dieselben Urteile. Trotz erkennbarer physischer Unterschiede wie der Hautfarbe, den Haaren und der Form der Augen verhielten sie sich grundsätzlich gleich. Die gewichtigsten Unterschiede zwischen den Völkern bestanden wohl in Fragen der Sitten, der jeweiligen Essgewohnheiten, der wissenschaftlichen Erkenntnisse und der Religion. Auch wenn die Barbarenschiffe besser für die Reise auf den Ozeanen geeignet und ihre Musketen furchteinflößender waren, konnten ihre Schwerter mit denen der Japaner nicht annähernd mithalten, waren ihre Essgewohnheiten abstoßend und ihre Abneigung gegen Körperpflege ein Angriff auf den Geruchssinn. Ihre Religion war aufdringlich und bizarr.
Im Frühjahr 1612, als Shiro achtzehn war, sprach er im Anschluss an eine Schwertkampf-Vorführung in der Burg Sendai den Fürsten an und erbat dessen Rat, was den Umgang mit Ausländern betraf. Ohne zu lächeln, bat ihn der Herr um eine ausführlichere Erklärung. Er hörte zu, und als Shiro fertig war, sagte er: »Komm mit mir.«
Shiro folgte dem Herrn in die Waffenkammer, wo Diener diesem die Kriegsrüstung abnahmen, jedes Teil in Seide wickelten und dann in lackierte Regale legten, neben denen uralte Schwerter, Speere, Bogen und Pfeile ausgestellt waren. Auf den Befehl des Herrn hin halfen sie auch Shiro, der sich geehrt fühlte. Dann entledigte sich der Herr der Kleidung, die er unter der Rüstung trug, und legte eine Robe an. Shiro wurde aufgetragen, es ihm nachzutun.
Von dort aus gingen sie durch einen langen, schmalen Korridor, der von dem Teil des Gebäudes wegführte, in dem der Herr mit seiner Frau und seiner Familie wohnte. »Deine Überlegungen machen mich zufrieden«, sagte er zu dem jungen Mann. »Alles, was du gesehen und worüber du nachgedacht hast, zeigt die Klarheit deines Verstandes und bestätigt mein Urteil. Meine eigenen Söhne, auch diejenigen, die älter sind als du, sind immer noch zu dreist, zu impulsiv, zu seicht, zu schnell zur Prahlerei und zum Ziehen des Schwertes bereit.« Wieder fühlte Shiro sich geehrt. Er brachte seine Dankbarkeit zum Ausdruck.
»Warst du schon einmal mit einer Frau zusammen?«, fragte der Herr.
Shiro errötete. »Nein, mein Herr.«
»Dann ist es Zeit.«
Sie kamen in einen Teil der Burg, von dem Shiro bisher nur gerüchteweise gehört hatte, einen üppigen Garten im Schutz hoher Anbauten und versteckt hinter Bäumen und Kletterpflanzen. Trotz der Tatsache, dass jeder einzelne Baum und Strauch mit Sorgfalt ausgewählt und gepflanzt worden war, machte der Garten einen wilden Eindruck. Mitten hindurch floss ein kleiner Bach. An Obstbäumen hingen Käfige mit Vögeln. Zwei große Holzbottiche standen in der Mitte, und wenn man den Bach über eine schmale hölzerne Brücke überquerte, teilte sich der Weg in zwei Pfade, die zu flachen Häuschen an den gegenüberliegenden Enden des Gartens führten.
Eine wunderschöne Frau in einem einfachen blauen Kimono, die er noch nie gesehen hatte, stand neben einem der Bottiche, die bereits mit Wasser gefüllt waren. Sie verbeugte sich vor dem Herrn und dann vor Shiro. Der Fürst trat auf sie zu, drehte sich um und ließ sich von ihr aus der Robe helfen. Nachdem sie ihn sauber geschrubbt hatte, ließ er sich in das Wasser sinken. Mit einem Blick bedeutete er ihr, mit Shiro genauso zu verfahren. Sie blieben eine halbe Stunde im Wasser, ehe der Herr die Frau heranwinkte. Er flüsterte ihr etwas ins Ohr, woraufhin sie sich zurückzog und verschwand. Einige Minuten später kehrte sie mit Handtüchern zurück. Der Herr verließ den Bottich und deutete auf eines der Häuschen. »Ich gehe dorthin. Du gehst in das andere. Später trinken wir Tee und sprechen über die Zukunft.« Shiro legte die Handflächen aufeinander, verbeugte sich und sah zu, wie der Herr sich entfernte. Die Frau folgte einige Schritte hinter ihm. Er sah, wie sie das Häuschen betraten und die Tür hinter sich zuschoben.
Als er aus dem Bottich stieg, fühlte er sich unbehaglich. Schließlich war er nackt und stand triefnass im Freien. Weder ein Handtuch noch eine Robe waren für ihn bereitgelegt worden. Er fragte sich, ob irgendwelche an den Mauern postierten Wachen ihn sehen konnten. Dann überquerte er die schmale Brücke und ging über den sorgfältig geharkten Weg zu dem Häuschen, das der Herr ihm zugewiesen hatte. Die Kiesel auf dem Pfad waren glatt und leicht zu begehen. Die Luft roch nach Apfel- und Pflaumenblüten. Er fragte sich, wer die Vögel füttern mochte.
Dann betrat er das Häuschen. Der Boden bestand aus poliertem Zedernholz. Senkrecht zum Eingang war ein Bett ausgerollt. Es gab keinerlei Dekoration, doch zeichneten sich die Umrisse der Pflanzen und Äste draußen als Schatten hinter den Papierwänden ab. Ein kleiner Heizofen dampfte über einem Feuer in einer Grube, die in der Mitte des Raumes in den Boden eingelassen war. Ein junges Mädchen von höchstens sechzehn kniete neben dem Ofen und erwartete ihn mit einem Handtuch und einer Robe. Als er Anstalten machte, sich zu bedecken, drehte sie den Kopf zur Seite. Dann erhob sie sich, trat hinter ihn und begann, ohne ein Wort zu sagen, ihn mit dem Handtuch vorsichtig abzutrocknen.
Zwei Stunden später traf er den Herrn in einem Teeraum am Rande des Gartens. Hier flogen Vögel frei herum oder hockten auf den Dachsparren. Der Mönch, der den Tee bereitete, war alt und blind und hatte schon Date Masamunes Vater treu gedient. Der Fürst hob die Tasse in Shiros Richtung.
»Wie ich höre, ging es gut.«
Shiro senkte den Kopf.
»Deine Bescheidenheit spricht für sich«, fuhr der Herr fort. »Du darfst die Nacht hier mit ihr verbringen und kehrst dann am Morgen in deine Baracke zurück.«
Wieder wurde Shiro rot.
»Deine Gedanken über die Barbaren erfreuen mich, denn du stehst vor einer großen Reise – als meine Augen und Ohren. Vielleicht hast du schon gehört, dass ein Adliger in meiner Provinz namens Hasekura Tsunenari wegen Korruption verurteilt wurde und enthauptet werden soll. Ich kenne ihn seit früher Jugend und bin sehr traurig. Er hat in vielen Schlachten mit mir gekämpft. Aus Rücksicht auf die Ehre seiner Familie habe ich seinen Sohn, Hasekura Tsunenaga, begnadigt und ihm dasselbe Schicksal erspart. Der Sohn ist doppelt so alt wie du und wird in meinem Auftrag eine Delegation von zweiundzwanzig Samurai auf einer Reise über die Ozeane anführen, darunter zehn Krieger des Shōguns und zwölf meiner Leute. Sie werden hundertzwanzig Händler, Seeleute, Diener und verschiedene Barbaren begleiten, deren wichtigste der spanische Pater Sotelo und der Seemann Sebastián Vizcaíno sind. Tokugawa Ieyasu und Tokugawa Hidetada haben mir diese Mission übertragen. Das Schiff wird vom Admiral des Shōguns gebaut, Mukai Shogen Tadakatsu, der schon eine Reihe Fregatten mit deinem Freund William Adams konstruiert hat. Im Herbst wird das Schiff zum Aufbruch bereit sein.«
An dieser Stelle legte Date Masamune eine Pause ein und trank noch einen Schluck Tee. Dann deutete er mit dem Finger direkt auf Shiro. »Du wirst mit niemandem über unsere Unterredung heute sprechen, nicht einmal mit Hasekura Tsunenaga. Du wirst dich verhalten wie die übrigen Krieger, aber mit wachen Sinnen. Denn bei eurer Rückkehr muss ich mich darauf verlassen können, dass mir die Wahrheit berichtet wird. Verstehst du das?«
»Ja, mein Herr. Wie lange werde ich fort sein?«
»Mindestens zwei Jahre.«
In der Nacht, nachdem das Mädchen Yokiko sich gebadet hatte und neben ihm eingeschlafen war, lag er wach und dachte über sie nach. Sie war die Tochter eines Gefangenen. Man hatte sie als Beute genommen und angelernt, dem Herrn zu dienen, wenn er sich bei seiner Geliebten aufhielt. Sie war einmal mit Date Masamune und auch mit seinen Söhnen zusammen gewesen und wurde ansonsten gut behandelt. In ihren eigenen Augen hatte sie Glück gehabt, weil ihre Schönheit sie vor einem härteren Schicksal bewahrt hatte. Während sie ihm diese Dinge erzählte, versuchte er, seine Gefühle zu ordnen. Keiner von beiden hatte davon gesprochen, was mit ihr geschehen könnte, wenn sie älter würde. Shiro schaute sie an und stellte sich vor, sie gehörte zu ihm. Kurz vor Morgengrauen begannen die Vögel in ihren Käfigen draußen zu singen. Er tat, als schliefe er, und betrachtete sie durch seine halb geschlossenen Augen beim Aufstehen und Ankleiden. Dann war sie fort.
Kapitel 4
In dem der Meister einen Langweiler erträgt, dessen schlimmste Sorge wahr wird
Marta Vélez war bereit, die Beziehung mit Rodrigo wiederaufzunehmen, nachdem er ihr eine Goldkette überreicht und versprochen hatte, den Namen ihres Neffen nie wieder zu erwähnen. Eines Abends blieb Rodrigo, der sich eigentlich auf dem Rückweg nach Sevilla befinden sollte, heimlich in Madrid. Er führte den angehenden Schwiegersohn zum Essen mit Miguel de Cervantes Saavedra aus.
Rodrigo hatte Cervantes kennengelernt, als der Autor in Sevilla inhaftiert gewesen war. Der Grande hatte regelmäßig Essen und Schreibutensilien ins Gefängnis geschickt, und auf seine Fürsprache hin war Cervantes ein Jahr früher entlassen worden. Rodrigo hatte dabei nicht aus Mitleid oder Leidenschaft für die Literatur gehandelt. Die einzigen Bücher, die man in seinem Haushalt fand, waren Bände über die Jagd, die Bibel und – um Eindruck zu schinden – Francesco Guicciardinis Geschichte Italiens. In Wahrheit hatte er auf Geheiß seiner Frau gehandelt. Doña Inmaculada nämlich hatte dargelegt, dass die gefälschten Rechnungen, derentwegen Cervantes zu Unrecht eingesperrt worden war, aus einer Zeit stammten, in der er als Versorgungskommissar für die Spanische Armada gearbeitet hatte. Und der Admiral der Armada war niemand anderes als Rodrigos Großonkel, der Herzog von Medina-Sidonia.
Nach seiner Entlassung war Cervantes stets froh, seine Dankbarkeit zeigen zu können. In letzter Zeit umso mehr, als Rodrigo ein enger Freund des mächtigsten Mannes auf der Iberischen Halbinsel geworden war, des Herzogs von Lerma. Cervantes hasste den Herzog. Als der König sein Wohlwollen für den Autor gezeigt und dem Herzog aufgetragen hatte, Cervantes zu unterstützen, hatte dieser nur spärlichste Geldmittel bereitgestellt und den Schriftsteller praktisch in die Armut gezwungen. Noch schlimmer war, dass in jenem Jahr eine gefälschte »Fortsetzung« seines Quijote in Tarragona erschienen war, für deren Verfasser Cervantes einen Günstling des Herzogs hielt, Fray Luis de Aliaga. Das Buch war ein großer Erfolg gewesen. Doch trotz dieser ganzen Vorgeschichte konnte und wollte Cervantes es auf keinen Fall riskieren, sich beim Herzog von Lerma unbeliebt zu machen.
Nachdem er den ganzen Tag am zweiten Teil seines Don Quijote gearbeitet hatte, war Cervantes für jede Unterbrechung dankbar, ganz besonders, wenn dabei eine opulente Mahlzeit heraussprang. Die beliebte und stets gut besuchte Taverne, in der sie speisten, lag am eleganteren Ende der Calle Mayor, nicht weit von dort entfernt, wo Cervantes wohnte. Seit Philipp II. Madrid anstelle von Valladolid zur ständigen Hauptstadt erklärt hatte, war die Stadt überschwemmt worden von Tausenden Höflingen, Adligen und jenen, die für deren Wohlergehen sorgten. Die Bevölkerungszahl hatte sich verdreifacht. Die Gegend um den Alcázar, den Königspalast, lag auf einer Landzunge über dem schmalen Wasserlauf, der liebevoll als »Fluss« Manzanares bezeichnet wurde. Dort war ein Gewirr schmutziger Sträßchen entstanden. Diese übel riechenden Gassen erweiterten sich hier und dort zu bescheidenen Plätzen. In diesem ganzen Labyrinth war es im Sommer brütend heiß und im Winter feucht. Wie die madrileños so gern über das Klima in ihrer Stadt sagten: »Son seis meses de invierno y seis de infierno.« (Wir haben sechs Monate Winter und sechs Monate die Hölle.)
Über einem Lammbraten, der so saftig war, dass man ihn mit der Kante eines Porzellantellers hätte schneiden können – was der lästige Besitzer auch immer wieder gern demonstrierte –, und einem sehr jungen, aber angenehmen Rotwein aus den riesigen Ton-Zisternen im Keller versuchte Rodrigo, den zukünftigen Schwiegersohn durch seine Bekanntschaft mit dem Schriftsteller zu beeindrucken. Dabei erweckte er den Anschein einer größeren Vertrautheit, als tatsächlich bestand.
»Ich lebe in einer altmodischen, provinziellen, allzu zeremoniellen Welt, Amigo«, sagte er zu dem Autor. »Aber Ihr habt die Geheimnisse des Lebens in vielen Ländern beobachtet und überdacht und lebt nun hier in diesem unablässigen menschlichen Gewimmel, in dieser rohen Umgebung. Sagt mir und diesem jungen Adligen, der heute Abend bei uns sitzt, wie Ihr das Verhalten der Jugend heutzutage einschätzt.«
Cervantes war die absonderliche Ausdrucksweise gewöhnt, die Rodrigo ihm gegenüber anschlug. Von anderen Bekannten des Granden wusste er, dass dieser ansonsten für seine Direktheit bekannt war; als eleganter, aber wortkarger Mann, dessen einzige Schwächen die Jagd, die Hurerei und seine Tochter waren. Cervantes hatte daraus richtig geschlossen, dass hinter Rodrigos verschachtelten Sätzen der hilflose Versuch stand, seinen Vorstellungen einer literarischen Konversation gerecht zu werden. Es amüsierte Cervantes und erweckte sogar eine Art Mitgefühl für diesen Mann, den er im Grunde für einen ausgemachten Primitivling hielt.
Von früheren gemeinsamen Abenden wusste er außerdem, dass Rodrigo sich für eine verwandte Seele hielt, einen Mann von Welt, der wie er den Geschmack der Schlacht gekostet hatte. Auch wenn dies den Schriftsteller im Prinzip belustigte, verspürte er zuweilen auch Ärger. Denn Cervantes war tatsächlich Soldat gewesen, war bei der Schlacht von Lepanto zweimal in die Brust und einmal in den linken Arm geschossen worden. Er wurde nicht umsonst Manco de Lepanto genannt. Danach hatte er in Algier fünf Jahre in Gefangenschaft verbracht und mehrfach versucht, aus den befestigten Verliesen zu fliehen. Rodrigo hingegen behauptete zwar regelmäßig, während Spaniens erfolglosem Seekrieg gegen die Engländer 1588 aktiven Dienst geleistet zu haben. Tatsächlich aber war er damals achtzehn Jahre alt und Adjutant seines Großonkels gewesen, des siebten Herzogs von Medina-Sidonia. Von einem langwierigen Anfall von Seekrankheit abgesehen, hatten Rodrigo und sein berühmter Verwandter das Debakel ohne jeden Kratzer überstanden. Während Cervantes in Ketten gelegt und von mordlustigen Wärtern verspottet wurde, hatten Rodrigo und sein Onkel das luxuriöse Leben auf ihren Landgütern wieder aufgenommen und sich mit der Jagd, frommen Ehefrauen und willigen Dienerinnen vergnügt.
»Ich bin nicht sicher, ob ich die genaue Bedeutung Eurer Frage begriffen habe«, erwiderte Cervantes. »Aber mir scheint, dass sich die jungen Leute heutzutage so verhalten, wie sie es immer schon taten.«
»Keineswegs, mein Freund«, erklärte Rodrigo herablassend. »Jedenfalls, was meine Gesellschaftsschicht betrifft – und bitte bekommt das jetzt nicht in den falschen Hals.«
»Keineswegs, Don Rodrigo.«
Die ironische Nachahmung seiner Ausdrucksweise entging dem Aristokraten, nicht aber dem jungen Mann neben ihm.
»Als Ihr und ich jung waren, zogen wir in den Krieg, Miguel, und zwar mit Freude«, erklärte Rodrigo mit einem Gesichtsausdruck, als könne er sich tatsächlich an Szenen blutiger Schlachten erinnern, die er nur mit Mühe überlebt hatte. »Heute habe ich noch von keinem Sohn eines Adligen gehört, der den Drang verspürt, sich auf solche Art zu beweisen.« Während des letzten Satzes stieß er den Ellbogen sanft gegen Juliáns Brust.
Cervantes gab sich alle Mühe, interessiert und verständnisvoll zu wirken. Dabei fragte er sich, worauf – wenn überhaupt – diese geistlose Unterhaltung abzielte. Währenddessen betrat ein kleiner Mann die Taverne, den er zunächst für seinen am meisten verhassten Rivalen hielt, den unerträglichen und massentauglichen Lope de Vega. Cervantes verspürte eine köstliche Erleichterung, als der Mann sich bei näherem Hinsehen als jemand anderer erwies.
»Was würdet Ihr vorschlagen, wo diese jungen Männer ihre Schwerter schwingen sollen, Don Rodrigo? Seit 1604 leben wir im Frieden mit den Engländern und seit fünf Jahren auch mit den Niederländern.«
»Beides wird nicht lange halten, mein Freund. Glaubt mir. Ich, der ich das Vertrauen vieler Informierter genieße, weiß über diese Dinge Bescheid. Aber darum ging es mir eigentlich nicht. Was ich im Hinblick auf unsere Jugend am meisten fürchte« – Rodrigo betrachtete den Autor mit einer Ernsthaftigkeit, die beinahe komisch wirkte –, »ist eine alarmierende Zunahme an Perversionen.«
Nun hatte er die Aufmerksamkeit seines Zuhörers geweckt.
»Perversionen.«
»Lasterhafte Perversionen. Junge Männer, die mit Verwandten herumtollen, statt sich auf dem Schlachtfeld zu erproben.«
Julián spürte, wie sich die Röte von seinem Hals nach oben ausbreitete. Cervantes legte seine gesunde Hand auf Rodrigos Unterarm.
»Sagt mir, guter Mann, was stört Euch? Wenn Ihr von ›Herumtollen‹ sprecht, bezieht Ihr Euch dann auf geschlechtliche Verbindungen?«
Rodrigo leerte seinen Becher und schloss einen Moment lang die Augen.
»Exactamente.«
»Dies ist das erste Mal, dass ich von solchem Benehmen höre. Vielleicht gibt es so etwas nur in Euren höheren Kreisen.«
Rodrigo war mit einem Mal die Lust an geistvollen Sprüchen vergangen. Stattdessen antwortete er mit einem Brummen und bestellte noch einen Wein.
»Doch wenn es tatsächlich so ist«, beharrte Cervantes, »muss ich feststellen, dass es sich dabei um nichts Neues handelt.«
»Was wollt Ihr, verdammt noch mal, damit sagen?«, platzte Rodrigo heraus.
»Was denkt denn Ihr, junger Mann?« Cervantes wandte sich an Julián und ignorierte Rodrigos Ausbrüche.
»Ich gestehe«, sagte Julián mit einem Blick auf den verschmierten Tisch, »dass ich nicht so recht begreife, worum es hier geht.«
»Nun, das will ich auch hoffen«, bemerkte Rodrigo eine Spur zu energisch.
Cervantes fragte sich, welches verdeckte Spiel hier im Gange sein mochte.
»Worauf ich mich beziehe, mein Herr«, sagte der Schriftsteller, »ist ein im Verlauf der Geschichte recht gewöhnliches Phänomen, weshalb ich wenig Sinn darin sehe, mehr Zeit darauf zu verschwenden.«
»Gewöhnlich? Recht gewöhnlich, sagt Ihr?« Rodrigo kochte.
»Recht gewöhnlich in Euren entschieden nicht so gewöhnlichen oberen Klassen.«
»Hol Euch der Teufel, Mann! Das ist nicht das, was ich hören wollte.«
Mit unterschiedlichen Graden der Verwirrung horchten alle drei Männer diesem letzten Satz nach.
»Unser eigener König war mit seiner Cousine verheiratet«, erklärte Cervantes. »Der Habsburger Monarch Maximilian II. heiratete seine Cousine ersten Grades, María von Spanien, Tochter von Karl V., und sie hatten sechzehn Kinder zusammen. Cleopatra war mit ihrem jüngeren Bruder verheiratet. Adonis war das Kind eines Vaters mit dessen Tochter. Abraham und seine Frau Sarah waren Halbgeschwister. Während der Römerzeit waren Verbindungen zwischen Bruder und Schwester verbreitet. Auch wenn dieses ›Herumtollen‹, wie Ihr es nennt, oft von einer Aura des Tabus umgeben war, ist die Sache als solche so alt wie die Menschheit.«
»Völliger Blödsinn«, sagte Rodrigo.
»Ich finde es faszinierend«, warf der junge Mann ein.
»Glaubt Ihr an die Bibel, Don Rodrigo?«, fragte Cervantes.
»Natürlich.«
»Mit wem hatte Kain seine Kinder? Die einzige Frau weit und breit war seine Mutter Eva. Mein Herr, ohne sexuelle Beziehungen zwischen Verwandten säßen wir alle nicht hier.«
Rodrigo beendete sein Mahl in übler Stimmung und fragte sich, ob es einen Weg geben könnte, den berühmten Schriftsteller vor das Heilige Offizium der Inquisition zu schleifen. Auf dem Weg nach draußen lief ihm Gaspar de Guzmán mit seinem absurden Schnurrbart über den Weg, der kriecherische Neffe von Don Baltasar de Zúñiga. Gaspar de Guzmán verbrachte seine Zeit damit, sich bei dem jungen Prinzen einzuschmeicheln, der eines Tages König Philipp IV. werden sollte, so wie der Herzog von Lerma es beim Vater des Prinzen getan hatte. Endlich dem raucherfüllten Lokal entkommen, verabschiedeten sich die drei Männer, indem sie sich immer wieder gegenseitig auf den Rücken klopften. Cervantes blinzelte Julián zu und empfahl ihm, gut auf seinen zukünftigen Schwiegervater aufzupassen. Rodrigo unternahm eine heroische Anstrengung, seine schlechte Laune zu überwinden, und sagte dem Schriftsteller mit bewundernswerter Freundlichkeit Lebewohl. Vielleicht gelang es ihm deshalb, weil der Moment, auf den er den ganzen Abend gewartet hatte, nun unmittelbar bevorstand.
Ein peinliches Schweigen legte sich über die beiden Aristokraten, als sie Cervantes fortgehen sahen. Dann folgte ein ritualisiertes Hin und Her über die Frage, wer wen zu seiner Unterkunft begleiten sollte. Julián bestand darauf, Don Rodrigo zu dem Zimmer zu bringen, das ihn im Alcázar erwartete, woraufhin dieser schließlich einwilligte. Während der zehn Minuten, die sie bis zum Königspalast brauchten, gaben sie ihr Bestes, den widerlichen Gestank von Abfällen und menschlichen Ausscheidungen in den Rinnsteinen zu ignorieren. Dabei priesen sie abwechselnd Guadas Vorzüge. Nachdem sie das bewachte Tor hinter sich gelassen hatten, umarmten sie sich und sagten gute Nacht. Keine Minute später aber folgte Rodrigo dem jungen Mann zurück in die dunklen Straßen, ein Jäger auf der Fährte des Bocks. Ein Teil von ihm hoffte verzweifelt, der Junge würde zur Academia de Madrid gehen, die er beim Abendessen beiläufig als den Ort erwähnt hatte, wo er übernachten würde. Trotzdem war Rodrigo auf das Schlimmste gefasst.