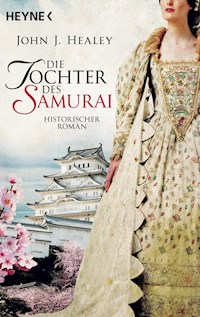
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Samurai-Saga
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Die ergreifende Fortstetzung von "Der Samurai von Sevilla"
Sevilla 1630. Soledad Maria, von ihrem Vater Masako genannt, ist ein Kind zweier Welten. Als Tochter einer leidenschaftlichen Spanierin und eines furchteinflößenden Samurai-Kriegers weiß Masako genau, was es bedeutet, zwischen zwei Ländern, Kulturen und Mentalitäten hin- und hergerissen zu sein. Und als ihr Vater nach dem tragischen Tod ihrer Mutter beschließt, in sein Heimatland zurückzukehren, verändert sich Masokos Leben grundlegend. Nach einer langen und gefährlichen Reise um die Welt kommen Vater und Tochter in Japan an und müssen feststellen, dass sie ihrem Land fremd geworden sind – und die Feinde des Samurais bereits tödliche Pläne schmieden …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 299
Ähnliche
Das Buch
Mutters Liebe zu meinem Vater ließ sie das Leben noch einmal als etwas Pulsierendes und Bedeutungsvolles erfahren. Dann verließ Mutter diese Erde, und der Samurai nahm mich mit sich fort. Seit dem Todestag meiner Mutter trug Doña Soledad Schwarz. Ehe wir Spanien verließen, überschrieb sie mir ihr enormes Vermögen. Es traf die Eltern meiner Mutter bis ins Mark, dass der Erstgeborene ihrer Tochter – ein Sohn, ein Spanier und ihr rechtmäßiger Erbe – von ihrer reichen Verwandten zugunsten der Mischlingstochter ignoriert worden war.
Sevilla, 17. Jahrhundert. Nach dem Tod ihrer Mutter machen sich Soledad María und ihr Vater auf den Rückweg nach Japan. Es ist eine Reise um die Welt, die mehrere Jahre andauern wird und während der mit jedem Sonnenaufgang auch neue Gefahren ans Tageslicht treten. Soledad kommt nicht umhin, sich zu fragen, wie das Leben gewesen wäre, wenn sie in Spanien geblieben wären. Für welche der beiden Welten schlägt ihr Herz – für die ihrer Mutter, einer temperamentvollen spanischen Doña, oder die ihres Vaters, eines ehrwürdigen Samurai? Und ausgerechnet die abenteuerliche und gefährliche Reise ist es, die Soledad eine Antwort auf diese Frage geben wird.
Der Autor
Der Amerikaner John Healey arbeitet als Schriftsteller, Dokumentarfilmer und Drehbuchautor. Seit Jahren pendelt der passionierte Historikforscher zwischen Amerika und Spanien.
Er schreibt regelmäßig für El País in Madrid und ist ein profunder Kenner der spanischen und japanischen Kultur.
JOHN HEALEY
Die Tochter des Samurai
Roman
Aus dem Amerikanischen von Stefan Lux
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Die Originalausgabe The Samurai’s Daughtererschien bei Arcade, New York
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Vollständige deutsche Erstausgabe 5/2020
Copyright © 2019 by John Healey
Copyright © 2020 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Thomas Brill
Umschlaggestaltung: Designomicon
unter Verwendung des Originalumschlags von
© Erin Seaward-Hiatt
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN: 978-3-641-23568-0V001
http://www.heyne.de
»Es gibt nichts anderes als den gegenwärtigen Moment.«
Hagakure: Der Weg des SamuraiYamamoto Tsunetomo
»… mein Herr, Ihr zeugtet, pflegtet, liebtet mich …«
Cordelia, König LearWilliam Shakespeare
LISTE DER WICHTIGSTEN PERSONEN
Die Date-Familie:
Date Katakura Shiro, genannt Shiro. Er ist ein Samurai, der uneheliche Sohn von Katakura Kojuro, einem engen Berater von Date Masamune und von Mizuki, Date Masamunes einziger Schwester.
Date Masamune, der Furcht einflößende und reiche, einäugige Hohe Herr und Daimyo von Sendai, Japan, der von ihm gegründeten Stadt. Erbauer der Burg Sendai, wichtiger Berater des Shoguns. Er ist Shiros Onkel und Beschützer.
Megohime Masamune, genannt Megohime. Date Masamunes intrigante Ehefrau.
Date Tadamune, Date Masamunes ältester Sohn. Ein Schurke.
Date Mizuki, genannt Mizuki. Shiros Mutter und Date Masamunes einzige Schwester. Eine bemerkenswerte Schönheit, die zunächst einen Samurai-Krieger geheiratet hatte, der in der Schlacht getötet wurde, und dann eine Affäre mit Katakuro Kojuro begann.
Soledad María Masako Date Benavides y de la Cerda, genannt Soledad María oder Masako. Die junge Frau, die dieses Buch erzählt, Tochter von Shiro und Guada.
Die Medinaceli-Familie:
María Luisa Benavides Fernández de Córdoba y de la Cerda, genannt Guada. Einzige Tochter von Don Rodrigo und Doña Inmaculada. Sie heiratete Julián von Denia, von dem sie – nach einer Vergewaltigung – ein Kind bekam, »Rodriguito«. Später hatte sie eine glückliche Liebesbeziehung zu Shiro, dem Samurai, und starb bei der Geburt der gemeinsamen Tochter María »Masako«.
Carlos Bernal Fernández de Córdoba y de la Cerda, genannt Carlos. Guadas älterer Bruder und Soledad María Masakos Onkel. Er heiratet Caitríona O’Shea und hat mit ihr eine Tochter, Carlota.
Soledad Medina y Pérez de Guzmán de la Cerda, genannt Doña Soledad Medina. Matriarchin und reichstes Mitglied der Familie. Guadas Tante und Beschützerin, Soledad María Masakos Großtante.
Rodrigo de la Cerda y Dávila, genannt Don Rodrigo. Vater von Guada und Carlos.
María Inmaculada Benavides Spínola, genannt Doña Inmaculada. Mutter von Guada und Carlos. Sie und ihr Ehemann sind ebenfalls mit Doña Soledad Medina verwandt.
Die Medina-Sidonia-Familie:
Rosario Martínez Gonzalez de Pérez de Gúzman, genannt Rosario. Sie ist die letzte Ehefrau von Alfonso Pérez du Gúzman, dem siebten Herzog von Medina-Sidonia. Ein einfaches Dorfmädchen, in das sich der alternde Herzog kurz vor seinem Tod verliebte.
Francisco Alonso Pérez de Gúzman Conde de Bolonia, genannt Francisco. Sohn von Rosario und dem siebten Herzog von Medina-Sidonia.
Die O’Shea-Familie:
Caitríona O’Shea, genannt Caitríona. Geboren in Galway, Irland, als Tochter eines erfolgreichen Whiskeyhändlers mit Geschäftskontakten in Spanien. Glühend in Shiro verliebt, heiratet sie Carlos, da sie vermutet, Shiro wäre tot.
Patrick Shiro Date O’Shea, genannt Patrick. Sohn von Caitríona und Shiro.
María CarlotaFernández de Córdoba y de la Cerda y O’Shea, genannt Carlota. Tochter von Caitríona und Carlos.
TEIL EINS
KAPITEL 1
Mein rosiges, runzliges Fleisch, von Schleim bedeckt. Die einsetzende Morgendämmerung. Das Schluchzen meiner Tante. Die klagende Hebamme. Die gemurmelten Gebete des Priesters. Vaters stoisches Schweigen. Der unangenehme Geruch des Blutes meiner Mutter. Ihr letzter Atemzug wie ein verblüfftes Flüstern. Das riesige Moratalla-Anwesen um mich herum. Die Villa und die Gärten. Die Kiespfade. Die Statuen römischer Götter. Der vor den Toren vorbeifließende Guadalquivir. Orangenblüten.
Sanlúcar, zwei Jahre später. Vater hält mich in den Armen und ergreift meine kleine Hand, damit ich meiner Tante zuwinke, die in Wahrheit meine Großtante ist, Doña Soledad Medina. Ihre schwarz-goldene Kutsche. Die livrierten Bediensteten. Ihre noble Haltung, wie sie in Trauerkleidung unbewegt am Anleger steht und die Abfahrt unseres Schiffes nach Japan beobachtet. Vater trug sein edelstes Samurai-Gewand. Die langen Griffe seines Messers und seines Schwertes drückten gegen meine Gliedmaßen. Ich war in eines von Mutters Tüchern gewickelt. Die Möwen. Das andalusische Nachmittagslicht. Die Strömungen in der Flussmündung.
Ich erinnere mich nicht mehr an das, was geschah, als die Piraten an Bord kamen. Wie Vater sein Schwert führte, um mich zu beschützen, bis sie ihn überwältigten, schlugen und fesselten. Eine Mitreisende, Caitríona, fünfzehn Jahre alt und erlesen schön, wurde vom Kapitän gepackt und gezwungen zuzusehen, wie ihr irischer Vater von einem englischen Entermesser durchbohrt wurde. Ihre Schreie, die jubelnden Männer, die Frauen, die an Deck zusammengetrieben und zum Spaß misshandelt wurden. Sie alle, einschließlich Caitríonas Mutter, aneinandergefesselt, um als Sklavinnen verkauft zu werden. Caitríona, die mit mir auf den Armen in die Kajüte des Kapitäns geschickt wurde. Der betrunkene, ungewaschene Seeräuber, nicht in der Lage, sich ihr mit Gewalt aufzuzwingen, außer sich vor Wut und Frustration, sie schlagend und mit dem Tod bedrohend. Ihr Flehen, ihr Versprechen, niemals ein Wort über seine Impotenz zu verlieren, ihr Angebot, sich in seinem Haushalt um mich zu kümmern. Die Ankunft eines weiteren Schiffes, die den Kapitän ablenkte. Der Sultan, der an Bord kam und Vater kaufte, um ihn als Krieger in irgendeiner barbarischen Arena einzusetzen.
Manchmal schimmern Bilder von unserer Ankunft in Venedig auf: die Geliebte des Kapitäns, Maria Elena Visconti, und ihr düsterer Palast. Wie sie mich an ihre Brust presste und bereit war, ihm dieses kostbaren Geschenks wegen seine Laster zu verzeihen. Der faulige Geruch des Kanals entlang der Giudecca. Die Glocken der Chiesa del Santissimo Redentore. Die Dienstmädchen. Unsere neue Kleidung. Das Essen und die Federbetten. Maria Elena verwöhnte mich. Caitríona wich nie von meiner Seite. Ein kleiner Hund schlief neben mir. Der Kostümball, den wir als Engel verkleidet besuchten.
KAPITEL 2
Der Sultan segelte nach Algier und steckte Vater ins Gefängnis, bis die alljährlichen Spiele begannen. Sklaven und Gefangene kämpften bis zum Tod gegen bewährte Soldaten, die bei ihren Herren Eindruck schinden wollten. Vater verhalf dem Mann, der ihn gekauft hatte, zu hohen Einnahmen. Während der ersten Woche stellte sich das abgestumpfte Publikum meist gegen ihn. Sie waren wütend, weil ein Fremder es schaffte, so viele rechtgläubige Soldaten zu erniedrigen und zu töten. Die Regeln wurden zu seinem Nachteil zurechtgebogen. In der zweiten Woche ließ man ihn gegen jeweils zwei Gegner antreten, und einmal sogar gegen ein Trio. Doch er gewann jedes Mal und verneigte sich anschließend auf eine Art und Weise vor den Leichen der Männer, dass auch die ungebildetsten Wetter begriffen, dass es ihm ernst damit war.
Dann ließen sie wilde Tiere auf ihn los. Einen alten Bären, riesig und verwirrt, in dessen Fleisch man einen Metallstachel fixiert hatte, um ihn aufzureizen. Mein Vater verachtete die Männer, die ein derart edles Geschöpf mit solcher Geringschätzung und Grausamkeit behandelten. Er schenkte ihm einen schnellen, schmerzlosen Tod.
Am folgenden Tag betraten zwei aggressive Gorillas die Manege. Einem von ihnen gelang es, Vater zu packen und ihn zu Boden zu schleudern. Als Vater atemlos dort lag, brach auf den Rängen des Amphitheaters Jubel aus. Doch bald schon rollten die riesigen Köpfe der Tiere über den Boden, was deren Besitzer erzürnte und die Masse zu noch lauterem Jubel anspornte. Vater sagte später, er habe solche Kreaturen nie zuvor gesehen und sie, als er ihre Kadaver untersuchte, nahezu menschlich gefunden.
Am letzten Tag der Spiele wurde eine Frau, die man des Ehebruchs beschuldigte, an einen Pfahl gebunden, mit Vater als einzigem Beschützer vor drei halb verhungerten Löwen. Obwohl er eine schwer blutende Kratzwunde auf dem Rücken davontrug, tötete er alle drei, und das Publikum geriet außer Rand und Band. Man hatte ihn glauben lassen, dass sein Sieg über die Löwen die Begnadigung der Frau nach sich ziehen würde, doch am folgenden Morgen zwang man ihn, ihrem Tod durch Steinigung beizuwohnen. Das versetzte ihn in derartigen Zorn, dass er auf dem Rückweg ins Gefängnis seine Bewacher überwältigte, ein Ruderboot stahl und zwei Tage lang übers Mittelmeer irrte. Halb tot landete er auf Sizilien in der Nähe von Akragas und reiste von dort nach Norden weiter. In Rom spürte er Galileo Galilei auf, mit dem er sich im Jahre 1615 angefreundet hatte.
KAPITEL 3
Vater hatte Galileo seit fünf Jahren nicht gesehen. Vier Jahre zuvor war Kardinal Roberto Bellarmino auf Anweisung von Papst Paul V. beauftragt worden, Galileo vorführen zu lassen und ihm das Urteil des Inquisitionsgerichts zur Frage des Heliozentrismus zu verlesen. Der Papst hatte Bellarmino in dem Wissen ausgewählt, dass die beiden Männer befreundet waren. Als die Samurai ein weiteres Jahr zuvor zu ihrer Audienz beim Papst in Rom gewesen waren, hatten Bellarmino und Galileo Vater in Kontakt mit Ärzten gebracht, die seine verstümmelten Hände weitgehend wiederherstellen konnten. In der Öffentlichkeit mochten der Geistliche und der Astronom wie erbitterte Gegner dastehen, doch im Privaten genossen sie gemeinsam die Freuden des Weins und der Frauen.
Galileos öffentliche Zurechtweisung war eine heikle Angelegenheit. Unter den zahlreichen Zeugen befanden sich andere Priester und vatikanische Offizielle, die nur darauf warteten, dem Papst über irgendwelche ironischen Reaktionen Galileos berichten und damit die Ernsthaftigkeit von Bellarminos Mission Lügen strafen zu können. Während Galileo vor ihm stand und auf den Marmorboden starrte, las der Kardinal seinem Freund aus dem offiziellen Dokument vor und warnte ihn, »sich vollständig von der Meinung abzuwenden, dass die Sonne fest im Zentrum der Welt stehe und die Erde sich um sie herum bewege. Und diese Meinung weder zu lehren noch auf irgendeine Weise zu verteidigen, sei es mündlich oder schriftlich.« Im Anschluss weigerte Galileo sich ein Jahr lang, mit Bellarmino zu sprechen.
Vater wusste nichts von alldem, als er Rom an jenem Abend erreichte. Nach seinen zahllosen Kämpfen in der Arena und dem strapaziösen Rudern übers Mittelmeer war er muskelbepackt, aber völlig verausgabt. Als er am Eingang zu Galileos Villa empfangen wurde, überraschte es ihn nicht, die beiden Männer bei einer aufwendigen Mahlzeit vorzufinden. Sie reagierten ebenso erfreut wie verblüfft über die erneute Begegnung. Doch sie nahmen ihn auf, gaben ihm zu essen und zu trinken und lauschten aufmerksam seinem Bericht über alles, was sich seit dem Aufbruch der Samurai aus Rom und ihrer Rückkehr nach Spanien ereignet hatte. Zufrieden nahmen sie den Zustand seiner Hände zur Kenntnis und staunten, als sie von seiner engen Beziehung zum spanischen König erfuhren. Sie gratulierten ihm dazu, den ersten Ehemann meiner Mutter getötet zu haben, und beklagten deren allzu frühes Sterben. Als sie von den Piraten hörten, reagierten sie empört und versprachen, ihn bei der Suche nach mir zu unterstützen.
Was ihn tatsächlich überraschte, war die Anwesenheit einer jungen Frau, die einst versucht hatte, ihn zu verführen. Bei seinem ersten Besuch in Galileos Haus war sie zu ihm ins Bad der Villa getreten, doch er hatte sie seiner Liebe zu meiner Mutter wegen mit freundlichen Worten abgewiesen. Sie hieß Olivia und hatte inzwischen Galileo geheiratet. An diesem Abend bediente sie die Männer mithilfe eines Sklaven und lauschte aufmerksam den Erzählungen meines Vaters. Galileo bemerkte ihr wieder erwachendes Interesse. Später am Abend ermunterte er sie, zu meinem Vater zu gehen, nach seinen Verletzungen zu sehen und ihn zu trösten. Ihre Ehe diente dem äußeren Anschein und war sexuell nicht vollzogen. Die Bedürfnisse des Astronomen wurden von jungen Männern befriedigt – und gelegentlich auch von Kardinal Bellarmino. Letzterer gab Vater und Olivia seinen Segen, ehe er sich verabschiedete.
Ich selbst lernte Olivia erst sehr viel später kennen. Sie beschrieb mir, wie es für sie gewesen war, Vater an jenem Abend erneut zu begegnen. Aus dem jungen Krieger, der sie fünf Jahre zuvor abgewiesen hatte, war ein erwachsener Mann und Witwer geworden, der seit langer Zeit nicht mehr mit einer Frau zusammen gewesen war. Sie badete ihn und säuberte die Wunden, die der Löwe verursacht hatte. Sie betrachtete seine Narben, rieb ihn mit Ölen ein und schenkte ihm ihre Jungfräulichkeit. Sie beschrieb mir das Vergnügen, das er ihr bereitet hatte und das sie so nie wieder erleben sollte, abgesehen von gelegentlichen Malen, wenn sie es sich selbst verschaffte. Während der darauffolgenden Jahre waren die Männer, die sich wie Affen in ihr erleichterten, entweder nicht willens oder nicht in der Lage, sich um die Feinheiten ihres Körpers zu scheren, dem Vater sich so hingebungsvoll gewidmet hatte.
Er verbrachte drei Tage mit Galileo und dem Kardinal, drei Nächte mit Olivia. Die Männer unterstützten ihn mit finanziellen Mitteln und brachten ihn zu einem Schneider, der seine Kleidung ausbesserte und neue für ihn anfertigte. Außerdem setzten sie ein Empfehlungsschreiben für einen einflussreichen Kontaktmann in Venedig auf, Paolo Sarpi. Dieser war ein angesehener Geistlicher, Wissenschaftler und Rechtsgelehrter, der ebenfalls in Konflikt mit dem Papst geraten und nur knapp dem Tode entronnen war. Olivia schenkte meinem Vater Trost und Entspannung, das unschätzbare Geschenk der Zärtlichkeit einer Frau. Als ich sie später kennenlernte, wehmütig und übergewichtig, starrte sie von meiner Veranda hinunter auf den Kanal. Sie erzählte mir, sie habe bei seinem Abschied geweint. So heftig geweint, dass Galileo plötzlich Zweifel überfielen, ob es wirklich klug gewesen war, sie zu ihrem Abenteuer zu ermutigen.
KAPITEL 4
Vater erschien auf dem Maskenball als er selbst. Seine kamishimo-Weste unterstrich noch die Breite seiner Schultern. Sein katana und das tanto waren so gründlich poliert, dass sie glänzten. Das nach hinten gekämmte Haar wurde von einer schwarzen Schleife gehalten. Auch sein Gewand war schwarz und von goldenen Fäden durchzogen, die die Symbole des Hauses von Date Masamune darstellten – die Burg Sendai, ein Schwert, einen aufsteigenden Kranich. Die einzigen venezianischen Elemente seiner Kleidung waren ein Paar Samtpantoffeln und eine schwarze, ebenfalls samtene Harlekinmaske mit dem typischen Teufelshorn. Er hatte den Kanal in einem sàndolo da barcariòl überquert, das von einem Ruderer in Diensten von Paolo Sarpi gesteuert wurde.
Die Feiernden versammelten sich auf der großen Terrasse in einem der oberen Stockwerke mit Blick auf den Kanal. In den Ecken brannten Fackeln, und ein kleines Orchester spielte zarte Weisen von Gioseffo Zarlino und Giovanni Croce. Nach und nach trafen die Gäste ein. Vater erzählte, der Palazzo sei vom Kanal aus wie ein Tempel beleuchtet gewesen. Später, in meiner Jugend, ließ ich ihn immer wieder die Gedanken wiederholen, die ihm in diesem Moment durch den Kopf gegangen waren. Als ihm klar geworden war, dass sein Kind sich in diesem Palazzo aufhielt, Fleisch von seinem Fleisch. Das kleine Mädchen, in dessen Adern Blut aus Sendai und Sevilla floss, das Blut japanischer Kriegsherren und spanischer Könige. Er erinnerte sich daran, dass er mehr als dreißig Männer getötet hatte, um hierherzukommen. Und dass er notfalls bereit war, zu meiner Rettung weiteren sechzig das Leben zu nehmen.
Caitríona hat mir erzählt, dass sein Kostüm bewundernde Blicke auf sich zog, vor allem von den signorinas, die im Flüsterton darüber spekulierten, wer der geheimnisvolle Fremde sein mochte. Reich an materiellen Gütern, aber povere an Fantasie, hatten sich viele der jungen Damen als die Prinzessinnen verkleidet, für die sie sich ohnehin hielten. Ihre Kleider waren aus dickem Seidenstoff genäht, laubgrün und pflaumenblau, zwei auch in feurigem Rot. Ihre gepuderten und gepolsterten Alabasterbrüste hoben und senkten sich zur allgemeinen Würdigung. In den mit Spitze oder winzigen Perlen geschmückten Säumen fing sich der Widerschein von Fackeln und Kerzen. Langes Haar war hochgetürmt, und behandschuhte Hände hielten an elfenbeinernen Stäben gefiederte Colombinamasken – Masken, die an Vögel aus den Tropen erinnern sollten, an Vögel aus den Salzmarschen der Lagune, an Raubvögel. Die Herren stolzierten mit gockelhafter Eitelkeit in seidenen Hosen und Dreispitzhüten umher, offenbar voll kindlicher Begeisterung über ihre vorstehenden Bauta- und Zannimasken, maschere, die in Anspielung auf die männliche Erektion gestaltet waren. Laut Caitríona kam einer als Caesar verkleidet, ein anderer – mit spindeldürren Beinen unter einem skandalös kurzen Rock – als Alexander der Große.
Als der Abend voranschritt und immer mehr Wein floss, tanzten Frauen mit Frauen, Männer mit Männern, Ehefrauen mit den Ehemännern anderer Frauen. Vater beteiligte sich nicht. Mehrere Grüppchen der etwas Mutigeren und Neugierigeren traten auf ihn zu und versuchten ihn auszufragen, darunter Maria Elena persönlich. Doch stets erklärte er nur, er sei ein Gast von Paolo Sarpi. Da dessen strahlender Intellekt, die Kontroversen mit der Kirche und seine unerschütterliche Loyalität zur Serenissima Repubblica di Venezia weithin bekannt waren, verstärkte Vaters Antwort nur die Faszination des Fremden in ihrer Mitte. Dass er ein Ausländer war, war wegen seines Akzents kaum zu überhören – doch woher er kam, blieb ein Gegenstand ausführlicher Spekulationen. »Von weither«, war die einzige Antwort, zu der er sich herabließ.
Jack Ward, der Piratenkapitän, war an jenem Abend im Haus. Er spielte in einem der unteren Stockwerke mit einigen seiner Männer Karten. Vater entdeckte uns schließlich in einem Salon, dessen Wände mit rosafarbener Seide behängt waren und der von Wandleuchtern erhellt wurde. Caitríona und ich trugen zueinander passende transparente Togen und aufwendig gestaltete Flügel mit Federn, die von überkreuz verlaufenden Gurten gehalten wurden. Wir saßen neben Signora Barbara, Maria Elenas Mutter, die Caitríona als elegant und streng in Erinnerung hat. Eine ältere Frau, die den Tollheiten des Abends mit Gleichgültigkeit begegnete. Vater trat auf uns zu, die Maske immer noch vor dem Gesicht. Da er bei der Witwe einen Mangel an Englischkenntnissen vermutete, sprach er Caitríona in ihrer Muttersprache an.
»Wir sind uns schon einmal begegnet«, sagte er.
»Davon weiß ich nichts«, sagte sie in der Annahme, einen der dekadenten Freunde ihrer Herrin vor sich zu haben. »Und Euer Gesicht ist verborgen.«
»Mit gutem Grund«, erwiderte er. »Erschrick nicht über das, was ich dir sagen werde. Und hör nicht auf, zu lächeln.«
»Worüber sollte ich erschrecken, mein Herr?«
»Wir sind uns auf See begegnet.«
»Auf See.«
»Nun aber Schluss«, mischte sich die Witwe auf Italienisch ein. »Ich will nicht, dass Ihr mit der jungen Dame in einer derart groben Sprache redet.«
Ich schaute zu ihm auf, ganz fasziniert von seiner Maske. Angeblich soll ich sogar die Hand ausgestreckt haben, um sie zu berühren.
»Was sagt diese Frau?«, fragte Vater Caitríona.
»Dass es nicht anständig ist, mit mir in einer Sprache zu reden, die sie nicht versteht.«
Er wandte sich an die ältere Frau und versuchte es auf Spanisch. »Es tut mir leid, gnädige Frau. Mein Italienisch ist nicht so gut, wie es sein sollte. Aber vielleicht versteht Ihr mich jetzt.«
»Das tue ich«, bestätigte sie nickend.
»Ich auch«, sagte Caitríona, immer noch verwirrt über das, was Vater ihr gerade offenbart hatte.
»Wie kommt das?«, fragte er sie.
»Meine Familie stammt aus Galway in Irland, und mein Vater trieb Handel mit Spanien.«
»Und Ihr seid auch in Spanien an Bord gegangen, nicht wahr?«, sagte er.
Ihr Lächeln verschwand.
»Was für ein Schiff?«, fragte Maria Elenas Mutter und öffnete einen Fächer, um sich Abkühlung zu verschaffen. In diesem Moment begann ich, an den Federn von Caitríonas Flügeln zu zupfen.
»Hör sofort auf damit, junge Dame«, sagte die Witwe und zog meine Hand fort.
»Ein Schiff, das Jack Ward überfallen und ausgeplündert hat«, sagte Vater zu der Frau. »Er hat den Vater dieser jungen Dame ermordet, ihre Mutter in die Sklaverei verkauft und sie zusammen mit diesem Kind auf widerliche Weise entführt.«
Caitríona begann, leise zu weinen. Verängstigt und flehend schaute sie ihm in die Augen. Die ältere Frau betrachtete ihn wie einen Verrückten.
»Wer seid Ihr, mein Herr? Wie habt Ihr Euch Zutritt zu diesem Haus verschafft? Was sind das für Lügen und Verleumdungen, die Ihr da von Euch gebt?«
Noch einmal zupfte ich an Caitríonas Flügeln. Diesmal schloss Signora Barbara wütend ihren Fächer und schlug mir damit aufs Handgelenk. Ich schaute auf die zurückgebliebene Strieme und begann, zu weinen. Vater riss ihr den Fächer aus der Hand. Vergeblich versuchte sie, ihn wieder zu packen zu bekommen. Die Leute ringsum begannen, neugierig zu uns herüberzuschauen.
»Versucht so etwas noch einmal«, sagte Vater, »und ich werde Euch diese Hand abtrennen und sie fortwerfen.«
»Das ist unerhört!«, entgegnete sie, nun wieder auf Italienisch.
Vater reichte Caitríona einen Arm. »Soll ich Euch und das Kind von hier fortbegleiten?« Sie hat mir erzählt, sie habe für einen winzigen Augenblick gezögert, ehe sie ihm ihr Vertrauen schenkte, sich erhob und mich auf den Arm nahm.
»Hier entlang«, sagte sie.
Die alte Frau erhob sich taumelnd und schien jeden Moment in Ohnmacht fallen zu wollen. Daraufhin eilten ihr die umstehenden Gäste zu Hilfe. Vater, Caitríona und ich flüchteten zwei dunkle Treppen hinab, die ansonsten den Dienstboten vorbehalten waren. Die Nachricht verbreitete sich durch die diversen Salons und erreichte schließlich Maria Elena, die auf der Veranda tanzte. Ihre Schreie ließen das Orchester innehalten, und offenbar hatte auch Jack Ward sie gehört, denn als wir den Anleger erreichten und in das sàndolo da barcariòl stiegen, waren er und einige seiner Männer bereits hinter uns her. Der betrunkene Schurke spannte eine Pistole und legte auf uns an. Dank des Alkohols in seinem Blut, der Aufregung und seines nachlassenden Sehvermögens traf der Schuss nicht uns, sondern Paolo Sarpis Ruderer. Zwar erreichten Ward und seine betrunkenen Männer nun den Anleger, doch besaß keiner von ihnen eine weitere Feuerwaffe, sodass unser Boot unbehelligt entkommen konnte. In diesem Augenblick entdeckte Vater den Dolch in Caitríonas Hand, ein Stilett, das sie bereits kurz nach unserer Ankunft im Haus gestohlen und all die Monate versteckt gehalten hatte. Er nahm ihr die Waffe ab und schleuderte sie mit aller Kraft nach Ward. Später hörte ich, sie sei mitten in die Kehle des Piraten gedrungen, der daraufhin ins Wasser gestürzt sei. Caitríona bezeugte, sie habe ihn voller Befriedigung ertrinken sehen.
Vaters Plan hatte vorgesehen, dass wir uns ein paar Tage lang im jüdischen Viertel verstecken würden, einem Gebiet, das vom Rest der Stadt abgetrennt war. Doch wegen des verwundeten Ruderers kehrten wir zu Paolo Sarpis Kloster zurück. Er wartete dort mit mehreren Dienern. Sie kümmerten sich um den Verletzten, und Vater entschuldigte sich dafür, den großmütigen Rechtsgelehrten in das Drama dieses Abends hineingezogen zu haben. Der venezianische Gelehrte reagierte mit offensichtlicher Verblüffung.
»Ich habe für einen solchen Fall Vorkehrungen getroffen und ein Schiff bereitstellen lassen. Meine persönlichen Habseligkeiten befinden sich bereits an Bord. Kommt«, sagte er und klopfte Vater auf die Schulter. »Wir haben keine Zeit zu verlieren.«
Der inzwischen verbundene Ruderer wurde eingeladen, uns zu begleiten. Wir gingen an Bord einer caorlinà und wurden zu einem Schiff gerudert, das vor dem Lido ankerte. Bis Wards Männer, diverse Gäste des Balls und eine hastig zusammengetrommelte Gruppe von Amtspersonen mit Fackeln und einer schriftlichen Anordnung zur Festnahme eintrafen, hatte unser Schiff bereits Fahrt aufgenommen.
KAPITEL 5
Auch wenn ich damals noch sehr jung war, erinnere ich mich doch an den folgenden Tag und die Nacht auf See. Irgendwann, als Caitríona schlief, nahm Vater meine Hand und bat Paolo Sarpi noch einmal um Vergebung.
»Ich kann nicht gestatten, dass Ihr Euch noch weiter entschuldigt«, sagte der Venezianer. »Ich verspüre die Genugtuung, die man aus einer guten Tat zieht. Darüber hinaus muss ich gestehen, dass die dramatischen Ereignisse und der plötzliche Ortswechsel, diese Reise, die Morgensonne und die Meeresluft, die Aussicht auf die Gesellschaft meiner Freunde in Sizilien, sehr belebend auf mich wirken. Zum ersten Mal seit vielen Monaten fühle ich mich wirklich lebendig.«
»Es ist sehr liebenswürdig von Euch, die Ereignisse auf diese Art zu beschönigen.«
»Es ist ganz einfach die Wahrheit. Und ich kann Euch versichern, dass man mich bei meiner Rückkehr nach Venedig für unschuldig erklärt.«
»Würdet Ihr das Mädchen mit Euch nach Sizilien nehmen?«, fragte Vater und meinte Caitríona, um deren Schicksal er sich sorgte. »Wir können sie nicht alleinlassen, und mein Ziel liegt weit entfernt von jedem Teil der Welt, an die sie gewöhnt ist.«
Sarpi legte meinem Vater eine Hand auf die Schulter.
»Mein Rat wäre, dass Ihr mich nach Sizilien begleitet. Die Kultur dort ist vielfältig, die Bewohner sind amüsant, und die Insel gehört zu dem Reich, das Euer Gönner, der König von Spanien, regiert. Von dort könnt Ihr nach Sevilla zurückkehren, um eine Erfahrung reicher. Nach Sevilla, wo Ihr und Euer Kind ein glückliches Leben führen könnt und von wo die junge Frau heim nach Irland reisen kann.«
Vater erzählte mir später, er habe seit der Flucht aus Venedig über kaum etwas anderes nachgedacht. Die Versuchung, die Reise nach Japan aufzugeben, sei stark gewesen. Darauf zu beharren, mich dorthin zu bringen, sei ihm nach allem, was wir durchgemacht hatten, wie der reine Wahnsinn erschienen. Wenn so viel Leid und Elend uns keine fünf Tage nach dem Aufbruch aus Sanlúcar de Barrameda ereilt hatten, was würde uns dann erst erwarten, wenn wir die halbe Welt durchqueren mussten? In Spanien hätten wir ein Zuhause, ein Leben in Luxus und eine Verwandte, die uns nur allzu gern verwöhnen würde. Er erinnerte sich daran, dass meine Mutter, seine geliebte Guada, im letzten Monat ihrer Schwangerschaft ihr Interesse erklärt hatte, Japan kennenzulernen. Damals hatte er sie gewarnt, die strapaziöse Reise sei das Risiko für Frauen und Kinder nicht wert. Und doch blieb er nun stur, denn er hatte seiner Mutter und seinem Herren und Onkel Date Masamune die Rückkehr versprochen.
Das Tageslicht schwand, und die Nacht senkte sich herab. In der Ferne flackerten die Lichter von Brindisi. Mediterraner Wind blähte die Segel. Das Meer war ruhig. Das stetige, sanfte Geräusch, mit dem der schwere Rumpf sich seinen Weg durchs Wasser bahnte, wirkte beruhigend auf uns alle. Am Heck saß Paolo Sarpi und nahm gemeinsam mit seinen Dienern ein Mahl ein. Die Besatzung erledigte in aller Ruhe ihre Aufgaben und freute sich, den Hafen zu erreichen. Von Brindisi aus wollte Paolo Sarpi mit einem anderen Schiff nach Sizilien aufbrechen. Vater und ich dagegen würden nach Osten segeln, Richtung Griechenland und Osmanisches Reich.
Caitríona hielt mich halb schlafend auf dem Arm und trat an meinen Vater heran. »Don Shiro«, sagte sie. »Ich möchte nicht nach Sizilien. Ich möchte bei Euch bleiben.«
»Das sagst du jetzt«, erwiderte er. »Ohne von den Tausenden von Meilen zu wissen, die zwischen hier und meinem Land liegen.«
»Trotzdem«, sagte sie und starrte auf seine Hand, die auf einem Stück der Takelage ruhte. Jahre später erzählte sie mir, sie habe in diesem Moment zum ersten Mal die Narben an seinen Gelenken bemerkt.
»Signor Sarpi ist ein vertrauenswürdiger, ehrbarer Mann«, sagte Vater. »Er wird alles tun, um für dich zu sorgen, bis du nach Hause zurückkehren kannst.«
»Ich habe kein Zuhause mehr«, sagte sie.
»Aber du kommst doch aus Irland?«
»Mein Vater hat mit Whiskey gehandelt«, sagte sie. »Und gut davon gelebt. Doch seine Söhne, meine älteren Brüder, haben ihn verlassen und ein eigenes Unternehmen aufgebaut, das mit Sklaven handelt. Sie haben das doppelte Vermögen angehäuft wie mein Vater, und das in der halben Zeit. Und dann haben sie sich über ihn und seine altmodischen Ansichten lustig gemacht. Nach zwei Jahren Widerstand gab er ihrem Flehen schließlich nach und schloss sich ihnen an. Wir waren unterwegs zu einem Sklavenmarkt in Afrika, als das Schiff überfallen wurde. Ich glaube einfach, dass sein Tod und das Schicksal meiner Mutter eine Strafe Gottes waren. Meine Familie und mein Zuhause in Galway sind nun meine Brüder und ihre Familien, die ich niemals wiedersehen will.«
Vater hörte sich das alles an und schwieg dann eine Weile. Schließlich sagte er: »Ich könnte es arrangieren, dass du in einem unserer Häuser in Spanien wohnst. Soledads Großtante, nach der sie auch benannt ist, würde alles tun, worum ich sie bitte. Vor allem, wenn sie hört, wie gut du dich um ihre Großnichte gekümmert hast.«
»Ich möchte mich auch weiter um sie kümmern«, sagte Caitríona. »Sie ist mir ans Herz gewachsen. Und sie hat mir das Leben gerettet.«
»Wie das?«
»Ihr könnt Euch wahrscheinlich vorstellen, was der Seeräuber mit mir vorhatte – mich auf die hässlichste Art und Weise auszunutzen und dann an den Höchstbietenden zu verkaufen.«
»Es ist nicht nötig, dass du noch einmal an die Gefangenschaft bei diesem Mann zurückdenkst.«
»Ich möchte es aber«, sagte sie. »Und sei es bloß, damit Ihr wisst, was passiert ist. Jedenfalls war er nicht in der Lage … nicht in der Lage, mir irgendwas anzutun. Ihr müsst, als Ihr mit meiner Mutter zusammen auf das andere Schiff gebracht wurdet, etwas gesagt haben, das ihn verhext hat. Das hat er jedenfalls behauptet. Er nahm mir den Schwur ab, seiner Mannschaft nichts davon zu verraten. Ich erklärte mich unter der Bedingung einverstanden, dass ich mich um das Kind kümmern und in seinem Haushalt arbeiten durfte. Ich glaube, er sah darin irgendeinen Vorteil für sich, sodass er sich einverstanden erklärte. Wahrscheinlich wusste er, dass die Frau, mit der er dort lebte, sich freuen würde. Wäre Soledad an diesem schrecklichen Tag nicht dabei gewesen, dann hätte er mich ohne zu zögern getötet oder verkauft.«
»Wenn du bei uns bleibst«, sagte Vater, »wird es gefährlich. Dein Leben könnte nochmals in Gefahr geraten.«
»Bei Euch fühle ich mich sicher.«
»Mein Land, wenn wir es denn je erreichen, wird dir völlig fremdartig vorkommen.«
»Ich würde es in Eurer Gesellschaft gern kennenlernen.«
Und damit war entschieden, dass Paolo Sarpi allein nach Sizilien reiste. Vater und ich würden in Gesellschaft von Caitríona O’Shea nach Osten aufbrechen.
Bevor beide Seiten ihrer Wege gingen, gab es ein Abschiedsessen. Caitríona beschrieb riesige Schüsseln mit Pasta, gewürzt mit Knoblauch, Olivenöl und Petersilie. Darauf folgten Platten mit gegrilltem Fisch, Tomaten und Fenchel. Sarpi bestellte den besten Wein, einen tiefroten aus Catania, der, so sagte Caitríona, nach Schiefer und Kirsche schmeckte. Die Trauben, aus denen er gepresst wurde, stammten aus Weinbergen, die von den Römern angelegt worden waren.
»Möge Gott Euch beschützen«, sagte Sarpi, der aufgestanden war und sein Glas erhob.
»Und möge der Teufel Euch erhalten«, erwiderte Caitríona in ihrem singenden Galway-Tonfall.
»Möge jeder von Euch das Leben führen, das er sich wünscht«, sagte Vater mit ernstem Blick und in einem Ton, der die fröhliche Runde innehalten ließ.
Als Caitríona und ich uns verabschiedeten, lud Paolo Sarpi Vater zu einem Spaziergang zum Hafen ein. Vater sagte, er hätte sich lieber mit uns aufs Ohr gelegt. Allerdings wollte er einem Mann, der so viel für uns getan hatte, eine derart simple Bitte nicht einfach abschlagen. Er sagte, Sarpi habe ein wenig gestottert und sei einer dieser gelehrten Herren gewesen, die sich stets in aller Ausführlichkeit äußerten und nicht in der Lage waren, irgendeine Geschichte oder Meinungsäußerung auf das Wesentliche zu reduzieren.
An jenem Abend ließ sich der Venezianer über die Entwicklung der Fischereipraktiken in der Adria aus und erzählte dann eine Geschichte darüber, wie er einen deutschen Prinzen einmal davon überzeugt habe, dass Nudeln an Bäumen wüchsen. An Bäumen, die nur wenig Wasser bräuchten und zweimal im Jahr mit Sensen abgeerntet würden. Anschließend lieferte er einen Überblick über die Länder und Kulturen, denen Vater auf dem Weg zurück nach Japan begegnen würde. Vater sagte, seine Gedanken seien während der stockenden Vorträge des Mannes abgeschweift. Er habe die Gerüche des Hafens aufgesogen, die aus dem Wasser und von den hölzernen, in den Sand getriebenen Pfählen aufstiegen. Feuchte, brackige Gerüche in der kühlen Abendluft. In jener Nacht sei Neumond gewesen, sagte er, und mit jeder Minute hätten sich neue Sterne am Himmel gezeigt.
»Ich habe einen Kollegen, dem Ihr auf Eurer Reise begegnen könntet«, erklärte Sarpi.
»Wer ist der Mann?«, fragte Vater.
»Ein wohlhabender Römer namens Pietro Della Valle. Er ist ein kultivierter Mann, der aufgebrochen ist, um viele der Länder zu erkunden, die Ihr besuchen werdet. Un culo agitato. Das Letzte, das ich von ihm gehört habe, war, dass er sich irgendwo in Persien niedergelassen hat.«
Vor dem Eingang des Gasthauses sagten sie sich gute Nacht. Paolo Sarpi machte einen Schritt auf Vater zu, als wolle er ihn umarmen, doch Vater trat zurück und verbeugte sich stattdessen dreimal. Sarpi lächelte und erwiderte die Geste, so gut er konnte.
KAPITEL 6
Das Schiff sollte uns nach Piräus bringen. Von dort wollten wir ebenfalls per Schiff nach Tartus und dann auf dem Landweg nach Basra oder Al-Qurain reisen, wo wir hoffentlich ein Schiff nach Indien finden würden. Doch als wir uns Griechenland näherten, wurde das Meer grau und kabbelig. Dann brach ein gigantischer Sturm über uns herein. Die Mannschaft kämpfte hart, um das Ufer zu erreichen, konnte der Macht der Naturgewalten letztlich aber nichts entgegensetzen. In Sichtweite der Insel Paxos rissen unsere Segel, und der Mast brach in zwei Teile. Eine riesige Welle warf den Rumpf auf die Seite.
Von den wenigen, die schwimmen konnten, rettete Vater sich – mitsamt seinen Waffen – als Einziger. Caitríona und ich klammerten uns an ihm fest, bis er ein Stück Mast zu fassen bekam, an dem wir alle Halt fanden. In dieser Nacht bot sich ein grausiges Bild ertrinkender Männer und heulender Winde. Mit dem Anbruch der Morgendämmerung, es regnete immer noch in Strömen, erreichten wir einen Strand aus glatten schwarzen Kieseln.
Wir stolperten unter niedrigen Kalksteinklippen voran, bis Vater eine Höhle fand, in der wir uns zitternd und erleichtert niederließen. Gegen Mittag hörte der Regen auf, und die Sonne brach durch die Wolken. Ganz in unserer Nähe waren tote Seeleute und ein Teil des Wracks angespült worden. Vater, den vor allem die Sorge um Nahrung umtrieb, ließ die Leichen liegen und machte sich mit uns auf den Weg ins Inselinnere. Es schien sich um eine größere Insel zu handeln. Olivenbäume wuchsen im Überfluss. Von irgendwelchen Bewohnern war weit und breit nichts zu sehen. Durch die Graswiesen zogen sich Bachläufe, und es gab Ziegen, die uns Milch und Fleisch lieferten.
In der ersten Nacht schliefen wir unter dem Sternenhimmel und fragten uns, welches Schicksal uns erwarten mochte.
»Ich habe dich gewarnt, dass dein Leben wieder in Gefahr geraten könnte, wenn du bei mir bleibst«, sagte Vater zu Caitríona.
»Und doch bin ich Euretwegen einmal mehr gerettet worden.«
Dieser Logik vermochte Vater nicht zu folgen.
»Ich habe das Meer satt«, erklärte er. »Nachdem ich den ganzen Weg von Sendai nach Spanien ohne größeren Zwischenfall hinter mich gebracht habe, scheine ich inzwischen bloß meinen Fuß auf eine Bootsplanke setzen zu müssen, und schon geschieht ein Unheil.«
Caitríona erzählte mir später, ich hätte an jenem Tag nur einen Satz gesagt: »Io voglio tornare a Venezia.«





























