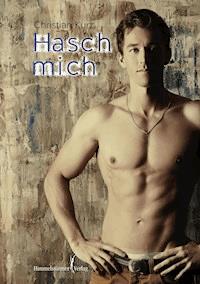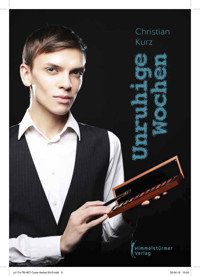Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Himmelstürmer
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Die Lage spitzt sich für die Geflüchteten in Kanada immer weiter zu. Mehr und mehr zieht sich die Schlinge um jeden Einzelnen unaufhaltsam zu und engt die vermeintlich grenzenlose Freiheit bis zum gnadenlosen Ersticken ein. Im Schwulenhaus kommt es zu neuerlichen Übergriffen auf die Geflohenen, die nichts weiter wollen, als offen in Freiheit zu leben. Der schwulenhassende Sheen kann immer mehr Leute auf seine Seite ziehen und mit Leichtigkeit für seine Zwecke einspannen. Aber auch Wehrhaus hat mittlerweile bereits einiges an Informationen gesammelt, um das zwischen den Ländern herrschende Machtgefüge zu seinen Gunsten zu beeinflussen, wodurch er langsam aber sicher einen alles umfassenden Angriff auf Kanada und die Bewohner des Hauses vorbereiten kann. Währenddessen bekommen Wolfgang und Caleb die Veränderungen genauso hart zu spüren und müssen in ihrem Buchladen um ihre Leben fürchten, denn Sheens Anhänger schrecken in ihrem selbstgerechten Wahn beinahe vor nichts mehr zurück, um gegen die beiden Ladenbesitzer vorzugehen. Die Veränderungen betreffen alle, wenn auch auf unterschiedliche Weisen. Karl, der von der Partei bis aufs äußerste verfolgte Autor von schwulen Winkel-Geschichten, und Patrick, die Liebe seines Lebens und Archivar im Schwulenhaus, versuchen sich trotz allem nicht unterkriegen zu lassen, aber auch sie spüren die neue Zeit anbrechen. Im Haus sorgt zudem ein neuer Mitbewohner aus eigenen Motiven dafür, dass die ohnehin bereits schlimme Situation für die Hausbewohner noch etwas gefährlicher wird. Durch sein Verhalten kommt auch bei einem anderen Hausbewohner eine Seite hervor, durch welche alles nur noch schlimmer gemacht wird, denn Gewalt erscheint in diesen Zeiten als angemessene Lösung für aufkommende Probleme. Sogar Jonsey muss sich eingestehen, dass er ohne es zu wollen, für einiges Leid mitverantwortlich zu machen ist, denn Jeanne, die Fälscherin, bekommt Besuch von Geheimagenten aus dem Reich, die nicht einmal vor Entführung zurückschrecken, um das zu bekommen, was sie haben wollen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 799
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christian Kurz
Der Schatten eines unbewaffneten Mannes
Von Christian Kurz bisher erschienen:
Allein unter seinesgleichen ISBN, print: 978-3-86361-564-2
Hasch mich, ISBN print: 978-3-86361-567-3
Regenbogenträumer, ISBN print: 978-3-86361-491-1
Samt sei meine Seele, ISBN print: 978-3-86361-617-5
Die Welt zwischen uns, ISBN print 978-3-86361-614-4
Die Zeit der bitteren Freiheit, ISBN print 978-3-86361-717-2
Alle Bücher auch als E-book
Himmelstürmer Verlag, part of Production House, 31619 Binnen
www.himmelstuermer.de
E-Mail: [email protected]
Originalausgabe, Juli 2019
© Production House GmbH
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Verlages.
Zuwiderhandeln wird strafrechtlich verfolgt
Rechtschreibung nach Duden, 24. Auflage
Cover: 123rf.com
Umschlaggestaltung: Olaf Welling, Grafik-Designer AGD, Hamburg. www.olafwelling.de
E-Book-Konvertierung: Satzweiss.com Print Web Software GmbH
Printed in Germany
ISBN print 978-3-86361-771-4
ISBN e-pub 978-3-86361-772-1
ISBN pdf 978-3-86361-773-8
Was bisher geschah:
Nachdem es den Nazis unter der Führung von Adolf Hitler während des Zweiten Weltkriegs von 1939 gelang, zusammen mit dem japanischen Kaiserreich von Hirohito und den Italienern unter Befehl von Mussolini die alliierten Kräfte zu besiegen, wurden die besiegten Gebiete unter den drei herrschenden Reichen aufgeteilt und nach ihrem Willen umgeformt. Der Faschismus breitete sich fast über die gesamte Erde aus und nur wenige Länder konnten sich damals dem Einflussbereich der Siegermächte entziehen, aber auch diese müssen weiterhin damit rechnen, von einer der drei Weltmächte angegriffen zu werden.
In den von den Nazis eroberten Gebieten wurden sofort die jeweiligen Kulturgüter wie Sprache, Schrift und Musik der besiegten Nation verboten und auf Deutsch umgestellt, genauso wie in den von den Japanern eroberten Gebiete nur noch Japanisch und in den italienischen Ländern nur noch Italienisch erlaubt wurde. Alle Bücher, Filme und dergleichen, die noch in der alten Sprache existierten, mussten zusammengetragen und vernichtet werden. Die alte Kultur wurde rigoros ausgelöscht und durch das jeweilige Weltbild der neuen Herrscher ersetzt, welche das jeweilige Volk in dem Glauben umerzogen, dass nur die neue genehmigte Kultur die einzig richtige sei und die ursprüngliche eine degenerierte Abart darstellte, von der man die Völker befreite und dadurch veredelte.
In den von den Nazis eroberten Gebieten wurden zudem sämtliche als „Untermenschen“ klassifizierten Menschen verfolgt und getötet, weshalb sie fast vollständig aus dem Bewusstsein des Volkes verschwanden. Diejenigen, die noch existieren, werden dumm gehalten und als Sklaven missbraucht – Schwarzen wird beigebracht, dass sie ohne den Kultureingriff der Nazis noch in Höhlen leben würden, weswegen sie sich glücklich schätzen könnten, dass man ihnen erlaubt, für die Herrenmenschen zu arbeiten.
Durch die strengen Gesetze und Todeskommandos verschwanden auch die Homosexuellen aus der Gedankenwelt der Menschen. Der Begriff „Schwul“ ist so gut wie unbekannt geworden, aber dennoch gibt noch Homosexuelle, wenngleich sie sich im Verborgenen halten müssen.
Aufgrund dieser Entwicklungen weiß der junge Wolfgang Volkmer nicht, was es zu bedeuten hat, als er sich in seinen besten Freund Nils Breuer verliebt. Er weiß nur, dass es nichts Richtiges sein kann, denn andernfalls würde er in der Lage sein, in Erfahrung zu bringen, was seine Gefühle zu bedeuten haben. Nach der Schule fängt Wolfgang in einer Buchhandlung an, während Nils eine Ausbildung beim Staat antritt, um den Dienst fürs Vaterland zu leisten. Wolfgang kommt bei der Arbeit mit den sogenannten „Winkel-Heften“ in Kontakt, bei denen es sich um illegal hergestellte Magazine handelt, die voll von schwulen Helden und Bildern mit hübschen Männern sind. Erst durch das Lesen dieser Hefte erkennt Wolfgang, dass er schwul und damit ungewollt ein Staatsfeind ist.
Einer der Autoren der Winkel-Hefte ist Karl Beck, der in einem Einkaufsmarkt arbeitet, heimlich jedoch Geschichten schreibt, in denen Schwule kraftvoll für das Recht auf Liebe einstehen. Karl kommt auf die Idee, eine Geschichte zu schreiben, in der die Nazis den großen Krieg verloren haben und die gesamte Welt deshalb nicht faschistisch geprägt wäre. Er kann sie in den Winkel-Heften veröffentlichen, wo sie auch von Wolfgang gelesen wird. Wolfgang wird durch diese Geschichte darin bestärkt, dass er sich für seine Homosexualität nicht schämen muss und diese auch nicht verstecken will. Weil in den Winkel-Heften und auch in alltäglichen Gesprächen das noch nicht durch eine der drei Weltmächte besetzte Kanada als letzter Ort der Freiheit angesehen wird, nimmt er all seinen Mut zusammen und will dort hinreisen, kommt aber zunächst nur bis ins ehemalige Amerika, das unter den Nazis als D-S-A, die Deutschen-Staaten-von-Amerika, bekannt ist.
Auch Karl beschließt, sein Glück in Kanada zu versuchen. Weil die Grenze jedoch geschlossen ist, muss er illegal ins Land kommen und arbeitet ohne Pass und Geld als Tellerwäscher im Restaurant von Mr. LeMesurier. Dort lernt er den umtriebigen Jonsey kennen. Weil Karl aufgrund seines Status als illegaler Einwanderer nicht zum Arzt gehen kann, stirbt er beinahe an einem Blinddarmdurchbruch, kann von Jonsey aber noch rechtzeitig zum Tierarzt O'Bannon gebracht werden. Karl sagt Jonsey, dass er schwul ist, woraufhin dieser ihn an Tim Löffler weiterleitet. Löffler betreibt ein Haus für Schwule und Literatur – er bietet jedem nach Kanada geflohenen an, in seinem Haus zu wohnen und dort mitzuhelfen, Exemplare von Büchern abzutippen, welche die Nazis vernichten wollen. Karl zieht ins Haus und lernt dort den jungen Archivar Patrick kennen und lieben.
Währenddessen kommt der für die Nazi-Partei arbeitende Schmidtz nach Kanada. Schmidtz hatte bereits zuvor versucht, Karl Beck zu fassen und für die Partei zu töten, weil die Winkel-Geschichte vom verlorenen Krieg in den Augen der Partei-Oberen eine Beleidigung von ungeahnten Ausmaßen ist, die unter allen Umständen mit dem Tod des Autoren zu ahnden sei.
Gleichzeitig kommt auch der kanadische Fabrikarbeiter Howard Sheen zu einiger Prominenz, weil er es versteht, seinen Hass auf Deutsche, Einwanderer, aber vor allem auf Schwule in Worte zu kleiden, welche die Zuhörer auf seine Seite ziehen. Sheen organisiert eine Menschenmenge, die das Schwulenhaus angreift und die Bewohner aus dem Land vertreiben soll. Schmidtz befindet sich ebenfalls im Haus und versucht Karl zu töten, jedoch gelingt es diesem mit Hilfe von Patrick, sich zur Wehr zu setzen. Schmidtz wird dabei verletzt, der Angriff der von Sheen aufgewiegelten Leute kann durch die kanadische Polizei unterbunden werden. Jedoch kann diese nicht offiziell gegen Schmidtz vorgehen, denn als Mitglied der Nazi-Partei würde eine Verurteilung schwerwiegende politische Konsequenzen nach sich ziehen. Sheen wird wegen seiner Tat zu einer Gefängnisstrafe verurteilt.
Wolfgang bekommt von alldem nichts mit, denn er ist immer noch in den D-S-A, zieht von einer Stadt in die nächste und arbeitet hauptsächlich in Buchläden, aber auch aushilfsweise in einem Kino. Dort begegnet er Caleb, einem gleichalten, hübschen Schwarzen, der ebenfalls schwul ist. Sie verlieben sich sofort ineinander.
Nils, der ehemalige Schulfreund von Wolfgang, wird als Aushilfs-Adjutant ebenfalls in die D-S-A beordert und begegnet dort Wolfgang wieder, dem er zu verstehen gibt, dass die Partei alles sei und alles Unerwünschte ausgerottet gehört.
Caleb hat bei seiner Arbeit in einem Hotel große Probleme, die damit enden, dass er zusammen mit Wolfgang aus den D-S-A fliehen muss. Nach mehreren Tagen kommen sie in einer Grenzstadt an und wollen von dort über die Grenze nach Kanada. Sie geraten an den zwielichtigen Hobbs, können ihm aber entkommen. Als alles verloren scheint, begegnen sie Jonsey, der sie nach Kanada und dort direkt ins Schwulenhaus bringt.
Schmidtz hat es derweil durch seinen Einfluss geschafft, Leiter der D-S-A-Staatspolizei zu werden. Er beauftragt Nils damit, sich als Homosexuell auszugeben, nach Kanada zu reisen und dort den Winkel-Autoren Karl Beck zu töten.
Zur selben Zeit trifft Jonsey auf den mysteriösen Walendy, der als Deutscher für die Japaner arbeitet und vorschlägt, dass der japanische Geheimdienst das Schwulenhaus vor feindlichen Angriffen durch die Nazis beschützen kann, wenn man ihnen im Gegenzug Datenkopien der im Haus befindlichen Bücher übergibt.
Nils gelangt ins Schwulenhaus, wird dort aber von Wolfgang entdeckt. Nils weiß sich nicht anders zu helfen und bedroht ihn mit einem Messer, dann schneidet er ihm die Kehle auf. Obwohl Wolfgang überlebt, beschließt Walendy, Nils diese Information vorzuenthalten und ihn durch die Schuld dazu zu bewegen, dass er zustimmt, eine Bombe zu Schmidtz zu bringen und diesen tötet. Nils willigt ein. Es gelingt ihm, Schmidtz zu töten, dann wird Nils aus den D-S-A in die Japanischen-Staaten-von-Amerika, den J-S-A, gebracht.
Jonsey und Walendy treffen sich einige Zeit später und kommen darin überein, das Nils in den J-S-A am Leben bleiben darf. Zudem beschließen sie, dass der japanische Geheimdienst ab sofort dafür sorgen soll, das von der Nazi-Partei geschickte Attentäter, die Karl wegen seiner Geschichte töten sollen, eliminiert werden.
In Neu-Seeland erhält der aufgrund einer Verfehlung in Ungnade gefallene Offizier Wehrhaus durch die Parteispitze den Auftrag, in die D-S-A zu reisen, den Posten als Staatspolizei-Leiter anzunehmen und dafür zu sorgen, dass der Autor Karl Beck endlich stirbt, damit er keine weiteren Schriften gegen das Reich verfassen kann. Wehrhaus nimmt seinen Bekannten Sturzrieger mit in die D-S-A und beauftragt ihn, diverse Forschungseinrichtungen zu überprüfen. Dabei erfährt Sturzrieger vom sogenannten „Reichskorn“, einem neuartigen, sehr kleinen Ortungsgerät.
Wolfgang und Caleb befinden sich in Kanada und haben eine eigene Buchhandlung, die jedoch nicht so gut läuft wie sie es sich wünschen. Karl und Patrick beschließen unerkannt Urlaub zu machen und werden dabei heimlich von Jonsey's Freunden vor Attentätern beschützt.
Trevor, der ehemalige Freund von Howard, verfällt dem Alkohol und will Howard töten, jedoch misslingt sein Versuch und er verletzt ihn nur. Auf der Flucht versteckt sich Trevor in der Buchhandlung von Wolfgang und Caleb, wird aber durch Herrn Löffler an die Polizei ausgeliefert.
Nils wird in den J-S-A dazu gezwungen, für den japanischen Geheimdienst zu arbeiten. Ihm wurde nicht gesagt, das Wolfgang noch lebt, weshalb er sich schwere Vorwürfe macht.
Jonsey wird während eines Aufenthalts in den D-S-A gefasst und in die Medizinische Zentrale gebracht, wo sich auch Sturzrieger befindet. Sturzrieger foltert Jonsey und verpasst ihm unbemerkt den Reichskorn-Sender, um Jonsey anschließend fliehen zu lassen, damit dieser die Verfolger zu Beck führt. Auf der Flucht tötet Jonsey den Schleuser Hobbs in Notwehr und lässt sich anschließend bei seinem Freund Dr. O'Bannon verarzten, woraufhin dieser das Ortungsgerät findet. Jonsey informiert Walendy, welcher sich bereit erklärt, die Verfolger unschädlich zu machen.
Sturzrieger verfolgt zusammen mit anderen Staatspolizisten das Signal und wird von Walendy und dessen Leuten gefangen genommen. Jonsey ist wegen der erlittenen Folter von Hass und Wut zerfressen, weshalb er Sturzrieger schwer verletzt und ihn dann Walendy überlässt. Der japanische Geheimdienstler verwendet die Leichen von Sturzrieger und den anderen, um einen Angriff des Reichs auf das japanische Kaiserreich vorzutäuschen. Jonsey rächt sich auch an dem Mann, der ihn an die Staatspolizei verraten hatte – der Schleuser muss sich zusammenreißen, damit er sich nicht völlig seiner Rache hingibt. Er findet in der Grenzstadt Alex und bringt diesen ins Schwulenhaus, damit ihm dort geholfen werden kann.
1.
Im Bücherlager des Schwulenhauses brachte Barry zwei große Kisten, die er mithilfe einer Sackkarre transportierte, in die Nähe von Patrick.
„Hier, Nachschub“, sagte der kräftige Mann und stellte die Sackkarre ab.
Patrick kam zu ihm und half dabei, die oberste Kiste runterzustellen. Da sie ein ordentliches Gewicht hatte, musste er ein wenig schnaufen, aber es gelang dennoch. „Das wird auch nie leichter“, sagte er anschließend.
„Und dabei sollte man meinen, dass man sich irgendwann daran gewöhnt hat.“ Barry wartete, bis der Archivar die andere Kiste seitlich ein wenig anhob, damit er die Karre wegziehen konnte. „Wo ist denn der Neue?“
„Alex? Auf dem Klo.“
„Wie macht der sich?“
Er lächelte ihn an. „Wieso? Hast du Interesse an ihm?“
„Das nicht, obwohl er schon gut aussieht, aber …“, der starke Mann machte einen zerknautschten Gesichtsausdruck, wodurch er noch mehr wie ein Teddybär wirkte, „... ich will ja nichts andeuten, aber er ist ein wenig …“
„Was? Sag es doch einfach.“ Patrick nahm ein Kartonmesser und öffnete die erste Kiste.
„Ein wenig zurückhaltend. Versteh mich nicht falsch, aber normalerweise versucht man doch, wenn man hier ist, sich mit den Leuten zu verständigen. Du weißt schon – man ist endlich unter seinesgleichen, da kann man sich auch viel offener bewegen. Aber soweit ich das mitbekommen habe, ist er ziemlich verschlossen.“
„Und wie hast du das mitbekommen?“ Er sah ihn an und lächelte stärker. „Hast du versucht mit ihm anzubändeln?“
Barry rollte mit den Augen. „Du schon wieder … Ich habe ganz normal mit ihm reden wollen, aber er hat sofort blockiert. Ich meine, sicher, vielleicht bin ich nicht sein Geschmack, kann ja sein, ich habe nun einmal starke Arme, aber er scheint mir an sich ziemlich verschlossen zu sein.“
„Mmh, das kann man ihm aber auch nicht wirklich übel nehmen.“
„Nein?“
„Nein“, bekräftigte der Archivar. „Er ist zwar schon ein paar Wochen hier, aber er kommt aus dem Reich. Da gibt es anfangs eben Anpassungsschwierigkeiten. Als ich hierher gekommen bin, da habe ich der ganzen Sache am Anfang auch nicht so ganz trauen wollen, einfach weil es zu schön war, um wahr zu sein. Wenn man sich immer verstecken muss und sich nie so zeigen darf wie man ist, dann kann es sehr schwerfallen, sich anderen gegenüber zu öffnen.“
„Hast Recht.“ Es klang nicht so, als wäre Barry überzeugt.
„Ich kann ja mit ihm ein wenig reden …“
„Nein, lass mal.“
„Ich werde nicht sagen, dass du etwas gesagt hast, in Ordnung?“
Der kräftige Mann zuckte mit der Schulter. „Das musst du wissen, ich halte mich da raus. Ich wollte es nur mal gesagt haben.“
„Du hättest es nicht gesagt, wenn du nicht gewollt hättest, dass ich mit ihm spreche.“
Barry schüttelte den Kopf. „Daran liegt das nicht. Ich meine nur, dass wir im Haus aufpassen müssen. Du weißt ja, warum.“
„Ja, das weiß ich. Aber Alex ist bestimmt kein Geheimdienstler oder sonst wie vom Reich hergeschickt, um Karl oder einen anderen von uns zu töten.“
„Und da bist du dir sicher?“
Patrick schwieg für einen Moment. „Er wurde überprüft.“
„Ja?“
„Ja. Tim lässt mittlerweile jeden überprüfen. Alex ist …“ Er stoppte, da er sah, wie der Neue das Bücherlager betrat.
Alex, ein Mann mit einem freundlichen Gesicht, aber stets neugierig wirkenden Augen, kam näher. „Ja? Ich bin hier. Was gibt es denn?“
Barry winkte ab. „Ich wollte nur wissen, ob du genauso faul bist wie der Andere, den wir mal hier hatten.“
„Ich hoffe doch nicht“, sagte er sofort.
Patrick schüttelte den Kopf. „Nein, das kann man wirklich nicht sagen. Du arbeitest gut.“
Der kräftige Mann griff die Sackkarre und drehte sich zum Gehen. „Und weil ihr gerade alle von Arbeit sprecht – ich habe jetzt Mittagspause. Bis dann.“ Er ging mit der Sackkarre weg.
Der Archivar öffnete die Kiste und reichte Alex das Kartonmesser. „Mach bitte die andere auf.“
„Ja.“ Der Neue ging hin und öffnete sie. „Darf man fragen, worum es gerade wirklich ging?“
„Was meinst du?“ Patrick holte mehrere Bücher aus seiner Kiste und besah sie sich – bereits auf den ersten Blick wurde deutlich, dass es sich vermehrt um Proud Canada von Howard Sheen handelte. Dieses hasserfüllte Machwerk war mittlerweile in fast jeder Lieferung enthalten und musste immer wieder aussortiert werden.
„Ihr werdet doch gerade nicht wirklich darüber gesprochen haben, ob ich faul bin oder nicht.“ Er nahm ebenfalls einige Bücher raus, die er beiseite legte.
„Wieso denkst du das?“
„Ich merke so was.“
„Gut, du hast Recht. Wir haben darüber gesprochen, dass du ja schon einige Wochen hier bist und dich anscheinend immer noch nicht ganz eingelebt hast“, sagte der Archivar.
Alex blickte ihn an. „Wie ist das gemeint?“
„Du redest nicht mit den anderen, du gehst nur zum Einkaufen in die Stadt, und wenn du mit der Arbeit fertig bist verschwindest du sofort in deine Wohnung.“
Er schüttelte den Kopf. „Das stimmt nicht.“
„So?“
„Ja. Und selbst wenn dem so wäre – ich stehe doch hier nicht unter Beobachtung, oder?“
Patrick lächelte wieder. „Nein, das natürlich nicht.“
„Na also.“
„Es ist ja auch ganz normal, dass man in der ersten Zeit etwas zurückhaltend ist und die Lage zunächst überblicken möchte. Aber du hast doch mittlerweile bestimmt schon mitbekommen, dass wir hier alle zusammenarbeiten, oder?“
Alex nickte. „Ja.“
„Und wir sind hier auch alle schwul, also brauchst du dich deswegen auch nicht zu verstecken wie im Reich. Du kannst mit jedem im Haus ganz offen sprechen. Jeder wird dir weiterhelfen, und bestimmt ist auch jemand dabei, mit dem du glücklich werden kannst.“
Der Neue senkte den Kopf. „Ja, vielleicht. Mal sehen.“ Er nahm einige Magazine aus der Kiste und betrachtete sie skeptisch. „Was ist das denn?“
„Zeig mal.“
Er reichte sie ihm. „Hier.“
Patrick nahm sie an sich. Es handelte sich um Mandingo-Hefte, in denen Schwarze von Nazis aufs Grausamste gefoltert wurden. „Schon wieder dieser kranke Scheißdreck …“, stieß er kopfschüttelnd aus. „Davon hatte ich neulich auch schon mal welche in einer Kiste. Dieser Mist muss nicht aufbewahrt werden. Das gehört vernichtet.“ Er legte die Hefte mit dem Titelbild nach unten auf einen Tisch und holte bei seiner Kiste wieder Bücher hervor.
„Was sind das denn für Hefte?“
„Vergiss es.“
„Sag doch.“
Er blickte ihn an. „Mandingo-Hefte. Im Reich werden Schwarze eingesperrt und dann von einigen Leuten gefoltert, und dabei werden Bilder gemacht und dann in einem solchen Magazin veröffentlicht. So was ist krank und einfach nur widerlich. Ich kannte das auch nicht, aber anscheinend wird es in den D-S-A unter dem Ladentisch verkauft.“
„Unter dem Ladentisch?“
„Öffentlich können sie es wohl nicht verkaufen, weil sonst die Schwarzen wüssten, dass die Nazis nicht ihre Freunde sind.“ Patrick schüttelte den Kopf, um die Bilder aus dem Kopf zu bekommen.
Alex atmete ein. „Gibt es solche Hefte auch über Schwule?“
„Nicht, dass ich wüsste.“
„Aber es wäre möglich?“
Der Archivar wollte nicht antworten, aber er tat es trotzdem. „Möglich wäre es … und ich will da gar nicht daran denken, aber wir wissen ja, dass die Nazis Schwule eigentlich sofort töten. Es wäre aber denkbar, dass sie auch Hefte haben, in denen wir Schwulen … naja, du weißt schon … Immerhin sind wir hier in Sicherheit.“ Er senkte den Blick und leerte die restlichen Bücher aus der Kiste. „So, und jetzt sortieren wir aus“, sagte er und versuchte seine normale freundliche Stimmung wieder zurück zu bekommen. „Diese Bücher hier“, er nahm sieben Exemplare von Proud Canada, „können sofort weg.“
„Verstanden.“ Alex sortierte seinen Bücherhaufen ebenfalls aus. Nach einigen Minuten waren beide fertig. Die Menge an Ausschuss war gewaltig.
„Das war auch schon mal weniger.“ Patrick blickte um sich. „Machen wir es so – ich hole eine Sackkarre und du schmeißt den Ausschuss in eine der Kisten. Dann können wir den Müll gleich wegbringen, ja?“
„Ja“, nickte Alex.
Der Archivar ging das Bücherlager entlang und suchte nach einer Sackkarre, die er verwenden konnte. Erst ziemlich weit hinten, direkt in der Nähe der Verladerampe, fand er neben einer Bücherkartonlieferung für den Laden von Wolfgang und Caleb eine stehen, die er sodann hinter sich herzog. Er ging zurück zu Alex, der gerade damit fertig wurde, die Bücher reinzuwerfen. „Da fällt mir gerade ein, dass wir es uns auch einfacher hätten machen können.“
„Wieso?“
Er stellte die Sackkarre ab. „Hätten wir zuerst die Karre geholt, dann hätten wir die leere Kiste daraufstellen und sie dann befüllen können. Jetzt aber müssen wir die volle Kiste seitlich anheben und sie auf die Karre bekommen.“
„Stimmt …“
„Egal. Merken wir es uns fürs nächste Mal.“ Patrick bemerkte, dass die Mandingo-Hefte fehlten. „Hast du die auch reingetan?“
Alex nickte. „Ja. Gleich als erstes. So was brauchen wir hier ja wirklich nicht rumliegen lassen.“
„Ganz genau. Also, wir machen wir es? Du hebst die Kiste an und ich bugsiere die Karre darunter, ja?“
„In Ordnung.“ Er tat wie angewiesen, wobei er ebenfalls aufgrund der Anstrengung sein Gesicht verzog, wenngleich auch nicht so stark wie Patrick zuvor.
„Na also. Geht doch.“ Er wollte bereits nach hinten fahren, als der Neue ihn aufhielt.
„Kann ich das machen?“
„Wenn du möchtest.“
„Natürlich.“ Alex kam zu ihm und nahm den Griff der Sackkarre. „Ich weiß doch, wo der Müllbehälter steht. Die Bücher kann ich da auch alleine reinwerfen und du kannst schon die neuen Bücher angucken. Arbeitsteilung.“
„Gut mitgedacht“, lobte Patrick ehrlich. „Was bist du nochmal von Beruf?“
Der Neue ging los. „Alles und nichts. Was ich gewesen bin, zählt hier ja schließlich nicht mehr.“ Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, ging er nach hinten.
Der Archivar sah ihm kurz nach, bevor er sich den Büchern zuwandte und sie in Augenschein nahm. Unter all den Exemplaren fiel ein kleines, bräunlich vergilbtes Büchlein auf, das wie selbstgeklebt wirkte. Er öffnete es und fand mit Bleistift eingetragene Notenfolgen, unter denen Texte standen. Anscheinend hatte jemand ein eigenes Liederbuch verfasst, denn die Texte, die darinstanden, glichen keinem Lied, das Patrick kannte. Er überflog das erste Lied und konnte sich nicht vorstellen, wie es gesungen klang, da er keine Noten lesen konnte und sich die Melodie nicht aus den Worten ablesen ließ. Er legte das Buch beiseite, um es sich später genauer anzugucken und hatte durch geübte Bewegungen bereits mehr als die Hälfte der Bücher begutachtet, als Alex endlich wieder zurückgeschlendert kam. „Jetzt bist du aber doch langsam.“
„Tut mir leid.“
„Das war ein Witz. Nimm nicht alles so ernst.“ Er gab ihm mit einem Blick zu verstehen, die restlichen Bücher zu nehmen. „Aber um nochmal auf das von vorhin zu sprechen zu kommen – du solltest schon gucken, dass du dich hier mit den anderen ein wenig verstehst. Ich meine, ich weiß ja nicht, wie lange du hierbleiben möchtest, aber du solltest …“
„Solange, bis ich meine Schuld abbezahlt habe“, unterbrach Alex, was ungewollt schroff wirkte. Es hatte den Anschein, dass er entweder wirklich nicht wusste, wie er auf andere wirkte, oder er schien etwas mit sich innerlich herumzutragen, dass ihn ein wenig abweisend erscheinen ließ.
„Du bist kein Gefangener. Nur, weil Jonsey dich über die Grenze gebracht hat und das etwas kostet heißt das nicht, dass du hier bleiben musst, bis du die Schulden zurückgezahlt hast“, merkte Patrick an.
„Es wäre aber falsch, mich hierher bringen zu lassen und dann einfach so zu verschwinden. Überhaupt hat mir Herr Löffler sehr deutlich gesagt, dass man hier einen kanadischen Ausweis benötigt, und den bekommt man nur, wenn man bereits einen hat … was ich selber nicht so ganz verstanden habe, aber egal – ohne Ausweis bin ich aufgeschmissen.“
„Keine Sorge, wir sind hier alle für dich da.“
Alex blickte ihn abrupt an. Es schien, dass er ihm etwas sagen wollte, aber er wandte sodann seinen Blick ab, ohne es geäußert zu haben. „Ja. Ich weiß.“
Patrick befand, dass es vorerst am besten sei, nicht weiter nachzuhaken – wenn sich der Neue mitteilen wollte, dann würde er es schon selber tun, wenn und wann er es für geeignet hielt.
Nach einigen Stunden war die Arbeit für den Tag beendet, weswegen Patrick sich auf den Weg zu seiner Wohnung machte, während Alex ebenfalls neben ihm mitging. Der Archivar hatte das kleine Liederbuch in seiner Hand, was dem Neuen auffiel.
„Tippst du das gleich in den Rechner ab?“, wollte Alex wissen.
Patrick nickte. „Ja. Es ist nicht viel, das kann ich gleich machen“, sagte er und betrat mit ihm zusammen das große Treppenhaus, in dem wie immer mehrere Männer herumgingen, miteinander redeten oder auch einfach so auf der Treppe saßen und Karten spielten. „Gehst du gleich zu dir in die Wohnung?“
Alex schüttelte unmerklich den Kopf. „Nein. Ich gehe erst einkaufen. Nur ganz schnell, zum Laden in der nächsten Straße. Dann gehe ich nach Hause. Warum?“
„Weil du dich doch auch durchaus mal mit anderen unterhalten könntest. Darüber hatten wir doch vorhin gesprochen – dass du mal neue Leute kennenlernen solltest. Du bist jetzt frei – mach was daraus. Lerne einen netten Mann kennen, rede mit ihm, und vielleicht habt ihr dann eine gute Zeit. Es bringt doch nichts, nach Kanada zu kommen, nur um dann die ganze Zeit in der Wohnung zu hocken.“
Er schien nicht überzeugt. „Ich bin nicht so der Mensch, der auf jede Feier geht“, meinte er ein wenig gestelzt, so als würde er sich erst die passenden Worte zurechtlegen müssen.
Patrick deutete mit dem Kinn in verschiedene Richtungen. „Guck mal – der blonde Süße da, der heißt Tom. Der ist noch nicht vergeben. Wenn du ihm ein Bier mitbringst, dann kommt ihr bestimmt ins Gespräch. Und der da drüben, der mit dem trainierten Oberkörper, das ist der Nicholas, und der hat gerade auch keinen. Der mag aber kein Bier, sondern Gemüse. Wenn du ihm eine Karotte gibst, dann könnt ihr ja miteinander reden. Und der da vorne …“
„Danke, aber ich möchte nicht“, unterbrach Alex.
„Warum denn nicht?“
Er zeigte auf die Ausgangstür. „Ich muss jetzt einkaufen. Dann gehe ich wieder in meine Wohnung. Und morgen arbeite ich weiter, bis ich meine Schulden abbezahlt habe. Ja? Also bis morgen.“ Er ließ Patrick stehen und ging an den anderen Männern vorbei, ohne sie auch nur eines Blickes zu würdigen.
Der Archivar sah ihm kurz nach, bevor er sich zu seiner Wohnung begab und anklopfte. „Feste Hand voll Ehrlichkeit“, gab er die Sicherheitsparole von sich.
Es dauerte einen Moment, bevor Lukas etwas sagte. „Treuevoll zu jeder Zeit.“ Er öffnete die Tür und ließ ihn rein.
Patrick sah sich um. „Wo ist Walter?“, fragte er den Musiker, der zusammen mit dem anderen als Wache diente.
„In der Stadt. Mir ist eine Gitarrensaite gerissen.“ Lukas nahm sein Instrument und zeigte die abstehende Saite. „Keine Ahnung, wie das passieren konnte. So alt ist die noch gar nicht.“
„Du spielst eben häufig.“
„Ja, muss ich ja auch. Ein Musiker, der nicht jeden Tag spielt, ist ein schlechter Musiker.“
Patrick hielt ihm das Buch hin. „Hier, ich habe etwas für dich.“
„So?“ Er nahm es an sich.
„Ja. Sei aber vorsichtig, es ist noch nicht abgetippt. Aber es ist ein Liederbuch mit Noten. Du kannst ja Noten lesen – wie ist es?“
„Mmh.“ Er sah auf das erste Lied und gab Patrick das aufgeschlagene Buch zurück, damit er die Noten lesen konnte, während er die Melodie langsam auf seiner Gitarre spielte. Die gerissene Saite sorgte dafür, dass er immer mal wieder die betreffende Note ausfallen lassen musste. „Fast der Himmel – meine Heimat …“, sang er die erste Zeile und murmelte sodann ein wenig vom restlichen Text. „Das ist gut …“, meinte er und stoppte mit dem Spielen. „Ich kann das aber nicht so spielen. Ich brauche meine Saite und muss das dann erst ein paar Mal gespielt haben, bevor ich es richtig spielen kann.“ Er nahm das Buch wieder an sich. „Von wem ist das denn?“
„Keine Ahnung“, antwortete der Archivar ehrlich. „Das Buch ist vorhin erst gekommen. Es sieht aus, als hätte das jemand selber geschrieben.“
„Hat auf jeden Fall Stil. Und ich darf das haben?“
„Ja, klar. Vorerst aber nur ausgeliehen. Es muss wie gesagt noch in einen Rechner getippt werden, aber wenn du willst, kannst du dir das ganze Buch angucken und dir die Lieder, die dir gefallen, für dich selber abschreiben. Ich dachte mir, dass es dir vielleicht gefallen könnte – gibt ja nicht so viele Lieder in deutscher Sprache, die nicht alte Heimatlieder oder Parteigesänge sind.“
„Stimmt. Danke.“ Lukas setzte sich hin und las geradezu begierig im Buch.
Patrick ging in das andere Zimmer und von dort durch den Kleider schrank in die angrenzende Wohnung, wo er bereits das Tippen von Karl hörte. „Bin wieder da“, sagte er, woraufhin das Tippen verstummte.
Karl kam zu ihm und strahlte ihn an. „Na endlich. Ich war schon ganz einsam.“ Er küsste ihn freudig.
„Du weißt doch, wie lange ich arbeite.“
„Sicher, aber …“ Er wollte es nicht sagen.
Patrick wusste genau, was los war. „Hast du wieder daran gedacht?“
Er senkte den Blick für einen kurzen, aber alles sagenden Moment. „Ja. Ich weiß, ich soll es nicht, aber dagegen kann ich nichts tun. Es kommt einfach so in den Kopf.“
„Es ist doch alles gut“, versicherte er ihm und gab ihm ebenfalls einen Kuss. „Es war nur ein dummer Traum, und dass der dich seit den Niagarafällen verfolgt, macht mir langsam schon ein wenig Sorgen.“
„Ich kann doch nichts dafür. Es ist einfach … so real … Immer, wenn ich von dem Feuer träume, dann …“
„Es wird nicht passieren.“ Patrick griff ihn an den Armen. „Vertrau mir. Es wird nicht passieren. Keiner wird sterben, das Haus wird nicht abbrennen – wir sind in Sicherheit.“
„Ich weiß“, sagte er wenig überzeugend, „aber es ist immer noch in meinem Kopf. Ich will ja gar nicht daran denken. Ich sitze am Rechner und tippe, und dann plötzlich ist es vor meinen Augen, einfach so, ohne dass ich es kontrollieren kann. Und dann wird immer stärker … jedes Mal … und dann reiße ich mich zusammen und hoffe, dass es schnell wieder weg geht, aber …“
Er umarmte ihn. „Ganz ruhig. Ich bin da. Du bist da. Wir sind hier, und hier ist es sicher. Seit dem Kerl, der sich hier eingeschlichen hat, ist keiner von der Partei mehr hier gewesen. Wir konnten ja sogar ganz in Ruhe Urlaub machen.“
„Ganz in Ruhe ist gut“, meinte der Autor. „Vergiss nicht die Leute, die sich in der Buchhandlung aufhetzen ließen. Das hätte auch schlimm enden können.“
„Hätte es, hat es aber nicht. Behalte die guten Dinge im Blick und nicht die schlechten, ja?“
„Ja, hast recht.“ Er senkte den Kopf, weil er zwar wusste, dass der Archivar die Wahrheit sagte, es jedoch schwerfiel, die bösen Gedanken zu vertreiben.
Patrick deutete die Kopfbewegung anders. „So habe ich das aber nicht unbedingt gemeint.“
Er verstand nicht. „Wie jetzt?“
„Na, ich sage, dass du die guten Dinge im Blick behalten sollst und du guckst mir gleich auf die Hose. Ich habe auch Augen.“
Karl musste wegen dem Gesagten ehrlich auflachen, woraufhin er ihm wieder einen Kuss gab und dann mit ihm gemeinsam in die Küche ging, um das Abendessen vorzubereiten.
Alex kam in dem kleinen Einkaufsladen an, ging jedoch nicht direkt hinein, sondern zunächst zu einer Telefonzelle, die sich daneben befand. Er blickte um sich und stellte sicher, dass ihm niemand gefolgt war, bevor er etwas Kleingeld hineinwarf und eine Nummer wählte, die er mittlerweile auswendig kannte. Am anderen Ende wurde sofort abgenommen.
„Ich habe noch nichts Relevantes erfahren können“, sagte Alex sofort. „Ich stehe aber im ständigen Kontakt zum Mann von Beck. Es wird also nur noch eine Frage der Zeit sein, bis ich Beck persönlich kennenlernen kann.“
„Wie lange?“, sagte die weibliche Stimme am anderen Ende der Leitung.
„Das weiß ich nicht.“ Stille. „Bitte, ich bemühe mich, ich bemühe mich wirklich, aber wenn ich zu schnell mache, dann wissen die doch, dass ich etwas im Schilde führe. Ich muss mir also etwas Zeit lassen.“
Wieder Stille. „Wenn Sie es verantworten können.“
Alex schluckte. „Bitte, tun Sie ihm nichts. Ich … ich tue doch schon alles, was sie mir sagen. Ich habe mich von diesem Schlepper über die Grenze bringen lassen und ich bin jetzt auch in diesem Haus mit diesen ekligen Perversen. Ich kann doch auch nicht schneller sein … Das fällt ansonsten auf …“ Er atmete einmal durch. „Bitte … geht … geht es ihm gut?“
„Es geht ihm gut.“
„Kann ich mit ihm sprechen? Bitte. Ich möchte nur hören, dass es ihm gut geht.“
Die Stimme schwieg für einen Moment, bevor sie autoritär sagte. „Erledigen Sie das, was man von Ihnen will und wir bringen Sie zu ihm.“
„Ja, ich weiß, danke. Aber kann ich nicht wenigstens einmal kurz mit ihm sprechen? Bitte – ich möchte ihm sagen, dass ich …“
„Erledigen Sie ihren Auftrag.“ Das Gespräch wurde beendet.
Alex wollte den Hörer auf die Telefongabel knallen, aber er unterließ es und tat nichts dergleichen. Schwach und entmutigt legte er auf und verließ die Telefonzelle, um sodann im Laden einige Lebensmittel zu kaufen. Er ging zurück ins Schwulenhaus, die Treppen hoch, vorbei an den anderen Männern, die er ignorierte, da er für sie sowieso nur Verachtung übrighatte. Dann betrat er seine Wohnung, stellte die Tüte in die Küche und setzte sich sodann auf einen kleinen Sessel, der bereits dringestanden hatte, als Herr Löffler ihm die Wohnung zuwies.
Er fuhr sich mit den Händen durch die Haare, atmete tief ein und ließ seine Hände sodann übers Gesicht gleiten, wo er sie ruhen ließ, um mit gebeugten Kopf für mehrere Minuten schwermütig zu verharren. Er lehnte sich zurück und überlegte, wie er so schnell wie möglich seinen Auftrag erledigen und diesen Karl Beck töten könnte. Es würde nicht einfach werden – immerhin hatte er noch nie zuvor jemanden getötet, aber er musste es tun. Das war er Leander schuldig …
2.
Wolfgang überprüfte einige Bücher, die er auf den Boden gelegt hatte, während Caleb mit einem Staubtuch das Regal reinigte. Seitdem sie auch neue Bücher ins Sortiment genommen hatten, lief das Geschäft etwas besser als zuvor. Zwar hatte es einige Zeit gedauert, bis sich herumgesprochen hatte, dass man bei Friends of Dorothy nun auch aktuelle Werke kaufen konnte und nicht wie bislang Neuauflagen von im Reich verbotenen Werken, aber seitdem kamen endlich mehr zahlende Kunden. Dies hatte aber zum Nebeneffekt, das Wolfgang und Caleb nun weitere Regale für Neuerscheinungen frei machen und die anderen Bücher in den Keller umlagern mussten, was vor allem Wolfgang nicht so sehr gefiel. Dennoch war es unumgänglich, damit der Laden Profit machte.
„Das möchte ich eigentlich ungern runterbringen“, sagte Wolfgang und zeigte es seinem Freund.
Caleb blickte darauf. „Das kenne ich gar nicht.“
„Ich habe das neulich mal durchgelesen. Also, nicht richtig. Aber es war eigentlich ganz gut.“
„Dann lass es doch hier. Ein paar alte Bücher können schon noch hier auf dem Regal bleiben.“
„Klar“, Wolfgang blickte sich um, „und in ein paar Wochen müssen wir dann noch ein Regal räumen, und dann noch eines, und bald haben wir dann nur noch neue Bücher im Laden und all die anderen im Keller.“
„Fang doch bitte nicht wieder davon an. Wir haben eben zu wenig Platz um alte und neue Bücher im Laden zu lassen. Und wenn wir nur die alten hier haben, dann kommt keiner. Also müssen wir neue haben. Du siehst doch selber, dass seitdem mehr Leute kommen. Zwar immer noch nicht so viele wie es gut wäre, aber mehr als früher.“
Er nickte. „Ja, weiß ich doch auch.“
„Die Bücher sind doch nicht weg, nur weil du sie in den Keller tust. Darüber haben wir doch schon gesprochen.“
„Ja. Ich weiß. Es fällt mir aber trotzdem immer ein wenig schwer.“
„Sei ehrlich“, sagte Caleb und stoppte mit dem Staubwischen, „du willst dich nur etwas beschweren, damit du hinterher sagen kannst, dass du dich gleich beschwert hast.“
„Quatsch“, er legte das Buch beiseite.
„Doch, doch. Das habe ich oft erlebt, als ich noch im Hotel gearbeitet habe. Da kamen auch immer mal wieder Leute an, die sich sofort über alles beschwerten, ohne dass es überhaupt einen Anlass dafür gab. Die sind dann gleich über alles und jeden hergezogen, haben über die Bedienung gemeckert, über uns Zimmernigger, ja das Hotel an sich, und als die dann abgereist sind, da hieß es dann immer, dass es ja doch nicht so schlecht gewesen wäre. Ich habe das am Anfang überhaupt nicht verstanden, warum die sich beschweren, bevor es einen Grund dafür gibt, aber einer meiner Kollegen hatte mir dann gesagt, das Weiße das eben so machen. Nur für den Fall der Fälle, dass es eben doch einen Grund zum Beschweren geben könnte, denn dann kann man hinterher sagen, dass man es ja gleich von vornherein gesagt hat. Und wenn es dann eben keinen Grund zum Beschweren gibt, dann sagt man einfach, dass es nicht so schlimm war wie vermutet.“ Er nickte mehrmals. „Und genau das machst du gerade auch. Du weißt, dass wir Kunden brauchen und dass die nur kommen, wenn wir neue Bücher haben, aber dennoch beschwerst du dich darüber, dass wir die alten Bücher aussortieren müssen. Und warum machst du das? Damit, wenn dann mal jemand reinkommt und den Laden verlässt, weil er kein altes Buch gefunden hat, du dann sagen kannst, dass du ja von vornherein gesagt hast, dass so etwas passieren wird.“
„Ach, Unsinn“, er schnappte sich einige Bücher und stand auf. „Wenn ich wirklich so nervig und vorhersehbare wäre, dann hättest du mich doch schon längst verlassen.“
Caleb machte einen Kussmund und wartete, bis er einen Kuss bekam. „Mich wirst du nicht los. Wir sind zusammen.“
„Das hoffe ich doch.“ Wolfgang gab ihm noch einen weiteren schnellen Kuss und verließ den Verkaufsraum durch die Tür zur Wohnung, um die Bücher in den Keller zu bringen.
Caleb nahm das Staubtuch und schüttelte es draußen vor der Ladentür aus, als ein Lieferwagen vorfuhr und anhielt.
Barry stieg aus. „Hallo. Hier, für euch.“ Er öffnete die Seitentür und holte einen Karton heraus, den er sofort ins Geschäft brachte. „Na, Platz macht ihr ja schon.“
„Wir müssen aussortieren. Hat Wolfgang die Bücher bestellt?“
„Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass der Karton zum Liefern bereitstand, und ich liefere eben aus, was man mir hinstellt“, sagte Barry und stellte es auf die Verkaufstheke. „So, ich muss dann aber auch gleich wieder los. Bis dann.“
„Bis dann.“ Er wartete, bis Barry wieder weggefahren war, bevor er die Tür zumachte und zum Karton ging. Wolfgang hatte ihm nicht gesagt, dass ein weiteres Paket mit Büchern aus dem Schwulenhaus geliefert werden würde. Jedoch bestand die Möglichkeit, dass ein Kunde die Bücher bestellt haben könnte und Caleb es im Moment einfach nicht mehr wusste. Er nahm ein Kartonmesser und öffnete das Paket, um nachzuschauen. Oben lag ein Magazin, dass ihm sofort auffiel. Er nahm es in die Hand und traute seinen Augen nicht – auf dem Titelbild war ein Schwarzer zu sehen, der blutig geschlagen, stumm zu schreien schien, während eine weiße Hand von rechts eine Messerspitze in seine Schläfe trieb. Mit weit aufgerissenen, ungläubigen Augen blickte Caleb sodann auf den Rest der Bilder, die sich in dem Heft befanden: Auf jedem einzelnen waren Schwarze zu sehen, die aufs grausamste misshandelt wurden und unsagbare Foltermethoden über sich ergehen lassen mussten. Die Widerwärtigkeiten waren stellenweise kaum in Worte zu fassen. In der Mitte war ein besonders grauenvolles Bild, dass ihn bis ins Innerste erschütterte und seinen Blick glasig werden ließ.
Wolfgang kam in den Laden zurück. „Haben wir ein Paket bekommen?“, sagte er und bemerkte, dass Caleb ihn überhaupt nicht zu registrieren schien. Er kam näher und sah das Mandingo-Heft. Sofort riss er es ihm aus der Hand. „Was zum … woher hast du diesen Dreck?“
„Du kennst das?“ Seine Stimme klang angespannt, um Fassung bemüht.
„Woher hast du das?“ Wolfgang wandte sich dem Paket zu. „Warum schicken die uns so einen Müll? Da sollten doch die Bücher für Herrn Felcher drin sein.“
Caleb starrte ihn regelrecht an. „Kennst du das etwa? Kennst du dieses Heft?“ Er riss es ihm aus der Hand und sah sich die Titelseite nochmals an. „Ausgabe zweiunddreißig, achtunddreißigster Jahrgang. Seit achtund dreißig Jahren gibt es dieses Heft?“ Sein Gesicht wurde fahrig.
Wolfgang versuchte Ruhe zu bewahren und diese auch zu vermitteln. „Glaub mir, ich habe auch lange nicht gewusst, dass es so etwas Widerliches gibt.“
„Aber du wusstest es?“
Wolfgang nahm ihm das Heft wieder aus der Hand und legte es weg. „Ganz ruhig. Glaube mir, ich finde das auch widerlich, und ich werde gleich bei Herrn Löffler anrufen und fragen, wie so was in das Paket kommen konnte. Aber um deine Frage zu beantworten: Ja, ich weiß, dass es solche Hefte gibt. Aber ich habe so etwas niemals selber gekauft. Als ich im Reich in verschiedenen Buchläden gearbeitet habe, ist mir so was auch nicht begegnet. Erst als ich einmal nach einem Winkel-Heft gefragt hatte, wollte man mir so einen Dreck andrehen. Und hier ist auch schon mal jemand reingekommen und hat nach diesem Müll gefragt.“
„Hier? Bei uns? In unserem Buchladen?“
„Ja.“
Caleb verstand nicht. „Ein Nazi? Ein Nazi war hier bei uns und hat danach gefragt?“
Wolfgang senkte den Blick. „Nein. Kein Nazi. Eine kanadische Frau.“
„Eine kanadische … Bist du dir sicher?“
„Ja.“
„Aber … die Kanadier haben doch nichts gegen Schwarze …“
Wolfgang wusste nicht, was er darauf sagen sollte, weshalb er nur langsam etwas von sich geben konnte. „Ich wollte nicht, dass du jemals so einen kranken Scheißdreck sehen musst. Niemand sollte so was sehen – so ein Müll sollte gar nicht erst existieren. Ich konnte mir ja denken, dass du dich deswegen aufregst. Jeder würde sich über so was aufregen. Darum habe ich dir nichts davon erzählt. Ich finde es ja selber widerlich, aber was soll man von Nazis denn auch schon anderes erwarten? Die haben ja alles nach ihrem Willen geformt – laut denen gibt es keine Schwulen mehr, und auch keine anderen Unerwünschten, und die Schwarzen werden wie Arbeitssklaven behandelt. Man hat ja sogar die ganze Geschichte umgedeutet, damit alles nach dem Wunsch der Partei ausgerichtet ist. Bevor wir hierhergekommen sind, haben wir beide ja noch nie von Frederick Douglass gehört, und …“
„Lenk bitte nicht ab“, unterbrach Caleb abrupt. „Du wusstest, dass es so etwas gibt, und du hast es mir nicht gesagt …“
„Was hätte das denn schon gebracht? Wir können doch sowieso nichts dagegen tun … die Partei macht das … und wahrscheinlich gibt es solche Hefte auch über gefolterte Schwule …“
„Soll mich das etwa beruhigen?“, stieß er zwischen den Zähnen hervor.
„Ich will nur sagen, dass ich genauso wütend bin wie du, aber ich wollte dir ersparen, so etwas zu sehen, weil es mich aufgeregt hat und es dich deswegen bestimmt genauso sehr aufregen wird wie mich, und mir war danach tagelang schlecht. Das wollte ich dir ersparen. Wir können ja sowieso nichts dagegen unternehmen. Die Partei gibt die Hefte heraus. Was sollen wir also machen?“ Er versuchte ihn zu umarmen, aber Caleb schubste ihn weg.
Wolfgang sah ihn verwirrt an – das hatte sein Freund noch nie zuvor getan.
„Lass mich einfach für einen Moment in Ruhe, ja?“ Er schnaufte angespannt, bevor er zur Ladentür ging und das Geschäft verließ.
Wolfgang konnte sich denken, dass sein Freund erst einmal allein sein wollte. Dennoch hielt er es für richtig, ebenfalls den Laden zu verlassen, die Tür abzuschließen und ihm hinterher zu gehen, damit er Caleb Beistand leisten konnte. Die Bilder waren in der Tat sehr schlimm und würden wohl bei jedem eine derartige Reaktion erzeugen.
„Warte“, sagte er und ging etwas schneller.
„Lass mich“, wehrte Caleb ab und ging weiter.
Wolfgang ließ nicht locker. Er blieb weiterhin hinter seinem Freund, der durch die Stadt ging, vorbei an Passanten und Geschäften, bis er die Stadt hinter sich gelassen und in ein Waldstück gelang war, wo er schließlich stehenblieb und sich umdrehte.
„Lass mich bitte einfach allein, ja? Bitte.“
Wolfgang kam näher. „Du solltest aber gerade nicht alleine sein.“
„Was weißt du schon …“
„Ich weiß, dass du dich gerade ziemlich schlecht fühlen musst … das tue ich auch …“
„Ach.“ Es klang schneidend.
„Ja.“ Er ging noch näher zu ihm, so dass er ihn berühren konnte. „Mir ist auch schlecht geworden, als ich solche Bilder gesehen habe.“
„Solche Bilder …“, wiederholte Caleb und biss sich kurz angespannt auf die Unterlippe, so dass sie fast zu bluten anfing. „Denkst du etwa, dass ich deswegen alleine sein will? Weil ich jetzt gerade anscheinend zum ersten Mal mitbekommen hätte, dass die Nazis uns Schwarze wie Vieh behandeln?“ Er schüttelte den Kopf. „Das weiß ich doch, das weiß ich doch schon seit meiner Geburt. Die Nazis nennen uns Nigger, sie nennen uns Abschaum, und sie behandeln uns wie Tiere … nein, sogar schlimmer als Tiere. Das weiß ich doch. Es überrascht mich also nicht, wenn ich sehe, dass die Nazis solche Hefte haben … wenn ich sehe, dass die uns Schwarze auspeitschen, verstümmeln und so weiter …“ Er atmete durch. „Aber … auf der einen Seite … auf der einen Seite in dem Heft …“ Seine Lippen zitterten. Tränen schossen ihm in die Augen. „Ich kenne ihn …“
„Wen?“
„Den Mann, der auf der einen Seite gefoltert wurde … und du kennst ihn auch. Das war Deacon … ganz eindeutig …“
„Deacon?“, wiederholte Wolfgang.
„Ja doch. Deacon. Ich irre mich nicht. Ich kenne ihn doch. Das war Deacon.“ Da er in Wolfgangs Gesicht ablesen konnte, das dieser nicht verstand, erklärte er. „Mein Kollege aus dem Hotel. Du hast ihn auch gesehen. Er war betrunken. Dieser Nazi, der Vorgesetzte von deinem Freund, der hat Deacon doch als ersten verhört …“ Er zitterte stärker. „Das ist Deacon im Heft, ganz sicher, ich irre mich nicht.“
Wolfgang ergriff seine linke Hand und wollte ihm die Tränen aus den Augen wischen, aber sein Freund wich mit dem Kopf zurück, weshalb er mit seiner Hand auch den rechten Arm von Caleb anfasste. „Das kann nicht sein. Das ist unmöglich.“
„Doch. Er ist es. Es ist Deacon. Ich irre mich nicht. Die haben Deacon gefoltert. Ich habe es auf dem Bild gesehen. Sie haben ihn …“
„Nein, nein, nein. Du irrst dich. Es kann nicht Deacon sein.“
„Doch, er ist es. Ich kenne ihn doch“, beharrte er.
„Weil er dein Kollege im Hotel war?“
„Ja.“
„Der Kollege, den ich auch gesehen habe? Der betrunken war? Der zuerst verhört wurde?“
„Ja doch, ja, ja, ja!“
Wolfgang versuchte ihm in die Augen zu blicken, aber sein Freund schloss sie und schüttelte den Kopf immer wieder. „Dann musst du dich irren. Es kann nicht Deacon sein. Deacon ist tot. Er wurde erschossen. Das weißt du doch. Du hast es doch auch gehört. Der Nazi hat ihn erschossen. Er hat ihn als ersten befragt und ihn dann erschossen. Das wissen wir doch.“
„Es ist Deacon. Ich irre mich nicht. Es ist Deacon.“
„Er kann es nicht sein. Deacon ist tot.“
Caleb japste. „Weil die ihn für ein Heft umgebracht haben. Weil er schwarz ist und darum für die Nazis nichts wert ist, genauso wie alle anderen Schwarzen!“
„Er war schon vorher tot. Deacon ist im Hotel gestorben. Er kann es nicht gewesen sein. Die haben andere für ihr Heft gefoltert und getötet, und das ist genauso widerlich … aber es kann nicht Deacon gewesen sein. Deacon wurde erschossen. Im Hotel. Du weißt das genauso gut wie ich. Wir wären schließlich auch beinahe gestorben.“ Er versuchte ihn weiter zu beruhigen, aber es gelang ihm nicht so gut wie er es erhoffte.
Caleb befreite sich aus den Händen seines Freundes und blickte ihn wie ein verwundetes Kind an, dass die Welt nicht mehr verstand. „Was willst du mir damit sagen? Das ich einen Schwarzen nicht von einem anderen unterscheiden kann? Das wir alle gleich aussehen? Willst du mir das sagen? Ich weiß doch, wie Deacon aussieht, und wenn ich sage, dass es Deacon ist, dann ist es auch Deacon. Warum sollte ich mich bei so etwas irren?“
„Beruhige dich bitte.“
„Ich soll mich beruhigen? Was würdest du denn …“ Er ballte die Fäuste und atmete hastig ein und aus. „Es ist Deacon. Ich irre mich nicht. Dieser Nazi hat ihn im Hotel nicht erschossen, sondern uns angelogen, damit er ihn später für dieses verdammte Heft benutzen konnte. Ganz sicher. Dieser Bastard hat ihn an diese Folterknechte weitergegeben, als wäre er kein Mensch, sondern einfach nur … nur …“ Er fand keine passenden Worte. Er ließ die Hände kraftlos herabhängen und schluchzte.
Wolfgang umarmte ihn wieder. „Ich weiß. Ich weiß.“
„Du weißt das nicht. Das kannst du nicht wissen“, sagte Caleb gedämpft, da sein Gesicht auf der Schulter seines Freundes ruhte. „Du kannst nicht wissen, wie das ist, wenn man von klein auf von allen anderen als minderwertig angesehen wird. Wenn man von Geburt an schon gesagt bekommt, dass man nie so sein kann wie andere. Dass man immer ein Ausgestoßener sein wird, egal wie sehr man sich anstrengt. Es ist egal, ob man klug ist oder nicht, oder man etwas leisten kann oder nicht – die sehen nur die Hautfarbe, und da sie nur das Schwarze sehen, sehen sie nur einen dummen Nigger. Immer. Egal wer man ist oder was man kann, man ist und bleibt ein dummer Nigger, der weniger wert ist als Scheiße.“
„Und du denkst wirklich, dass ich nicht weiß, wie sich so etwas anfühlt?“, gab Wolfgang von sich, woraufhin sein Freund ihn anblickte. „Was meinst du, wie ich mich gefühlt habe, als ich mitbekommen habe, dass ich auf Männer stehe? Ich habe mich immer als Teil der Gesellschaft gefühlt, und plötzlich merke ich, dass ich wegen meiner Liebe ein Verbrecher bin. Das ich von einem Tag auf den anderen ein Verbrecher bin, der nicht zur Gesellschaft gehört und der, egal ob er schon jemanden geliebt hat oder nicht, verfolgt und bestraft gehört.“
„Das ist nicht dasselbe“, wandte Caleb ein. „Du hast dich davor wenigstens als zugehörig fühlen können. Ich habe das niemals gehabt.“
„Na, das ist doch auch durchaus positiv. Ich meine, was ist denn schlimmer? Wenn man sich jahrelang als zugehörig empfindet und dann plötzlich zum Ausgestoßenen wird, oder wenn man von vornherein weiß, dass man nicht dazugehört und sich deswegen auch gar nicht erst anstrengen muss, dazugehören zu wollen?“
Er schüttelte den Kopf. „So einfach ist das auch nicht. Ich war ja noch ein Kind – ich wollte ja dazu gehören und habe nicht verstanden, warum ich das aufgrund meiner Hautfarbe nicht durfte.“
„Ich war ein Jugendlicher, als ich gemerkt habe, dass ich schwul bin. Glaubst du, dass ich da verstanden hätte, wieso ich nicht länger dazugehören darf?“, wandte er leicht verschmitzt ein, um die Stimmung etwas zu lockern. Er wollte noch etwas sagen, aber er umarmte Caleb stattdessen. Sie hielten sich für einige Zeit fest, dann ließen sie sich langsam wieder los.
„Es ist Deacon, da bin ich mir sicher“, sagte er nochmals, dieses Mal jedoch gefasster.
Wolfgang nickte. „Wenn du es sagst, dann glaube ich dir. Dann hat der Nazi uns angelogen. Sollte einen ja nicht wirklich überraschen.“
„Hatte dein Freund dir nichts dazu gesagt?“
„Du meinst, bevor er mir die Kehle aufschneiden wollte?“
„Hat er doch.“
„Nicht ganz. Aber nein, er hat nicht gesagt, dass Deacon noch am Leben gewesen ist. Ansonsten hätte ich dir das gesagt.“
„Sicher?“
Er verstand nicht. „Sicher, dass ich es dir gesagt hätte, oder wie meinst du das?“
Caleb präzisierte. „Ob du sicher bist, dass er nichts über Deacon gesagt hat.“
Er überlegte. „Ich bin mir ziemlich sicher, aber … es war ziemlich chaotisch. Aber ich denke mir, dass ich so etwas nicht überhört hätte … zumindest hoffe ich es.“ Er zuckte mit der Schulter.
Sein Freund nickte. „Ja. du hättest es mir gesagt. Bestimmt.“
„Das ich die Hefte nicht erwähnte habe tut mir leid, aber ich dachte mir eben …“
„Ja, ich weiß. Hast du mir ja vorhin gesagt.“ Er senkte den Kopf. „Tut mir leid, dass ich dich angeschrien habe.“
„Du hattest einen guten Grund.“
„Schon, aber du warst ja nicht schuld. Ich hätte es nicht an dir auslassen sollen …“
„Schon vergessen.“ Er streichelte ihm mit dem Daumen über den Handrücken. „Ich schlage vor, dass wir in den Laden zurückgehen. Ich rufe dann Herrn Löffler an und frage ihn, wie dieses Heft bei der Lieferung für uns mit reinrutschen konnte. Und dann zerstören wir es gemeinsam, ja?“
Caleb wollte bereits zustimmen, als er sich zurückhielt, da er eine Idee hatte. „Kann man rausbekommen, wo diese Hefte hergestellt werden?“
„Wieso? Was bringt das?“
Er ging nicht darauf ein, sondern fragte. „Kann man? Was meinst du?“
Wolfgang antwortete bedächtig. „Denke schon. Ich glaube zwar nicht, dass ein Verlagsverzeichnis darin steht, aber ich habe mir diese Hefte ehrlich gesagt auch noch nie so genau angeguckt. Die Bilder haben mir schon gereicht.“
„Wenn ein Jahrgang auf dem Umschlag steht, dann muss auch ein Verlagsverzeichnis drinstehen“, meinte sein Freund und wischte sich über die Augen, in denen die Tränen bereits am Trocknen waren. „Dann können wir bestimmt herausfinden, wo diese Hefte gedruckt werden, und wenn wir das wissen, dann finden wir auch heraus, wo die Bilder hergestellt werden.“
„Und dann? Was hast du davon, wenn du das weißt?“ Er blinzelte. „Du willst doch nicht etwa da einbrechen oder so was?“
„Eigentlich sollten wir das tun. Wir sollten dahin und den Laden zerstören … aber wir beide sind dafür nicht trainiert. Die würden uns sofort erwischen und ebenfalls töten. Nein, was ich mir gerade denke, ist, dass die doch auch eine Art Liste haben müssen mit den Namen der Leute, die sie gefoltert haben.“
„Wahrscheinlich …“
„Wir sollten herausbekommen, wo diese Folterknechte sind und dann rufen wir an und fragen nach, ob die einen Deacon bei sich haben.“
Wolfgang verstand immer noch nicht. „Und weiter? Was bringt das?“
„Dann wissen wir doch, ob ich auch wirklich recht habe oder nicht, auch wenn ich mir sicher bin, dass ich recht habe.“
„Schön und gut, aber was bringt das? Sagen wir mal, die haben einen Deacon bei sich in der Liste. Gut, und weiter? Er dürfte mittlerweile tot sein, und wir haben doch sowieso gedacht, dass er bereits im Hotel gestorben ist. Es ist zwar scheiße, dass er gefoltert und dann ermordet wurde, aber genauso scheiße ist es, dass er im Hotel erschossen wurde. So hart es klingt, aber tot ist tot. Da können wir nichts mehr machen. Und wenn wir da anrufen sollten, dann können die doch bestimmt herausbekommen, dass wir aus Kanada anrufen. Und dann fragen die sich, warum jemand aus Kanada bei ihnen nachfragt. Und dann werden die nachforschen und feststellen, dass wir hierher geflohen sind.“
„Wir machen es anders“, sagte Caleb. Seine vorherige emotionale Verwirrtheit schien wie verschwunden. „Wir fragen Jonsey, ob er anrufen kann, wenn er wieder in den D-S-A ist. Er ruft einfach von einer Telefonzelle an.“
„Ich weiß nicht … Wir sollten Jonsey nicht mit reinziehen.“
„Was heißt da mit reinziehen? Wir machen schließlich nichts Illegales. Wir versuchen lediglich herauszufinden, ob ich recht habe oder nicht.“
Wolfgang stieß etwas Luft durch den Mund und machte ein zerknautschtes Gesicht. „Und was bringt es dir, wenn du recht hast? Was hast du davon? Nochmal: Wir haben gedacht, dass Deacon im Hotel gestorben ist, und jetzt denkst du, dass er gefoltert und für eines dieser Hefte missbraucht wurde. So, und weiter? Tot ist tot, egal ob im Hotel oder später woanders. Er bringt ihm nichts, wenn wir das wissen, und es bringt uns auch nichts.“ Er zuckte mit der Schulter und blinzelte mehrmals. „Bitte, ich verstehe es nicht. Erkläre es mir. Was bringt es, wenn wir es wissen?“
„Ich möchte es einfach wissen.“
„Gut. Und warum? Was bringt es dir?“
„Ich möchte es wissen.“
„Ja, aber warum? Ob Deacon im Hotel gestorben ist oder später, er ist …“
„Ich will es wissen“, unterbrach Caleb ihn etwas schärfer, bevor er ihn mit einem flehenden Blick ansah. „Bitte. Ich will es wissen. Ich muss es wissen. Frag mich nicht, warum. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß, dass du recht hast. Ich weiß, dass es streng genommen egal ist, ob er im Hotel gestorben ist oder Wochen später woanders. Er ist tot, so oder so. Aber ich muss wissen, ob er im Hotel gestorben ist oder später. Nicht, dass es etwas bedeutet, aber …“ Er zuckte mit der Schulter. „Wenn er nicht im Hotel gestorben ist sondern später, dann …“
„Dann?“ Wolfgang hatte eine plötzliche Idee, was seinen Freund bedrücken könnte. „Er wäre nicht deine oder meine Schuld, wenn er später gestorben ist. Der Kerl hatte gesagt, dass er ihn getötet hat, und wir haben ihm geglaubt und sind darum so schnell wie möglich aus dem Hotel geflohen. Wir hätten ihm sowieso nicht helfen können, wenn er irgendwo in einem der Hotelzimmer gewesen wäre.“
„Aber wir haben nicht einmal nachgeguckt“, sagte er matt. „Wir haben uns einfach auf das Wort von einem Nazi verlassen. Wir hätten nachgucken müssen.“
„Dazu hatten wir aber keine Zeit. Wir mussten schnell weg, das weißt du doch.“
Caleb schluckte. „Also haben wir unsere Freiheit, weil wir Deacon zurückgelassen haben?“
„So darfst du das nicht sehen. Wir wissen doch nicht, ob er noch lebte …“
„Und darum will ich das wissen.“
Wolfgang wusste langsam nicht mehr, was er noch sagen sollte, um seinen Freund, diese in seinen Augen dumme Idee auszutreiben. „Und was bringt es, wenn wir wissen, dass Deacon noch lebte? Würdest du dann ewig denken, dass wir unsere Freiheit nur haben, weil wir ihn zurückgelassen haben, obwohl wir zu dem Zeitpunkt gar nicht wussten, dass er noch lebte? Würdest du dann sagen, dass wir nicht frei und glücklich sein können, weil wir uns auf das Wort eines Nazis verlassen haben? Ja, was wäre denn, wenn Deacon damals tatsächlich gestorben ist? Was dann? Sagst du dann, dass wir uns nichts vorzuwerfen hätten und wieder so glücklich miteinander sein können wie zuvor? Oder würdest du nicht aufgeben und versuchen herauszufinden, wer der Mann auf dem Bild ist, nur damit du auch wirklich absolut sicher sein kannst, dass wir nichts Falsches getan haben, von dem wir noch nicht einmal wussten, dass wir es getan haben?“ Er verstummte abrupt. Es dauerte eine Weile, bevor er kleinlaut wieder etwas sagte. „Du bist das Beste, dass es in meinem Leben gibt. Ich möchte dich nicht verlieren. Ich möchte nicht, dass sich etwas zwischen uns stellt. Wenn du also möchtest, dann fragen wir Jonsey gemeinsam, ob er da Informationen bekommen kann. Aber bitte … egal, was dabei herauskommt … Ich liebe dich. Das weißt du. Vergiss das bitte nie. Egal was auch passiert, ich liebe dich, und ich werde dich immer …“
Er kam nicht weiter, da Caleb ihn umarmte und ihm einen starken, intensiven Kuss gab, den er mit der gleichen Liebe erwiderte. Sie wollten sich gegenseitig ohne jedweden Zweifel versichern, dass es nichts auf der Welt gab, das ihre Liebe gefährden würde.
Patrick sortierte einige der neuen Bücher, als Tim Löffler ins Bücherlager kam. „Alles in Ordnung bei euch?“, wollte der Hausleiter wissen.
„Ja, natürlich“, er sah zu Alex, der etwas abseitsstand und mit einem Rechner überprüfte, welche Ausgaben des Buches, dass er in der Hand hielt, bereits gelagert wurden und ob es nötig wäre, das betreffende Buch abtippen zu lassen. Gelegentlich gab es bei den verschiedenen Auflagen gravierende Unterschiede, die allesamt gesichert werden mussten.
„Wir arbeiten wie immer, nicht wahr?“
Alex blickte beide für einen Moment perplex an, so als hätte er nicht mitbekommen, worum es in dem Gespräch ging. „Ähm, ja. Natürlich.“
„Ganz in die Arbeit vertieft“, sagte Löffler höflich und wandte sich an Patrick. „Kann ich dich aber mal kurz mitnehmen? Bei mir am Rechner stimmt etwas nicht.“
Der Archivar wusste, dass in einem solchen Fall eigentlich Oskar, der Mann von Löffler, oder einer der anderen Leute aus der geheimen Rechnerabteilung dafür herangezogen wurde, weswegen er sich denken konnte, dass der Hausleiter gerade nicht offen mit ihm sprach. „Natürlich, kein Problem. Alex macht das hier schon.“
Alex nickte. „Natürlich. Einfach die Auflagen überprüfen und dann entweder auf den einen oder den anderen Stapel. Hinterher einsortieren oder warten, bis Patrick es sich angeguckt hat.“ Er nickte mehrmals. „Ich weiß schon, wie es geht.“
„Sehr gut.“ Löffler ging voran. Sie verließen den Lagerbereich des Hauses und kamen in die Nähe des Treppenhauses, wo der Hausleiter stehenblieb.
„Was ist denn passiert?“, wollte Patrick wissen und ließ durch die Frage sogleich durchklingen, dass er wusste, dass es sich nicht um ein Problem mit dem Rechner handeln konnte.
„Ich habe einen Anruf von Wolfgang bekommen. Du weißt schon – ihm hatte man doch versucht die Kehle aufzuschneiden.“
„Ja. Ich weiß, wer Wolfgang ist. Er und sein Freund haben den Buchladen.“
„Genau der“, nickte Löffler. „Und er hat heute ein Paket von uns bekommen.“
„Ja. Das stimmt. Barry hat es ihm geliefert. Das stand schon zwei Tage hier, aber wir hatten noch nicht alle Bücher fertig. Hat etwas nicht gestimmt?“
„Das kann man so sagen.“
Der Archivar verstand nicht. „Worum geht es denn genau? Wegen einem falschen Buch würdest du dich doch jetzt nicht so benehmen als wäre es das Ende der Welt. Was ist denn los?“
Löffler blickte sich kurz um. „Wer hat das Paket zugemacht?“, sagte er leise.
„Wieso?“
„Ich muss das wissen. Wer hat es gepackt, wer hat es zugemacht, und wer hat es Barry zum Ausliefern gegeben?“
Patrick überlegte. „Also, gepackt habe ich es. Und zugemacht … keine Ahnung. Aber eigentlich stand es, wie gesagt, zwei Tage offen herum. War da eine Spinne drin oder so was?“ Er versuchte locker zu bleiben. „Ich weiß gerade wirklich nicht, was los sein soll.“
Löffler wurde sichtbar unwohl zumute. „Du weißt, dass Caleb, der Freund von Wolfgang, schwarz ist? Das weißt du, ja?“
„Ja. Er ist schwarz. Und? Was hat das mit irgendwas zu tun?“
Er kam etwas näher. „In dem Paket war ein Mandingo-Heft.“
Der Archivar riss die Augen auf. „Ein Mandingo-Heft?“