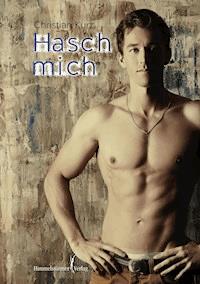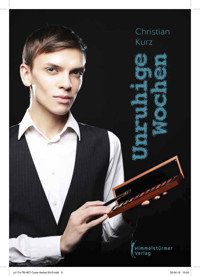Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Himmelstürmer
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Die Partei lässt auch nach den letzten Ereignissen nichts unversucht, um Karl Beck, den Autor der Winkelbücher, endlich zu töten, denn es ist für die Parteioberen ein großer Autoritätsverlust, das ein Schwuler sie mit seinen Schriften über Gleichheit, Toleranz und Liebe regelrecht vorführt. Offizier Wehrhaus, ein ebenso intelligenter wie skrupelloser Mann, der sich nicht davor scheut, selber Hand anzulegen, wird umgehend damit beauftragt, sich um diese Angelegenheit zu kümmern, damit alles so wird, wie es die Partei haben möchte. Damit er seinen Auftrag so schnell wie möglich ausführen kann, wird ihm völlige Handlungsfreiheit gewährleistet, die er auch rigoros in Anspruch nimmt. Aber auch von anderer Seite drohen Gefahren für die Bewohner des kanadischen Schwulenhauses - der Schwulenhasser Howard Sheen wird aus dem Gefängnis entlassen und verbreitet sein Gedankengift aufs Neue. Seine Worte schaffen es weiterhin mit einer erschreckenden Leichtigkeit, die bislang nur latent in den Köpfen der kanadischen Bevölkerung vorhandenen Vorurteile gegenüber den schwulen Einwanderern zu alles zersetzenden Hass aufzuhetzen. Aber auch Jonsey bekommt Probleme, denn er muss schmerzlich erkennen, dass seine Grenzübergänge nicht so unbemerkt geblieben sind, wie er es bislang immer gedacht hatte. Und auch wenn Wolfgang und Caleb sich ihren Traum von einer eigenen Buchhandlung erfüllen konnten, lassen die Probleme nicht lange auf sich warten, denn die durch Sheen in ihrem Hass befeuerten Kanadier sehen es gar nicht gerne, wenn zwei Schwule deutsche Bücher verbreiten. Selbst für den in die japanischen Gebiete geflohenen Nils gestaltet sich sein Leben ebenfalls immer schwerer, denn seine teuer erkaufte Freiheit muss immer wieder aufs Neue bezahlt werden. Die dunklen Wolken, die sich im Hintergrund langsam, aber dafür umso gewaltiger über die Leben von allen aufziehen, lassen auf nichts Gutes schließen. In einer Welt, die auf den Allmachtsvorstellungen einiger wenigen Führer aufgebaut wurde, haben es Liebe und Ehrlichkeit sehr schwer, nicht zwischen all dem Hass zerrieben zu werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 865
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christian Kurz
Die Zeit der bitteren Freiheit
Von Christian Kurz bisher erschienen:
Allein unter seinesgleichen ISBN, print: 978-3-86361-564-2
Hasch mich, ISBN print: 978-3-86361-567-3
Regenbogenträumer, ISBN print: 978-3-86361-491-1
Samt sei meine Seele, ISBN print: 978-3-86361-617-5
Die Welt zwischen uns, ISBN print 978-3-86361-614-4
Fremde Heimat, ISBN print: 978-3-86361-652-6
Augen voller Sterne, ISBN 978-3-86361-672-4
Alle Bücher auch als E-book
Himmelstürmer Verlag, part of Production House, Hamburg
www.himmelstuermer.de
E-Mail: [email protected]
Originalausgabe, Februar 2017
© Production House GmbH
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Verlages.
Zuwiderhandeln wird strafrechtlich verfolgt
Rechtschreibung nach Duden, 24. Auflage
Cover: 123rf.com
Umschlaggestaltung: Olaf Welling, Grafik-Designer AGD, Hamburg. www.olafwelling.de
E-Book-Konvertierung: Satzweiss.com Print Web Software GmbH
Printed in Germany
ISBN print 978-3-86361-717-2
ISBN e-pub 978-3-86361-718-9
ISBN pdf 978-3-86361-719-6
Was bisher geschah:
Nachdem es den Nazis unter der Führung von Adolf Hitler während des großen Krieges von 1939 gelang, zusammen mit dem japanischen Kaiserreich von Hirohito und den Italienern unter Befehl von Mussolini die alliierten Kräfte zu besiegen, wurden die besiegten Gebiete unter den drei herrschenden Reichen aufgeteilt und nach ihrem Willen umgeformt. Der Faschismus breitete sich fast über die gesamte Erde aus, und nur wenige Länder konnten sich damals dem Einflussbereich der Achsenmächte entziehen, die aber auch untereinander verfeindet sind und mit gegenseitigen Angriffen rechnen müssen.
In den von den Nazis eroberten Gebieten wurden sofort die jeweiligen Kulturgüter wie Sprache, Schrift und Musik der besiegten Nation verboten und auf Deutsch umgestellt, genauso wie in den von den Japanern eroberten Gebiete nur noch japanisch und in den italienischen Ländern nur noch italienisch erlaubt wurde. Alle Bücher, Filme und dergleichen, die noch in der alten Sprache existierten, mussten zusammengetragen und vernichtet werden. Die alte Kultur wurde rigoros ausgelöscht und durch das jeweilige Weltbild der neuen Herrscher ersetzt, die die jeweiligen Völker in dem Glauben umerzogen, dass nur die neue genehmigte Kultur die einzig richtige sei und die ursprüngliche eine degenerierte Abart darstellte, von der man die Völker befreite und dadurch veredelte.
In den von den Nazis eroberten Gebieten wurden zudem sämtliche als „Untermenschen“ klassifizierten Menschen verfolgt und getötet, weswegen sie fast vollständig aus dem Bewusstsein des Volkes verschwanden. Diejenigen, die noch existieren, werden dumm gehalten und als Sklaven missbraucht – Schwarzen wird beigebracht, dass sie ohne die Hilfe der Nazis noch in Höhlen leben würden, weswegen sie sich glücklich schätzen könnten, dass man ihnen erlaubt, für die Herrenmenschen zu arbeiten.
Durch die strengen Gesetze und Todeskommandos verschwanden auch die Homosexuellen aus dem Gedankenbild der Menschen. Der Begriff „Schwul“ ist so gut wie vergessen, aber dennoch gibt es noch Homosexuelle, wenngleich sie im Verborgenen leben müssen.
Aufgrund dieser Entwicklungen weiß der junge Wolfgang Volkmer nicht, was es zu bedeuten hat, als er sich in seinen besten Freund Nils Breuer verliebt. Er weiß nur, dass es nicht richtig sein kann, denn andernfalls würde er in der Lage sein, in Erfahrung zu bringen, was seine Gefühle zu bedeuten haben. Nach der Schule fängt Wolfgang in einer Buchhandlung an, während Nils eine Ausbildung beim Staat antritt, um den Dienst fürs Vaterland zu leisten. Wolfgang kommt bei der Arbeit mit den sogenannten „Winkel-Heften“ in Kontakt, bei denen es sich um illegal hergestellte Magazine handelt, die voll von schwulen Helden und Bildern mit hübschen Männern sind. Erst durch das Lesen dieser Hefte erkennt Wolfgang, dass er schwul und damit ungewollt ein Staatsfeind ist.
Einer der Autoren der Winkel-Hefte ist Karl Beck, welcher in einem Einkaufsmarkt arbeitet, heimlich jedoch Geschichten schreibt, in denen Schwule kraftvoll für das Recht auf Liebe einstehen. Karl kommt auf die Idee, eine Geschichte zu schreiben, in der die Nazis den großen Krieg verloren haben und die gesamte Welt deswegen nicht faschistisch geprägt wäre. Er kann sie in den Winkel-Heften veröffentlichen, wo sie auch von Wolfgang gelesen wird. Wolfgang wird durch diese Geschichte darin bestärkt, dass er sich für seine Homosexualität nicht schämen muss und diese auch nicht verstecken will. Weil in den Winkel-Heften und auch in alltäglichen Gesprächen das noch nicht durch eine der drei Weltmächte besetzte Kanada als letzter Ort der Freiheit genannt wird, nimmt er all seinen Mut zusammen und will dort hinreisen, kommt aber zunächst nur bis ins ehemalige Amerika, das unter den Nazis als D-S-A, die Deutschen-Staaten-von-Amerika, bekannt ist.
Auch Karl beschließt, sein Glück in Kanada zu versuchen. Weil die Grenze jedoch geschlossen ist, muss er illegal ins Land kommen und arbeitet ohne Pass und Geld als Tellerwäsche im Restaurant von Mr. LeMesurier. Dort lernt er den umtriebigen Jonsey kennen. Weil Karl aufgrund seines Status als illegaler Einwanderer nicht zum Arzt gehen kann, stirbt er beinahe an einem Blinddarmdurchbruch, kann von Jonsey aber noch rechtzeitig zum Tierarzt O'Bannon gebracht werden. Karl sagt Jonsey, dass er schwul ist, woraufhin dieser ihn an Tim Löffler weiterleitet. Löffler betreibt ein Haus für Schwule und Literatur – er bietet jedem nach Kanada geflohenen an, in seinem Haus zu wohnen und dort mitzuhelfen, Exemplare von Büchern abzutippen, welche die Nazis vernichten wollen. Karl zieht ins Haus und lernt dort den jungen Archivar Patrick kennen und lieben.
Währenddessen kommt der für die Nazi-Partei arbeitende Schmidtz nach Kanada. Schmidtz hatte bereits zuvor versucht, Karl Beck zu fassen und für die Partei zu töten, weil die Winkel-Geschichte vom verlorenen Krieg in den Augen der Partei-Oberen eine Beleidigung von ungeahnten Ausmaßen ist, die unter allen Umständen mit dem Tod des Autors zu ahnden sei.
Gleichzeitig kommt auch der kanadische Fabrikarbeiter Howard Sheen zu einiger Prominenz, weil er es versteht, seinen Hass auf Deutsche, Einwanderer, aber vor allem auf Schwule in Worte zu kleiden, die die Zuhörer auf seine Seite ziehen. Sheen organisiert eine Menschenmenge, welche das Schwulenhaus angreift und die Bewohner aus dem Land vertreiben soll. Schmidtz befindet sich ebenfalls im Haus und versucht Karl zu töten, jedoch gelingt es diesem durch die Hilfe von Patrick, sich zur Wehr zu setzen. Schmidtz wird dabei verletzt, der Angriff der von Sheen aufgewiegelten Leute kann durch die kanadische Polizei unterbunden werden. Jedoch kann diese nicht offiziell gegen Schmidtz vorgehen, denn als Mitglied der Nazi-Partei würde eine Verurteilung schwerwiegende politische Konsequenzen nach sich ziehen. Sheen wird wegen seiner Tat zu einer Gefängnisstrafe verurteilt.
Wolfgang bekommt von alldem nichts mit, denn er ist immer noch in den D-S-A, zieht von einer Stadt in die nächste und arbeitet hauptsächlich in Buchläden, aber auch aushilfsweise in einem Kino. Dort begegnet er Caleb, einem gleichalten, hübschen Schwarzen, der ebenfalls schwul ist. Sie verlieben sich sofort ineinander.
Nils, der ehemalige Schulfreund von Wolfgang, wird als Aushilfs-Adjutant ebenfalls in die D-S-A beordert und begegnet dort Wolfgang wieder, dem er zu verstehen gibt, dass die Partei alles sei und alles Unerwünschte ausgerottet gehört.
Caleb hat bei seiner Arbeit in einem Hotel große Probleme, die damit enden, dass er zusammen mit Wolfgang aus den D-S-A fliehen muss. Nach mehreren Tagen kommen sie in einer Grenzstadt an und wollen von dort über die Grenze nach Kanada. Sie geraten an den zwielichtigen Hobbs, können ihm aber entkommen. Als alles verloren scheint, begegnen sie Jonsey, der sie nach Kanada und dort direkt ins Schwulenhaus bringt.
Schmidtz hat es derweil durch seinen Einflussbereich geschafft, Leiter der D-S-A-Staatspolizei zu werden. Er beauftragt Nils damit, sich als homosexuell auszugeben, nach Kanada zu reisen und dort den Winkel-Autoren Karl Beck zu töten.
Zur selben Zeit trifft Jonsey auf den mysteriösen Walendy, der als Deutscher für die Japaner arbeitet und vorschlägt, dass der japanische Geheimdienst das Schwulenhaus vor feindlichen Angriffen durch die Nazis beschützen kann, wenn man ihnen im Gegenzug Datenkopien der im Haus befindlichen Bücher übergibt.
Nils gelangt ins Schwulenhaus, wird dort aber von Wolfgang entdeckt. Nils weiß sich nicht anders zu helfen und bedroht ihn mit einem Messer, dann schneidet er ihm die Kehle auf. Obwohl Wolfgang überlebt, beschließt Walendy, Nils diese Information vorzuenthalten und ihn durch die Schuld dazu zu bewegen, dass er zustimmt, eine Bombe zu Schmidtz zu bringen und diesen tötet. Nils willigt ein. Es gelingt ihm, Schmidtz zu töten, dann wird Nils aus den D-S-A in die Japanischen-Staaten-von-Amerika, den J-S-A, gebracht.
Jonsey und Walendy treffen sich einige Zeit später und kommen darin überein, dass Nils in den J-S-A am Leben bleiben darf. Zudem beschließen sie, dass der japanische Geheimdienst ab sofort dafür sorgen soll, das von der Nazi-Partei geschickte Attentäter, die Karl wegen seiner Geschichte töten sollen, eliminiert werden.
Wolfgang und Caleb befinden sich genauso wie Karl und Patrick in Kanada und versuchen in Freiheit zu leben. Jonsey fährt einmal die Woche in die Grenzstadt und versucht Leuten über die Grenze zu helfen. Nils ist in den J-S-A und denkt, dass er seinen besten Freund getötet hat. Der Posten des D-S-A-Staatspolizeileiters wurde neu besetzt. Die Nazi-Partei hat nicht vergessen, was vorgefallen ist.
1.
Offizier Harald Wehrhaus saß auf einem leicht dreckig weißen Stuhl vor dem kleinen Restaurant in Christchurch in Neuseeland, während einige schwer bewaffnete deutsche Soldaten der Wehrmacht an ihm und seinem Kollegen Sturzrieger vorbeigingen. Wehrhaus trank etwas Kaffee und blickte unbemerkt um sich, was seinem Kollegen dennoch auffiel. „Was suchst du?“
„Die Japaner“, sagte er und setzte die Tasse ab.
Sturzrieger rümpfte die Nase. „Ja, die sind wirklich überall. Denen hätte man gar nicht erst erlauben sollen, sich die ganzen Küstengebiete zu schnappen. Ich meine“, er lehnte sich ein wenig vor und flüsterte, „denen kann man so ein schönes Land doch überhaupt nicht anvertrauen. Und das sage ich ganz ehrlich. Klar, die gehören auch irgendwie zu uns, aber die Japsen verstehen doch wirklich nichts von Natur. Wirklich nicht. Die reden zwar immer davon, dass sie die Natur lieben und dass es bei ihnen die schönsten Kirschblütenbäume gibt und so weiter, aber eigentlich vergewaltigen die Japsen die Natur nur. Darum haben die auch den Banzai-Baum erfunden.“
„Bonsai“, berichtigte Wehrhaus in einem Tonfall, der erkennen ließ, dass er es gewohnt war, kleinere Fehler seines Kollegen zu korrigieren.
„Genau, sage ich ja. Was ist ein Bonsai-Baum denn bitteschön anderes als eine Vergewaltigung der Natur? Die Äste des gesunden Baumes werden gekürzt, gestutzt und auf Biegen und Brechen so kaputt gemacht, dass sich der Baum überhaupt nicht ausbreiten und zu wahrer Größe heranreifen kann. Und warum macht der Japaner das? Ich sage dir, der Japaner macht das, weil er Angst vor der Größe hat. So sieht es aus. Der Japaner hat Angst vor der Größe und will darum alles immer klein haben. Je kleiner desto besser.“ Sturzrieger lehnte sich wieder zurück und musste leicht lächeln. „Ist bei den Titten von den Frauen von denen ja dasselbe, genau wie bei ihren Schwänzen. Die Japsen könnten alle mit Mäusen ficken und die Mäuse würden sich beschweren, weil sie nichts spüren, hahahahaha.“
„Wir sind auch nicht besser im Umgang mit der Natur“, befand Wehrhaus lapidar.
„So? Wie meinst du das?“
„Ich meine“, sagte er etwas gedehnt, „dass es der Partei gelungen ist, dass wir Christchurch und die Bay-Gebiete behalten können. Governors Bay, Charteris Bay, das ganze Buchtengebiet bis rüber zur Birdling's Flat gehört der Partei.“
„Die wirklich mal die Namen ändern sollte“, mischte sich sein Kollege ein.
Wehrhaus wischte den Einwand beiseite. „Dass ist das geringste, was gerade getan wird. Die Umerziehung der Leute wird ein langwieriger Prozess werden. Aber egal. Jedenfalls gehört der Partei dieses schöne Gebiet, und was machen wir damit? Wir planieren es. Wir ebnen es ein. Wir machen es flach. Als ich hierhergekommen bin, da habe ich in Duvachelle am Ufer gesessen und mir gedacht, wie schön es hier doch ist und wie herrlich es erst sein wird, wenn die Partei alle Menschen hier umerzogen hat. Und dann ging der Streit mit den Japanern los. Dass die auch ihren Anteil von Neuseeland haben wollen, obwohl es ihnen eigentlich nicht zusteht.“
„Vergiss die Italiener nicht.“
Er winkte ab. „Die haben das Gebiet von Gisborne bis hin zu Hamilton bekommen. Denen gehört jetzt auch Auckland. Die sollen damit zufrieden sein. Jedenfalls haben wir Christchurch und das Buchtengebiet, und was machen wir damit? Wir zerstören es.“
„Sicher“, nickte Sturzrieger. „Aber doch nur, weil die Japsen uns die anderen Hafengebiete genommen haben. Darum müssen wir ja jetzt wettbewerbsfähig bleiben und aus dem Buchtengebiet einen einzigen großen Hafen machen, damit wir unsere Vormachtstellung nicht verlieren.“
„Aber dennoch zerstören wir dadurch die natürliche Schönheit der Insel.“
„Sicher, aber die Rohstoffe, die wir dabei gewinnen, machen das doch wieder gut.“ Er nahm seine Tasse und trank einen kleinen Schluck, bevor er auf seine Armbanduhr blickte. „Wir sollten uns auf den Weg machen.“
„Ich weiß“, sagte Wehrhaus und trank seine Tasse leer.
„Sicher. Weil du die Uhr im Kopf hast … Na ja, würde mich bei dir nicht wundern.“ Sie verließen das Restaurant und machten sich auf den Weg durch die Stadt, in der es von Soldaten nur so wimmelte.
Ein Trupp führte einen Mann und zwei Frauen mit sich. Als eine der Frauen nicht schnell genug lief, schlug ihr einer der Soldaten ins Gesicht, worauf der Mann etwas auf Englisch sagte und dafür ebenfalls einen harten Schlag kassierte. Die Soldaten machten den Gefangenen klar, dass sie sich nicht wehren sollten. Die andere Frau weinte stumme Tränen und sah zu Boden.
Die beiden Offiziere gingen an den Soldaten vorbei und grüßten militärisch, ohne wirklich auf das Geschehen zu achten. „Wie geht es eigentlich Maria?“, wollte Wehrhaus wissen.
„Ach, der geht es gut“, lächelte Sturzrieger.
„Hat sie dir wieder geschrieben?“
„Ja, ja, das hat sie, ja.“
„Das hast du mir gar nicht gesagt.“
„Ach, was soll ich da schon sagen. Das war ein privater Brief …“ Er lächelte lüsternd.
Wehrhaus verzog keine Miene, gab sich aber dennoch freundlich. „Wohl ziemlich versaut, was?“
„Hahahaha, was heißt da versaut, sie ist schließlich meine Verlobte. Da kann sie mir ja schon schreiben, was wir miteinander machen, wenn wir uns wiedersehen.“ Er lehnte sich etwas zu ihm rüber, ohne seine Schritte zu verlangsamen. „Ich sage dir, wenn die Briefe nicht kontrolliert würden, dann hätte sie mir schon längst ein neues Bild von ihrem Fötzchen geschickt, aber das muss ja niemand außer mir und ihr sehen. Aber sie kann ja beschreiben, was sie dann mit meinem Schwanz so anstellt. Da kann der Kerl von der Kontrolle sich ruhig auch einen runterholen, solange er nicht auf den Brief spritzt, hahahahaha.“
„Weil du das ja machen willst.“
„Genau“, nickte er. „Zum Glück hat Maria mir vor meiner Abreise ja ein Bild von ihrem Fötzchen geschenkt.“
„Wirklich?“
„Ja. Hat sie wirklich. Ist schon eine klasse Frau. Und es ist wirklich ein nettes Fötzchen, das muss ich dir sagen. Ich meine, ich weiß vielleicht nicht mehr so ganz, wie sie komplett aussieht, aber ihr Fötzchen, das erkenne ich. Das sehe ich gerade jeden Abend, und dann …“ Er lachte und ging wieder normal neben ihm.
Wehrhaus nickte. „Da hast du ja gerade mehr Sex als wenn ihr beiden zusammen seid, was?“
Sturzrieger sah ihn flüchtig an und schüttelte sodann den Kopf. „Ach, das ist bei Frauen eben so. Die wollen nicht immer. Die sagen zwar, dass Männer diejenigen sind, die eine Ruhepause brauchen, aber eigentlich sind es die Frauen, die nicht immer können. Ein Mann kann eigentlich immer. Vielleicht nicht immer mit dem Penis, aber dann doch mit den Händen und so weiter. Wenn die Frau nicht Nein sagt, dann braucht man ja auch gar nicht von der runtergehen. Aber das wollen die eben nicht, also sagen die irgendwann, dass es zu viel wäre. Also sind es die Frauen, die eine Ruhepause brauchen. Aber wenn ich Maria wiedersehe, dann ist mir egal, was sie sagt. Dann nehme ich sie so ran, dass sie drei Monate nur noch kriechen kann, das sage ich dir. Dann haben sich die Trockenübungen wenigstens ausgezahlt, hahaha.“
„Du Schlingel“, sagte er kumpelhaft.
„Ja, wer muss, der muss, und wer kann, der kann, und wer nicht kann, der muss, und wenn er nicht muss, dann kann er mich mal am Arsch lecken.“ Er lachte auf und verstummte beinahe abrupt, als er auf der anderen Straßenseite einen Japaner gehen sah. „Nun guck dir das an.“
„Was?“
„Den Japsen. Das hier ist deutsches Gebiet. Eigentum des Reichs. Der soll gefälligst in den Japsen-Teil von Neuseeland rein.“ Er flüsterte. „Ist bestimmt ein Spion.“
Wehrhaus blickte aus den Augenwinkeln rüber. „Glaube ich nicht.“
„Nicht? Denkst du etwa, dass das ein Reisender ist? Warum sollte der hierherkommen?“ Ohne auf eine Antwort zu warten, rief er zum Passanten: „Hey! Du da! Stehenbleiben!“ Er ging zu ihm rüber.
„Muss das jetzt sein?“, wollte Wehrhaus wissen. „Wir wollten zurück und für heute fertig werden.“
„Die sollen warten“, meinte er und ging auf den Japaner zu. „Du da. Was machst du hier? Hä? Was machst du hier?“
„Excuse me, I'm …“, fing der Mann an, aber Sturzrieger brüllte dazwischen.
„Deutsch, Arschloch! Rede Deutsch! Das hier ist deutsches Gebiet! Hier redet man Deutsch!“
Der Mann blickte verwirrt um sich. „Please, I just wanted to …“
„Deutsch!“, Sturzrieger sah ihn böse an.
Wehrhaus schaltete sich dazwischen. „Do you speak German?“
„A little …“
„Well, than use it.“
Der Mann schluckte nervös. „Ich … einkaufen … muuusssen.“
„Einkaufen? Will der uns verscheißern? Zeig mal deinen Ausweis.“ Da der Japaner nicht reagierte, brüllte Sturzrieger ihn an. „Papers! Papers!“
„Yes, yes, papers, I have papers, yes …“ Der Mann griff in seine Jackentasche und holte ein Etui hervor, das ihm der Offizier entriss. „Please, I have to …“
„Halt's Maul.“ Er öffnete es und warf einen Blick auf den Ausweis, der den Mann als Einwohner von Christchurch identifizierte. Zusätzlich befand sich im Etui noch ein Bild von dem Mann, wie er fröhlich lächelnd zusammen mit einer nicht-asiatischen Frau am Strand stand.
Wehrhaus warf einen Blick auf den Ausweis. „Der ist hier geboren. Das ist kein Japaner.“
„Kein Japaner, wie?“ Sturzrieger behielt das Etui bei sich. „Der weiß aber schon, dass wir jetzt hier sind und dass er nicht mehr englisch sprechen darf, oder?“
„Soll ich ihn fragen?“
Ohne auf eine Antwort zu warten, zog der Offizier seine Pistole und hielt sie dem nun völlig verängstigten Mann vor die Brust. „Das hier ist deutsches Gebiet. Alle Neuseeländer, die sich hier befinden, sind nun Eigentum der Partei. Und die Partei hat es euch Untermenschen ganz klar verboten, dass ihr in eurer Untermenschensprache sprechen dürft. Hier hat jeder Deutsch zu reden, so wie jeder bei den Japanern japanisch und bei den Italienern italienisch zu sprechen hat. Also – ich frage dich jetzt, und du antwortest mir gefälligst auf Deutsch: Was hast du hier zu suchen?“
Der Mann schien nur die Hälfte des Gesagten bruchstückhaft verstanden zu haben. Er sah hilfesuchend zu Wehrhaus, der keinerlei Anstalten machte, ihm irgendwie entgegen zu kommen. Schließlich kam es zögernd aus ihm heraus: „Ich … Ich muuusssen einkaufen … Frau krank … Ich muuussen gehen Doktor …“
„Frau?“ Er hielt ihm das Etui entgegen. „Die hier?“
„Yes“, er nickte.
Sturzrieger drückte ab. Die Kugel durchschlug das Herz des Mannes und tötete ihn auf der Stelle. Der Offizier steckte die Waffe ein und schüttelte den Kopf. „Ich hatte ihm doch gesagt, dass er auf Deutsch antworten soll. Ich habe es ihm gesagt.“
„Ja, hast du“, stimmte Wehrhaus zu. „Können wir dann?“
„Jetzt warte doch.“ Er untersuchte das Etui. „So ein dreckiger Untermensch. Aber seine Frau ist eigentlich ganz niedlich. Immerhin keine Japsen-Schlampe. Wusstest du, dass die Japsen-Frauen die Fotze schräg haben?“
„Kommt wohl darauf an, wie man sie sich hinlegt.“
„Hahahaha, stimmt, stimmt genau, hahahahaha.“ Er nahm das Bild aus dem Etui, riss die Hälfte mit der Frau ab, steckte die andere wieder zurück und warf es auf die Leiche. Er betrachtete das Foto einen Moment lang und ging weiter.
Wehrhaus begleitete ihn. „Willst du Maria etwa mit der Frau von dem betrügen?“
„Quatsch doch keinen Stuss“, meinte er sofort. „Hast doch gehört, was der Reisfresser gesagt hat. Die ist krank, und wenn er nichts für sie einkauft, dann stirbt sie doch aller Wahrscheinlichkeit nach, und mit dem Bild von einer Toten ist es kein Betrügen. Oder ist es etwa betrügen, wenn ich mir zu den Bildern von einer toten Schauspielerin einen runterhole?“
„Das wohl weniger …“
„Na also.“
„... aber er war kein Reisfresser. Er war Neuseeländer“, meinte Wehrhaus matt.
„Was auch immer“, winkte sein Kollege ab. „Wenn er es bis jetzt noch nicht begriffen hatte, dass er sich im deutschen Gebiet aufhält und darum auch nur noch deutsch zu sprechen hat, dann hätte er es sowieso niemals begriffen, also wäre er sowieso früher oder später bei uns gelandet.“
„Stimmt auch wieder.“
Sie gingen in ein großes Gebäude, welches zur Zentrale der Deutsch-Neuseeländischen Staatspolizei umgebaut wurde. Die Arbeiten waren zwar bereits größtenteils erledigt, aber dennoch befanden sich im weiträumigen Eingangsbereich mehrere Paletten mit Hakenkreuzemblemen, die noch angebracht werden mussten, um die dauerhafte Anwesenheit der Partei für absolut jeden zu verdeutlichen. Sturzrieger und sein Kollege gingen zu den Fahrstühlen, wobei Wehrhaus für einen Moment zögerte, in die Kabine zu gehen, weshalb Sturzrieger ihn am Arm griff und reinzog. „Komm. Das hatten wir doch schon alles. Du bist doch darüber hinweg.“
„Ja, sicher, schon …“ Er atmete einige Male tief ein und stellte sich ein wenig verschränkt hinein, wobei er immer wieder die Augen öffnete und schloss. „Es ist eben nur, das …“
„Ich weiß, ich weiß“, sagte sein Arbeitsfreund aufmunternd. „Du hast es mir schon oft genug gesagt, und ja, ich hätte wahrscheinlich auch einen Riesen Bammel, jemals wieder in einen Fahrstuhl zu gehen. Aber nur weil das einmal passiert ist, muss das ja nicht wieder passieren. Ich bin doch dabei. Ist doch jetzt alles vollkommen anders, nicht wahr?“
„Mmh-mmh.“ Er biss sich auf die Unterlippe, während die Türen zuglitten und den Raum noch enger machten. Eine Flucht war nun unmöglich.
„Du musst stark sein. Das weißt du doch. Ich meine, nimm's mir nicht übel, aber es ist schon ein verdammter Scheißwitz, dass ausgerechnet du Angst vor Fahrstühlen hast.“
„Können wir bitte das Thema wechseln?“
Er schwieg kurz. „Du musst darüber hinwegkommen. Irgendwann wirst du dich auch wieder allein in einem Fahrstuhl befinden, oder mit Unbekannten, und dann …“
„Rede bitte über etwas Anderess“, stieß Wehrhaus aus.
„Gut, meinetwegen. Wir sind ja gleich da.“ Er überlegte. „Also, ich sage dir jetzt bestimmt nicht, wie das Fötzchen von meiner Maria aussieht. Ich mag dich zwar, aber so sehr, dass ich dir ihr Loch beschreibe auch wieder nicht.“
„Klar“, er lächelte leicht, „aber rede weiter.“ Er schloss die Augen und ließ sie geschlossen, was jedoch mit sich brachte, dass sich seine Ohren ungewollt auf das Geräusch des Fahrstuhls konzentrierten, was ihn noch mehr in Unsicherheit versetzte. „Bitte.“
„Naja, was soll ich dir schon sagen? Ich muss wohl mal ein Witzebuch mitnehmen, dann hätte ich etwas, womit ich dich unterhalten kann.“ Er sah zu Wehrhaus und griff ihn fürsorglich am Arm. „Hast es gleich geschafft. Nur noch drei Stockwerke.“
„Gut … gut … Danke …“
„Kein Problem. Aber reiß dich zusammen. Muss ja nicht jeder wissen, und wenn die anderen sehen, dass du schweißgebadet aus dem Fahrstuhl kommst, dann denken die sich noch was dabei.“
Wehrhaus lachte leicht, aber es war ein erzwungenes, nervöses Lachen. Schließlich öffneten sich die Türen, woraufhin er heraussprang und tief Luft holte. „Danke … Danke … Ich weiß, es ist bescheuert, und ich komme mir selber ganz blöd vor, aber …“
„Kein Thema“, nickte Sturzrieger und deutete den langen Gang runter, woraufhin sich beide langsam in Bewegung setzten. „Du musst aber dagegen unbedingt ankämpfen. Dich von der Angst befreien. Das ist deine einzige Angst, und ich sage dir ja, dass ich es verstehe. Niemand will so was durchmachen wie du, das kannst du mir glauben, aber …“ Er schwieg, da eine der vielen Türen im Gang aufging und ein Mann herauskam. „Clemens. Wie geht’s?“, begrüßte er ihn freundlich.
Der hagere Offizier kam ihnen entgegen. „Die verfluchten Maoris.“ Er schüttelte den Kopf und wischte sich einmal mit der Hand übers Gesicht. „Die sind stur wie ein Bock, das kann ich euch sagen. Seid bloß froh, wenn ihr keinen von denen bei euch habt.“
„Wieso denn?“
„Na, da sage ich doch gerade. Stur wie ein Bock. Denen kann man zehnmal sagen, dass sie deutsch sprechen sollen, und denen ist das egal. Also läuft es immer auf das gleiche heraus. Ich sage euch, am besten rottet man die alle einfach aus. Die kann man gar nicht umerziehen.“ Clemens schüttelte den Kopf. „Die sind so tief in ihrem Untermenschendasein verwurzelt, dass man die nur ausrotten kann, aber eine Veredlung zu einem wenigstens halbwegs anständigen Menschen ist meiner Meinung nach ausgeschlossen. Da sind Nigger ja als Arbeitstiere geeigneter als diese sturen Böcke.“ Er sah zu Wehrhaus und stutzte. „Was ist denn mit dir los? Du bist ja weiß wie nochmal was.“
„Falschen Fisch gegessen“, sagte er schnell.
„Oh. Scheiße. Ach, einfach rauskotzen. Das hilft meistens. Auf keinen Fall drin lassen, sonst droht noch eine Lebensmittelvergiftung. Aber so ist das hier eben in diesem Land. Schönes Land, wirklich, aber die Leute sind einfach nur Abschaum.“ Clemens schüttelte erneut seinen Kopf und ging zum Fahrstuhl. „Egal, ich muss zum Boss. Man sieht sich.“
Als der Kollege verschwunden war, sprach Sturzrieger weiter. „Einen Maori hatte ich neulich auch bei mir. Der war aber nicht sonderlich hart im Nehmen, das kann ich dir sagen.“ Er blickte Wehrhaus nachdenklich an. „Du bist wirklich weiß. Kämpf dagegen an. Wenn du nämlich mal mit den Parteioberen zusammen bist und die mit dir Fahrstuhlfahren, dann wäre es nicht so gut, wenn du denen die Schuhe vollkotzt.“
Er lächelte. „Die Parteioberen wollen von mir nichts wissen.“
„Ach was. Du bist gut, und wäre die blöde Sache nicht passiert, dann wärst du schon längst in Berlin und an der Spitze, das kannst du mir glauben. Das hier“, er zeigte um sich, „diese Umerziehungsarbeit, das kann man doch dem Laufpersonal überlassen. Aber du, du bist jemand, der dafür sorgt, dass das Laufpersonal nicht so viel Arbeit hat. Du bist gut in der Planung, und das werden die auch wiedererkennen. Glaub mir. Aber bis dahin musst du eben wie ich hier arbeiten. Das ist eben so.“
„Ich beschwere mich nicht über die Arbeit … nur über den Fahrstuhl“, meinte Wehrhaus. „Egal. Dann wollen wir mal. Mal gucken, wer früher fertig ist.“
„Egal wer es ist, er wartet auf den anderen. Nicht vergessen – du schuldest mir noch ein Bier von gestern.“
„Aber auch nur, weil du geschummelt hast. Der Pfeil war auf der Kante.“
Sturzrieger nickte. „Ja klar, ist schon recht.“ Er ging zu seiner Tür. „Bis nachher.“ Er öffnete sie und verschwand dahinter.
„Bis nachher.“ Wehrhaus begab sich zu seiner Tür, trat ein und zog in dem dahinter befindlichen medizinisch-kühl anmutenden Raum seine Uniform aus, bekleidete sich anschließend mit einem chirurgisch erscheinenden Kittel, bevor er zum Waschbecken ging und seine Augen überprüfte. Er spritzte sich etwas kaltes Wasser ins Gesicht, setzte eine Mundschutzmaske auf, begab sich zu einer stabilen Eisentür und zog seine Gummihandschuhe an, die auf einem Rollwagen lagen, der neben der Tür stand und mit allerlei medizinischen Gegenständen überfrachtet war. Mit einer zackigen Bewegung öffnete er die Verriegelungen an der Eisentür, ließ die Klinke fest herunter sausen und schob den Wagen in das dahinterliegende Verhörzimmer. Seine zuvor durch den Fahrstuhl hervorgerufene Unsicherheit war komplett verschwunden – hier war er ganz Profi und absoluter Herr über alles, was geschah.
Die an den Stuhl gefesselte Frau, die sich in dem Raum befand, blickte ihn aus starr geweiteten Augen ängstlich an. An ihrem Kopf befand sich eine stählerne Apparatur, die mittels Schraubzwingen einen großen Druck auf ihre Schläfen ausübte. In ihrem Mund war ein mit Lederriemen festgezurrtes ball-ähnliches Gummiteil, dass ein Loch in der Mitte aufwies und insgesamt dazu diente, dass sie nicht erstickte und sich auch nicht die Zunge abbeißen konnte. An ihren blutigen Händen waren tiefe Schnitte sowie Quetschungen zu erkennen. Die Frau trug nur eine dreckige Unterhose sowie ein graues, aus einem sperrigen Stoff gefertigtes Gefangenenhemd. Sie atmete hektisch und absolut ängstlich, als sie sah, dass der Rollwagen neben sie gestellt wurde.
„So. Dann wollen wir mal weitermachen. Oder haben Sie sich dazu entschlossen, zu reden? Sie wissen, dass Sie sich eine Menge Schmerzen ersparen können, wenn Sie mir sagen, was ich wissen will.“ Er wartete einen Augenblick, bevor er sich dem Rollwagen zuwandte. „Nun gut, Ihre Entscheidung.“ Er nahm ein stumpf glänzendes Gerät an sich, das ähnlich wie eine Schere aussah, jedoch über gezackte Enden verfügte. Er öffnete das Gerät einige Male, um zu zeigen, wie weit es auseinanderging. „Sie können sich sicher denken, wo ich das bei Ihnen einführen werde, wenn Sie sich weiterhin weigern.“ Er hielt ihr das Gerät dicht vors Gesicht. „Die Zacken sind sehr scharf. Das Gerät wird eingeführt und auseinandergeweitet. Das verursacht große Schmerzen und wird auch in Zukunft dafür sorgen, dass sie weiterhin Schmerzen empfinden.“ Er wartete einen Moment, bevor er ihr mit der anderen Hand an die Unterhose griff und diese wegriss. „Wie Sie wollen.“ Er senkte die Hand mit dem Gerät, als die Frau einige gepresste Töne von sich gab. Er stoppte. „Wollen Sie reden?“ Sie nickte einige Male, weshalb er das Gerät wieder auf den Rollwagen zurücklegte und ihr den Gummiknebel aus dem Mund nahm. „Reden Sie. Wie viele ihrer Leute gibt es? Und wo halten sie sich auf?“
Sie japste ein wenig. „I can't tell you how many …“
„Deutsch“, sagte er in einem Tonfall, der deutlich machte, dass er ihr ansonsten nicht zuhören würde.
Sie atmete durch. „Ich … können nicht sagen, wie viele Leuten wir sind. Ich nicht wissen. Wir viele. Wir Neuseeland. Wir nicht wollen das Nazi hier sind.“
„Wir haben ihr Land erobert. Sie sollten froh darüber sein, dass wir jetzt hier sind und Ihnen unsere Kultur vermitteln. Wenn Sie Pech gehabt hätten, dann wären Sie jetzt im japanischen Gebiet, oder bei den Italienern, oder Sie wären immer noch ohne eine der drei großen Kultureinflüsse. Sie sollten uns also nicht bekämpfen, sondern uns unterstützen. Was wir tun, hilft schließlich dabei, dass ihre Untermenschenrasse veredelt wird.“
Sie zitterte. „Wir das nicht wollen. Wir …“ Sie musste überlegen. „Wir brauchen sie nicht. Wir wollen sie nicht. Wir bekämpfen sie.“
„So. Sie und wie viele noch?“ Da sie nichts sagte, nahm Wehrhaus das Gerät wieder an sich. „Ich frage nicht noch einmal.“
„Ich das nicht wissen. Keiner in Neuseeland mögen euch. Alle gegen euch. Wir immer kämpfen. Ihr nie wissen wann, aber wir immer gegen euch und kämpfen.“
Er steckte ihr das Gerät unsanft in die Vagina, woraufhin die Frau schmerzhaft aufschrie. „Sie hatten ihre Möglichkeit, das zu verhindern.“ Er drehte das Gerät nach links, dann nach rechts. Blut floss aus ihr raus und über seine Hand. „Sie können mir immer noch sagen, wo sich die Verstecke befinden.“
„Ich … nicht wissen … überall … Überall in Neuseeland … Wir alle gegen euch“, stieß sie aus und rüttelte mit ihren Armen und Beinen, die sich aber aufgrund der Fesseln um keinen Zentimeter bewegten.
Wehrhaus steckte ihr geradezu gelangweilt wieder den Gummiball in den Mund. Da sie sich wehrte, drückte er ihn brachial rein, wodurch einige Zähne nach hinten gebogen wurden. „Sie hatten Ihre Wahl. Wer sich gegen die Partei stellt, wird bestraft.“ Er dehnte die Schere, wodurch sich die Zacken in die Vagina trieben. Die Frau gab Schmerzenslaute von sich, die aufgrund des Gummiballs sehr seltsam klangen.
Wehrhaus wollte das Gerät wieder zurückdehnen, als plötzlich die Tür einen Spalt weit geöffnet wurde. Er drehte sich um und sah Clemens, der ihn zu sich winkte.
„Komm. Ist wichtig.“
Wehrhaus ließ das Gerät durch eine kleine Vorrichtung auf diesen Dehnungsgrad eingerastet in der Vagina der Frau stecken, während Blut heraussprudelte und auf seine Handschuhe spritzte. Er drehte sich um, verließ den Raum und schloss die Tür. „Was ist denn los? Du siehst doch, dass ich gerade arbeite.“
„Ja doch. Weiß ich doch auch. Aber Aurich hat nach dir verlangt.“
„Aurich?“, wunderte er sich. „Wieso denn?“
„Keine Ahnung“, sagte Clemens ehrlich, „aber wenn der Boss was von einem will, dann sollte man auch zu ihm kommen. Ich war ja gerade bei ihm, und da hat er mir gesagt, dass du sofort zu ihm hoch sollst. Wäre wichtig.“
„Mmh. Weißt du, worum es geht?“
„Nein. Geht mich ja auch nichts an. Ich bin ja nur zu ihm, weil dieser Maori bei mir stur wie ein verdammter Bock ist und ich darum ein paar Chemikalien haben will, damit ich den brechen kann. Aber die muss man sich ja erst genehmigen lassen, und das nur, weil dem dummen Höchst damit mal ein Unfall passiert ist.“
Wehrhaus nickte. „Ja, daran kann ich mich erinnern, aber da ist er selber schuld. Der hat den Gefangenen nicht richtig festgebunden.“ Er begann damit, seine dreckigen Handschuhe auszuziehen und seine Uniform anzulegen.
„Ja, und da darf er sich ja nicht wundern, wenn der Kerl ihm in die Eier tritt und er dann selber mit dem Gesicht voran in den Säurebottich fällt. Aber deswegen braucht man den Einsatz von Chemikalien doch nicht gleich für alle anderen unter Antragspflicht stellen.“ Clemens schüttelte genervt den Kopf. „Das verzögert doch alles nur. Ich sage dir, ein Tropfen Schwefelsäure, und schon weiß der Gefangene, dass er zu reden hat. Das muss noch nicht mal auf den Eiern, der Schwanzspitze oder im Auge sein, da reicht auch der Daumennagel. Das geht viel schneller als mit der jetzigen Methode. Jetzt denken die doch, dass sie sich noch irgendwie geistig über den Schmerz stellen können, aber wenn die von vornherein wissen, was man mit denen anstellen wird und wie schmerzhaft ein einziger Tropfen von dem Zeug ist, dann reden die sofort. Da muss man denen nur noch sagen, dass man denen noch einen Tropfen auf die Schwanzspitze oder die Fotzlippen gibt, und schon reden die ohne Unterbrechung. Die sagen dann alles, das kannst du mir glauben. Viel einfacher und schneller als die jetzige Methode.“
„Ja. Da gebe ich dir recht.“ Er strich seine Uniform mit den Händen glatt. „Danke, dass du mich gleich informiert hast.“
„Musste ich ja“, zuckte er mit der Schulter. „Aber wenn du bitte auch bei Aurich ein Wort einlegen könntest, dann wäre das sehr nett von dir. Ehrlich. Ich wäre viel effizienter und könnte mehr Parteiarbeit leisten, wenn ich wieder meine Chemikalien hätte.“
„Ich guck, ob ich es erwähnen kann.“ Sie verließen gemeinsam das Zimmer und gingen in den Flur.
„Danke. Ich weiß doch, dass du nicht gerne hier bist. Aber trotzdem bist du einer von uns. Und du bist der beste. Das sage ich immer wieder“, schleimte Clemens und ging zu seiner Tür. „Ich weiß, auf dich kann man sich verlassen.“
„Kein Problem.“ Wehrhaus sah, wie Clemens hinter der Tür verschwand, bevor er zum Fahrstuhl ging. Für einen Moment überlegte er, dass er viel lieber die Treppen hochgehen würde, aber da man den hiesigen Staatspolizeileiter besser nicht warten ließ, musste er wohl oder übel doch wieder in die enge Kabine zurück. Er ballte seine Fäuste und fuhr mit dem Fahrstuhl hoch, wobei er sich innerlich immer wieder zur Ordnung rief. Als sich die Türen endlich wieder öffneten, kam er dennoch mit Schweiß auf der Stirn heraus. Er wischte sich mit der Hand drüber und ging zum Büro, wo er sich bei der Sekretärin anmeldete, die ihn sogleich rein ließ.
Ober-Offizier Aurich, ein glatzköpfiger, dicker Mann mit einer viel zu straff sitzenden Uniform, saß hinter seinem massiven Schreibtisch und las gerade in einigen zusammengehefteten Papieren, die er sofort weglegte. „Ah, Wehrhaus. Sehr gut.“
„Sie wollten mich sprechen?“ Er kam näher, nahm aber erst Platz, als der Vorgesetzte ihm durch eine Handbewegung dazu einlud.
„Ja. Es geht darum, dass Sie anscheinend ein Glückskind sind.“
„Ich verstehe nicht.“
„Dachte ich mir.“ Aurich nahm die Papiere wieder an sich. „Anscheinend hat man in Berlin ein ziemliches Nachsehen mit Ihnen, oder aber Ihre Fähigkeiten werden so geschätzt, dass man jetzt nicht anders kann, als Sie zu rekrutieren.“ Er reichte die Papiere rüber. „Der Befehl, dass Sie sich so schnell wie möglich in der Parteizentrale in Berlin einzufinden haben.“
„In Berlin?“ Er nahm die Papiere und las sie schnell durch.
„Freuen Sie sich. Das bedeutet garantiert eine Verbesserung Ihrer Möglichkeiten. Hier wird es Ihnen ja sowieso nicht gefallen haben, oder?“
„Ich kann mich nicht beschweren.“
„Ach, kommen Sie. Ein Mann von Ihren Talenten, und dann werden Sie wegen so einer dummen Sache dazu abbeordert, in einem Untermenschenland Aufbauarbeit zu leisten? Das muss Ihnen doch übel aufstoßen. Geht doch gar nicht anders.“ Aurich nickte. „Es weiß jeder hier, dass Sie eigentlich kein Mann für grobe körperliche Arbeiten sind, sondern besser in strategischen Angelegenheiten eingesetzt werden sollten. Sie können zwar durchaus zupacken, und Ihre Arbeitsquote in Bezug auf diese Untermenschen ist ebenfalls sehr gut, aber wenn man sich Ihren bisherigen Lebenslauf so ansieht, dann sollten Sie wirklich nicht klein-klein, sondern groß-groß arbeiten. Sie verstehen?“
Wehrhaus legte die Papiere zurück auf den Schreibtisch. „Ich denke schon. Aber wie gesagt, ich beschwere mich nicht, dass ich hier bin. Es ist ein schönes Land mit etlichen Möglichkeiten und natürlichen Schätzen, und wenn die Partei es erst einmal vollbracht hat, diese Untermenschen zu zivilisieren, dann wird es ein absolutes Paradies werden.“
Aurich lachte auf. „Ja, wenn wir es für uns selber hätten, aber das ist ja egal. Sie jedenfalls werden wieder das tun, was Sie am besten können. Hier sind Sie soweit fertig. Gehen Sie also nach Hause und bereiten Sie alles vor. Ihr privates Flugzeug nach Berlin fliegt heute Abend.“
„Heute Abend schon?“
„Ja doch. Anweisung von den Parteioberen …“ Er zögerte. „Und genau darum denke ich, dass etwas sehr Schlimmes vorgefallen sein muss, wenn man Sie nicht nur wieder zurückbeordert, sondern auch noch so einen Zeitdruck macht. Aber worum es genau geht, weiß ich leider auch nicht. Ich habe alle Hände damit zu tun, aus diesem Land einen neuen Teil des Reiches zu machen, da habe ich keine Zeit dafür, auch noch nachzugucken, was in der Heimat geschieht. Aber wenn man Sie sofort zurückbeordert …“ Er sprach nicht weiter.
Wehrhaus wusste, dass es keinen Sinn hatte zu protestieren. Selbst kleine Einwände wären vergeblich gewesen, da es sich um eine Anordnung der Parteizentrale handelte und Aurich deswegen gar nichts dagegen unternehmen könnte. „Ja, es wird wohl schon seine Richtigkeit haben. Die Partei macht schließlich keine Fehler“, sagte er matt.
„Stimmt. Aber freuen Sie sich doch. Sie sind wieder obenauf.“ Er reichte ihm die Hand, die Wehrhaus auch schüttelte. „Behalten Sie uns in guter Erinnerung, ja?“
„Natürlich. Wenn ich meine Arbeit für die Parteizentrale erledigt habe, werde ich fragen, ob ich nicht doch wieder hierher zurückkommen darf.“
„Gefällt es Ihnen denn so sehr bei uns?“
„Wie gesagt, es ist ein sehr schönes Land.“ Er machte den Parteigruß und verließ das Büro. In seinem Kopf zischten unzählige Gedanken hin und her, da er zum einen dankbar sein sollte, dass man ihm seinen Fehler bereits vergeben hatte, aber zum anderen auch überlegte, ob er nicht etwas tun könnte, damit er von vornherein hierblieb. Aber es half nichts. Es war ein Parteibefehl, also musste er ihm Folge leisten.
Die Fahrstuhlfahrt nach unten war ein erneuter Angriff auf seine Nerven. Unten angekommen begab er sich zur Tür von Sturzrieger, der gerade im Vorraum seiner Arbeitsstätte stand und blutige Handschuhe auszog. „Jetzt sag mir nicht, dass du schon fertig bist“, meinte dieser beim Anblick seines Kollegen.
Wehrhaus schüttelte den Kopf. „Nein. Bin ich nicht. Oder doch, ja.“
„Aha. Und das heißt?“
„Dass es heute Abend nichts wird. Ich bin nach Berlin zurückbeordert worden.“
Sein Freund sah ihn verblüfft an. „Wie jetzt?“
„Clemens war vorhin bei mir und hat gesagt, dass Aurich mich sehen will. Ich bin also zu ihm hin und …“
„Gelaufen?“
„Nein. Fahrstuhl.“
Sturzrieger zog die neuen Handschuhe an und ging zu ihm. „Wirklich? Ganz allein?“ Er klopfte ihm auf die Schulter. „Siehst du, es geht doch. Du kannst es.“
„Ja schon, aber …“
„Klar, gefallen tut es dir nicht, aber es geht. Langsam wird es wieder gehen, ganz sicher.“
Wehrhaus nickte. „Ja, jedenfalls war ich bei Aurich, und der hat mir den offiziellen Befehl gezeigt, dass ich noch heute Abend mit einem Privatflugzeug nach Berlin und dann in die Parteizentrale soll.“
„Parteizentrale? Das ist doch gut. Sehr gut sogar. Das bedeutet doch, dass sie dir den kleinen Fehler verziehen haben.“
Er schüttelte den Kopf. „Oder, wie Aurich vermutet, dass etwas vorgefallen ist, weshalb man mich jetzt zurückbeordert.“
„Klar, weil du der Beste bist.“
„Ach was. Wohl eher, weil ich entbehrlich bin.“
Sturzrieger zog eine Schnute. „Sei doch nicht immer so negativ zu dir selber. Wenn die dich zu sich rufen, dann wird das schon einen Sinn haben. Auf jeden Fall bedeutet es, dass du eine zweite Möglichkeit hast dich zu beweisen. Dann musst du ja auch nicht länger hier sein.“
„Ich habe nichts dagegen, hier zu sein. Mir gefällt Neuseeland.“
„Klar doch, mir ja auch. Aber du kannst ja immer wieder zurück. Du gehst nach Berlin und machst da, was die Partei sagt, und wenn du wieder hierher zurückkommst, dann haben wir, also ich, Clemens und all die anderen, wir haben dann die Insel bereits von den Untermenschen bereinigt und alles zivilisiert gemacht. Du wirst sehen, das wird richtig toll.“ Er klopfte ihm freundschaftlich auf die Schulter. „Du, weißt du was? Warte ungefähr zwanzig Minuten auf mich, dann kann ich mitkommen. Dann feiern wir in deiner Wohnung noch schnell.“
„Ach, das geht doch nicht. Ich …“
„Doch, doch, das geht“, nickte Sturzrieger. „Ich mache den bei mir noch schnell gesprächig. Wird zwar nicht schön, wenn es so schnell geht, aber das ist ja egal. Hauptsache, wir konnten noch ein bisschen feiern, ja?“
Wehrhaus nickte. „Ja. In Ordnung. Du bist ein guter, ein echter Freund.“
„Oh, jetzt werde ich aber rot.“ Er setzte seine Chirurgenmaske auf. „Ich komm dann in zwanzig Minuten zu dir. Ach was, den schaffe ich in zehn, vielleicht sogar in fünf Minuten, dann haben wir mehr Zeit.“ Er verschwand hinter der schweren Eisentür.
Wehrhaus verließ den Raum, ging zurück zu seiner Tür und zog in dem Zimmer dahinter seine Uniform nicht aus, sondern legte den Ärztekittel einfach darüber. Ohne eine Maske aufzusetzen oder Handschuhe anzuziehen, ging er durch die schwere Eisentür, schloss sie und blickte die Frau für einige Momente lang mit einem dumpfen, leeren Blick an. Die Frau hatte zwischen ihren Beinen einiges an Blut verloren, und ihr angespanntes Gesicht war von Tränen feucht. Der Offizier ging zu ihr. „Sie sehen, dass ich keine Maske mehr trage. Das bedeutet, dass es mir egal ist, was Sie zu sagen haben. Solange ich eine Maske trage, bedeutet das, dass Sie noch hier herauskommen können. Ich trage keine Maske mehr. Sie verstehen, was ich damit sage.“
Die Frau starrte ihn an und gab einige entkräftete Laute von sich.
Er ignorierte ihren Versuch sich mitzuteilen und griff das Gerät, das sich in der Vagina befand. „Es ist seltsam. Wirklich. Auf der einen Seite sollte es mich freuen, dass ich wieder das Vertrauen der Partei genieße, aber auf der anderen Seite hat es mich gefreut, dass ich ohne größeren Erwartungsdruck arbeiten konnte. Verstehen Sie das? Hier muss ich nur eine kleine Quote erfüllen, aber bei meiner anderen Arbeit …“ Er sah in ihren Augen, dass sie nicht verstand, wovon er sprach. „Stimmt ja … Das hat nichts mit Ihnen zu tun.“ Er drehte das Gerät nach links. Die Zacken bohrten sich tiefer in das weiche Fleisch und rissen es auf. Die Frau versuchte aufzubrüllen, aber der Gummiball dämpfte ihre Schreie. „Nichts hat etwas mit Ihnen zu tun. Gar nichts.“ Er riss das scherenartige Teil aus ihrer Vagina, woraufhin erneut ein Schwall Blut hervorspritzte, welcher ihn beinahe erwischt hätte, aber er konnte gerade noch schnell genug ausweichen. Die Frau atmete spastisch und sackte sodann in sich zusammen.
Wehrhaus blickte geradezu gelangweilt auf sie, dann auf die Zackenschere, an der sich rohe Fleischklumpen nass-glänzend befanden. Er legte das Gerät auf den Rollwagen, verließ den Raum, schloss die Tür, zog den Kittel aus und wartete, dass sein Kollege zu ihm kam.
Gemeinsam könnten sie, während er seine Sachen packte, vielleicht noch ein oder zwei Bier trinken, bevor das Flugzeug abhob und ihn zurück in den unmittelbaren Einflussbereich der Partei zurückbrachte, wo der Erwartungsdruck größer war als hier und er sich keinen einzigen Fehler erlauben durfte. Es grenzte sowieso an ein Wunder, dass sie ihn nach der Sache mit dem Fahrstuhl nicht gleich standrechtlich erschossen hatten, aber wahrscheinlich dachte die Parteispitze, dass man ihn schonen sollte, falls sich doch einmal ein Vorfall ereignete, der sein Wissen benötigte.
Er atmete tief durch. Das ruhige, gemütliche Leben in Neuseeland war wohl wieder vorbei.
Wolfgang stand hinter der Kasse des „Friends of Dorothy“-Buchladens, welcher ihm zusammen mit seinem Mann Caleb gehörte und der mit Hilfe von Herrn Löffler ausstaffiert worden war. Das mittelgroße Geschäft verfügte über prall gefüllte Regale, auf denen die Bücher standen, die von der Partei verboten und durch das Schwulenhaus gerettet worden waren. Das Geschäft ging verhältnismäßig gut, auch wenn es natürlich durchaus auch besser hätte laufen können, aber weder Wolfgang noch sein Mann beschwerten sich. Sie waren glücklich.
Caleb sortierte einige Bücher ein, als ihm auf dem Regal ein schwarzes Buch auffiel. Er nahm es zur Hand, betrachtete es skeptisch und ging mit dem Exemplar zu Wolfgang. „Guck mal – das ist nicht von uns.“
„Was meinst du?“ Er nahm es an sich und blickte auf das schlecht gearbeitete Buch, welches wohl eindeutig in Privatdruck entstanden sein musste.
„So was führen wir doch nicht.“
Er las den Titel vor. „'Proud Canada' von Howard Sheen.“ Er blätterte es einmal schnell durch. „Das sagt mir auch nichts.“
Caleb nickte. „Das hat nicht einmal einen Preisaufdruck.“
„Stimmt … meinst du, dass das jemand einfach so ins Regal gestellt hat?“
„Möglich, aber warum sollte man das tun? Da verdienen die doch nichts daran.“
Wolfgang zuckte mit der Schulter. „Stimmt auch wieder. Komisch. Naja, egal.“ Er nahm das Buch und legte es unter den Tresen, bevor er sich umsah. Lediglich zwei Kunden befanden sich im Geschäft, die die Regale absuchten, jedoch eindeutig nicht wussten, was für Bücher sie da gerade eigentlich betrachteten. „Kann ich Ihnen helfen? Can I help you?“
Einer der Kunden ignorierte ihn, wohingegen der andere etwas sagte. „As a matter of fact, yes. I'm looking for the works of Dan Gerrocks.“
„Sorry, we don't have him. We have books in German and translations of German books“, erwiderte er freundlich.
Caleb, der mittlerweile auch einiges an Englisch aufgeschnappt hatte, um zu verstehen, dass sein Freund gerade sagte, dass sie deutsche Bücher und deren Übersetzungen führten, ging zu dem Mann und zeigte auf die Regale. „German. English.“
„Thanks, but I was looking for Gerrocks. Too bad.“ Der Mann verließ das Geschäft, und auch der andere Kunde ging nach einiger Zeit.
Caleb zuckte mit der Schulter. „Wenigstens zwei Bücher haben wir verkauft. Ist ja auch nicht schlecht.“
„Klar“, lächelte Wolfgang, „aber auf eigenen Füßen stehen wir damit noch lange nicht. Und wir möchten ja auch nicht ewig bei Herr Löffler in der Schuld stehen, oder?“
„Das tut er doch wohl auch ein bisschen bei uns, meinst du nicht?“ Er ging zu ihm und küsste ihn auf die gut verheilte Halsnarbe, bevor er ihm einen weiteren Kuss auf die Lippen gab. „Was meinst du? Sollen wir für heute schon schließen? Kommt bestimmt keiner mehr.“
„Mmh … ja, in Ordnung.“ Er gab ihm ebenfalls einen zärtlichen Kuss.
Caleb schloss die Ladentür. „Und Herr Löffler steht bei uns sowieso viel mehr in der Schuld als wir bei ihm. Immerhin gehen wir ja auch ein Risiko ein, weil wir ihm den Keller überlassen haben.“
„Das konnten wir ihm und seinem Mann ja wohl auch schlecht abschlagen. Immerhin haben sie uns hier mit dem Geschäft geholfen, und sie helfen uns auch weiterhin. Da kann man ja nicht sagen, dass man nichts mehr von ihnen wissen will.“ Er wollte noch etwas dazu sagen, aber er nahm stattdessen das seltsame Buch wieder an sich.
Der junge Schwarze deutete darauf. „Was meinst du?“
„Wegen Herrn Löffler oder dem Buch?“
„Dem Buch. Das mit Herrn Löffler ist mir schon klar. Ich meinte ja nur …“
„Schon klar.“ Wolfgang drehte das Buch in der Hand und öffnete es. „Keine Ahnung. Also von uns ist es bestimmt nicht. Und wenn das aus Versehen mitgeliefert worden sein sollte, dann hätten wir es beim Einsortieren doch bestimmt bemerkt.“ Er las einige Sätze. „Mmh … Englisch. Wo stand es denn?“
„Da vorne, das hast du doch gesehen.“
„Wo genau?“
Caleb ging zum Regal, und Wolfgang folgte ihm. „Da, genau zwischen Hasenclever und Hermann.“
„Auch noch falsch einsortiert“, lächelte er und sah sich um. „Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat.“
„Muss ja nichts zu bedeuten haben.“
„Schon, aber … ich meine, wer stellt denn einfach so ein Buch in einen Buchladen?“
Caleb zuckte mit der Schulter. „Vielleicht der Autor. Der will auf sein Buch aufmerksam machen.“
„Klar. Aber selbst, wenn das jemand sieht und kaufen will, dann hat erstens der Autor nichts daran verdient, und zweitens kann man es sowieso nicht verkaufen, weil ja kein Preis draufsteht.“ Wolfgang atmete einmal durch. „Am besten …“
„Mmh?“
„Am besten ich lese da mal rein. Nicht, dass das irgend so ein Schweinkram ist und jemand versucht, unserem Laden etwas anzuhängen, dass wir schlimme Bücher verkaufen oder so.“
Caleb nickte. „Klar, aber …“ Er fasste ihn zärtlich am linken Arm und streichelte ihn leicht. „Kannst du das nicht später machen?“
Er biss sich vorfreudig auf die Unterlippe. „Klar doch. Aber erst einmal müssen wir ja sowieso nachgucken, ob im Keller alles in Ordnung ist.“
„Mach du. Ich überprüfe hier oben nochmal alles, dann sind wir schneller fertig. Dann können wir auch viel schneller …“ Er brauchte nicht zu Ende zu reden, sein Augenausdruck sagte alles.
Wolfgang streckte die Zunge raus. „Wie habe ich ohne dich nur jemals leben können?“
„Weiß ich nicht. Ich jedenfalls habe ohne dich nicht gelebt.“ Sie küssten sich.
Während Caleb nochmals alles im Geschäft kontrollierte, ging Wolfgang mit dem seltsamen Buch in der Hand hinter die Theke und von dort durch die Verbindungstür in den Wohnraum des Gebäudes, wo sich ihre privaten Räume befanden. Es waren zwar nicht die größten Zimmer, aber immerhin hatten sie nicht nur eine eigene gemeinsame Wohnung, sondern sogar ein eigenes Haus. Vor allem waren sie sehr nahe bei ihrem Geschäft, weshalb es auch nichts ausmachte, wenn sie mal aufgrund von zu viel Bettenaktivität ein wenig zu lang schliefen.
Wolfgang legte das Buch auf den Wohnzimmertisch und begab sich sodann zur Kellertür, die mit drei Schlössern gesichert war. Er schloss sie auf, machte das Licht an und ging die steinernen Treppenstufen runter. Neben einigen leeren Buchkartons befanden sich mehrere miteinander verbundene Rechner, die an das Weltnetz der Nazis angeschlossen waren und als Speichereinheit fungierten. Nach den Ereignissen im Schwulenhaus hatte Herr Löffler sowohl Wolfgang als auch Caleb darin eingeweiht, dass sein Mann Oskar zusammen mit anderen den Datenverkehr der Partei überwachte, es jedoch aufgrund der gehäuften Angriffe auf das Haus angebracht wäre, Notfallstationen einzurichten. Als dann ein geeignetes Haus gefunden war, dass als Buchladen fungieren konnte, bedurfte es nicht wirklich einer Überzeugungsarbeit, damit Wolfgang und Caleb zustimmten, dass im Keller die Rechner aufgestellt und immer mal wieder von einem der anderen Mitarbeiter auf die Funktionstüchtigkeit überprüft wurden. Dennoch sah jeden Tag einer von beiden selber nach, ob auch alles in Ordnung war, auch wenn sie die Rechner an sich nicht berührten.
Er ging zu den sieben Rechnern, die auf einem Tisch standen und zwischen denen sich ein Monitor sowie eine Tastatur befand. Eine leichte Staubschicht hatte sich auf den Gehäusen abgelegt. Er überlegte, ob er sie wegwischen sollte oder nicht, aber da sie die Rechner nicht anfassen sollten, unterließ er es und überprüfte lediglich, ob der Strom weiter floss. Ein kurzer Blick auf das Blinken der Energielichter, die sich unten am Gehäuse befanden, gab Gewissheit darüber. Wolfgang sah zum angelehnten Kellerfenster und ging dann wieder die Treppen hoch, machte das Licht aus und schloss die Tür ab, bevor er ins Wohnzimmer ging und dort Caleb sah, wie er im Buch blätterte. „Und?“
„Im Laden ist alles in Ordnung“, sagte er und hielt ihm das Buch hin. „Dein Englisch ist besser als meines.“
„Ich lese nachher darin.“ Er nahm es und legte es beiseite, bevor er näher zu ihm kam, ihn verliebt anguckte und einen Kussmund machte. „Jetzt sollten wir aber trotzdem erst etwas essen, meinst du nicht auch?“
„Ich weiß nicht … mit vollen Magen …“ Caleb lächelte.
Wolfgang gab ihm einen Kuss und streichelte ihm über die Brust, bevor er seine Hände tiefer gleiten ließ. „Da hast du auch wieder Recht.“
Sein Mann umarmte ihn und schmiegte sich dicht an ihn. „Dann gehen wir aber ins Bett … auf dem Tisch möchte ich es nicht machen.“
„Das hat dich letztes Mal doch auch nicht gestört.“
„Schon, aber da warst du ziemlich zurückhaltend.“
Wolfgang stutzte. „Wie meinst du das?“
„Du hast mich zwar schon gut geliebt, aber als der Tisch geknarrt hat, da warst du dann ganz vorsichtig, so als wäre ich aus Glas und ein Stoß oder ein Lecken würde alles zerspringen lassen. Das war dann etwas …“ Er zuckte mit der Schulter. „Normalerweise bist du ein richtiger Wolf.“
Er gab ihm einen Kuss. „Gut, dann gehen wir ins Bett, und du zeigst mir, wie ich es hätte machen sollen. Ja? Ohne Zurückhalten.“
Caleb lächelte und schien etwas sagen zu wollen, aber Worte waren überflüssig, weshalb er ihn einfach umarmte, küsste und streichelte. Beide waren glücklich miteinander, und das war das größte Geschenk, dass sie haben konnten.
Jonsey trank in dem Gemischtwarenladen etwas aus seiner Wasserflasche, während der Besitzer Petersen einen anderen Kunden bediente. Nachdem der Kunde aus dem Laden gegangen war, blickte sich Petersen um und stellte sicher, dass sie alleine im Geschäft waren. „Wird es dir nicht langsam doch zu riskant?“, fragte er leise.
Jonsey schüttelte den Kopf. „Einmal die Woche geht es noch. Ich würde ja auch gerne öfters rüberkommen, aber das geht nicht.“
„Weil dein Freund nur einmal die Woche Dienst hat?“
„Genau.“
„Mmh.“
„Was?“
Der Besitzer zögerte. „Versteh mich nicht falsch, aber ich mache mir eben Sorgen.“
„Um mich?“
„Um wen denn sonst? Wenn du jede Woche am gleichen Tag hierherkommst, dann fällt das doch irgendwann auf. Ich meine, die haben hier ja sowieso wieder die Polizeipräsenz erhöht, aber gut, das hier ist eben die Grenzstadt nach Kanada. Da kommen ja viele hin. Aber wenn du einmal die Woche rüberkommst, dann …“ Er sprach nicht weiter.
Jonsey verstand. „Hast du Angst, dass jemand weiß, dass du die Kisten annimmst?“
Er schüttelte den Kopf. „Nein. Um mich habe ich keine Angst. Nimm's mir nicht krumm, aber wenn die Polizei zu mir kommen sollte, dann kann ich immer noch sagen, dass ich die Kisten nur weitersende und nicht selber reingucke.“
„Und du glaubst, das reicht, damit die dich dann in Ruhe lassen?“
Petersen biss sich auf die Unterlippe. „Wohl weniger. Aber wenn die dich erwischen sollten, dann wärst du dran … und das muss ja nicht sein.“
Jonsey trank einen weiteren Schluck. „Well, dass die Staatspolizei hier gerade stärker rumläuft als vorher, ist ja zu erwarten gewesen. Aber die Kisten müssen trotzdem geliefert werden. Und ich habe da eben die nötigen Kontakte, damit das gemacht werden kann. Natürlich könnte ich jetzt jemand anderes auch die Kontakte vermitteln, damit der mithilft, aber dann würde ich denjenigen ja nur dem Risiko aussetzen, das ich gerade habe. Und ich will dieses Risiko niemand anderes geben. So bin ich eben. Und überhaupt“, er deutete auf die Ladentür, „würde ein anderer wohl nur die Kisten abliefern und dann sofort wieder zurück über die Grenze fahren, aber ich sehe mich immer noch ein wenig um.“ Er brauchte nicht ins Detail zu gehen, seine Anspielung war deutlich genug.
Petersen nickte. „Ich meine ja nur. Was machst du denn, wenn dein Freund von der Grenzpolizei mal nicht da sein sollte?“
„Well, dann muss ich mir eben etwas anderes einfallen lassen, wie ich hierherkomme.“ Er trank die Flasche leer und griff in seine Tasche, um sein Portemonnaie zu holen.
„Lass stecken. Geht auf's Haus.“
„Thanks.“
„Pass bloß auf dich auf. Versprich mir das, ja? Ich habe hier langsam wirklich Angst um dich. Ich meine, ich höre ja, was die Leute so reden, die hier reinkommen. Die Staatspolizisten, die reden zwar nicht so offen, aber die sagen dennoch einiges, und wenn ich dann von anderen Leuten andere Dinge höre und das dann miteinander verbinde, dann mache ich mir wirklich Sorgen.“ Er senkte die Stimme zu einem Flüstern. „In den letzten Wochen wurden sehr viele Lieferwägen zur Med-Zen geschickt.“
Jonsey horchte auf. Die Medizinische Zentrale galt als Folterort, in welchem Staatspolizisten zusammen mit Ärzten sogenannte Vaterlandsverräter, aber vor allem Schwule, Schwarze und andere Unerwünschte aufs äußerste misshandelten. „Hast du dazu etwas Näheres gehört?“
Petersen schüttelte den Kopf. „Nein. Nur, dass eine Menge Wagen dahin gekommen sind. Keine kleinen, sondern so richtig große Umzugslaster. Ich glaube aber nicht, dass die Med-Zen abgeschafft werden soll. Wäre zwar wünschenswert, aber das glaube ich nicht.“
„Also neue Ausrüstung?“
„Wahrscheinlich. Und wenn die Partei es für nötig hält, die Ausrüstung in der Med-Zen zu erneuern … Ich meine, nach allem, was man darüber hört, haben die jahrelang mit rostigen Skalpellen gearbeitet und es nicht für nötig empfunden, daran etwas zu verbessern …“
Jonsey ließ sich das Gesagte durch den Kopf gehen. „Well, we'll see. Danke für das Trinken.“
„Immer doch. Dann bis nächste Woche. Pass auf dich auf.“ Er reichte ihm die Hand.
„Und du auf dich.“ Er gab ihm ebenfalls die Hand. „Bye.“
Er verließ den Laden und ging ein wenig durch die Grenzstadt, in der an jeder Ecke ein Staatspolizist patrouillierte. Mit professioneller Vorsicht begab er sich durch die Straßen, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Er überlegte sich, ob er selber zur Med-Zen gehen sollte, um sich die Angelegenheit aus der Nähe anzusehen, aber er entschied sich dagegen – niemand ging auch nur in die Nähe der Zentrale, wenn man nicht gerade gegen seinen Willen dort hingeschleppt wurde.
Er entschloss sich, dennoch ein wenig herumzulaufen, um zu gucken, ob er irgendwo jemanden erblickte, der ganz offensichtlich über die Grenze wollte und dabei Hilfe benötigte. Nach einiger Zeit bemerkte er einen jungen Mann mit schwarzen Haaren, der in einer Gasse zwischen zwei Häusern stand und immer wieder um sich blickte, so als würde er auf jemanden warten. Jonsey hielt dennoch zunächst etwas Abstand, da er sich zwar sicher war, dass der Mann über die Grenze wollte, aber es wirkte nicht so, als wäre der Fremde verloren, sondern eher so, als würde er ungeduldig auf seine Gelegenheit warten, dem Reich zu entfliehen. Nach ungefähr einer Minute, in welcher Jonsey auf der anderen Straßenseite hinter einer Gebäudeecke gestanden und immer wieder unbemerkt rüber geguckt hatte, kam ein anderer Mann in schwarzen Klamotten zum Fremden. Jonsey erkannte ihn – er hatte zwar noch nie persönlich mit ihm zu tun, aber der Kerl war ihm dennoch bekannt.
Hobbs ging zu dem jungen Mann. „Alles soweit klar“, sagte er und stellte sich so hin, dass der andere Mann nur noch Augen für ihn besaß.
„Ja? Wirklich?“
„Ja. Wenn ich es doch sage. Du musst dich einfach an mich halten, dann geht alles klar“, versicherte Hobbs ihm erneut.
Jonsey bemerkte, dass sich aus der Gasse ein Mann und von der Straße her zwei weitere Männer zu den beiden hinbewegten. Die nun aufgetauchten Männer waren eindeutig Staatspolizisten, auch wenn sie zivile Kleidung trugen, aber ihre Gangart, ja ihr ganzes Wesen verriet sie. Die Männer kamen immer näher zu Hobbs und dem jungen Fremden, den sie schließlich abrupt griffen und mit einem festen Schlag auf den Hinterkopf bewusstlos schlugen. Sie schleppten ihn in die Gasse, während einer der Männer Hobbs geschwind ein Geldbündel reichte, dass dieser annahm und sogleich weiterging, ohne sich um den Niedergeschlagenen zu kümmern. Hobbs steckte das Geld ein und überquerte die Straße. Er kam immer näher.
Jonsey griff geschwind in seine Tasche und holte sein altes Feuerzeug hervor, dass er nur noch bei sich trug, falls er es irgendwann doch noch benötigen sollte. Er senkte den Kopf und tat so, als würde er versuchen, es anzumachen. „Scheiße … Scheiße …“, sagte er murmelnd.
Hobbs kam näher. „Moment.“ Er griff in seine Tasche, holte ein silbernes, teures Feuerzeug hervor und entzündete es.
Jonsey ließ den Kopf leicht gesenkt und gab sich unterwürfig. „Danke, vielen Dank. Aber haben Sie auch noch eine Zigarette?“
Hobbs machte das Feuerzeug wieder aus. „Schnorrer“, zischte er und ging weg.
Jonsey blickte ihm aus den Augenwinkeln nach und setzte sich sodann in Bewegung. Er wusste, dass es sinnlos gewesen wäre zu versuchen, dem Unbekannten zu helfen. Der Mann befand sich bereits in der Gewalt der Staatspolizei. Sie würden ihn wohl in die Med-Zen bringen, und das, was man dort mit ihm machen würde, wollte sich Jonsey nicht einmal in einem Albtraum vorstellen.