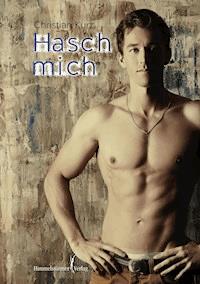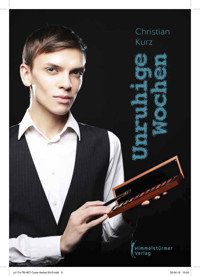Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Himmelstürmer
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Leben steckt voller Seltsamkeiten: es könnte für den Filmkritiker Peter Haase alles so einfach sein, wenn nur nicht seine Mutter wäre. Diese ist zwar nett, aber sie weiß nicht, dass er schwul ist, und nun setzt sie ihn unter Druck, sich eine Frau zu suchen und endlich für Nachwuchs zu sorgen. Aber auch der junge Lukas Jäger hat seine Probleme, denn obwohl er einen netten Kerl zum liebhaben gefunden hat, kann er sich beim besten Willen nicht an dessen Namen erinnern, und eine Arbeit sollte er auch finden. Und der erfolglose Komiker Benjamin König hat es vielleicht am schwersten von allen, da er sich mittlerweile nicht mehr vorstellen kann, jemals Erfolg zu haben. Auch seine LP-Sammlung spendet ihm nicht immer Trost, weswegen er immer wieder depressive Phasen erlebt und am liebsten alles beenden möchte. Alle drei treffen sich in einer Schwulenbar und kommen ins Gespräch, gehen dann aber wieder ihrer Wege. Peters Mutter versucht währenddessen mit Hilfe einer Freundin, ihren Sohn online zu verkuppeln, wobei sie seinen bevorzugten Typ Frau natürlich nur vage schätzen kann. Unterdessen taucht auch noch der heimlich schwule Neo-Nazi Kevin auf, der sich krampfhaft beweisen will, dass er ein ganzer Kerl sei. Der Neo-Nazi will um jeden Preis seine Frustrationen ablassen und trifft dabei auf Benjamin, aber auch Peter hat nach wie vor seine Probleme, da er seiner Mutter zwar sagen will, dass er schwul ist, es sich aber nicht so richtig traut. Als schließlich Peter im Suff seiner Mutter sein Schwul-sein gesteht, ist das Chaos fast perfekt, denn eine rigorose Rentnerin mit Beschützerkomplex und zwei ruppige Polizisten mischen auch noch mit. Alle beeinflussen auf seltsam-komische Weise gegenseitig die Leben der anderen, denn niemand lebt für sich alleine.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 349
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christian Kurz
Regenbogenträumer
Himmelstürmer Verlag, Kirchenweg 12, 20099 Hamburg,
Himmelstürmer is part of Production House GmbH
www.himmelstuermer.de
E-mail: [email protected]
Originalausgabe, September 2015
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Verlages
Rechtschreibung nach Duden, 24. Auflage.
Coverfoto: istockphoto.com
Umschlaggestaltung: Olaf Welling, Grafik-Designer AGD, Hamburg. www.olafwelling.de
E-Book-Konvertierung: Satzweiss.com Print Web Software GmbH
ISBN print 978-3-86361-491-1
ISBN epub 978-3-86361-492-8
ISBN pdf: 978-3-86361-493-5
Die Handlung und alle Personen sind frei erfunden. Jegliche Ähnlichkeiten mit realen Personen wären rein zufällig.
1.
Peter Haase wachte um 8 Uhr auf, ging aufs Klo, aß danach einen kleinen Salat, putzte sich die Zähne und schaltete den Computer ein, um sich einen Film anzusehen, für den er sodann eine Review schrieb. Der Streifen war eher von billiger Natur – was war es nur mit modernen Regisseuren, dass sie sich einbildeten, nicht mehr auf Zelluloid drehen zu müssen? Das Endprodukt konnte doch nur nach einem Amateurfilm aussehen, egal ob sich bekannte Schauspieler darin befanden oder nicht. Er schaltete daher die Wiedergabe auf doppelte Geschwindigkeit, wodurch die Schauspieler ihren Text eher quietschten, aber er war diese Zeitersparnis bereits gewohnt und verstand darum mühelos, worum es in dem Film ging, und worum es ging, war nicht sehr viel – quasi die typische Quintessenz aller „preiswert“ produzierten Billigfilmchen, in denen Zombies herumliefen und von den „Schauspielern“ mittels After-Effekts blutig zerteilt wurden, bis entweder die Story abrupt zu einem wie auch immer gearteten Ende kam oder der Speicher des Camcorders belegt war, und Peter traute den Machern dieses Werkes nicht soviel Intelligenz zu, als dass sie wüssten, wie man eine Speicherkarte wechselte.
Nachdem der Abspann vorbeigerauscht war, schrieb er seine Review, die etwas großzügig formuliert ausfiel, aber dem Leser dennoch zu verstehen gab, dass der Film nichts besonderes ist, aber für einen vergnüglichen Abend mit Freunden und viel, viel Alkohol dennoch tauglich sei. Eigentlich hasste er es, einem Film das „Party-tauglich“-Etikett auszustellen, denn das sagte schließlich nichts über den Wert des Streifens an sich aus – so gut wie alles wird erträglich, wenn man das Gehirn nur in genügend Alkohol ersäuft. Er tippte die Review, sah auf die Uhr und entschied sich, noch einen weiteren Film anzusehen. Dieser stellte sich als Gangstergeschichte heraus, in welcher einige vermeintlich harte Kerle einen Raubüberfall begehen wollten und – natürlich – alles vermasselten, weswegen es zu Drama, Tod und Schießerei kam. Na ja, dachte er bei sich, wenigstens ist dieser Streifen auf Zelluloid gedreht. Die Handlung verblüffte ihn allerdings nicht im geringsten, ja er konnte an einigen Stellen den Text sogar stumm mitsprechen, einfach weil es sich so vorhersehbar gestaltete oder weil er aufgrund seiner Arbeit schon so viele gleichwertige Produktionen gesehen hatte, dass er genau wusste, wie dieses streng nach Schema F ablaufende Stückchen sich entwickeln würde. Immerhin war einer der Schauspieler sehr schön anzusehen – ein nettes jugendliches Gesicht, und in einer Szene sah man sogar den leicht trainierten Oberkörper, was Peter dann doch ein verspieltes Lächeln abrang, ihn jedoch nicht daran hindern würde, dem Film die Review zu schreiben, die er seiner Meinung nach verdiente. Den sexy Schauspieler würde er hinterher aber dennoch im Internet nachschauen – so was leckeres hatte er schon länger nicht mehr gesehen.
Nachdem er auch diese Review verfasst hatte, guckte er sich ein bisschen Nachrichten an, bei denen es um das übliche ging – irgendwo hungerten welche oder wurden politisch verfolgt und mussten daher hier aufgenommen werden, und natürlich war jeder, der etwas dagegen sagte, ein Rassist, aber man wollte den Zuwanderern auch kein Sozialhilfeanspruch zugestehen, denn das würde auf die Staatskasse drücken und überhaupt zu Sozialgeldtourismus führen, weswegen ein Gericht nun beschlossen hatte, dass man Zuwanderern kein Geld geben müsse, was von allen begrüßt wurde, denn anscheinend konnten die wenigstens so klar denken wie Peter und deswegen erkennen, dass Zuwanderer, die man reinlässt und dann das Geld verweigert, fast schon keine Alternative besaßen als zu klauen, denn soviel Arbeit wird es für die ja dann auch nicht geben. Er hatte so eine Handlung schon einmal in einem Film gesehen, aber er konnte sich partout nicht mehr darin erinnern, wie dieser hieß, aber da er täglich zwischen 4 und 6 Filme sah, vermischten sich einige Punkte eben – Peter Cushing ist zum Beispiel ein guter Schauspieler und immer wieder ein Meister seines Faches, aber nachdem man mehrere Filme mit ihm gesehen hat, wird es wohl den meisten schwerfallen, sich daran zu erinnern, ob er Dracula in „Dracula braucht frisches Blut“ mit einem Kruzifix tötete, oder mit einem Pfahl ins Herz stieß, oder ob das nicht doch der Teil war, in welchem der Vampir von einem Dornenbusch aufgehalten wurde, was Cushing dann die Möglichkeit gab, ihm ein abgebrochenes Wagenrad in den Brustkorb zu rammen. Peter dachte allerdings nicht so oft darüber nach – wenn er wirklich Gewissheit haben wollte, dann würde er eben einfach seine gesammelten Reviews mit Hilfe der Wortsuche durchgehen, um die Antwort zu erfahren.
Er überprüfte die beiden Reviews auf Schreibfehler und polierte sodann nochmals einige Sätze, damit sie flüssiger wirkten, bevor er sie abschickte – die eine an ein DVD-Magazin, die andere an eine Fernsehzeitung. Später müsste er noch eine Besprechung für die Tageszeitung schreiben, und für eine Webseite war da noch das Box-Set, das zwar schön aussah, aber viel Zeit in Anspruch nahm. Im Gegensatz zu anderen „Kollegen“ sah er nicht einfach nur einen kleinen Teil einer TV-Serien-Box, sondern jede einzelne Folge, bevor er seine Review schrieb – aufgrund der enormen Minutenanzahl bedeutete das natürlich, dass er die komplette Serie in doppelte Geschwindigkeit sehen müsste, was gerade bei Charaktergetriebenen Serien fast schon einer Schande gleichkam, aber anders konnte er das Pensum nicht bewältigen. Er beschwerte sich aber auch nicht – wieso auch? Er war glücklich. Andere mussten täglich ins Auto springen, irgendwo hinfahren, stundenlang von wildfremden Menschen umgeben sein und eine Arbeit erledigen, die ihnen langsam aber sicher den Körper alt und faltig machte, und er konnte zu Hause bleiben, seine Post entgegennehmen und gemütlich ein paar Filme gucken, für die er dann eben seine Besprechung schrieb. Was machte es da schon, dass er für mehrere Zeitungen und Magazine schrieb? Hauptsache, das Geld stimmte und er verfügte über reichlich Freizeit und -raum.
Er schaltete den Computer auf Stand-by, zog sich an und verließ die Wohnung. Der Sommer war wieder hervorragend, was allerdings auch mit sich brachte, dass etliche Leute an ihm vorbei liefen, die Deodorant wohl für optional hielten. Die Stadt roch durch die wenigen Bäume nach Leben und stank durch die Mehrzahl ihrer Bewohner nach schlechtem Fleisch, oder gutem Käse, je nachdem. Er ging zur Bäckerei, deren Verkäuferin ein blaues Auge zur Schau stellte, und kaufte sich ein kleines Brötchen, das er bereits halb gegessen hatte, bevor er den Supermarkt erreichte, wo er sich drei Salate und zwei Wasserflaschen kaufte und dabei den netten Verkäufer leicht begutachtete, bevor er wieder nach Hause ging, um weiterzuarbeiten – der DVD-Stapel wurde schließlich nicht von alleine weniger.
Kaum war er zuhause angekommen, als er das Blinken seines Anrufbeantworters bemerkte. Er räumte erst seinen Einkauf weg, bevor er sich die Nachricht anhörte.
„Ja, hallo, ich bin es ... bist du da? - - - Hallo? - - - Bist du da? - - - Ruf bitte zurück. Ist etwas Wichtiges“, sagte seine Mutter und ließ noch ein wenig Zeit verstreichen, bevor sie auflegte und damit die Nachricht beendete.
Er atmete einmal durch – er mochte seine Mutter sehr, aber er hatte ihr nie sagen können, dass er schwul ist. Nicht, dass er sich deswegen schämte oder so was, das nun wirklich nicht. Schwul war für ihn normal. Punkt. Da brauchte man nicht diskutieren. Das war er und das blieb er. Ganz einfach. Aber er hatte auch noch nie die Situation, dass er es seiner Mutter sagte – dass er sich eben vor sie hinstellte und sagte, dass er schwul ist und dass das eben so sei und wenn sie ihn liebe, es auch akzeptieren würde. Er hatte solche Szenen immer wieder in Filmen gesehen, und auch wenn das natürlich nicht die Wirklichkeit widerspiegelte, so wusste er doch, dass viele es in der Realität auch machten. Wahrscheinlich weil sie selber unsicher waren und darum auf die Akzeptanz ihrer Familie bauten. Aber er war ja nicht unsicher. Er war schwul. Dessen war er sich sicher. Absolut. Also warum sollte er seine Mutter damit behelligen? Das ergab für ihn keinen Sinn, und darum wusste sie es nicht, und sein Vater war sowieso abgehauen und darum aus der Rechnung gestrichen.
Er nahm den Hörer und wählte. Es dauerte ein wenig, bevor sie abnahm. „Ja?“
„Ich bin’s.“ Da keine Reaktion erfolgte, fügte er hinzu: „Peter.“
„Das weiß ich schon, ich trink gerade was“, sagte sie. „Wo warst du denn?“
„Einkaufen. Was gibt’s?“
„... wir müssen sprechen.“
„Gut. Worüber?“
„Nicht am Telefon.“
„Ist es was Schlimmes?“
„Nicht am Telefon“, sagte sie erneut. „Kannst du nicht schnell herkommen?“
„Was ist denn los?“
„Nicht am Telefon. Komm einfach her, ja?“
„Ja, klar.“
„Gut. Ich warte.“ Sie legte auf.
Ein wenig verwirrt sah er auf das Telefon und legte sodann auf, um sich auf den Weg zu machen. Da er kein Auto besaß, brauchte er gut 30 Minuten, bis er beim Reihenhaus ankam, in welchem seine Mutter wohnte. Er schloss die Haustür auf und ging bis zur Wohnungstür, die er ebenfalls hätte öffnen können, da er aus Sicherheitsgründen einen Schlüssel besaß, aber er klingelte lieber. Es dauerte ein wenig, bis sie aufmachte. „Hallo. Was ist denn los?“, sagte er.
Die zierliche alte Frau schüttelte den Kopf. „Nicht an der Tür.“ Sie ging in Richtung Wohnzimmer, während er die Tür schloss. „Möchtest du etwas trinken? Einen Kaffee?“
„Nein, danke.“
„Sicher? Ich habe den Guten.“
„Nein, ich möchte nichts, danke.“ Er ging ins Wohnzimmer, das spärlich, geradezu spartanisch erschien, jedoch ein Übermaß an gehäkelten Deckchen aufwies, die über Tisch, Sofa, Zeitungsständer und Fernseher hingen. „Worum geht es denn?“
„Musst du etwa schon wieder los?“
„Nein.“
„Dann hetz doch nicht so.“ Sie saß auf dem mattgrünen Sessel und trank etwas Kaffee aus der weißen Tasse, bevor sie aus der geöffneten Milchpackung etwas hinzugoss. „Die Milch schmeckt schlecht.“
„Abgelaufen?“
„Mach dich nicht lächerlich, die habe ich gestern erst gekauft. Die werden einer alten Frau doch keine abgelaufenen Lebensmittel andrehen. Oder gerade doch. Mit unsereins kann man es ja machen.“
Er nahm die Packung zur Hand.
„Möchtest du doch einen Kaffee?“
„Nein, danke.“ Er deutete auf die Packung. „Entrahmt.“
„Und?“
„Du kaufst doch nie entrahmte Milch.“
„Ist da ein Unterschied?“
„Schon. Darum schmeckt die dir wohl auch nicht.“
„Die ist schlecht, das ist alles.“ Sie trank noch einen Schluck und versuchte sodann, den Geschmack mittels mehrerer Zuckerwürfel zu verbessern.
Er sah ihr dabei zu, wie sie zwei Schluck zu sich nahm, bevor er fragte: „Weswegen sollte ich denn so schnell kommen?“
„Musst du schon wieder weg?“
„Nein. Aber es klang so ... Na ja ... wenn du es nicht am Telefon sagen kannst ...“
Sie atmete einmal tief durch. „Du kennst doch die Frau Berger.“
Er nickte, obwohl er sich auf Anhieb nicht so sicher war. „Ja, schon.“
„Ich und die Frau Berger, wir treffen uns ja immer wieder. Also nicht ständig, aber schon so einmal die Woche. Oder alle drei Tage, je nachdem. Ich habe ja auch nicht immer Zeit, und außerdem redet die immer zu viel. Die wird eben auch schon schusselig. Oder sie ist soviel allein. Da wird man wohl auch rechthaberisch. Jedenfalls haben wir uns neulich getroffen, und da hat sie mir davon erzählt, dass sie immer wieder zum Arzt muss, weil sie ja Zucker hat. Das würde im Alter kommen. Würde jeder bekommen. Ich denke mir nichts dabei, die redet eben viel. Aber dann sehe ich im Fernsehen nur noch Beiträge zum Thema Zucker. Immer wieder. Auch in meinen Serien geht es nur noch um Zuckerkranke. Also sage ich mir, dass ich dann vielleicht doch mal zum Arzt gehen sollte. Nicht weil ich denke, dass ich Zucker habe, sondern einfach, weil dann vielleicht damit aufgehört wird, mir mein Fernsehen damit zu verschandeln. Also bin ich zum Arzt gegangen und habe gesagt, dass der mich auf Zucker untersuchen soll. Und das hat er dann auch gemacht.“ Sie trank noch einen Schluck.
„Und das Ergebnis ...“ sagte er, obwohl er wusste, dass sie eigentlich keinen Zucker haben konnte, denn wenn sie krank wäre, dürfte sie ihren Kaffee nicht süßen.
„Dass ich keinen Zucker habe.“
„Ist doch gut.“
„Ja, schon, aber als ich da war, habe ich mir gedacht, dass ich dem Arzt dann ja auch gleich sagen kann, was mir noch so wehtut. Wann komm ich denn schon zum Arzt? Das muss ich doch ausnützen.“
„Du kannst jeden Tag zum Arzt gehen.“
„Und dann so sein wie einer von diesen Hypochondern? Nein, nein, soweit kommt’s noch, dass ich einer von denen werde. Wegen solchen Leuten hatte man mal Praxisgebühr eingeführt, weil eben zu viele Leute wegen eingebildeten Schmerzen zum Arzt gegangen sind und den ganzen Betrieb aufgehalten haben. Das war schlimm, da hat man seine Krankenversicherung gezahlt, und dann hat man noch extra Geld zahlen müssen, damit der Arzt einen überhaupt angucken darf, um zu entschieden, ob man krank ist oder nicht, und dabei haben die einen Eid geleistet, dass die jedem helfen müssen. Egal ob jemand arm ist oder reich. Aber Reiche haben ja sowieso immer einen eigenen Doktor. Unsereins kann sehen, wie man mit Schmerzen zurechtkommt, und Reiche schnippen mit den Fingern und bekommen gleich alles auf dem silbernen Tablett serviert. Als ob die das brauchen würden. Den Armen müsste man so helfen und zuvorkommend sein, nicht den Reichen. Die können sich ja doch selber alles leisten.“ Sie trank einen weiteren Schluck. „Jedenfalls habe ich ihm dann gesagt, dass ich leichte Verspannung in der Brust habe. Nichts Ernstes. Ist eben ein leichter Krampf. Er wollte sich das aber nicht so richtig angucken, weil er darauf nicht spezialisiert ist. Aber er hat mich zu einem Frauenarzt geschickt.“
„Gehst du nicht zu deinem Frauenarzt?“
„Warum sollte ich? Wenn ich mich gesund fühle, dann bin ich das auch. Da muss ich doch nicht zu einem Frauenarzt springen, damit der mir bestätigt, dass ich gesund bin. Wenn ich mich gesund fühle, dann bin ich das auch, ganz einfach. Aber gut, dachte ich mir, was soll’s, gehe ich eben dahin. Ich habe mir sogar extra ein Romanheft mitgenommen gehabt, weil ich mir schon gedacht habe, dass es da länger dauert. Um 12 Uhr war der Termin, und um 13 Uhr 20 bin ich drangekommen. Zum Glück hatte ich mir noch ein Brötchen mitgenommen. Ich meine, jemanden während der Mittagszeit warten zu lassen, ist doch wirklich nicht nett. Und Na ja, dann bin ich eben drangekommen und habe dem dann das auch gesagt, dass ich eben eine Verspannung in der Brust habe, und dann hat der eine Mammographie gemacht und einen Stanztest ...“
„Stanztest?“
„Da wird ein Stück aus der Brust rausgestanzt“, erklärte sie beiläufig. „Und dann wurden Tests gemacht, und gestern sollte ich anrufen, und das habe ich auch gemacht, und dann musste ich heute hinkommen.“
„... und?“
„Ich habe Brustkrebs“, sagte sie mit einer seltsamen Gefasstheit. „Sogar aggressiv.“
„Nein ...“
„Und gestreut hat er auch.“
Er musste die Nachricht erst einmal verarbeiten, aber je länger er stumm blieb, umso mehr beschlich ihn das Gefühl, dass er etwas sagen musste, einfach irgendetwas: „A-aber behandelbar ist er, oder?“
„Der Arzt sagt ja.“
„Okay ...“
„Man muss mir die gesamte rechte Brust abnehmen und auch noch einige Lymphen entfernen. Und eine Chemotherapie muss ich auch machen.“
Er nickte und versuchte die richtigen Worte zu finden, auch wenn er nicht wusste, welche dies waren, und auch sein enormes Filmwissen half ihm im Moment kein Stückchen weiter. „Also ... ist ... eine Heilungschance da ... das ist doch schon mal was ... ich meine, was soll ich da sagen?“
„Wegen mir musst du da nichts sagen.“
Er horchte auf. „So?“
„Ja“, meinte sie und trank noch einen Schluck, mit dem sie sodann die Tasse leerte. „Schmeckt wirklich schlecht. Der Brustkrebs und so weiter – das ist meine Sache. Da kannst du mir ja nicht helfen. Da muss ich eben durch. Aber deswegen wollte ich heute auch nicht mit dir sprechen.“
„Nicht?“ Er wurde zunehmend verwirrter. „Weswegen dann?“
„Ich wollte mit dir sprechen. Über dich.“ Sie sah ihn mit einer ambivalenten Mimik an, so dass er nicht wusste, was er von der ganzen Situation halten sollte – sie wirkte gefasst, so als hätte sie den Krebs akzeptiert und wäre bereit, ihn zu bekämpfen, aber im Moment wollte sie eine andere Schlacht schlagen.
„Über mich?“
„Ja. Über dich.“
Er verstand nicht. „Wieso? Das mit dir ist doch gerade wichtiger.“
„Ach, das wird schon. Ich meine, so was ist heutzutage doch Routine.“
„Ja, sicher, sicher wirst du wieder, aber trotzdem ... das ist schon ...“
„Egal.“, wehrte sie schnell ab. „Ich mache das und zieh das durch, und wenn ich gesund werden soll, dann werde ich auch wieder gesund, und wenn nicht, dann eben ...“
„Sag das nicht.“
„Es ist aber so.“ Sie sah ihn direkt an. „Wir müssen reden. Normalerweise würde ich dir das nicht so direkt sagen, aber jetzt weiß ich ja nicht, wie viel Zeit ich eigentlich noch habe.“ Sie machte eine Pause. „Ich habe dir ja eigentlich nie Vorschriften gemacht. Jeder lebt sein Leben so, wie er es für richtig hält.“
„Oookay ...“
„Aber du bist ja jetzt auch schon 39. In dem Alter haben andere schon lange Familie. Du aber ... ich mische mich da nicht ein, und du sollst auch nicht gleich die Erstbeste nehmen, das nun wirklich nicht, aber ... ich möchte einen Enkel.“
Er nickte, stutzte, blinzelte, nickte vorsichtshalber noch einmal und hakte sodann nach, weil er dachte, dass er sich nur verhört haben konnte: „Einen Enkel?“
„Ja. Ich möchte, dass du dir eine nette Frau suchst und mit der dann einen Enkel zeugst“, sagte sie und lächelte sanft. „Ich weiß, du genießt dein Junggesellenleben, aber irgendwann kommt für jeden nun mal der Ernst des Lebens. Und so gesehen hattest du ja genügend Zeit, dir die Hörner abzustoßen. Ich möchte, dass du dir eine nette Frau suchst und die dann heiratest und mit ihr ein Kind zeugst. Meinetwegen auch zwei. Ich möchte einfach einen Enkel haben. Ich weiß ja jetzt nicht mit dem Krebs, ob ich den einfach so besiegen kann oder nicht. Ich meine, was habe ich denn schon großartiges, für das ich hinarbeiten kann? Ich lebe von Rente, ich gucke meine Serien, ich lese meine Romane. Dafür muss ich nicht gesund sein. Aber wenn ich weiß, dass du einen Sohn oder eine Tochter hast ... für einen Enkel muss man gesund sein. Die kleinen Racker halten einen ja ganz schön auf Trab.“ Sie musterte ihn und sah seinen perplexen Gesichtsausdruck. „Du wirst sehen, sobald du ein Kind hast, ist das was ganz schönes. Das kommt dir jetzt natürlich etwas viel auf einmal vor.“
„Ja ...“ japste er.
„Und natürlich ist das für dich eine große Umstellung. Das ist schon klar. Aber bei mir ist das ja jetzt auch eine Umstellung, sogar eine sehr große, vielleicht sogar größer als bei dir. Ich meine, sicher ist es schwer, heutzutage eine hübsche Frau zu finden, die nicht zu burschikos ist. Aber wenn du nicht suchst, dann findest du auch nichts. Das ist mit allem so. Du musst dich auf die Suche machen. Ich meine, du siehst doch gut aus. Du bist nicht fett wie der Sohn von Elsie, also der Frau Borowitz. Die kennst du doch auch, ja? Der wiegt viel, aber gut, was soll er machen. Die Elsie sagt, dass er das von seinem Vater hat. Schwere Knochen, oder so was. Als ob schwere Knochen durch Computerspiele hervorgerufen werden. Aber gut, das geht mich ja nichts an. Du kennst doch bestimmt eine Menge Frauen, oder? Du sitzt doch bestimmt nicht nur den ganzen Tag zuhause und guckst Filme.“
Er nahm mittels Schnappatmung etwas Luft zu sich. „Das ist meine Arbeit. Ich muss Filme gucken, und so leicht wie sich das für manche anhört, ist das schließlich auch nicht. Das kann auch nicht jeder. Die meisten können über einen Film schimpfen und sagen, dass der schlecht gewesen ist, aber sie können dann nicht erklären, warum er schlecht ist. Also muss ...“ Er schüttelte den Kopf. „Egal. ... du möchtest also, dass ich heirate ...“
„Ja. Es sollte schon ein ehelicher Enkel sein. Standesamt reicht doch.“ Sie lächelte weiter. „Ich verlange doch nun wirklich nicht zu viel. Manche Jungen heiraten gleich nach der Schule und konnten sich dann nie so richtig austoben – ich weiß doch, wie Jungen sind, und wenn sich ein Junge nicht austoben kann, dann läuft er weg oder macht sonst so einen Unsinn. Aber irgendwann muss aus dem Jungen eben ein Mann werden.“
„Und ein Mann hat Kinder?“
„Ja, natürlich. Was denn sonst?“ Sie blickte ihn geradezu durchdringend an. „Ich möchte, dass du eine Frau findest. Und ich möchte ein Enkelkind von dir. Ansonsten wüsste ich nicht, woher ich die Kraft nehmen soll, die Therapie und das ganze Gelump zu ertragen. Versprich mir das. Versprich mir, dass du dir eine Frau suchst und mit ihr ein Kind zeugst. Das ist nicht zu viel verlangt, oder?“
Er atmete durch. „Ähm ...“ Er kämpfte innerlich eine aussichtslose Schlacht, denn trotz allem Für und Wider das es gab in Bezug auf die Formulierung des einfachen Satzes Ich bin schwul, wusste er doch von vornherein, dass er ihr es nicht sagen konnte. Nicht weil er sich schämte, denn das tat er nicht – nicht weil er nicht den Mut dazu aufbringen konnte, denn daran mangelte es ihm nicht. Es scheiterte einfach an der Tatsache, dass er seiner kranken Mutter in diesem Moment nicht den Grund ruinieren konnte, weswegen sie gegen den Krebs kämpfen wollte. Also verlor er die Schlacht der Argumente und sank blutüberströmt auf das Schlachtfeld der Gefühle und meinte nickend: „Ich kann es immerhin versuchen ... ich meine, ich werde ja nicht gleich sofort eine finden ...“
„Das ist mir schon klar. Und nimm keine, die schon ein eigenes Kind hat, das gibt immer nur Probleme. Die schleppen immer ihre ganzen negativen Erfahrungen mit, das kannst du mir glauben. Hat schon seine Richtigkeit, dass die dann auf sich gestellt sind. Und nimm eine, die auch ein Kind gebären kann. Ich möchte kein adoptiertes. Es soll ein Erbe sein. Nicht nur für mich, auch für dich. Glaub mir, Männer wollen immer kein Kind haben, weil das zu viel Verantwortung ist und man kein Junge mehr sein kann, sondern dem Kind eben ein Vater, also ein Mann sein muss, aber eigentlich bedeutet ein Kind, dass man gleichzeitig Mann und Kind sein kann. Das wirst du auch noch sehen.“ Sie nickte geradezu selig, weil sie wusste, dass sie ihren Willen bekommen hatte.
Er nickte ebenfalls, weil er sah, dass sie nickte, aber eigentlich hatte er im Moment keinerlei Ahnung, weswegen er seinen Kopf bewegte, denn alles um ihn herum schien wie durch Melasse getaucht – worauf hatte er sich da eingelassen?
Der Tag begann für Benjamin König wie immer, und das bedeutete nichts anderes als dass er mit einem leichten Kater in seiner kleinen und doch ziemlich vollgestopften Wohnung aufwachte und zunächst einmal ins Badezimmer wankte, wo er der unrasierten Fratze, die ihn im Spiegel blöd ansah, die Zunge rausstreckte, bevor er auf die Toilette ging und während des Pissens herzhaft gähnte. Nachdem er wieder in sein Schlafzimmer gegangen war, ging er zum Wandschrank, der die gesamte Fläche einnahm und dessen Inneres mit Schallplatten gefüllt war, während die Kleidungsstücke, die eigentlich hineingehörten, wie immer auf einem aufgrund der auf ihn abgelegten Jacken, Hosen, Shirts und Socken nicht mehr zu erkennenden Drehstuhls lagen. Benjamin griff sich „Bat out of Hell“ von Meat Loaf und legte sie auf den Plattenspieler, der auf seinem Nachttisch stand. Er nahm die Kopfhörer, setzte sie auf und ließ die Nadel dann in die Rille fallen – Seite 2, Lied 1. Er legte sich wieder ins Bett und hörte sich das Stück komplett an, während er die Decke anstarrte und überlegte, ob er es noch einmal versuchte, oder ob er nicht doch endlich einen Schlussstrich setzen sollte.
Alles, was er im Leben zu erreichen hoffte, war ein bekannter Comedian zu werden. Kein weltberühmter oder so was, sondern einfach nur bekannt. Auch kein Satiriker oder Komiker, also so was altbackenes, das man von Karnevalsveranstaltungen kennt, sondern einfach ein Comedian, so wie Lenny Bruce, oder Bill Hicks, oder einen der vielen, vielen anderen Comedians, die seinen Humor so sehr beeinflussten, die allerdings hierzulande fast nur Eingeweihten vertraut waren, weswegen seine Versuche, in dieser Richtung Erfolg zu haben, nicht von Erfolg gekrönt wurden. Hier und da hatte er zwar ein paar kleinere Auftritte – die, wenn es nach seinem Lebensplan ging, nur der erste Schritt auf der Karriereleiter sein sollten und dazu führten, dass er entdeckt und ein bekanntes Mediengesicht wurde, also mit einer eigenen TV-Serie, oder gleich einem Spielfilm – aber das Publikum schien eher verhalten zu reagieren, vielleicht, weil sie noch zu sehr im deutschen Nichtigkeitensumpf verankert waren und man ihnen mittels eines Tusches vermitteln musste, wann denn die Stelle zum Lachen kam. Eine Praxis, die Ben, wie er seinen Namen für seinen Auftritt immer verkürzte, absolut zuwider fand, denn ein derart konditioniertes Publikum denkt doch dann gar nicht mehr selber über die Witze nach, sondern wartet nur darauf, dass es den Tusch hört, ähnlich einem Parwlow'schen Hundes, der auch sofort das Sabbern anfing, weil er die Glocke hörte und nun durch antrainiertes Verhalten annahm, dass es Essen gab.
Nein, Ben wollte, dass das Publikum von selber lachte – aber das tat es nicht. Jedenfalls nicht so sehr, wie er es gerne wollte. Er hatte seinen Auftritt schon mehrfach abgeändert, an jedem einzelnen Satz gefeilt, jede Pointe bis zum geht-nicht-mehr poliert und sein Timing dadurch absolut perfektioniert, aber dennoch fand er keinen Anklang. Und nach einer solchen niederschmetternden Erfahrung – denn Ablehnung ist mithin das Schlimmste, was einem erwartungsvollen Menschen widerfahren kann – nahm er immer das wenige Geld, das er mit dem Auftritt verdiente, und steckte es sofort in Alkohol, weswegen es nicht selten vorkam, dass er dem Etablissement, in welchem er aufgetreten war, hinterher noch Geld schuldete. Immerhin konnte er sich ansonsten nicht über Geldprobleme beklagen – sein Vater hatte eine gutlaufende Firma und überwies ihm monatlich genügend Geld, dass er die Wohnung halten konnte, auch wenn es für weiteren Luxus dann doch nicht ausreichte, aber solange Ben auf Flohmärkten schöne Exemplare für seine Schallplattensammlung fand, war er vergleichsweise glücklich. Vergleichsweise, da er das Geld von seinem Vater eigentlich nicht annehmen wollte, denn der monatliche Betrag kam nur zustande, weil sein Vater von ihm nichts mehr wissen wollte, nachdem er den damals siebzehnjährigen Ben mit einem gleichaltrigen Jungen im Bett vorfand, was für den alten Herrn dann doch zu viel gewesen ist, und auch Ben trug von dem Erlebnis Narben zurück – körperliche, weil sein Vater ihm hinterher mit dem Gürtel auf den Rücken schlug und so ein paar gezackte Erinnerungen zurückließ, und seelische, weil Ben sich seither nicht mehr richtig an ein sexuelles Erlebnis gewagt hatte. Er sah zwar verhältnismäßig gut aus, aber wenn die erste sexuelle Erfahrung dergestalt schmerzhaft verlief, wollte er irgendwie nicht wirklich mit jemanden zusammen sein. Die andere Person hätte ja die Narben auf dem Rücken sehen können, und überhaupt – wenn er es nicht fertigbrachte, jemand zum Lachen zu bringen, wie gut konnte er denn dann wirklich im Bett sein?
Er wollte das Geld nicht annehmen, aber es ging nicht anders. Sollte er denn nein sagen und zum Amt gehen? Wozu? Er hatte doch eine Geldquelle. Andere würden doch sofort mit ihm tauschen wollen. Aber er selber fühlte sich nicht wohl dabei. Er fühlte sich nicht geliebt und auch nicht verstanden. Und wenn er weiter darüber nachdachte, dann fühlte er sich überflüssig, ja sogar als Lebensverschwendung. Was hatte sein Leben denn schon für einen Sinn? Was machte er denn damit? Platten sammeln, ja, aber was weiter? Und überhaupt – in einigen Jahren werden die doch sowieso wertlos sein. Selbst heutige Kinder wissen nicht mehr, wie man eine Platte richtig abspielt. Die verlernen sogar, was CDs sind. Und Musik- oder Hörspielkassetten? Als ob ein Jugendlicher wüsste, warum man immer einen Bleistift neben dem Kassettenrecorder liegen haben musste. Bandsalat – was ist das? Und je mehr er dachte, desto depressiver wurde er. Dann kamen die Selbstmordgedanken. Warum denn auch nicht? Was ist ein Clown, der niemand zum Lachen bringen kann? Wertlos. Früher hätte man den noch den Löwen vorgeworfen, dann hätte man wenigstens noch ein bisschen Unterhaltung herausbekommen.
Er sah auf die Platte. Track 2. Ein schönes Lied, aber noch mehr gefiel ihm der Titeltrack, er hatte mal in einer Dokumentation gesehen, dass das Motorengeräusch im Lied nicht von einem Motorrad oder einer echten Maschine stammte, sondern von einer E-Gitarre, was für ihn absolut unglaublich war. Er wünschte sich, dass er ein Musikinstrument spielen könnte, aber dafür war er absolut unbegabt. Er hatte es immer wieder versucht, aber es klappte einfach nicht, und im Gegensatz zu seinen Versuchen, eine Arbeit als Comedian zu finden oder einen netten Mann zu angeln, konnte er den Schlussstrich bei der Erlernung von Musikinstrumenten sehr, sehr leicht ziehen. Außerdem würden es die Nachbarn wohl weniger schätzen, wenn er sich doch noch dazu entschließen und Dudelsack oder Didgeridoo[1] spielen lernen würde.
Das letzte Lied erklang, ein ruhiges, melancholisches Stück. Normalerweise hätte er es ganz gehört, aber da er sowieso schon wieder depressiv wurde, hob er die Nadel ab, steckte die Platte zurück in die Schutzhülle und räumte sie in seinen Schrank, bevor er sich eine Single griff und „Agadou“ von der Saragossa Band hörte - ein schönes Nonsens-Lied, das seine Stimmung wieder ein wenig verbesserte. Danach schaltete er den Plattenspieler aus und ging nochmals seine Notizen durch - immerhin hatte er in wenigen Stunden einen Auftritt und wollte darum alles auf die Witzigkeit hin überprüfen. Er verstand nicht, was die Leute daran auszusetzen hatten – schon allein beim oberflächlichen Durchschauen musste er lächeln, und beim genaueren lesen konnte er gar nicht anders als bis über beide Ohren hinweg zu grinsen – eigentlich müssten die Leute lauthals aufbrüllen vor Freude, aber sie taten es nie. Und dennoch hoffte er, dass es besser wurde, dass dieser Auftritt endlich den gewünschten Erfolg brachte. Und dann, vielleicht, mit etwas eigenem Geld und Ruhm, würde er seine Scheu überwinden und jemanden finden können, den er dann von ganzen Herzen liebt, aber erst das eine, dann das andere – daran führte kein Weg vorbei.
Er aß ein Brötchen und trank etwas Saft, während er gleichzeitig nochmals das Skript durchlas. Gelegentlich mimte er die Gesichtsausdrücke, die er während der Pointe zur Schau stellen wollte, das musste perfekt sitzen, da gab es keine zweite Aufnahme wie bei einem Film, bei dem man solange die Szene wiederholen konnte, bis sich ein befriedigendes Ergebnis einstellte – auf der Bühne war alles live, und das bedeutete, dass jede einzelne Mimik sitzen musste, jede einzelne Betonung eines Wortes entschied über Sieg oder Niederlage, darüber ob das Publikum lachte oder ob es buhte, oder, was weitaus schlimmer wäre, vollkommen kalt von dem Dargebotenem blieb.
Nachdem er das Essen beendet hatte, setzte er sich ins Wohnzimmer und sah kurz Nachrichten, bevor er auf einen anderen Kanal umschaltete und eine Zeichentrickserie ansah, in welcher ein Geheimagenten-Hund ohne Hose, der mit einer Katze zusammenarbeitete und einen Floh als Boss hatte, eine Ratte verfolgte, die mal wieder die Stadt bedrohte. Ein gestaltenwandelndes Chamäleon tauchte auch auf, und Ben konnte nicht umhin zu bemerken, dass dieses als ein wenig tuckig angelegt war – nicht dass er etwas dagegen gehabt hätte, aber es schien schon bewiesen, dass der Bösewicht derjenige mit den latent homosexuellen Tendenzen war.
Schließlich sah er auf die Uhr und entschied sich eine Hose anzuziehen und nach der Post zu gucken. Er ging das Treppenhaus zu den Briefkästen runter und nahm einen Stapel Werbung heraus, die er mit nach oben nahm und gelangweilt auf den Tisch im Wohnzimmer warf, bevor er sie durchsah. Jede Woche aufs neue ein Hochglanzprospekt, das dazu aufforderte, sich neue Möbel zu kaufen – an wen richteten sich die Dinger eigentlich? An reiche Leute mit Wegwerfpsychose? Auch die anderen Prospekte boten auf wenigen Seiten wenig Artikel für viel Geld an – nichts, was ihn auch nur ansatzweise interessierte. Zwischen den bunten Blättern tauchte plötzlich ein Brief auf. Zuerst dachte Ben, dass es sich um einen dieser elendigen Spendenbriefe handelte, von der Art „Bitte geben Sie uns Geld, damit wir Gutes tun können“, aber wenn die Vereinigung wirklich Geld braucht, woher hatte sie dann bitteschön das Geld, um diese ganzen Briefe herzustellen und zu versenden? Bei näherer Betrachtung stellte sich allerdings heraus, dass der Brief von seinem Vater stammte. Er öffnete ihn und las:
„Ben, ich weiß, das kommt jetzt für dich ziemlich überraschend, aber die Situation auf dem Arbeitsmarkt ist gerade sehr schlecht. Der Firma geht es nicht gut, was du auch wüsstest, wenn du selber arbeiten würdest und dich nicht einfach von mir aushalten lassen müsstest. Und genau das geht nicht mehr. Der Firma geht es nicht gut, und ich muss überall Einsparungen vornehmen. Und bevor ich noch mehr Personal entlasse, welches es wirklich nicht verdient hat, werde ich die monatlichen Zahlungen für dich einstellen. Du bekommst noch den nächsten Monat Geld, aber das war es dann. Versuche nicht, mich umzustimmen. Es ist mir egal, was du für Probleme hast. Jeder hat seine eigenen. Und wenn du ein richtiger Mann wärst, dann hättest du auch schon längst selber Arbeit und würdest dich nicht auf dem Geld von mir ausruhen. Wenn du keine Arbeit findest, dann melde dich eben beim Amt oder mach, was immer du willst. Das ist mir egal – du bist alt genug, um selber für dich zu sorgen. Dein Vater.“
Er las nochmals, aber der unpersönliche Stil, dem sein Vater zueigen war, ließ keinen Zweifel daran offen, worum es ging. Er atmete tief durch und blickte starr auf das kleine Stückchen Papier, das ihm gerade den Boden unter seinen Füßen weggezogen hatte. Das konnte sein Vater doch nicht so einfach ... obwohl, doch, doch das konnte er, und es entsprach ihm auch ... es grenzte ja schon fast an ein Wunder, dass er ihm noch eine Gnadenfrist gewährte und noch einer Zahlung zustimmte ...
Das Einzige, was ihm durch den Kopf ging, war ein Satz: „Verdammt ... Scheiße, verdammte ...“ Er schlug sich mit der flachen Hand ein paarmal auf den linken Oberschenkel und blinzelte mehrmals. Das war nicht fair ... oder doch, vielleicht doch ... sorgfältig wähnte er seine Optionen ab: er konnte nun darüber lamentieren und noch depressiver werden und sich dann mit einem Messer die Pulsadern aufschneiden, oder er konnte es als Weckruf und Chance sehen, quasi als Jetzt-Oder-Nie-Angelegenheit, denn er wollte ja kein Geld von seinem Vater annehmen müssen und auf eigenen Beinen stehen, und nun hatte er dazu die Gelegenheit, und wenn es doch nicht funktionieren sollte, ja dann musste er eben doch zum Amt gehen und Geld beantragen, oder sonst irgendwie zu Geld kommen.
Er entschloss sich dazu, es als Gelegenheit zu betrachten und beim Auftritt im „Rosa Panther“ sein Bestes zu geben. Es musste einfach klappen, es musste ... und wenn nicht, dann blieb ihm immer noch das Messer ... aber was konnte denn schon lustiger sein als ein Clown, der zum sterben bereit war und darum nichts mehr zu verlieren hatte?
Lukas Jäger wachte auf und sah nach rechts aus dem Bett, wo er auf dem Boden zwei Perser vorfand – der eine war ein gebrauchter Teppich, und der andere lag nackt darauf. Lukas musste kurz nachdenken, dann wusste er wieder, dass er den Nackten gestern in einer Bar getroffen hatte. Der Sex hatte sich zwar ganz ordentlich gegeben, aber nichts, was längerfristig in Erinnerung blieb, aber das konnte auch am Alkohol liegen.
Er gähnte herzhaft und blickte kurz zur Decke, bevor er seine Zigaretten nahm, die neben dem Bett lagen und glücklicherweise nicht vom Perser zerdrückt wurden. Wie kam der überhaupt auf den Boden? Er zündete die Zigarette an und überlegte ... er und der Perser ... wie hieß der doch gleich? Irgendetwas mit C, da war er sich sicher. Cesaro? Cecil? Cristo? Keine Ahnung, aber irgendetwas mit C, da war er sich sicher. Also jedenfalls hatte er C-irgendwas in der Bar kennengelernt. Schrecklicher Ort, das. Die Musik war blöde, und eine Menge Touristen. Da kann man sich ja gar nicht richtig entspannen. Und dann war da dieser C. Wahrscheinlich Conchita ... nein, das ist ja ein Frauenname. Aber immerhin war dieser C-unbekannt ein richtiger Hingucker. Sind die Perser ja meistens, wenngleich auch ein bisschen eingebildet bis zur Grenze der Selbstverliebtheit. Aber doch schön knackig. Also hingegangen und gewagt, und schließlich gewonnen, auch wenn es einige Drinks gekostet hatte, aber was soll’s, solange die Latte noch steht. Und das tat sie, oh ja, die ganze Nacht, und irgendwann waren er und C-Namenlos dann im Bett eingeschlafen, aber das beantwortete nicht die Frage, wieso der Perser jetzt auf dem Teppich lag. Immerhin atmete er noch, auch wenn Lukas eher Augen für den Penis hatte als den Bauch, selbst wenn dieser fast schon durchtrainiert wirkte. Wirklich ein schöner Mann, ein echter Hingucker.
Er rauchte weiter und stand sodann auf, wobei er vorsichtig über seinen Teppichschläfer stieg und in Richtung Badezimmer ging. Er pisste und ließ die Zigarette träge aus dem Mundwinkel herabhängen. Wie lange sollte er den Typen schlafen lassen? Der konnte ja nicht den ganzen Tag hierbleiben. Nicht, dass Lukas jetzt unbedingt dringend irgendwohin musste, aber er wollte auch nicht den ganzen Tag darauf warten, dass seine Fickbekanntschaft der letzten Nacht einen geruhsamen Schönheitsschlaf hinter sich brachte. Aber ihn jetzt einfach so aufzuwecken, war ja auch nicht die feine Art, vor allem, da er noch nicht einmal seinen Namen wusste. C, es begann mit C. Chico? Nein. Chi-cha-che-chu ... oder so ähnlich. Er sollte ihm zumindest Frühstück machen, das gehörte sich so und nach dem Fick, der zwar nicht das Optimum Ultimo an Ficks darstellte, aber dann doch ganz gut gewesen sein musste, denn an schlechte erinnerte er sich, gehörte es sich einfach, dass man ein Frühstück hinstellte.
Er spülte runter und ging in die Küche, die mit leeren Einkaufstüten übersät war. Irgendwann müsste er sich mal ein Regal kaufen, in welchem er die Tüten einsortierte, aber bislang bestand dafür keine Notwendigkeit – er nahm jedesmal beim Einkaufen eine Gratistüte mit und verwendete diese dann als Mülltüte, was ja dann auch eine Form von Recycling war. Der Kühlschrank wies eine gähnende Leere auf – eine angefangene Flasche Malzbier, eine Packung mit vier angebissenen Würstchen, zudem noch eine Milchtüte, die sich bereits auf ungesunde Weise ausbeulte, dazu noch ein Glas Gurken und die Überreste einer Pizza. Die Malzbier-Flasche befand sich erst seit kurzem darin, jedoch hatte der Inhalt bereits den Geschmack des Kühlschranks angenommen und war daher eigentlich nur noch zum Mundspülen zu gebrauchen, aber nicht mehr zum regulären Verzehr. Die Packung mit den Würstchen stellte die Frage auf, wieso jedes einzelne angeknabbert wurde und keines zur Gänze gegessen war. Die Milchpackung stand bereits drin, seitdem er die Wohnung hatte – auch das Packungslogo wurde nicht mehr in dieser Form von der Milchfirma verwendet. Bei den Gurken handelte es sich um ein Geschenk, das ihm mal ein netter Typ namens Fabian gemacht hatte – und an dessen Namen erinnerte er sich, weil Fabian nicht nur ziemlich gut bestückt war, sondern auch wusste, wie er damit umzugehen hatte – und die Pizza musste wohl ebenfalls schon länger vorhanden sein, auch wenn Lukas im Moment beim besten Willen nicht wusste, seit wann dies gewesen sein könnte, aber die aufgerollten und sichtbar verhärteten Ränder deuteten darauf hin, dass es sich bereits um einige Wochen handeln musste. Da sich nichts präsentables im Kühlschrank befand, schloss er ihn, ging zurück ins Zimmer, zog sich eine Unterhose an, dann die Jeans, die allerdings zu groß ausfiel und darum wohl dem Perser gehören musste, und schließlich den Rest, woraufhin er leise hinaus ging und die Wohnungstür schloss.
Er rauchte die Zigarette zu Ende und warf sie auf der Straße in einen Gulli, bevor er sich auf den Weg zum Bäcker machte, der sich zwei Straßen weiter befand, aber mittels einer Abkürzung durch einen Schrebergarten gelangte er innerhalb weniger Minuten zu seinem Ziel. Die Verkäuferin wirkte irgendwie depressiv, was wohl mit dem blauen und leicht geschwollenen Auge zusammenhing, das sie mit Make-up mehr schlecht als recht zu verbergen suchte, aber er wollte nicht fragen, denn das ging ihn ja nichts an. Manche würden seine Einstellung als unsozial betrachten, da man sich ja um seine Mitmenschen kümmern sollte, aber er war seit jeher der Auffassung, dass man durch so was ein Problem nicht verbessern, sondern eigentlich nur präsenter machen konnte – vielleicht kam die Bäckerin gerade selber auf eine Lösung ihres Problems, und eine Einmischung, und sei sie auch noch so edel, würde die Frau nur dazu verleiten, sich nicht mehr selber um ihre Probleme zu kümmern, sondern sich auf die Hilfe von Fremden zu verlassen, und das war nun wirklich keine gute Einstellung, um mit irgendetwas fertigzuwerden. Also kaufte er zwei Croissants und verließ den Laden, um wieder die Abkürzung zu nehmen, als sich eines der Fenster der in der Nähe befindlichen Häuser öffnete und eine schnarrende Frauenstimme krächzte: „Ja ich glaub’s ja nicht! Was fällt Ihnen denn ein?“
„Meinen Sie mich?“, sagte er und gähnte erneut.
„Ja, das will ich wohl meinen!“, blaffte sie zurück. „Sie, das geht aber nicht, was Sie sich hier erlauben! Das ist kein öffentlicher Fußweg – das ist nur für die Anwohner!“
„Ich wohn doch hier.“
„Nein, nein, das tun Sie nicht.“
„Doch. Da vorn.“ Er deutete in eine unbestimmte Richtung.
„Aber Sie wohnen nicht hier in diesem Haus. Und nur, wer in diesem Haus wohnt, ist Anwohner, und nur, wer in diesem Haus Anwohner ist, darf einen Schrebergarten haben, und nur, wer einen Schrebergarten hat, darf den Weg hier benutzen!“
Er sah sich um. „Und wo ist das Schild?“
„Was für ein Schild?“