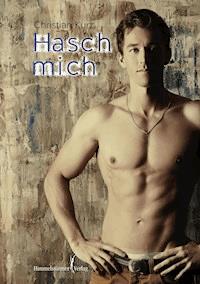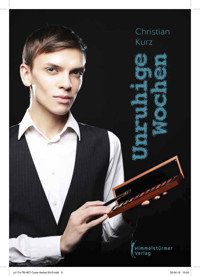Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Himmelstürmer
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Wolfgang Volkmer lebt bereits seit Monaten in den Deutschen Staaten von Amerika und ist immer noch auf der Suche nach einem Mann, mit dem er zusammen glücklich werden kann. Während der Arbeit begegnet ihm der hübsche Hotelangestellte Caleb, der ebenfalls schwul ist und als Schwarzer im von den Nazis beherrschten Land täglichen Anfeindungen ausgesetzt ist. Noch während sich Wolfgang und Caleb näherkommen, taucht aus dem Heimatland Niels auf, in den Wolfgang damals während der gemeinsamen Schulzeit heimlich verliebt war. Niels ist mittlerweile ein getreuer Staatsdiener, der alles befolgt, was die Partei vorgibt, vor allem das gnadenlose Ausrotten von Schwulen und anderen staatsfeindlichen Elementen. Das Wiedersehen mit dem ehemaligen Schulfreund gerät für Wolfgang zur Belastungsprobe. Aber auch für Caleb wird es gefährlich, da in dem Hotel, in welchem er arbeitet, gefährliche Dinge geschehen, gegen die er sich nicht zur Wehr setzen kann. Je mehr Wolfgang und Caleb versuchen, ein normales Leben miteinander zu haben, umso mehr werden sie in immer lebensbedrohlichere Situationen gezogen. Alle Anzeichen scheinen auf Krieg zu stehen, und Krieg ist nur ein anderes Wort für Mord.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 716
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Von Christian Kurz bisher erschienen:
Allein unter seinesgleichen ISBN, print: 978-3-86361-564
Hasch mich, ISBN print: 978-3-86361-567-3
Regenbogenträumer, ISBN print: 978-3-86361-491-1
Samt sei meine Seele, ISBN print: 978-3-86361-617-5
Die Welt zwischen uns, ISBN print: 978-3-86361-614-4
Alle Bücher auch als E-book
Himmelstürmer Verlag, part of Production House, Hamburg
www.himmelstuermer.de
E-Mail: [email protected], Juli 2017
© Production House GmbH
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Verlages.
Zuwiderhandeln wird strafrechtlich verfolgt
Rechtschreibung nach Duden, 24. Auflage
Cover: 123rf.com, Jaromir Chalabala
Umschlaggestaltung: Olaf Welling, Grafik-Designer AGD, Hamburg. www.olafwelling.de
ISBN print 978-3-86361-650-2
ISBN e-pub 978-3-86361-651-9
ISBN pdf 978-3-86361-652-6
Alle hier beschriebenen Personen und alle Begebenheiten sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit lebenden Personen ist nicht beabsichtigt.
Christian Kurz
Fremde Heimat
1.
Wolfgang Volkmer putzte sich wie jeden Morgen im Bad seiner kleinen Ein-Zimmer-Wohnung die Zähne und überlegte dabei, ob er noch eine schnelle Dusche nehmen sollte, bevor er zur Arbeit ging. Er blickte auf seine Wanduhr, die noch vom Vormieter stammte: es wäre noch genügend Zeit, also beschloss er zu duschen. Die Sommertage in Süd-Dakota waren sowieso dermaßen warm, dass man sich gar nicht oft genügend säubern konnte, und der Schweiß, der aufgrund der beiden Teilzeitbeschäftigungen entstand, hinterließ auch seine Spuren. Aber Wolfgang beschwerte sich nicht – das war nun sein Leben, und er würde sich nicht unterkriegen lassen. Er war noch jung, und wer jung ist, der hat vor nichts Angst.
Er spuckte den weißen Zahnpastaschaum aus, leckte sich mit der Zunge über die Zähne und betrachtete sich kurz im Spiegel, bevor er sein T-Shirt und seine Unterhose auszog und sich wieder ansah. Die Arbeit war zwar nicht so anstrengend, aber aufgrund der ständigen Beschäftigung hatte er nun einige leichte Bauchmuskeln bekommen. Nicht genug, um damit anzugeben, aber immerhin auch nicht so unauffällig, dass es niemand bemerken würde ... wenn, ja wenn er denn jemand finden würde, der sich mit ihm vergnügen wollte. Aber das war leichter gesagt als getan. Als er vor Monaten in Neu York angekommen war, weil er wusste, dass er als Schwuler nicht bei seinen Eltern bleiben konnte, ohne sie in Gefahr zu bringen, hatte er zunächst einen großen Kloß im Hals gehabt. Alles schien möglich, und das war einfach zu überwältigend gewesen. Wenn alles möglich ist, dann blockierte sich alles irgendwie gegenseitig, was dazu führte, dass er die ersten drei Tage in einer Herberge verbrachte, ohne sich wirklich nach draußen zu trauen.
Dann aber hatte er sich getraut und die Stadt erkundigt, und Neu York war so viel größer als jede andere Stadt in Deutschland. Es schien fast unvorstellbar, dass es der Partei im großen Krieg gelang, diese Stadt zu erobern, nicht zu sprechen vom Rest des Landes, das nun die D-S-A war. Aber das war wohl ein ewiges Zeugnis für die Stärke der Partei – einer Partei, die Allem ihren Stempel aufdrückte und die alles, was jenseits ihrer Norm lag, nicht tolerieren wollte. Als Wolfgang durch Neu York ging, hörte er zwar nur deutsche Stimmen (ganz, ganz vereinzelt auch einige japanische und italienische), aber er begegnete niemanden, vom dem er annehmen könnte, dass diese Person genauso wie er Männer liebte. Jeder Neu Yorker war laut und dabei gleichzeitig auf eine seltsame Art in sich gekehrt, quasi ein wandelnder Widerspruch in sich. Wahrscheinlich machte sich der Zwiespalt in ihnen bemerkbar, dass sie mit Gewalt auf Deutsch getrimmt worden waren, und obwohl sie es niemals nach außen oder sich selber gegenüber zugeben würden, schien es sie im Kern zu irritieren. Und solche Leute konnte Wolfgang nun wirklich nicht danach fragen, ob es in dieser Riesen-Metropole nicht doch irgendwo einen Ort gab, an dem sich Schwule ungestört treffen könnten. Wie hätte er denn auch danach fragen können? Und vor allem: wen? Er kannte doch niemanden hier. Er war auf sich allein gestellt, aber genau das hatte er ja gewollt, damit er endlich er selber sein könnte.
Nach einigen Tagen fast schon ziellosen Herumtreibens in der Stadt war er sodann weitergereist. Nach Harrisburg, dann nach Columbus, und dort ging ihm sein Erspartes aus. Aber das war kein großes Problem, da er relativ schnell eine Anstellung als Küchenhilfe finden konnte. Die Gastfreundschaft mancher Leute war einfach überwältigend, denn im Gegensatz zu den Neu Yorkern schienen diese ihr Deutsch-Sein regelrecht zu zelebrieren. Warum denn auch nicht? Wenn man auf der Gewinnerseite stand und es nichts gab, was die Partei gegen einen haben konnte, dann wäre man doch nur dumm, wenn man protestierte. Nachdem Wolfgang etwas Geld verdient hatte, ging es weiter ins Land, von einer Stadt in die nächste und von einer Gelegenheitsarbeit zur anderen. Junge Hände waren immer gern gesehen, und zumeist verlangten die Arbeitgeber höchstens mit einem kumpelhaften Grinsen, dass man sich von ihren Töchtern fernhielt – ein Versprechen, das Wolfgang nur allzu leicht geben konnte, aber er hatte sich relativ schnell angewöhnt, so zu tun, als würde er Frauen mögen. Das war sicherer und sorgte dafür, dass niemand dumme Fragen stellte.
Natürlich machten sich dann und wann in den langen, einsamen Nächten auch Gewissensbisse bemerkbar. Was würde denn seine Mutter gerade denken? Oder sein Vater? Er sollte es ihnen erklären – er musste. Einmal hatte er sich vorgenommen, einen langen Brief zu schreiben, in denen er alles erklärte. Wirklich alles. Aber er wusste, dass dieser Brief leicht abgefangen werden konnte. Garantiert überprüfte die Partei sämtlichen Schriftverkehr, der von den D-S-A in die Heimat ging. Da konnte die Offenbarung, dass er Männer liebte, doch nur negative Folgen haben. Nicht nur für ihn, sondern eben auch für seine Eltern. Er wollte sich nicht einmal auch nur ansatzweise vorstellen, dass die Staatspolizei den Brief las und daraufhin seine Eltern verhörte, ob diese denn nicht gewusst hätten, dass ihr Sohn aufgrund seiner parteifeindlichen Veranlagung ein Staatsverbrecher sei. Er wusste, dass genau das passieren würde, wenn er einen solch offenen Brief abschickte. Aber irgendetwas musste er ihnen mitteilen, damit sie sich keine Sorgen machten. Also schrieb er einfach eine Postkarte mit dem Vermerk, dass es ihm gut geht und er noch ein wenig länger bleibt – macht euch keine Sorgen, ich habe Arbeit gefunden – alles in Ordnung – hab euch sehr, sehr lieb. Das musste reichen, und die Gewissensbisse wurden dadurch vorerst auch beruhigt.
Schließlich, nach einigen Wochen, kam er in Süd-Dakota an, und dieses Gebiet unterschied sich kulturell gewaltig von all den anderen Gegenden, die er bislang in den D-S-A bereist hatte. Da sowohl die angrenzenden Staaten Nord-Dakota, Montana und Wyoming zu den Japanischen Staaten von Amerika gehörten, waren die Leute hier aufgrund der Einflüsse der asiatischen Kultur ein wenig anders eingestellt als im Rest des Landes. Immerhin wurden hier die Schwarzen nicht allesamt erfasst und dann später zwangskastriert – etwas, das Wolfgang zunächst gar nicht glauben konnte, dann aber so oft gehört hatte, dass es wohl stimmen musste. Überhaupt übten Schwarze irgendwie eine fast schon unglaubliche Anziehung auf ihn aus. Höchstwahrscheinlich lag das darin begründet, dass er noch nie zuvor einen gesehen hatte, und als er dann zum ersten Mal in seinem Leben welche von ihnen sah ... da hatte irgendetwas in ihm Klick gemacht, und er hatte ein schönes, warmes Gefühl, nicht ganz unähnlich dem Wasser, das nun aus dem Duschkopf rauskam und ihn nass machte.
Er seifte sich ein und ließ die Fingerspitzen dabei sanft an seinen Seiten heruntergleiten. Er schloss die Augen und stellte sich vor, dass er jemand zum Liebhaben mit sich in der Dusche hätte. Er musste lächeln und bemerkte, dass er gerade eine ziemlich harte Erektion besaß. Er packte mit der rechten Hand seinen Penis und holte sich einen runter, während er gleichzeitig mit der linken Hand über seinen Bauch, seine Brust und sodann an seinen Hoden herumstreichelte. Das schöne Gefühl, das dabei entstand, breitete sich überall im Körper aus. Er überlegte wie es wäre, wenn er endlich einen Hübschen zum Liebhaben finden würde. Was würden sie dann alles miteinander anstellen? Und wie würden sie es denn machen? Er wusste dank der Winkel-Bücher, die er im versteckten Raum im Buchladen von Herrn Rommler gelesen hatte, welche Arten von schwuler Liebe es eigentlich gab. Würden er und sein noch unbekannter Hübscher sich gegenseitig den Penis lecken? Sanft über die Spitze, dann die Zunge herumkreisen lassen, alles in den Mund nehmen und daran herumsaugen, bis sich die aufgestaute Lust entlud? Oder doch eher in den Hintern? Würde das nicht wehtun? Wolfgang wusste es nicht, da er diese Erfahrung eben noch nicht erlebt hatte, aber noch mit geschlossenen Augen führte er seine linke Hand von seinen Hoden weg in Richtung seines festen Hinterteils. Er ließ die Finger ein wenig an seinen After herumgleiten und beschleunigte währenddessen das Tempo mit der rechten Hand. Das Wasser plätscherte auf sein Gesicht, seine Brust und lief von dort an ihm runter – er beugte den Kopf ein wenig nach vorne, wodurch das warme Wasser an seinem Rücken runterlief und an seine Pobacken kam. Er rieb mit dem linken Zeigefinger am After herum, sodass sich der Schließmuskel lockerte. Schließlich steckte er den Finger ein wenig hinein, aber nicht zu weit, da es ein neues, unbekanntes Gefühl war und er es vorsichtig angehen lassen wollte. Er öffnete die Augen und unterließ die Bewegungen mit der rechten Hand für einen Moment. Langsam bewegte er den linken Zeigefinger tiefer in sich rein. So würde sich das also anfühlen ... wenn der Schwanz von seinem Zukünftigen ziemlich dünn wäre. Er musste noch den Mittel- und den Ringfinger hineinbringen, um einen wirklich Eindruck zu bekommen, aber er zierte sich, weswegen er den Finger rauszog und abwusch. Dennoch – es war ein Anfang. Und wo ein Anfang ist, da geht es auch weiter. Er machte mit der rechten Hand wieder einige Bewegungen, auch wenn sein stahlharter Penis keinerlei Anzeichen machte, wieder schlaff zu werden – er war jung, da blieb eine Erektion, wenn nötig auch stundenlang vorhanden. Er befeuchtete seine Hand wieder mit Wasser, bevor er erneut an seinem After spielte und diesmal die drei Finger hineinbrachte. Er musste leicht nach Luft schnappen, da ihn das Gefühl überwältigte. Nun bewegte er sowohl die rechte wie auch die linke Hand hin und her, wodurch sein ganzer Körper rote Flecken der Wollust produzierte. Das Gefühl übernahm ihn komplett und kam durch eine enorme Entladung zu einem wahrhaft schönen Ende.
Wolfgang japste leicht, wischte über die nun klebrige Stelle an der Wand und säuberte seine Hände, bevor er den Wasserhahn zudrehte und sich mit dem Handtuch abtrocknete. Egal, wie schön das Erlebnis gerade auch war – mit einem richtigen Mann an seiner Seite würde es noch viel schöner werden. Er sah sich wieder im Spiegel an und lächelte entspannt, bevor er erneut zur Wanduhr blickte: verdammt, er würde zu spät kommen.
Es war zwar nur eine Teilzeitarbeit, aber dennoch sollte er es nicht darauf ankommen lassen, weswegen er sich schnell anzog. Am Abend musste er sowieso noch woanders arbeiten, damit er genügend Geld hatte, um die Miete zu bezahlen und sparen zu können, weshalb er es nun wirklich nicht brauchen könnte, wenn Frau Dante ihn die Zeit, die er zu spät kam, länger arbeiten ließ. Da stand das Geldverdienen leider dem Erleben von schönen Erfahrungen eindeutig im Weg, aber auch das würde noch kommen. Da war er sich sicher.
Herr Kissler verzog sein Gesicht und entfernte die Bandagen um seine Füße, welche stark stanken. Die offenen Stellen nässten aufgrund des warmen Sommers wieder ziemlich stark, und der Geruch wurde mit jeder entfernten Bandage umso intensiver. „Verdammt ... verdammt ...“, sagte er mehr zu sich als zu seiner Tochter, die sich ebenfalls im Büro des Hotelchefs befand.
Gerda kannte den Anblick der Füße zur Genüge, genauso wie sie deren Entstehungsgeschichte schon oft von ihrem Vater gehört hatte: dass er noch ganz normale Füße hatte, als er sich für den Dienst an der Waffe einschrieb und er noch ganz normale Füße besaß, als er einige geisteskranke Volksverräter in Griechenland erschoss. Aber als er dann am Ende seines Dienstes in Frankreich seine Schuhe auszog und die Füße in den Fluss steckte, um sie abzukühlen, ja ab dem Moment hatte er das Problem, und auch wenn die Wissenschaftler enorme Fortschritte auf nahezu allen Gebieten gemacht hatten, so war es ihnen anscheinend immer noch nicht möglich, ein Heilmittel für offene Füße zu finden. Das Einzige, was es anscheinend geben würde, wäre Amputation, oder Totalverätzung – dann wären die Füße zwar nicht mehr zu gebrauchen, aber immerhin auch nicht länger offen. Das konnte und wollte ihr Vater aber nicht, weswegen er nun eben mit den offenen Stellen lebte und zur Betäubung der Schmerzen jeden Tag Pervitin-Schmerzmittel nahm.
„Hier“, sie reichte ihm eine Tablettendose.
Er nahm sie wortlos an sich und schluckte drei Stück auf einmal. „Ich brauche neue Bandagen.“
Sie ging zu einem der Schränke im Büro und holte es für ihn.
Er nahm sie an sich und legte die dreckigen Bandagen neben sich auf den Tisch. „Hast du schon deine Runde gemacht?“, fragte er, während er seine Füße wieder einwickelte.
„Ich dachte, das mache ich erst nachher – du musst doch erst ...“
„Die Runde ist wichtiger“, unterbrach er sie fast schon schroff. Immer, wenn er Pervitin nahm, schien sich seine Laune schlagartig zu ändern, und da er jeden Tag diese Schmerzmittel nahm, erschien er gelegentlich fast schon unberechenbar. „Du weißt doch: die Hausnigger darf man nie an die lange Leine lassen. Denen darf man nie das Gefühl geben sich Freiheiten zu erlauben. Ich finde zwar nicht, dass man die wie Tiere behandeln muss, so wie die das in den großen Städten machen, aber man darf die Zügel bei denen nicht lockerlassen. Die müssen immer wissen, dass man der Herr ist. Da darf man niemals Schwäche zeigen.“
„Ich weiß, ich weiß“, nickte sie, da sie den Vortrag schon zur Genüge kannte. „Johann kann sich doch auch darum kümmern ...“
Er schüttelte den Kopf. „Johann wird am Empfang gebraucht. Und du bist meine Tochter, und ich bin der Chef dieses Hotels, also musst du das machen. Irgendwann sollst du ja schließlich das Hotel übernehmen. Da kannst du gar nicht früh genug damit anfangen, Verantwortung zu übernehmen.“
„Ich weiß – ich bin schon 19, und ich ...“
Er machte ein grunzendes Geräusch, da er ihr nicht länger zuhören wollte. „Geh und mach deine Runde. Ich komme hier allein zurecht.“
Sie atmete einmal leicht durch, nickte und verließ sodann das Büro. Sie wusste, dass ihr Vater es nicht so unhöflich meinte, wie man es aufgrund seines Tonfalls vermuten musste – es war das Schmerzmittel, das aus ihm sprach. Nichts weiter. Mit normalen Tempo ging sie zum Empfang, wo Johann auf seinem Stuhl saß und ein wenig geistesabwesend vor sich hinsah. „Nicht schlafen.“
Er lächelte sie an. Er war nur ein paar Jahre älter als sie, und es war deutlich, dass er ein gewisses Interesse an ihr besaß. „Ich schlafe nie bei der Arbeit.“
Sie erwiderte das Lächeln. „Wo ist Caleb?“
„Wo soll der Nigger schon sein? Bei seiner Arbeit, denke ich mal.“
„Sag nicht immer Nigger – das ist ...“ Sie ließ den Satz unbeendet.
Johann zog eine Schnute. „Das Thema hatten wir doch schon. Es heißt nun einmal Nigger, und die Bezeichnung für die Nigger, die bei uns arbeiten, lautet Zimmernigger. Selbst wenn wir die jetzt alle anders nennen, so wie du das willst, ändert das nichts ...“
„Ja, ich weiß“, unterbrach sie und rollte mit den Augen. „Du hast es mir erklärt, mein Vater hat es mir erklärt. Aber trotzdem ... ich finde Nigger ...“
„Wenn wir es dir erklärt haben, dann ist doch alles in Ordnung.“ Er lächelte und deutete in Richtung des Büros. „Musst du wieder die Zimmernigger überprüfen?“
„Ständig. Da ist mein Vater ganz eigen.“
„Kann man ihm ja auch nicht verdenken. Die sehen zwar aus wie Menschen, aber wenn es richtige Menschen wären, dann hätte die Natur sie nicht schwarz gemacht und so für alle anderen als minderwertige Untermenschen gekennzeichnet. Gibt sowieso zu viele von denen. Ich sag dir, da muss man aufpassen.“
„Sicher ... also? Wo ist Caleb?“
„Habe ich dir doch schon gesagt. Bei der Arbeit.“
„Und wo genau?“
Johann überlegte. „Um die Zeit? Wenn der Nigger nicht faul ist, dann im zweiten Stock. Aber wenn er faul war, dann kann er überall sein. Wie soll ein Nigger auch merken, ob er sich auf die faule Haut gelegt hat? Er ist doch schon schwarz.“ Er grinste frech.
„Sicher.“ Sie ging zu den Treppen.
„Hast du nachher noch etwas vor?“, rief er ihr hinter dem Empfangstresen hinterher. „Wir könnten ins Kino gehen.“
„Erst die Arbeit.“
„Ist das ein Ja?“
„Erst die Arbeit“, wiederholte sie und ging die Treppen hoch in den zweiten Stock des alten Hotels, das seine besseren Zeiten noch nicht hinter sich haben konnte, weil es noch nie gute Zeiten gesehen hatte. Das Gebäude war zwar nicht renovierungsbedürftig, allerdings auch nicht auf dem neusten Stand. Dennoch fanden sich genügend Gäste ein, um die Betriebskosten zu decken, und zu diesen Kosten gehörten auch die drei Zimmernigger, die man zu anderen Zeiten wohl als Zimmerbedienstete bezeichnet hätte. Da diese Posten allerdings ausschließlich an Farbige vergeben wurden, hatte sich der neue Begriff allgemein eingebürgert, und lediglich Gerda schien daran Anstoß zu nehmen. Sie mochte es einfach nicht, wenn Leute sich anderen Personen gegenüber als überlegen aufführten, und leider taten das viele, scheinbar einzig und allein aufgrund der herabsetzenden Bezeichnung.
Caleb, ein junger Schwarzer mit kurzgeschnittenen Haaren, kam gerade aus einem der Hotelzimmer und sah Gerda. „Hallo, Frau Kissler“, sagte er freundlich.
Sie lächelte. „Ich habe dir doch schon oft gesagt, du sollst mich bitte nicht so nennen. Das klingt so, als wäre ich eine alte Frau.“
„Ja, aber wie soll ich Sie denn dann nennen?“
„Einfach Gerda. Ich nenne dich doch auch bei deinem Vornamen.“
Caleb schüttelte den Kopf. „Das darf ich nicht. Dann wäre ich gleich die Arbeit los. Und wenn Herr Kissler mitbekommen würde, dass ich Sie nicht als Frau Kissler anspreche, dann wäre ich auch meine Arbeit los.“
Sie nickte. „Das würde ich nicht wollen.“
Er lächelte. „Ich auch nicht.“
„Wie weit bist du denn schon mit den Zimmern?“
Er zeigte nach vorne. „Ich muss nur noch drei weitere machen. Da war zwar niemand drin, aber Herr Kissler besteht ja darauf, alles jeden Tag zu säubern“
Sie nickte erneut. „Ja, da ist er eigen. Und deine Kollegen?“
„Jerome dürfte noch im ersten Stock sein, und Deacon ist anscheinend schon mit dem dritten Stock fertig. Jedenfalls habe ich ihn vorhin gesehen, aber vielleicht ist er auch nur kurz wohin gegangen. Ich will da nichts Falsches sagen.“
Gerda lächelte verschmitzt. „Ich habe Jerome nicht im ersten Stock gesehen, aber ehrlich gesagt, habe ich auch gar nicht so genau nachgeguckt.“
„Er müsste aber da sein. Er wird nicht einfach weggegangen sein.“
„Du weißt schon, du kannst mit mir offen sprechen. Ich beiße dich nicht.“
Caleb nickte. „Ja, sicher, aber alles sollte ich ja doch nicht sagen. Ich möchte nicht etwas Falsches sage. Deacon und Jerome sind immerhin meine Kollegen, da sollte ich nichts sagen, was nicht gut für die beiden ist.“
„Das verstehe ich. Ihr seid ja immer zusammen.“
Er zog eine Schnute. „Naja, nicht immer. Aber meistens. Wir gehen nach der Arbeit ja auch immer mal wieder wohin. Aber manchmal gehe ich nicht mit, weil mir das nicht gefällt. Aber was rede ich denn da – so was interessiert Sie doch nicht, und ich muss mit meiner Arbeit weitermachen.“
Sie nickte. „Dann will ich dich nicht länger aufhalten.“ Sie ging zu den Treppen und begab sich ein Stockwerk höher. Caleb war ein guter Angestellter, zwar aufgrund seiner nur marginal vorhandenen Schulbildung ziemlich unbelesen, aber immerhin verfügte er über eine bessere Arbeitsmoral als die beiden anderen. Jerome und Deacon waren auch schon einige Jahre länger im Hotel angestellt, weshalb sie die Arbeitsvorgaben manchmal sehr eigen interpretierten und unbenutzte Zimmer nicht jeden Tag, sondern gelegentlich auch nur einmal die Woche säuberten. Mehr war zwar streng genommen auch nicht nötig, aber wenn der Chef etwas anderes anordnete, dann sollten sich die Angestellten auch daran halten. Das sah Gerda tief in sich eigentlich genauso: ein Befehl war ein Befehl, unabhängig von der Hautfarbe. Überhaupt wirkte die Nachlässigkeit von Jerome und Deacon manchmal so, als würden sie von den Problemen des Chefs mit seinen Füßen wissen, aufgrund dessen er nicht dazu in der Lage war, die Arbeit seiner Angestellten zu überprüfen. Sollte ihr Vater je davon erfahren, wie die beiden die Zimmer säuberten, dann würde je nach Pervitin-Laune ein Gewitter oder gleich das Jüngste Gericht über die beiden hereinbrechen.
Gerda erreichte den dritten Stock und konnte Jerome und Deacon bereits von weitem miteinander reden hören. Sie schlich sich an und lauschte durch die halb geöffnete Tür des Hotelzimmers, in welchem die beiden waren. „... hatte doch einen guten Arsch“, meinte Jerome, „und gut sah die auch aus, aber der Arsch war doch das Beste. Du hast sie doch auch gesehen.“
„Klar habe ich die gesehen“, sagte Deacon mit seiner sehr tiefen Stimme, „aber er wollte sie ja nicht, er wollte sie ja nicht haben.“
„Ich verstehe den manchmal nicht. Ich meine, der soll sich nicht so anstellen. Er hat doch genügend Auswahl. Kann doch nehmen, welche er will. Mit großen Titten und kleinem Arsch, oder mit kleinen Titten und großen Arsch, oder beides klein oder beides groß. Gibt doch genug Auswahl. Aber er nimmt nie eine.“
„Ja, ich weiß. Vielleicht will er sich ja aufsparen.“
„Aufsparen.“ Jerome lachte dreckig. „Frauen sparen sich auf, aber Männer nehmen sich gleich alles. Sonst denkt dein Prügel doch, du respektierst ihn nicht, wenn du ihn nicht immer wieder ins Loch steckst. Männer müssen sich nicht aufsparen.“
Deacon lachte ebenfalls. „Ja, da hast du Recht, da hast du vollkommen Recht. Bei Frauen ist das wirklich was anderes. Die verkleben, wenn die zu viel mit anderen rummachen. Wenn die mit jedem Mann rummachen, dann wird die ganze Sülze von den Leuten zu Kleber in denen drin, und da steckt doch niemand mehr etwas rein. Aber wenn ein Mann nicht abspritzt, dann verklebt es ihn innen, und dann geht nichts mehr.“
„Genau. Du sagst es, Bruder, du sagst es. Aber der Junge will ja nicht. Und man kann ihn ja jetzt auch nicht zu einer Nutte bringen und die beiden in einen Raum einsperren. Das ist doch auch nicht das richtige. Aber mehr als ihn mitnehmen und ihn auf die Frauen loslassen, können wir ja nicht tun.“
„Meinst du, er ist ...“, fing Deacon an, als Gerda sich dazu entschloss, die Tür zu öffnen.
„Wer ist was?“, sagte sie und sah, wie Jerome auf dem Gästebett lümmelte, während Deacon am offenen Fenster stand und eine Zigarette rauchte. Sofort sprang Jerome regelrecht auf, während sein Kollege die Zigarette erst aus dem Fenster werfen wollte, sich aber dann doch dazu entschloss, sie aus dem Mund in die Hand zu nehmen und diese hinter seinem Rücken zu verstecken. „Ich habe euch doch hoffentlich nicht bei der Arbeit gestört, oder?“
„Nein, nein, wir ... ähm ...“, fing Jerome an und begann damit, das Bett wieder herzurichten.
„Wir haben nur eine kleine Pause gemacht“, beteuerte Deacon.
„Habe ich mitbekommen.“ Gerda sah beide nacheinander an. „Worüber habt ihr euch denn unterhalten?“
„Nichts Besonderes. Über Caleb.“ Er strich das Bettlaken wieder glatt.
Wäre ihr Vater hier gewesen, so hätte er die beiden nicht nur angeschrien, sondern auch darauf bestanden, das Bettlaken nun frisch zu überziehen, da man es den zukünftigen Gästen nicht zumuten könnte, dort zu liegen, wo ein Farbiger zuvor lag. Gerda sah die Sache allerdings entspannter, weshalb sie nichts dergleichen sagte. „Ich habe etwas über dicke Ärsche und kleine Titten gehört.“
Deacon nickte verlegen. „Nun ja, das müssen Sie bitte verstehen ... wenn wir mit der Arbeit fertig sind, dann ... gehen wir eben wohin und ...“
„Und ihr nehmt Caleb immer mit, ja?“
„Sicher – der Junge muss ja auch etwas vom Leben haben.“
Sie grinste. „Frauen mit dicken Titten?“
Jerome antwortete: „Das mag doch jeder.“
Sie vermittelte allein durch ihr Stimmlage die Gewissheit, dass alles in Ordnung war und sie ihrem Vater nichts von alldem hier erzählen würde. „Also Männer ganz sicher, aber vielleicht will er einfach nicht gleich direkt ins Wasser gestoßen werden. Manche wollen eben erst in Ruhe gucken und brauchen dann eine Weile, bevor sie sich entscheiden. Unter Druck gesetzt zu werden ist da eher schädlich. Warum geht ihr mit Caleb nicht einfach mal wieder ins Kino?“
Deacon öffnete den Mund um etwas zu sagen, als die Zigarette ihn leicht an den Fingern verbrannte, weswegen er sie geradezu panisch aus dem Fenster warf. „Dammt, dammt nochmal!“, sagte er laut und meinte sogleich kleinlaut: „Entschuldigung ...“
„Macht nichts. Also?“
Jerome bewegte den Kopf ein wenig hin und her. „Naja, Kino ist zwar schön und gut, aber wir dürfen ja nur ins Niggerkino, und da läuft seit Wochen nur der eine gleiche Film, und den haben wir schon gesehen.“
„Caleb auch?“, hakte sie nach.
Jerome antwortete, während Deacon sich den leicht angebrannten Finger in den Mund steckte: „Ja. Wir haben ihn mitgenommen. War aber kein guter Film.“
„Aber es waren auch Frauen im Publikum?“
„Denke schon.“
„Na, dann passt es doch“, lächelte sie. „Ihr geht ins Kino und nehmt Caleb mit. Da ihr den Film schon gesehen habt und der sowieso nicht gut ist, habt ihr Gelegenheit, während dem Film im Publikum rumzugucken und nach einer netten Frau zu gucken. Und da wird bestimmt auch Caleb eine finden.“
Jerome nickte. „Das ist eine gute Idee. Das sollten wir machen.“
„Aber“, sagte Deacon, „das Kino ist teuer.“
Gerda griff in ihre Tasche und holte drei Geldscheine heraus. „Hier – ihr nehmt ihn mit und lasst es euch gut gehen. Aber nichts meinem Vater sagen, verstanden?“
Jerome zögerte. „Das können wir nicht ...“
„Doch, könnt ihr.“ Sie nahm seine Hand und drückte das Geld rein. „Keine Sorge, ich werde es nicht von eurem Gehalt abziehen. Das ist einfach ... nehmt es einfach.“
„Danke, danke“, sagte er.
Deacon nickte ebenfalls. „Vielen Dank, das ist sehr freundlich von Ihnen.“
Sie lächelte gütig. „Passt in Zukunft einfach auf, das ihr euch nicht auf die Betten setzt. Oder wenn ihr es doch tut, dann schließt die Tür.“
„Aber dann hören wir doch nicht, falls jemand kommt“, meinte Deacon etwas bräsig.
„Das habt ihr jetzt auch nicht.“ Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, lächelte sie beide nochmals an und verließ sodann das Zimmer. Sie ging die Treppen runter und kam wieder zum Empfangstresen, hinter dem Johann wieder faul im Stuhl saß. „Nicht schlafen.“
„Ich schlafe nicht“, sagte er sofort. „Ich beobachte.“
„Sicher.“ Sie schritt an ihm vorbei und öffnete die Tür zum Büro. Ihr Vater nahm noch eine Handvoll Schmerztabletten. „So schlimm heute?“
„Frag nicht so dumm“, maulte er sofort. Seine Laune wurde also wieder gereizter. „Hast du deine Runde gemacht?“
Sie schloss die Tür hinter sich. „Ja. Alles in Ordnung.“
„Sollte es auch besser sein. Ich sage dir, diese Nigger, die sind eine Plage. Aber billig sind sie, aber auch nur, weil sie eine Plage sind. Gute Arbeiter kosten Geld, aber Nigger machen alles für wenig Geld, aber wenn man sie nicht überprüft, dann fressen sie einem die Haare vom Kopf.“ Schlagartig verstummte er und blickte starr ins Leere.
„... ist etwas?“
„... hast du die Küche überprüft?“
„Die Küche?“
„Ja, die Küche.“ Sein Blick wurde fahrig. „Verdammt nochmal, wir haben Nigger im Haus. Die haben ihre schwarzen Finger bestimmt an unserem Essen gehabt. Das sieht denen doch ähnlich. Das haben die doch in ihrem dreckigen Blut. Die können doch gar nicht anders. Die klauen einem das Essen doch sogar aus der Hand. Das liegt denen einfach im Blut. Das Blut von denen ist krank. Darum sind die auch schwarz. Schwarz wie die Sünde. Genau.“ Er starrte sie mit einem durchdringenden, krankhaften Blick an. „Du musst sofort in die Küche und das ganze Essen wegschmeißen lassen. Sag denen, sie müssen das Essen wegwerfen.“
„Das ganze Essen?“
„Ja doch. Das ganze Essen. Wir können nicht riskieren, dass einer unserer Gäste so eine Niggerkrankheit bekommt. Das ruiniert uns doch nur.“ Er atmete stoßartig.
Gerda überblickte die Situation gekonnt – ihr Vater hatte mal wieder eine seiner paranoiden Phasen, in welchen er hinter allem nur Verrat und Betrug witterte. Irgendetwas im Schmerzmittel musste für diese Reaktionen verantwortlich sein, aber er brauchte das Pervitin, also konnte man nichts anderes tun als mit seinen Launen verantwortungsvoll umzugehen. „Ich werde es sagen, aber ich bin sicher, dass keiner seine Finger an unserem Essen hatte.“
„Und woher weißt du das? Woher willst du das wissen? So ein Nigger hinterlässt doch keine Fingerabdrücke. Guck dir die Hände von denen doch nur mal an. Hast du die schon mal genau angesehen? Ich habe die angesehen. Die sind weiß – die Handinnenflächen von denen sind weiß.“ Er atmete erregt ein und aus, so als wäre er einer großen Verschwörung auf die Schliche gekommen. „Innen sind die weiß wie bei normalen Menschen, und darum glauben die, sie können sich alles einfach so schnappen. Weil die Hände innen weiß sind. Aber die sind trotzdem weiterhin Nigger, und Nigger sollten nicht Sachen anfassen, die für Weiße sind.“ Er sah seine Tochter schlagartig mit einem Gesichtsausdruck an, der zwischen besorgt und fanatisch schwankte: „Lass nicht zu, dass dich einer von denen anfasst. Hörst du? Lass das ja nicht zu. Die verseuchen dich sonst. Und das könnte ich nicht ertragen.“
„Keine Sorge, ich passe auf mich auf ...“ Sie wartete, ob er noch etwas sagte, aber er starrte sie nur unbehaglich an. „Soll ich in die Küche gehen?“
Er blinzelte. „Wieso?“
„Weil ich das doch sagen sollte.“
„Sagen?“
„... ich sollte dir doch etwas zum essen und trinken bringen. Ja?“
Herr Kissler nickte. „Ja ... das klingt gut ... ja.“ Seine Lippen bebten. Er lehnte sich in seinem Stuhl zurück und atmete ruckartig, während ihm der kalte Schweiß von der Stirn runterlief.
„... nimm nicht so viel von diesen Tabletten. Bitte“, sagte sie schwach.
Er schloss die Augen. „... ich muss doch ... die Füße ... ich muss ...“ Er verstummte.
Gerda verließ das Büro und ging langsam in Richtung der Küche, wobei sie erneut am Empfang vorbei musste. Johann stand aufrecht dahinter. „Siehst du – diesmal sitze ich nicht. Du kannst mich also in meiner ganzen Pracht bewundern.“
Sie rang sich ein Lächeln ab. „Die ganze Pracht, wie? Wenn es für dich reicht.“ Sie ging an ihm vorbei.
„Was sollte denn das heißen?“, sagte er mehr zu sich selber, bevor er ihr nachsah und sodann leise ausstieß: „Fotze. Gehörst mal gefickt.“
„Bist du schon fertig mit dem Aussortieren in dieser Reihe?“, wollte Frau Dante wissen.
Wolfgang hob die Bücher, die er in der Hand hielt, ein wenig hoch. „Fast fertig. Darin habe ich schon Übung.“
„Schön für dich.“ Sie ging durch ihren Buchladen und steuerte direkt auf einen Kunden zu, um diesen zu fragen, ob sie ihm weiterhelfen könnte.
Wolfgang beförderte die Bücher in den Rollwagen vor sich. Der Buchladen von Frau Dante war um einiges größer als der von Herrn Rommler, aber das Prinzip war eigentlich das gleiche: auch hier in den D-S-A gab es immer wieder Listen, welche Bücher aus den Regalen entfernt werden mussten. Da es sich um eine ziemliche Menge handelte, war Frau Dante froh gewesen, als Wolfgang bei ihr um eine Arbeit nachgefragt hatte – so konnte er den gesamten Laden säubern, während die eigentlichen Angestellten sich weiterhin um die Kunden kümmern konnten. Und weil die Partei in der D-S-A fast jede Woche neue Listen ausgab, hatte er gelegentlich noch nicht einmal die alte Liste vollständig abgearbeitet, bevor er auch schon die nächste machen musste. Alles in allem handelte es sich um eine beständige und zugleich auch relativ entspannte Tätigkeit, wenngleich diese auch nur darin bestand, altes Wissen von den Leuten fernzuhalten.
Da es sich um einen zweistöckigen Laden handelte, fielen die aussortierten Bücher nicht weiter auf – kaum war eine Lücke entstanden, wurde sie auch schon sofort durch Neuerscheinungen geschlossen. Das Einzige, was es hier nicht zu geben schien, waren die Winkel-Hefte, die Wolfgang im Laden von Herrn Rommler so geliebt hatte. Was war nur aus Herrn Rommler geworden? Das letzte Mal, als Wolfgang ihn gesehen hatte, wurde der Alte von der Staatspolizei abgeführt. Hatten sie ihn ins Gefängnis gesteckt? Wahrscheinlich. Oder noch Schlimmeres mit ihm gemacht? Anzunehmen. Und das nur, weil er in seinem Laden Hefte verkaufte, in welchen Männer mit anderen Männern Liebe machten. Es verwunderte darum nicht wirklich, dass sich in einem größeren Buchladen diese Art von Literatur nicht befand – Frau Dante würde nie im Leben das Risiko eingehen, der Staatspolizei negativ aufzufallen.
Wolfgang vermisste die Hefte. Es war eine Offenbarung gewesen, über andere Menschen zu lesen, die genauso waren wie er. Männer, die Männer liebten und sich dafür nicht schämten. Die es als etwas Normales ansahen. Als Teil ihrer Selbst. Ohne diese Hefte hätte er sich wohl weiterhin für etwas Abnormales gehalten – etwas, das nicht in die Gesellschaft passte. Wahrscheinlich wäre er ein Einsiedler geworden, jemand, der sich nicht unter die Menschen traute, weil er sich schämte, so zu sein wie er nun einmal war. Er hätte sich verleugnet, verbogen und damit um sämtliches Potenzial gebracht, das er besaß. Aber dazu war es zum Glück nicht gekommen. Er wusste, wer er war. Er war Wolfgang Volkmer, und er war schwul. Das durfte er zwar nicht so offen zeigen wie er es sich wünschte, aber er brauchte sich auch nicht in einem Zimmer vor der Welt zu verstecken. Nein, das brauchte er nicht. Er konnte die ganze Welt erkunden, wenn er es wollte – warum denn auch nicht? Er war schwul, ja, aber das schränkte ihn doch nicht ein – im Gegenteil, seit er sich dessen bewusst geworden war, hatte er eine Selbstsicherheit erlangt, die er zuvor nicht in sich vermutet hätte. Zuvor hätte er sich doch nie getraut, in die D-S-A zu reisen und dort sein Glück zu suchen. Aber die Hefte hatten ihm ein Ziel gezeigt ... das zwar Kanada hieß, aber der Weg ist das Ziel, und direkt nach Kanada zu gehen, war dann doch ein Schritt, der noch zu groß erschien. Immerhin waren Reisen dorthin komplett verboten, und wenn er es nicht schaffen sollte, hier auf eigenen Füßen zu stehen, dann würde es in Kanada auch nicht gelingen. Und hier konnte er im Notfall immer noch wieder zurück nach Hause reisen. Diese Möglichkeit gäbe es nicht, wenn er gleich zu seinem eigentlichen Zielort gereist wäre. Er musste erst sicher sein, dass es gelingen konnte – aber das es gelingen sollte, davon war er überzeugt. Er wollte mit den hübschen kanadischen Männern aus den Heften zusammen am Strand liegen, die nackten Oberkörper noch feucht vom Wasser, dann mit der Hand langsam darüber streicheln und einfach nur frei und ungehemmt leben.
Eine Stimme riss ihn aus seinen Gedanken. „Stimmt etwas nicht mit den Büchern?“
„Mmh? Wie bitte?“
„Die Bücher.“ Der alte Mann zeigte auf die Bücher, die sich im Rollwagen befanden. „Sind das Mängelexemplare?“
„Ähm, nein, nicht direkt. Die müssen aussortiert werden.“
„Aussortiert? Sind die denn irgendwie defekt?“
Er schüttelte den Kopf und überlegte, was er sagen sollte. Er wusste, dass es laut Parteianordnung verboten war, den wahren Grund zu nennen. Überhaupt wäre es wohl sowieso besser gewesen, so etwas erst nach Ladenschluss zu machen, aber kein Buchhändler wollte die benötigten Überstunden in seinem Geschäft verbringen, weshalb es immerwährend der Öffnungszeiten gemacht wurde. „Die müssen einfach aussortiert werden.“
„Ja, aber warum? Sind die Ausschuss? Gibt es die dann billiger? Sie wissen schon – Mängelexemplare?“ Der alte Mann zeigte auf eines der Bücher im Wagen. „Das da, das hätte ich mir nämlich kaufen wollen, aber das ist mir noch zu teuer. Aber wenn es jetzt runtergesetzt wird, ja, dann kann ich es mir kaufen. Ich habe ja auch nicht so viel Geld zum Leben, wissen Sie? Und ob es jetzt ein Mängelexemplar ist oder nicht, das ist mir dann auch egal. Aber kaufen möchte ich es schon.“
„Tut mir leid – ich soll die Bücher aus den Regalen nehmen. Die werden nicht länger verkauft.“
„Ja, das sagten Sie, aber warum denn? Hat der Verlag die zurückgerufen?“
„Nicht direkt, nein.“
„Ja, was dann?“ Der Alte sah ihn mit einem Ausdruck an, den normalerweise nur Großväter besaßen, wenn sie einem kleinen Kind Süßigkeiten schenkten. „Ich würde das Buch wirklich gerne kaufen, und wenn Sie es sowieso aus den Regal nehmen, dann wollen Sie es doch nicht länger im Laden führen. Ja?“
„Ich will es ja gar nicht rausnehmen, aber ich muss“, sagte Wolfgang ehrlich. „Ich muss einige Bücher rausnehmen.“
„Ja, ich weiß, das sagten Sie. Aber warum denn?“ Da keine Antwort kam, meinte er: „Sehen Sie, junger Mann, ich möchte das Buch doch kaufen. Ich bin extra heute hier hergekommen, weil ich mir das Buch kaufen wollte. Ich habe zwar nicht so viel Geld, aber ich dachte, es mir heute zu kaufen, wenn es da ist. Und jetzt bin ich hier, und ich sehe, wie Sie es aus dem Regal nehmen. Und da habe ich gehofft, es würde bedeuten, dass es billiger gemacht wird. Ich meine, selbst wenn nicht ... ich würde es mir kaufen wollen.“ Er blickte ihn wieder gutmütig an.
„Ich weiß, aber ... es wird leider aussortiert. Das darf nicht mehr verkauft werden.“
„Ja, aber warum denn nun?“
Bevor Wolfgang etwas darauf sagen konnte, kam Frau Dante dazu: „Kann ich helfen?“
„Ich möchte ein Buch kaufen.“ Der Alte zeigte auf den Wagen. „Aber ihr Mitarbeiter hat es bereits weggepackt.“
„Ja – das darf dann auch leider nicht mehr verkauft werden“, meinte sie mit erzwungener Höflichkeit. „Diverse Exemplare werden leider von Zeit zu Zeit vom Verkauf zurückgezogen und dürfen darum nicht weiterverkauft werden.“
„Aber ich möchte es doch kaufen“, beharrte er.
„Wir dürfen es aber nicht weiterverkaufen. Dieses Buch, genauso wie alle anderen, die gerade von den Regalen genommen werden, dürfen nicht weiterverkauft werden. Wir haben noch viele andere Bücher, die Ihnen bestimmt auch gefallen wer...“
Der Alte unterbrach sie: „Und warum müssen die Bücher aus dem Regal genommen werden?“
Wolfgang schaltete sich ein: „Weil wir leider an diverse Vorschriften gebunden sind, aber wenn Sie Glück haben, dann finden Sie noch ein Exemplar in einer anderen Buchhandlung. Versuchen Sie es am besten in einem kleineren Buchladen – die haben ab und zu Bücher, die woanders nicht mehr verkauft werden können.“
Der Alte überlegte und nickte sodann: „Gut, junger Mann, das klingt gut. Vielen Dank. Dann versuche ich mein Glück eben woanders.“ Er nickte erneut und ging gemächlich in Richtung Ausgang.
Frau Dante warf Wolfgang einen geradezu vorwurfsvollen Blick zu, der ihn jedoch weitestgehend kalt ließ: „Er wollte das Buch, und wenn jemand anders es ihm verkauft, dann fällt das immerhin nicht negativ auf Ihre Buchhandlung zurück“, meinte er gelassen.
Sie schien nicht vollkommen überzeugt. „Das mag schon sein, aber wenn er seine Bücher woanders kauft, dann habe ich gerade einen Kunden verloren.“
„... dem Sie das Buch, das er wollte, sowieso nicht verkaufen durften.“
Sie schnaufte leicht und griff in den Wagen. „Welches wollte der denn überhaupt?“ Sie suchte ein wenig herum.
Wolfgang griff hinein und holte es zielsicher heraus: „Hier – ‚Tage unter dem Blütenhimmel’ von Richard Brautigan.“ Er reichte es ihr.
Sie nahm es an sich und las geschwind die Inhaltsangabe durch. „Und das muss laut der Partei aussortiert werden?“
„Ja.“ Er zeigte auf den Ausdruck, den er seitlich an einem Klemmbrett befestigt am Wagen mit sich führte. „Hat mich auch gewundert – das Buch handelt davon, was Brautigan in den Achtzigern in den Japanischen Staaten erlebt hat. Es ist keine Übersetzung, es ist nicht Japanfeindlich ...“ Er zuckte mit der Schulter. „Keine Ahnung, warum die Partei das aussortiert haben will.“
„Ja, das weiß man nie so genau. Aber die werden schon wissen, warum es vom Markt muss.“ Sie legte das Buch wieder zurück. „Der restliche Brautigan ist aber noch vorhanden?“
„Ja.“
„Gut. Dann mach jetzt mal weiter. Und wenn wieder ein Kunde nach einem Buch fragt, dann schick ihn nicht woanders hin. Wir haben genug Bücher im Laden. Da ist für jeden etwas dabei. Im Zweifelsfall soll der Kunde sich ein Buch über die Geschichte der D-S-A kaufen. Das ist immer richtig.“ Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, ging sie weg und suchte nach neuen Kunden, denen sie behilflich sein konnte.
Wolfgang machte mit seiner Arbeit weiter und befreite auch die übrigen Regale von unerwünschten Büchern. Da von einigen mehrere Ausgaben vorhanden waren, füllte sich sein Wagen nach kurzer Zeit, weswegen er ihn ins Lager schieben und dort entleeren musste. Die Bücher wanderten allesamt in einen mittelgroßen Container, und weil sie sowieso vernichtet wurden, brauchte er sie nicht fein säuberlich reinstapeln, sondern konnte sie einfach so reinwerfen. Einige wurden dabei aufgerissen und wieder andere lagen beinahe anklagend mit dem Titelbild in seine Richtung. Das Vorhaben, jedes einzelne verbotene Buch zu lesen, hatte Wolfgang bereits in der Buchhandlung von Herrn Rommler aufgegeben, und jetzt, da er schon seit Wochen wieder und wieder Unmengen an Papier wegschaffte, schien allein die bloße Vorstellung, sein Vorhaben auch nur ansatzweise in die Tat umzusetzen, wie purer Irrsinn. Niemand, absolut niemand konnte alle Bücher lesen, die die Partei entfernt haben wollte.
Er sah für einen Moment in den Container und bemerkte erst jetzt, das auffallend viele der unerwünschten Schriften mit den Japanischen Staaten zu tun hatten. Hatte das vielleicht etwas zu bedeuten? Wahrscheinlich, aber als jemand, der seiner täglichen Arbeit nachgehen musste, um in dieser Welt überleben zu können, konnte er sich nicht die Freiheit nehmen, weiter nachzuforschen und in Erfahrung zu bringen, was es damit auf sich hatte. Es ging ihn ja auch nichts an. Die Oberen taten eben, was sie für richtig hielten, und dass es nicht alles richtig sein konnte, das wusste Wolfgang nur zu gut, aber er konnte auch nicht wirklich etwas dagegen unternehmen. Alles, was er konnte, war, sein Leben so gut zu leben wie er es eben konnte, auch wenn die Partei Leute wie ihn tot und vernichtet sehen wollte.
Er schob den Rollwagen zurück in die Verkaufsräume und arbeitete die Liste weiter ab. Es würde noch einige Stunden dauern, bevor er für heute im Buchladen fertig war. Aber selbst dann konnte er sich nicht ausruhen, da er seinen Zweitjob antreten musste. Dieser machte ihm aber zugegebener weise mehr Spaß, da er hauptsächlich auf einem Stuhl sitzen konnte, und das war nach einem harten Tag auf den Beinen wie eine wahre Wohltat.
2.
Caleb ging zusammen mit Jerome und Deacon die Straße herunter. Deacon rauchte wie immer eine Zigarette, während Jerome von seiner letzten Eroberung sprach: „Ich sage euch, die war richtig. Das war eine echte. Die hatte eine Haut, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und der Arsch von ihr, der war richtig zum reinsinken.“
Caleb lächelte schief. Deacon stieß etwas Rauch aus: „Red lieber nicht so viel über deine letzte – sonst schnappt der Junge sie dir noch weg.“ Er lachte auf.
„Der soll sich lieber mal eine eigene schnappen. Am besten heute im Kino, ja?“
„Ins Kino? Ich habe kein Geld“, meinte der junge Farbige.
„Ach“, Jerome schnalzte mit der Zunge, „das macht doch nichts. Wir legen es dir aus. Kein Problem.“
„Sicher?“
„Ja klar.“ Er sah zu Deacon, damit dieser nicht die Wahrheit mit dem Geld und der Tochter des Chefs sagte. „Wir gehen heute alle ins Kino. Den Film kennen wir ja schon. Aber das ist doch dann gerade das Gute. Wir kennen den Film und müssen darum nicht aufpassen, was passiert. Wir können uns stattdessen die Weiber angucken und uns die richtige aussuchen.“
„In der Dunkelheit?“, hakte Caleb nach.
Jerome zuckte mit der Schulter. „Na klar – eine Frau, die im Dunkeln gut aussieht, reicht doch schon. Beim Ficken braucht man doch kein Licht anlassen. Ist doch nur Stromverschwendung.“ Er grinste breit.
„Eigentlich möchte ich nicht ins Kino“, sagte Caleb matt.
„Nun hör doch damit auf“, meinte Deacon und klang ein wenig ungeduldig. „Du musst doch auch mal eine abbekommen. Wir sind deine Freunde, und wir machen uns da schon richtig Sorgen um dich. Du kannst doch nicht ewig auf die richtige warten. Frauen machen das, aber Männer machen das nicht. Männer ... Männer testen eben herum, damit sie wissen, was sie machen, wenn sie die richtige Frau gefunden haben. Das muss man üben. Das kann man nicht von Natur aus. Man muss wissen, wann man die Titte leckt und wann man sie kneift. Wann man den Arsch knetet und wann man ihn schlägt. Gibt nämlich Weiber, die stehen da nicht so drauf. Da muss man lernen, damit man die Weiber verstehen kann. Weißt du, wie ich das meine? Wenn du genügend rumgefickt hast, dann weißt du, wann du kneten, kneifen, lecken und schlagen musst. Aber wenn du es nicht weißt, dann findest du die richtige, und wenn ihr dann fickt, ja dann“, er zog an seiner Zigarette, „schlägst du, wenn du kneifen sollst und du leckst, wenn du kneten sollst, und dann ist deine Tussi weg. Und das nur, weil du als Mann gedacht hast, du musst dich aufsparen.“
„Genau, genau“, nickte Jerome.
Caleb wusste, dass es nichts brachte, dagegen zu argumentieren, und die Wahrheit konnte er ihnen sowieso nicht sagen.
Aufgrund des Schweigens fügte Deacon hinzu: „Sieh es mal so: in anderen Staaten hättest du jetzt deine Gelegenheit zum Ficken schon gehabt. In Neu York zum Beispiel sind die da sehr streng, und in Texas werden Leute wie wir überprüft und an der Leine gehalten. Da hätte man dir schon längst die Eier abgeschnitten, damit du keine Lust mehr am herumficken hast. Und wenn du sagst, du hast noch nie gefickt, weil du dich für die richtige aufsparst, ja dann hätte dir das keiner geglaubt. Und was hättest du dann jetzt zwischen deinen Beinen? Ein schlappes Ding, das nur zum Pissen gut ist. Wenn du ficken kannst, dann ficke. Darum geht es im Leben.“
„Genau, das stimmt“, nickte Jerome erneut. „Das musst du doch selber wissen. Ich meine, wenn man einmal gefickt hat, dann weiß man, worum es im Leben ...“ Er stoppte im Satz und sah Caleb an. „Du hast doch schon mal gefickt, oder? Du bist doch alt genug.“
Der Junge wandte sich ein wenig peinlich. „Klar habe ich. Hör auf zu fragen.“
Jerome lachte laut auf. „Daran liegt das also! Und wir haben uns schon Sorgen gemacht, du wärst ein Falscher.“
„Ein Falscher?“, wollte er wissen.
Deacon klärte auf: „Einer, der nicht weiß, dass ein Mann mit einer Frau fickt und nicht mit einem anderen Mann.“
Jerome boxte Caleb leicht auf die Schulter und lachte herzergreifend: „Wir haben uns wirklich schon Sorgen um dich gemacht, weil du nie mit einer Tussi etwas anfangen willst. Aber jetzt wissen wir ja, was los ist.“ Er atmete einmal durch. „Dammt, wir haben erst gedacht, dass du Gelbfieber hast und nur Japanerinnen ficken willst, aber das kannst du dir ja von vornherein abschminken. Die würden dich gleich bei lebendigem Leib auffressen. Und dann dachten wir, du würdest nur auf weißes Fleisch stehen.“
„Wie die Tochter vom Chef.“ Deacon stieß wieder Rauch aus.
Caleb schüttelte den Kopf. „Nein, nein – ich habe nichts gegen sie, aber sie ist die Tochter vom Chef, und überhaupt ...“
„... und überhaupt dürfen Leute wie wir mit diesem Herrenvolk sowieso nicht ficken“, beendete Jerome den Satz. „Da wirst du nicht nur deine Eier los, sondern auch alles andere. Da kennen die nichts. Leute wie wir sind für die doch nur so was wie abgerichtete Affen, die ihnen die Arbeit abnehmen sollen, die sie selber nicht gerne machen. Jedes Klo muss geputzt werden, jeder Boden gefegt werden und so weiter, und das ist alles Dreck von den Weißen, aber wer muss es wegmachen? Wir. Aber egal. Wir haben uns ja sowieso gedacht, dass du nicht auf weißes Fleisch stehst. Aber wir wussten nicht, warum du dich trotzdem weigerst, eine Tussi abzuschleppen. Aber das es daran liegt, dass du noch nie eine hattest ... darauf sind wir nicht gekommen.“ Er boxte ihn erneut auf die Schulter. „So was kannst du uns doch sagen – wir sind doch deine Freunde. Wir helfen dir dabei.“
„Ich bin nicht ...“
„Doch, bist du“, unterbrach Deacon ihn. „Hat keinen Sinn es zu leugnen. Du bist eine Jungfrau. Aber das ist nichts, weswegen man sich schämen muss. Wir waren das ja alle irgendwann einmal. Aber keine Sorge, wir helfen dir, eine zu finden.“
Caleb nickte leicht. „Mal sehen ... wir können ins Kino und ... vielleicht ist da eine, die mir gefällt. Aber wenn nicht, dann will ich nicht eine von euch aufgezwungen bekommen.“
„Aufzwingen? Wir dir?“ Jerome lachte erneut. „Wir zwingen dir keine auf. Aber wir können dir sagen, welche die richtige für dich ist. Du zeigst uns einfach die Tussi, die du magst, und wir sagen dir, ob die überhaupt zu dir passt. Kann ja sein, du nimmst eine, die außerhalb deiner Fähigkeiten ist.“
„Meiner Fähigkeiten?“
Deacon klärte auf: „Ja. Ob die bereits zu erfahren ist oder noch zu unerfahren. Eine, die unerfahren ist, bringt dir ja nichts bei. Und eine, die zu erfahren ist, die hat schon ihre eigene Vorstellung von Ficken, und die bringt sie dann jedem bei. Aber das trifft dann eben nur auf sie zu und nicht auf alle anderen. Die sind da schon so eingeritten, dass sie gar nicht mehr wissen, wie das Ficken generell sein soll. Die mögen es immer etwas härter, aber du kannst bei einer Anderen dann nicht gleich auf hart machen. Das verschreckt die nur. Die meisten wollen erst schmusen. Weißt du? Ein bisschen Zärtlichkeit. Aber nicht zu viel. Weiber, die noch zu unerfahren sind, wollen immer nur schmusen. Da ist dann nur viel Berührung, aber nicht wirklich etwas, was sich zu lernen lohnt. Die wissen selber noch nicht, was sie wollen, weil sie eben zu unerfahren sind. Also musst du dir als Erste zum ficken eine suchen, die genau richtig ist. Nicht zu unerfahren, dass sie nur gestreichelt werden will, aber auch nicht zu erfahren, dass sie nur noch zum Schreien kommt, wenn du ihr die Titten gegen den Uhrzeigersinn umdrehst. Du musst eine finden, die genau weiß, wie alle Frauen gerne angefasst werden wollen. Nur so lernst du.“
Caleb wollte darauf nichts sagen, da er befürchtete, etwas Falsches zu sagen, und da seine Freunde ihm nun beiläufig zu verstehen gegeben hatten, dass sie „Falsche“ nicht sonderlich zu mögen schienen, war es wohl das Beste, überhaupt nichts von sich zu geben. Dennoch musste er irgendwie signalisieren, er sei mit dem, was sie sagten, durchaus einverstanden, weshalb er einfach lächelte und nickte.
„Genau, du hast es verstanden“, lachte Jerome wieder. „Wir bekommen das schon hin. Keine Sorge. Wir gehen alle ins Kino und du suchst dir eine aus, und wir sagen dir dann, ob die richtig ist oder nicht. Und dann machen wir dir Mut, damit du weißt, wann und wie du sie ansprechen sollst.“ Er blickte geschwind zu Deacon. „Und weil das ja etwas ganz Besonderes ist, brauchst du uns das Geld fürs Kino auch nicht zurückzuzahlen. Ja? Wäre doch dumm, wenn du dein erstes Mal mit so was verbindest.“
„Danke“, war alles, was er sich zu sagen traute.
Deacon griff in seine Tasche und holte eine Zigarette hervor. „Hier – wenn du sie gefickt hast, dann musst du eine rauchen. Das verstärkt dann noch mal das Gefühl. Wenn du nach dem Ficken eine rauchst, dann ist das so, als würde du gleich nochmal ficken.“
Caleb nahm sie an sich und steckte sie in seine Jackentasche. „Danke.“
„Jetzt bedank dich nicht immer“, meinte Jerome. „Wir sind unter uns. Wenn du dich da dauernd für jeden kleinen Scheiß bedankst, klingst du wie ein Falscher, und das will niemand haben.“ Er klatschte in die Hände. „Also los – ins Kino. Heute wird er zu einem echten Mann gemacht.“
Johann saß hinter dem Empfangstresen und betrachtete seine Fingernägel, unter denen sich ein wenig Dreck befand. Er nahm sich einen Brieföffner und säuberte sie, als er bemerkte, dass zwei Männer in Parteiuniformen ins Hotel kamen. Sofort wollte er den scharfkantigen Brieföffner weglegen, verletzte sich dabei aber an seinem Finger und schnitt direkt ins Nagelbett. Blut quoll augenblicklich heraus. Um sich keine Blöße zu geben, ignorierte er den Schmerz und stand respektvoll gerade. „Heil“, begrüßte er die beiden sofort.
„Heil. Haben Sie ein Doppelzimmer frei?“, fragte der etwas Ältere von beiden, wohingegen der deutlich Jüngere mit stechenden Augen die Gegend regelrecht sondierte.
„Ich sehe nach, aber ich bin mir sicher, dass wir eines haben. Und selbst wenn nicht, dann machen wir für Sie natürlich sofort eines frei.“ Er blätterte im Empfangsbuch herum. „Ah ja – zweiter Stock, Zimmer 28.“
„Sehr gut. Das nehmen wir.“
„Sehr schön. Ihre Ausweise, bitte.“
„Hier.“ Der Ältere hielt seinen hin.
Johann schrieb den Namen auf. „Offizier Katzmeister.“
„Und das ist mein Assistent Breuer.“
Nils hielt ebenfalls seinen Ausweis hin, wobei er weiterhin mit seinen geschulten Augen die Umgebung im Blickfeld behielt.
„Assistent Breuer.“ Johann blickte den Offizier an. „Wissen Sie schon, wie lange Sie ungefähr zu Bleiben wünschen?“
„Nein. Es könnte sich um mehrere Tage handeln. Die Rechnung übernimmt das Hauptquartier.“
„Natürlich, natürlich. Haben Sie irgendwelche besonderen Wünsche?“
„Ja. Ihr Personal hält sich vom Zimmer fern. Niemand darf rein, es sei denn, wir erteilen eine ausdrückliche Genehmigung. Ist das klar?“
Johann nickte. „Natürlich. Das wird sofort veranlasst.“ Er gab ihm den Zimmerschlüssel. „Haben Sie Gepäck dabei?“
„Draußen im Wagen.“
„Einen Moment, bitte.“ Er verständigte einen der anderen Bediensteten. „Bring das Gepäck in Zimmer 28, aber schnell.“ Der Farbige nickte stumm und ging raus.
„Noch ein Nigger“, meinte Nils verächtlich.
„Die D-S-A wimmelt davon“, meinte Katzmeister. „Aber auch nicht mehr lange.“
Der Hotelangestellte kam mit zwei Koffern rein und ging zum Empfang. Johann sah beide nacheinander an. „Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt bei uns. Wenn Sie irgendwelche Wünsche haben, dann nehmen Sie einfach das Telefon. Ich werde mich sofort höchstpersönlich darum kümmern, Ihren Aufenthalt hier so perfekt zu gestalten wie es hochrangigen Leuten wie Ihnen zusteht.“ Er lächelte schleimig.
„Gut.“ Der Offizier und sein Assistent folgten dem Diener nach oben.
Johann sah den Drei hinterher. Als er sich sicher sein konnte, dass sie außer Reichweite waren, lief er sofort zum Büro von Herrn Kissler und klopfte an. „Herr Kissler? Es ist dringend.“
„Was denn?“, erklang es hinter der Tür.
Er öffnete sie einen Spalt weit. „Ich wollte sagen, dass gerade zwei Parteimitglieder bei uns ein Zimmer genommen haben.“
„Parteimitglieder? Bei uns?“, sagte er ungläubig.
Johann traute sich nicht, die Tür weiter zu öffnen, da er nicht wusste, wie sein Chef darauf reagieren würde. „Ja. Ich muss jetzt wieder an den Empfang zurück, falls die etwas von mir wollen. Aber ich dachte mir, Sie sollten sofort wissen, dass wir Parteimitglieder bei uns haben. ... Vielleicht wollen Sie sich denen später noch vorstellen ...“
„Vorstellen?“ Es klang geistesabwesend. „Vielleicht. Wo ist Gerda?“
„In der Stadt. Das hatte sie Ihnen doch vorhin gesagt. Ist alles in Ordnung?“
„Ja.“ Seine Stimme wirkte wie von einem anderen Stern.
Johann wusste ebenfalls, dass sein Chef durch das Pervitin manchmal bis auf den Mond befördert wurde. „Gut. Ich gehe wieder an den Empfang zurück.“ Er schloss die Tür und begab sich zum Tresen. Er starrte auf das Telefon und konnte nun nicht länger den Schmerz ignorieren, der sich von seinem Finger breitmachte. Er steckte den blutigen Finger in den Mund und sah in Richtung Büro – eine Spur aus Blutstropfen führte hin und wieder zurück. Er verständigte einen weiteren Bediensteten zum sauberwischen, und wartete sodann auf das klingeln des Telefons, damit und er solch wichtigen Leuten einen Gefallen tun konnte.
Nach der Arbeit im Buchladen ging Wolfgang durch die Stadt direkt zu seiner zweiten Nebenbeschäftigung. Das kleine, zwischen mehreren alten Häusern leicht alleinstehende Kino war zwar nicht so stark besucht wie die anderen Kinos der Stadt, aber das lag zweifelsohne daran, dass in diesem auch Schwarze Zutritt hatten. Während in den anderen Lichtspielhäusern eine strenge Regelung bestand, durfte hier die farbige Bevölkerung der Stadt wenigstens in einem kleinen Leinwandraum sitzen und sich zumeist denselben Film wochenlang ansehen. Weil die meisten anderen Filmvorführer keine Lust daran hatten, immer wieder den gleichen Film abzuspielen (noch dazu für Leute, welche von ihnen verächtlich als „Nigger“ bezeichnet wurden), übernahm Wolfgang mit größtem Vergnügen diese Aufgabe. Man hatte ihm beigebracht, wie man die Filmrollen einwechselt und den Projektor bedient, und mehr musste man für diese Arbeit auch nicht wissen, zumal der Film für diesen Saal sowieso auf eine einzige große Rolle gezogen war und er deswegen nicht alle 15 Minuten wechseln musste.
Er betrat das Kino durch die Angestelltentür, meldete sich beim Besitzer Herrn Millburg und ging sogleich zum abgelegenen Kinosaal, welchen er routinemäßig anguckte. Die Stühle hier waren bereits stark abgenutzt, und die Klimaanlage wurde auch nicht regelmäßig angeschaltet, weshalb es stark nach Schweiß roch – etwas, das Herr Millburg auf die körperliche Schwäche der Farbigen zurückführte. Diese würden eben anders riechen als „normale Menschen“ – purer Blödsinn, wie Wolfgang fand, aber er sagte nichts dagegen. Immerhin wollte er nicht negativ auffallen, und einen derart ruhigen Job würde er vielleicht nicht wieder so schnell finden.
Er kramte einige leere Tüten vom Boden auf, weil die Putzleute diesen Raum mal wieder gemieden hatten. Vorurteile hinderten sie daran, hier für Sauberkeit zu sorgen – für solche Leute waren Farbige keine Menschen, und Wolfgang wollte überhaupt nicht wissen, was Schwule für diese Personen wären. Er warf die Tüten in einen Mülleimer und ging sodann in den Projektorraum, wo wieder derselbe Film darauf wartete, abgespielt zu werden. Eine dämliche Komödie mit hauptsächlich weißen Schauspielern, aber weil ein Schwarzer als Diener mitspielte und dadurch eine größere Rolle besaß als in den sonstigen Filmen, wurde der Film wohl für das „Niggerkino“ freigegeben. Wolfgang hatte sich den Streifen ebenfalls angesehen – der Diener war dumm, unterwürfig und bereitete durch seine Ungeschicklichkeit die meisten Lacher für ein weißes Publikum, aber die Farbigen sahen die Sache anders. Sie erblickten einen von Ihnen, der versuchte, seiner Arbeit so gut es ging nachzugehen, während die Weißen um ihn herum nur Forderungen stellten und für ihn und seine Probleme keinerlei Interesse hatten. Aber wenigstens war der Schwarze vorhanden – wenigstens gab es einen Schwarzen im Film, denn so sehr Wolfgang auch darauf achtete, konnte er keine Anzeichen für eine schwule Rolle finden. Natürlich nicht – laut Partei gab es diese ja auch gar nicht mehr. Schwule galten als ausgerottet und wurden darum überhaupt nicht dargestellt, nicht einmal als Witzfiguren. Schwarze hingegen konnte man überall sehen, und wahrscheinlich war es deswegen erlaubt, einen von ihnen in einem Film zu zeigen, auch wenn er dermaßen stupide agierte, dass die Heldin des Films ihm in der finalen Szene des Films mit der flachen Hand ins Gesicht schlug. Eine Szene, die abweichende Emotionen hervorbrachte: als der Film noch vor Jahren einem weißen Publikum gezeigt wurde, da haben wohl alle gejubelt, dass die Heldin sich endlich zur Wehr setzte. Jetzt, wo ein schwarzes Publikum den Film sah, galt die Ohrfeige eher als ernüchternde Bestätigung der Befürchtung, dass es für Schwarze nie besser werden würde. Wie sollte man als Schwarzer denn auch Hoffnung auf Besserung entwickeln können, wenn es keine Helden zu geben schien? Aber dennoch ging es ihnen besser als den Schwulen, fand Wolfgang – immerhin tauchten sie in Filmen auf, und auch wenn sie aufgrund ihrer Hautfarbe anders behandelt wurden, so war diese Hautfarbe dennoch etwas, das sie definierte. Sie konnten ihre Farbe ja nicht so verstecken wie ein Schwuler seine Homosexualität, aber genau deswegen konnten sie sich auch nicht selber verleugnen und dadurch ihren Geist töten, damit dieser in das Parteisystem passte. Schwule lebten zwar so gesehen freier, eben weil sie sich verstellen konnten, aber war das wirklich besser? Sich verbiegen, verdrehen und dadurch selber verleugnen?