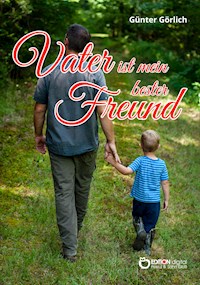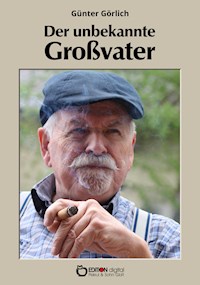8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der 1957 veröffentlichte „Schwarze Peter“ war das erste Jugendbuch von Günter Görlich. 1958 wurde er dafür mit dem Jugendbuchpreis des Ministeriums für Kultur der DDR ausgezeichnet. Peter, die Hauptfigur, hat keine Eltern mehr, er lebt bei seiner Großmutter - der einzige Mensch, der gut zu ihm ist - und er soll jetzt bei einer großen Sache mitmachen - ansonsten hauen wir dich zusammen, sagt Bruno. Und Peter weiß, dass das stimmt. „Mach keinen Unsinn“, sagt Bruno versöhnlich und streift mit einem Ruck seine Kapuze vom Kopf, „wir drehen ein Ding, da ist alles dran.“ Aus der Tasche seiner Tarnjacke holt er ein paar zerknitterte Geldscheine. „Hier, kauf dir was.“ Peter hatte Bruno auf dem Schwarzmarkt kennengelernt: Das war gleich nach dem Unglück mit Ente. Aus den Trümmern hatte ich eine alte Küchenwaage geholt, und die wollte ich verkaufen. Sie war ganz schön verbeult, und ich brachte sie erst in Ordnung. Großmutter putzte sie blank. Eine Frau wollte sie mir für zehn Mark abkaufen. Ich tippte an die Stirn und sagte nur: „Hundert Mark ist sie wert in unserer Zeit.“ Die Frau wollte mir eine kleben, aber sie hat es doch nicht getan. Für achtzig Mark wurde ich die Waage los. Als ich gerade verschwinden wollte, stieß mich jemand an. Vor mir stand ein großer Kerl mit einer grauen Militärmütze auf dem Kopf. Ich hielt mein Geld in der Tasche fest. „Brauchst keine Angst zu haben“, sagte der Große, „ich will dein Geld nicht haben.“ Er hatte zugesehen, wie ich die alte Waage verkauft hatte. Er sagte: „Mensch, ich hätte mich schieflachen können, als du den Preis für das rostige Blechding bis auf achtzig Mark hochgeschraubt hast.“ Er wollte mit mir ein Geschäft machen: „Mir fehlt dein Talent zum Handeln, dafür habe ich aber einen Haufen Zeug zum Verkaufen. Natürlich nicht solch alten Plunder wie deine rostige Waage“, sagte er. Seit dieser Zeit verkaufe ich für Bruno allerhand Zeug auf dem schwarzen Markt. Vom Verdienst bekomme ich etwas ab. Aber ich sehe schon zu, wo ich bleibe. Genau braucht Bruno nicht zu wissen, was ich so aus den Sachen herausschlage. Das große Ding, von dem Bruno gesprochen hatte, sind zum Beispiel Laubeneinbrüche. Während die anderen weglaufen können, wird Peter geschnappt und fürchtet, jetzt nach Sibirien zu kommen. Stattdessen kommt Großmutter, die sehr krank ist, ins Krankenhaus und ihr Enkel in ein Kinderheim. Doch als es ihr wieder besser geht und sie aus dem Krankenhaus entlassen wird, kommt auch Peter wieder zurück nach Hause nach Berlin.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 342
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Impressum
Günter Görlich
Der Schwarze Peter
ISBN 978-3-96521-677-8 (E-Book)
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
Das Buch erschien 1957 im Verlag Neues Leben Berlin.
© 2022 EDITION digital Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.de
Erster Teil
Genosse hat mir Ente weggenommen
Der Wind weht kalt und treibt graue Wolken über das weite Trümmerfeld. Ich hocke im Kellereingang und warte auf Ente. Ente ist gegangen, um Paul abzuholen.
Draußen wird es dunkel. Es regnet.
Im Keller quietschen Ratten, und ich habe vor ihnen Angst. Die Ratten sind fett und guter Dinge, weil in den Ruinenkellern noch viele Leichen liegen.
In meiner Nähe kollern Steine; Ente tappt vorsichtig die Stufen herunter.
Träge schüttelt er die Nässe aus den Kleidern; seine Hände und Lippen schimmern blau vor Kälte. Er sieht mich missmutig an und kneift die Augen zusammen.
„Paule kommt nicht“, sagt er.
„Ist er krank?“
Ente schüttelt den Kopf und spuckt aus. „Er macht nicht mehr mit.“
Er setzt sich neben mich und erzählt:
„Ich hatte kaum an die Wohnungstür geklopft, da öffnete ein Mann. ,Willst wohl Paul abholen?‘, fragte der und kam ganz dicht an mich ran. ,Mach, dass du wegkommst; mit der Klauerei ist jetzt Schluss', drohte er. Da bin ich natürlich abgehauen. Im Flur hing ein blauer Rock. Der Alte ist bestimmt zur Polizei gegangen.“
Ich beiße die Zähne aufeinander, dass es knirscht.
Paules Vater ist erst vor ein paar Tagen nach Hause gekommen, weiß der Kuckuck, woher. Bis jetzt ging alles in Ordnung. Seine Gören hatten eine warme Bude und was für den Magen. Nun ist er gekommen und sofort Polizist geworden. Da haben sie das nicht mehr nötig. Die Polizeileute bekommen sicher Zuteilung.
Paul kommt also nicht mehr. Der Feigling hat sich rumkriegen lassen. Zu Ente kann ich aber nicht sagen, was ich so denke. Wir sind nur noch zwei, und wenn ihm auch so etwas einfallen sollte …
Ente lehnt mit dem Rücken an der Mauer und döst vor sich hin. Manchmal schüttelt er sich, weil er friert.
Ich brauche keine Angst zu haben. Bei Ente kann kein Vater kommen und schnell Polizist werden. Entes Vater haben sie im Krieg totgeschossen.
Ich hänge Ente meine Joppe um. Sie ist warm und reicht fast bis zu den Waden wie ein Mantel. Die Ärmel hat Großmutter umgenäht. Die Joppe hat einen Zentner gute, glänzende Steinkohle gekostet.
Ente wird wieder fröhlich. Aus der Hosentasche angelt er sich einen Zigarettenstummel. Er meint, wenn man raucht, und wenn es nur eine Kippe ist, spürt man den Hunger nicht so sehr. Ich glaube das nicht. Soll er rauchen; er ist ein Jahr älter als ich, er ist schon dreizehn.
Vielleicht werde ich später auch rauchen.
Ente ist schnell zufrieden und macht auch alles mit, wenn er nur nicht seinen Kopf anzustrengen braucht. Ich muss immer alles ausknobeln.
„An die Bunker kommen wir nicht ran, dort schnüffelt zu viel Polizei mit ihren Hunden herum“, sage ich.
Ente brummt undeutlich.
„Wir müssen das anders anstellen“, sage ich für mich.
Ente zieht an seinem Stummel und antwortet nicht.
Da werde ich böse.
„Los, wir hauen ab!“
Ich habe mir schon alles ausgedacht. Auf dem hohen Bahndamm steht das Hauptsignal. Die Kohlenzüge fahren an dieser Stelle langsam und müssen fast immer vor dem Signal halten. Ich werde auf einen Waggon klettern und die Kohlen hinunterwerfen. Ente wird sie sammeln.
Wir laufen los. Inzwischen ist es stockdunkel geworden, und der Regen sprüht fein und gleichmäßig.
Ich habe meine Joppe wieder an. Ente hat sich einen Kohlensack über die Schultern gelegt. Die Ohrenklappen seiner Russenpelzmütze hat er nach unten gezogen. Er watschelt ein bisschen beim Laufen, darum rufen wir ihn auch „Ente“. Richtig heißt er Rudi.
Die Ruinen reichen bis zu den Bahnschienen, und das ist für uns sehr günstig.
Ich bin ein bisschen neidisch, weil Ente die schöne warme Pelzmütze hat. Er erzählte, dass er sie einem toten Russen vom Kopf genommen hat. Das ist bestimmt geflunkert.
Bald ist Weihnachten. Vielleicht kaufe ich mir dann eine auf dem schwarzen Markt. Großmutter müsste auch eine haben. Dann sieht Großmutter aus wie ein Russe.
Ganz in unserer Nähe poltert es dumpf.
„Oh, verflucht!“, sagt Ente und hält sich an mir fest.
Was ist denn schon? Bei dem Wind fallen die verkohlten Häuser zusammen. Wir laufen weiter.
Die Signallampen leuchten rot und grün. Ich und Ente liegen am Hang des Bahndammes und warten. Über die vielen Schienen sind wir gut hinweggekommen, wir trafen keine Polizisten. Die sind mehr in der Nähe des Bunkers oder hocken bei diesem Wetter in ihrer warmen Wächterbude. Der Regen ist schwächer geworden. Das alte Gras fühlt sich stachlig und feucht an.
Wir warten und frieren. In der Tasche habe ich noch eine Scheibe Röstbrot. Außen ist sie hart und knusprig, innen aber weich und klebrig. Großmutter gab sie mir, ehe ich ging. Ich fange an zu kauen. Neben mir seufzt Ente. Ich breche die Röstbrotscheibe in der Mitte durch und gebe ihm die eine Hälfte.
Wir haben vier große Säcke mit, denn wir haben uns heute allerhand vorgenommen. Manchmal müssen wir für ein einziges Brot einen halben Zentner Kohle opfern. Das sind so die Preise auf dem Markt; man darf sich aber nicht übers Ohr hauen lassen.
Ente meint, dass es bald schneien wird.
In der Ferne pfeift eine Lokomotive, und langsam nähern sich zwei trübe Lichter. Das Signal steht auf Halt. Die Lokomotive pfeift noch einmal, schrill und wütend. Meine Rechnung scheint zu stimmen. Ente schnauft vor Aufregung. Der Zug klirrt und rumpelt über die Schienen. Mein Herz schlägt schnell. Es ist ein Kohlenzug, und er muss halten.
Die Begleitpolizisten sitzen immer hinten auf dem letzten Waggon. Schnell klettere ich eine nasse, kalte Eisenleiter hoch. Ich werfe die Kohlen über den Rand des Waggons, und dabei rinnt mir der Schweiß über den Rücken. Es hängt alles davon ab, wie schnell wir arbeiten, Ente und ich. Ein plötzlicher Ruck reißt mich nach hinten. Der Zug fährt wieder. Die Puffer knallen laut zusammen, und doch höre ich deutlich das Schreien. Es scheint von weit her zu kommen und dann wieder sehr nahe zu sein.
Mein erster Gedanke ist Ente …
Ich springe vom Waggon. Die scharfen Steinkanten des Schotters reißen mir Hände und Knie auf. Ich presse mich an die Erde, rühre mich nicht, lausche. Die Räder rollen, die Waggons poltern, und doch höre ich das Schreien.
Dort, wo Ente liegen muss, schwanken Lampen hin und her. Eine heisere, aufgeregte Männerstimme ruft: „Los, macht schnell, der blutet aber …“
Ich springe auf, laufe, stolpere über Schienen, falle hin, haste weiter. In meinem Hals würgt es, und mir wird glühend heiß und dann wieder eiskalt. Großmutter werde ich nichts sagen. Ich weiß nicht, was ich tun soll.
Mein Freund Ente ist vom Kohlenzug überfahren worden.
Der Winter ist bald vorbei. Der Schnee pappt, und es ist nicht mehr so kalt.
Großmutter sagt: „Gott war uns barmherzig!“
Ich weiß nicht, in diesem Winter war es hundekalt, und erfroren sind genug.
Die Schule wurde geschlossen; dadurch sparte ich das Schwänzen.
Ich will Ente im Krankenhaus besuchen, und mir ist im Bauch so schwach. Für Ente habe ich ein Päckchen mit; ein Brot und ein ganzes Pfund Zucker sind drin.
Wie wird Ente nur aussehen? Den linken Fuß bis über den Knöchel sollen sie ihm abgeschnitten haben. Das tat sicher sehr weh. Als ich damals hörte, dass Ente nicht tot sei, war ich sehr froh. Ich werde ihm sehr viel erzählen müssen. Schon oft wollte ich ins Krankenhaus gehen, und immer wieder schob ich es auf. Ich traute mich einfach nicht hin.
Einmal sprach der Lehrer in der Schule über das Unglück. Am liebsten wäre ich in die Erde versunken, aber von mir sagte der Lehrer nichts. Ente hatte mich nicht verraten.
Zum Krankenhaus gehören viele große rote Häuser. Auf das Krankenhaus sind auch Bomben gefallen. Ich staune, dass in allen Fenstern Glasscheiben blinken.
In den Trümmern wühlen Frauen. Trümmerweiber seien das, sagte einmal Bruno, und sie seien schön dumm, dass sie so schuften. Sie sehen wirklich schlecht aus, und man denkt, der Wind könnte sie umblasen. Bruno meint auch, dass sie von den Russen dazu gezwungen werden. Ich lasse mich nicht zwingen.
Ich steige eine breite Treppe hoch. Es riecht so seltsam, das sind bestimmt die Krankheiten. In meinen Halsadern pocht das Blut, und ich schwitze richtig.
Eine Schwester will mir zeigen, wo Ente liegt. Sie spricht zu mir ganz laut, als ob es gar kein Krankenhaus sei. Ich möchte wieder umkehren, aber die Schwester geht neben mir.
In einem hellen Zimmer stehen weiße Betten, und in einem liegt Ente. Ich stehe vor dem Bett und kann nicht reden. Ente sieht gar nicht aus wie Ente. Er hat so große Augen, und blass ist er und sehr sauber.
„Tag, Rudi“, sage ich, „hier ist es aber schön warm.“
Die wenigen Worte bringe ich mühsam heraus.
„Tag, Peter! Das ist prima, dass du mal kommst“, antwortet Ente, lächelt dabei und wird rot. Ich setze mich, will ihn ansehen und kann es nicht. Ich gebe ihm das Paket, und er nimmt es vorsichtig mit seinen weißen, sauberen Händen. Ich weiß nicht, wo ich meine hintun soll.
„Meine Mutter sagte mir, dass du ihr jede Woche was zum Essen und zum Feuern bringst“, beginnt Ente zu sprechen.
„Ja“, sagte ich, „deine Mutter hat es nicht leicht mit den Kleinen, und wo du doch nicht mehr kannst.“
„Du, Peter“, Ente zieht mich am Arm, und ich muss ihm in die Augen sehen, „mach das nicht mehr, geh keine Kohlen mehr klauen …“
Jetzt schaue ich ihm in die Augen.
„Ich hole keine Kohlen mehr, bestimmt nicht, seit damals nie mehr. Das kann ich schwören.“
Ente lässt sich in das Kissen zurückfallen. Er scheint zufrieden zu sein.
Dann erzählt er. Die Polizisten und Eisenbahner haben ihn vom Eisenbahngelände getragen. Weit und breit war kein Auto aufzutreiben, und er wäre bald verblutet. Zum Glück kam dann noch ein Russenauto. Es war auch höchste Zeit. Der Russe fuhr wie der Blitz, und so ist Ente nicht verblutet.
Hier im Krankenhaus sind alle gut zu ihm. Die Russen kümmern sich sehr viel um das Krankenhaus. Sie bringen Glas für die Fenster und Kohlen zum Heizen. Der Russe, der ihn mit dem Auto ins Krankenhaus gebracht und ihm das Leben gerettet hat, besuchte ihn auch einmal. Er sagte, dass alle Leute, die fleißig und ehrlich arbeiten, es später gut haben werden.
Ente spricht und spricht. So kenne ich ihn gar nicht. Aber Ente ist krank, und das mit dem Fuß ist schlimm. Sonst würde ich ihm sagen, dass er ganz schön redet, dass aber in Wirklichkeit alles ganz anders aussieht.
Habe ich nicht erlebt, dass im Winter viele verhungert und erfroren sind? Und Bruno hat ja auch gesagt: „Die Trümmerweiber müssen schuften, und die Russen schleppen alles aus Deutschland weg.“ Ich möchte wissen, warum Ente so anders geworden ist. Ich frage ihn, von wem er das alles weiß. Ente zeigt zum anderen Bett hinüber, und ich sehe ein mageres, gelbes Gesicht in einem weißen Kissen.
„Er heißt Genosse“, flüstert Ente. „Der ist sehr schlau. Sie haben ihn immerzu gejagt, und davon ist er krank geworden. Der kann erzählen.“ Ich schiele nach drüben.
Wer Zeit hat, kann viel erzählen, und für Ente ist das auch ganz gut, da wird er nicht so traurig.
Es ist still zwischen uns. Plötzlich zupft mich Ente am Ärmel. „Sag mal, Peter“, er zeigt auf das Päckchen, „wo hast du das alles her?“ Ich werde rot. Was soll ich antworten? Soll ich von Bruno erzählen und vom schwarzen Markt? Ente ist ganz anders geworden. Er wird viel fragen und mich nicht mehr verstehen.
„Weißt doch, Rudi, in den Trümmern findet man so allerhand“, sage ich leichthin.
Er mahnt, ich soll vorsichtig sein. Viele werden ins Krankenhaus eingeliefert, die in den Ruinen herumgekrochen sind. Ich sitze auf dem Bettrand und bringe nichts Gescheites mehr heraus. Dafür redet aber Ente. Er sieht mich merkwürdig an und sagt, dass es falsch ist, die Schule zu schwänzen, weil man sich dabei sozusagen nur ins eigene Fleisch schneidet.
Ich denke, dass Ente vor Weihnachten noch viel weniger zur Schule ging als ich, und eigentlich müsste ich jetzt ein bisschen lachen. Ente sagt aber noch, dass alle fleißig lernen sollen, weil später alle sehr klug sein müssen, und dass er jetzt schon damit anfängt und dass Genosse ihm dabei hilft.
Nun, da weiß ich gleich, woher der Wind weht.
Ente redet, und ich bin schweigsam. Früher war es mit uns beiden umgekehrt. Eigentlich könnte ich schon gehen, aber ich bin neugierig, wie der abgeschnittene Fuß aussieht. Ente wird vielleicht sehr traurig werden, wenn ich ihn danach frage.
Er fängt aber selbst davon an. Er schlägt die Bettdecke zurück, und ich sehe seine dünnen Beine nebeneinanderliegen. Das eine Bein hat keinen Fuß mehr. Ente sagt, dass er in einem Jahr wieder laufen könne. Das glaube ich aber nicht, und er muss es wohl merken.
„Sie machen mir einen Fuß aus Leder und Holz“, sagt er und beugt sich weit zu mir hinüber. „In Russland lebt ein Flieger, dem wurden beide Beine weggeschossen. Der läuft wie ein gesunder Mensch und fliegt sogar wieder Flugzeug. Das ist eine tolle Geschichte mit diesem Flieger. Genosse hat sie mir erzählt, er hat sie in einem Buch gelesen.“
Ente hat von diesem vielen Erzählen rote Backen bekommen. Ich bin froh, dass die Schwester in das Zimmer ruft: „Die Besuchszeit ist zu Ende.“ Ente drückt mir die Hand. Seine Augen sind fröhlich. Noch einmal blicke ich verstohlen zu Genosse hinüber. Er schläft. Aber ich bin traurig.
Er hat mir Ente weggenommen.
In Brunos Faust glänzt ein Messer
Der kleine Muck hat seine Zauberpantoffeln verloren; das ist auf Seite 82 gerade noch zu lesen. Das nächste Blatt ist aber schon Seite 150, und da steht nichts mehr vom kleinen Muck geschrieben. So ist es, wenn im Buch die Hälfte fehlt; dabei gefällt mir die Geschichte vom kleinen Muck so gut.
Großmutter sitzt in dem roten Plüschsessel, der bestimmt schon älter ist als sie selbst, und strickt. Die Wolle zog sie aus einem alten Strumpf, und jetzt soll für mich ein warmer Schal daraus werden. Vor dem Fenster treiben weiße Flocken. Vor kurzem schien noch die Sonne, und hoch am Himmel zogen lustige weiße Wattewölkchen. Ein Spruch sagt: April, April, macht, was er will.
Von der Straße her pfeift es. Ich zucke zusammen. Das ist Bruno. Vorsichtig spähe ich hinter der Gardine zum Fenster hinaus. Unten auf der anderen Straßenseite steht er in seiner gesprenkelten Tarnjacke, die Kapuze hat er über den Kopf gezogen.
Damals, als ich von Ente aus dem Krankenhaus kam, ging ich einfach nicht zum Treffpunkt am Alex. Ich dachte immerzu an Ente, der so anders geworden ist. Ich habe auch über den Mann mit dem gelben Gesicht nachgedacht. Von ihm hat Ente anscheinend viel gelernt. Im Stillen wünschte ich mir manchmal, auch im Krankenhaus zu liegen, in einem weißen, warmen Bett. Einer erzählt, und man kann zuhören und fragen.
Ente und ich haben geschworen, uns niemals zu trennen und einander immer beizustehen. Einmal tat ich das nicht, weil ich Angst hatte, aber dann machte ich das wieder gut. Ich ging nicht hin zu Bruno. Schon zwei Wochen fehlte ich keinen Tag in der Schule. In Großmutters Kommode stehen ein paar Bücher. Zuerst las ich die Bibel, und die ist nicht so langweilig, wie ich dachte. Da ziehen sie oft in den Krieg und kämpfen.
Großmutter ist fromm. Sie besitzt ein ganz dickes Buch, so dick wie ein viereckiges Russenbrot.
Da sind tausend Geschichten von Heiligen drin. Das legte ich bald weg, weil ich in der Nacht davon träumte. Da wurden welche ins Feuer geworfen, aber verbrannt sind sie doch nicht, nur gestorben. Manche gingen einfach durch die Wände hindurch, schwebten über dem Marktplatz und sprachen zu den Leuten. Ich wurde von diesen Geschichten richtig wirr im Kopf.
Großmutter sagte ich, dass ich alle Heiligengeschichten gelesen hätte. Ich wusste, dass sie sich darüber freuen würde.
Großmutter hat noch ein Andenkenbuch an Großvater, und das hält sie sehr in Ehren. Sie hat es noch nicht gelesen, weil sie nicht richtig lesen kann. Bebel heißt das Buch; das klingt ähnlich wie Bibel. Ich nahm es mir einmal heimlich aus der Kommode. Das kann aber kein Mensch lesen. Die Schrift ist so krakelig, und mit dem Geschriebenen ist nichts anzufangen. Vielleicht ist das ein Arztbuch von früher. Großmutter erzählt immer, dass Großvater sehr klug war, bald wie ein Doktor, und er wollte auch andauernd allen armen Menschen helfen.
Das beste Buch von Großmutter ist das mit den Märchen. Das habe ich schon dreimal gelesen, aber beim kleinen Muck hat mir das nicht viel genutzt. Ich weiß bis heute noch nicht, was aus ihm geworden ist.
Das Lesen ist ganz schön, aber satt werde ich davon nicht. Manchmal dachte ich an Bruno. Jetzt hat er rausbekommen, wo ich wohne. Wieder gellt ein langer schriller Pfiff von der Straße. Ich muss jetzt nach unten.
Bruno sieht mich böse an und gibt mir nicht die Hand. Er ist einen Kopf größer als ich und über zwei Jahre älter.
„Warum kommst du nicht mehr?“, fragt er.
„Ich mache nicht mehr mit.“
Brunos Augen werden groß. „Wir hauen dich zusammen.“
Das werden sie tun, ich weiß es. Ich sage aber kein Wort.
„Mach keinen Unsinn“, sagt Bruno versöhnlich und streift mit einem Ruck seine Kapuze vom Kopf, „wir drehen ein Ding, da ist alles dran.“ Aus der Tasche seiner Tarnjacke holt er ein paar zerknitterte Geldscheine. „Hier, kauf dir was.“
Die S-Bahn schaukelt und schlingert hin und her, weil die Schienen ausgeleiert sind. Ich habe ein Abteil ausgesucht, wo die Fenster Glasscheiben haben, denn da kann ich hinausschauen.
Was wird heute Abend los sein? Bruno nahm mich noch nie zu einer großen Sache mit. Was verstehen die überhaupt unter einer großen Sache?
Bruno lernte ich auf dem schwarzen Markt kennen. Das war gleich nach dem Unglück mit Ente. Aus den Trümmern hatte ich eine alte Küchenwaage geholt, und die wollte ich verkaufen. Sie war ganz schön verbeult, und ich brachte sie erst in Ordnung. Großmutter putzte sie blank. Eine Frau wollte sie mir für zehn Mark abkaufen. Ich tippte an die Stirn und sagte nur: „Hundert Mark ist sie wert in unserer Zeit.“ Die Frau wollte mir eine kleben, aber sie hat es doch nicht getan. Für achtzig Mark wurde ich die Waage los. Als ich gerade verschwinden wollte, stieß mich jemand an. Vor mir stand ein großer Kerl mit einer grauen Militärmütze auf dem Kopf. Ich hielt mein Geld in der Tasche fest.
„Brauchst keine Angst zu haben“, sagte der Große, „ich will dein Geld nicht haben.“
Er hatte zugesehen, wie ich die alte Waage verkauft hatte. Er sagte: „Mensch, ich hätte mich schieflachen können, als du den Preis für das rostige Blechding bis auf achtzig Mark hochgeschraubt hast.“ Er wollte mit mir ein Geschäft machen: „Mir fehlt dein Talent zum Handeln, dafür habe ich aber einen Haufen Zeug zum Verkaufen. Natürlich nicht solch alten Plunder wie deine rostige Waage“, sagte er.
Seit dieser Zeit verkaufe ich für Bruno allerhand Zeug auf dem schwarzen Markt. Vom Verdienst bekomme ich etwas ab. Aber ich sehe schon zu, wo ich bleibe. Genau braucht Bruno nicht zu wissen, was ich so aus den Sachen herausschlage.
Der Bahnsteig in Rummelsburg ist leer. Es wird bald schummrig. Hier soll ich Bruno treffen. Ich sehe ihn schon. Er steht unten vor dem Bahnhof, und noch zwei andere sind bei ihm. Ich kenne sie, weil sie mir oft Zeug zum Verkaufen bringen.
Die drei, die Hände tief in den Taschen, starren mich aus verfrorenen Gesichtern unfreundlich an.
„Wird Zeit, dass du kommst“, brummt Bruno.
Wir trotten los, und Bruno läuft an der Spitze unseres Trupps. Er scheint hier gut Bescheid zu wissen. Ich kenne diese Gegend nicht. Ich weiß nur, dass in der Richtung, in der wir laufen, viele Lauben liegen. Großmutter erzählte mir einmal, dass wir früher auch Laubenpieper waren, zwischen Rummelsburg und Ostkreuz.
Ich bin aufgeregt, weil ich nicht weiß, was wir vorhaben. Den ganzen Nachmittag dachte ich darüber nach, was das eigentlich für eine große Sache sein könnte, von der Bruno sprach. Vielleicht haben sie in einer Ruine einen wertvollen Schatz entdeckt. In der letzten Zeit des Krieges vergruben viele Leute ihr Zeug. Davon habe ich schon oft gehört. Aber in dieser Gegend waren schon immer nur Lauben und arme Leute. Was sollte da wohl vergraben worden sein.
Die letzten Häuser liegen schon weit hinter uns, und wir laufen immer hinter Bruno her. Der Weg ist sandig und voller Löcher, in denen Wasser steht. Ich bin schon ein paarmal in eine Pfütze getreten. Meine Füße sind nass und kalt. Ich muss mir unbedingt feste Schuhe besorgen.
Bruno läuft in hohen, festen Schuhen mit dicken Ledersohlen. Das sind amerikanische Soldatenschuhe. Wir laufen und sprechen nichts, und ich habe eine Wut, weil ich friere. Aber es ist schon zu spüren, dass der Frühling kommt. Es riecht nach feuchter Erde und altem Laub. Ich habe den Frühling gern.
Bruno läuft langsamer. In einigen Lauben brennt trübes Licht.
Wir biegen in einen zwischen Gärten gelegenen schmalen Weg ein. Vor einem niedrigen Zaun bleibt Bruno stehen. Wir drängen uns an ihn heran und lauschen. Irgendwo bellen Hunde.
Ich glaube, mein Herz schlägt so laut, dass es weithin zu hören ist. Im Dunkel des Gartens steht eine Laube. Bruno drückt die Klinke der Gartentür nach unten. Die Tür quietscht in den Angeln. Wir gehen auf das Häuschen zu. Mit meinem Knie stoße ich gegen etwas Festes, Hartes. Dumpf poltert etwas zu Boden.
Bruno bleibt stehen und schimpft leise: „Mensch, nimm dich zusammen!“
Das Knie tut mir weh. Mit einem Stemmeisen bricht Bruno die Tür auf, die mit Dachpappe benagelt ist. Jetzt weiß ich, was wir hier sollen. In der Laube ist es warm, und es riecht nach Äpfeln und allerhand Kraut. Erkennen kann ich nichts, weil es stockdunkel ist. Eine Taschenlampe leuchtet auf. Ihr Schein irrt im kleinen, engen Raum umher, gleitet über einen Schrank, einen wackligen Tisch, einen schwarzen, rußigen Kanonenofen und bleibt plötzlich stehen. An der Wand steht ein Bett, und dort liegt ein Mensch. Ich spüre das Zittern meiner Beine. Der Mensch bewegt sich, hebt den Kopf und starrt in den Schein der Lampe. Der Mann ist alt und hat einen weißen Bart.
„Was wollt ihr?“, fragt er leise und stockend, und seiner Stimme ist anzuhören, wie erschrocken er ist.
Es ist still, jeder versucht wohl den Atem anzuhalten.
„Was wollt ihr?“, sagt der Mann schon lauter und richtet sich auf. Bruno geht zögernd einen Schritt auf ihn zu und flüstert: „Sei ruhig Mann, wir suchen was!“
Doch der Alte steht ächzend und stöhnend auf. Zerzaust steht er vor Bruno. „Diebe seid ihr! Ach, Diebe …“, sagt er weinerlich. Ich presse mich an die Wand. Ich möchte weglaufen, nur weglaufen. Bruno stößt den Mann vor die Brust, und der fällt auf das Bett zurück. Bruno hat ein Messer in der Faust. Die schmale Klinge glänzt kalt im Licht der Lampe.
Der Alte starrt mit großen Augen auf das Messer.
„Wir suchen was“, murmelt Bruno.
Einer stößt mich an. „Los, greif zu!“
Ich finde nichts, ich weiß nicht, was ich tun soll.
„Lange Leitung, he?“, höre ich neben mir.
Ich greife ein Bügeleisen; ich nehme noch mehr. Das Zittern meiner Beine verschwindet nicht.
Wir sind wieder auf den dunklen Wegen zwischen den Gärten. Wir laufen nicht mehr zurück nach Rummelsburg, wir laufen in Richtung Ostkreuz. Keiner spricht. Wir haben allerhand zu schleppen.
„Wir hätten abhauen sollen“, sagt plötzlich einer.
„Du bist vielleicht einer, hättest lieber zu Hause bleiben sollen“, entgegnet Bruno wütend.
Dann ist es wieder ruhig, nur der Sand knirscht unter den Schuhen, und Metallzeug scheppert in den Säcken. Wir hasten schneller an den Gärten vorbei. Dahinten in der Laube wird ein alter Mann verzweifelt nach seinen Sachen suchen.
Ich will nicht daran denken.
Ein Paar feste, hohe Schuhe habe ich mir eingepackt. Morgen werde ich sie mir richtig einfetten, und dann ist es vorbei mit den nassen Füßen.
Der Jugendhelfer schickt mich weg
Das Fenster ist nicht groß, und davor sind dicke Eisenstäbe. Der Wächter hat in der Zelle das Licht ausgeschaltet und gesagt: „Schlaf jetzt und mach ja keine Dummheiten.“
Ich bin geschnappt worden. Die anderen konnten noch weglaufen.
Durchs Fenster blinken ein paar Sterne. Es ist nicht kalt, denn es ist schon lange Mai, aber ich friere doch.
Großmutter wird zu Hause warten. Sie wird nicht einschlafen können und immerfort an mich denken müssen.
Was werden die von der Polizei morgen mit mir anstellen? Ob sie mich nach Sibirien schicken? Die schicken ja alle nach Sibirien. – Das sagte der Vater vom Bruno. Aber vielleicht bin ich noch zu klein. Was soll ich schon in Sibirien, da erfriere ich nur. Der eine von der Polizei war sehr freundlich zu mir. Er sah mich an und wackelte andauernd mit dem Kopf.
„Morgen wirst du uns alles erzählen, und dann werden wir weitersehen“, sagte er. Die können sich ganz schön verstellen. Ich werde aber nichts sagen, weil ich nichts sagen darf. Sonst kommt alles heraus, von der Laube und alles andere.
Ich darf die anderen nicht verraten. Ich habe schwören müssen, einen ganz schweren Schwur. Wer einen Schwur nicht hält, ist ein großer Lump.
Das war am 1. Mai. Vorher nahm mich Bruno noch einmal zu einer Sache mit. Zuerst hatte ich Angst. Aber es war nicht so schlimm wie in der Laube, und es lohnte sich auch. Wir stiegen in einen Bäckerladen ein, und ich bekam vier Brote.
Der 1. Mai ist ja ein Feiertag, da hatten wir keine Schule. Wir fuhren nach Erkner, Bruno, die anderen beiden und ich. Bruno hatte einen fleckigen Rucksack auf dem Rücken. Im Wald führte er uns zu einer einsamen Stelle. Es war noch früh, und die Sonne kam gerade über den Bäumen hoch. Bruno stellte uns im Kreis unter einen großen Baum. Er tat sehr geheimnisvoll und sagte, dass wir einen Bund gründen müssten, weil wir dann besser zusammenhalten würden und der eine sich auf den anderen verlassen könnte. Wenn wir ein Geheimbund sein wollten, müssten wir einen Schwur leisten.
Unter seiner Jacke holte er ein großes Messer hervor, das in einer schwarzen Metallscheide steckte.
In der Hitlerzeit trugen die Jungen solche Messer.
Aus seinem Rucksack kramte er eine Blechtasse und eine Bierflasche mit Kaffee hervor. Er goss etwas Kaffee in die Tasse. Jeder musste seinen Arm über die Tasse halten, und Bruno ritzte mit dem Messer über die Haut, bis das Blut kam. Das Blut tropfte in die Tasse, und Bruno rührte mit dem Messer um.
Jeder trank einen Schluck. Ich verzog keine Miene.
Dann legten wir unsere Finger auf die breite Messerklinge und schworen. Der Schwur war so: Jeder muss alles mitmachen, was der Geheimbund befiehlt, und keiner darf etwas verraten, sonst wird er sehr schlimm bestraft, denn wir sind sozusagen Blutsbrüder. Als wir mit der Schwörerei fertig waren, legten wir uns in den Wald auf eine sonnige Wiese und hielten ein Mahl. Bruno hatte auch Brot und Margarine mit. Ich rauchte eine Zigarette und trank etwas Schnaps mit. Mir wurde übel, und den anderen ging es auch nicht viel besser. Nur Bruno lachte darüber, aber schlecht war ihm auch.
Später fuhren wir in die Stadt zurück, und dort marschierten welche mit roten Fahnen, weil Feiertag war. Bruno sagte: „Das sind alles Bolschewisten, die stecken mit den Russen unter einer Decke und machen einen Haufen Propaganda. Aber lange dauert’s nicht mehr, dann hängen die alle.“
An einer Straßenecke arbeiteten welche in den Trümmern, und ganz oben hatten sie eine rote Fahne aufgepflanzt.
Bruno sagte lachend: „Einen schönen Feiertag haben die.“ Ich begriff nicht, was er damit sagen wollte; mir war auch sehr schlecht.
Danach drehten wir noch ein paar Sachen. Bruno und der Geheimbund verlangten viel. Ich wurde erwischt, als wir in einem Konsum einbrechen wollten. Bruno hatte ausspioniert, dass in diesem Konsum viel Speck und Fleisch war. Speck wird gut bezahlt auf dem schwarzen Markt. Dort stand aber ein Wächter. Ich fiel hin, und er hatte mich am Kragen.
Jetzt sitze ich in der Zelle, und morgen werden sie mich vernehmen. Wenn das Ente wüsste. Ich werde ihn nie mehr sehen und die Großmutter auch nicht mehr. Wer soll ihr jetzt helfen?
„Los, Junge aufstehen!“
Ich träumte gerade von Ente. Er machte mit einem Bein große Sprünge und kam auf mich zu. Riesengroß stand er vor mir und lachte laut, und ich hatte Angst, weil es plötzlich nicht mehr das Gesicht von Ente war, das sich zu mir hinabbeugte. Es war das alte Gesicht des Mannes aus der Laube.
Ich öffne die Augen. Die Sonne scheint durch die Eisengitter. Der Wächter, der mich gestern Abend eingeschlossen hat, steht vor meiner Pritsche.
Mir fällt alles wieder ein. Der Mann hat müde Augen und sieht mich nicht sehr freundlich an.
„Komm schon, nur Ärger hat man mit euch.“
Wir gehen durch einen langen Korridor. Es riecht nach altem Tabaksqualm. Jetzt möchte ich eine Zigarette rauchen. Ich werde sehen, dass ich türmen kann. Einsperren sollen sie mich nicht. Ich werde mich schon irgendwo verstecken.
Der Mann schiebt mich durch eine Tür, und ich rieche sofort, dass es hier etwas zu essen gibt. Ich werde später ausrücken. Vor einem weißgescheuerten Tisch steht eine Frau.
„Gib ihm was zu essen“, sagt der Mann zu ihr und geht wieder. Die Frau schaut mich an. Sie kann noch nicht sehr alt sein, hat aber doch schon graue Haare.
„Was hast du denn ausgefressen?“, fragt sie.
„Nichts habe ich ausgefressen“, sage ich.
Sie schüttelt den Kopf und seufzt: „Das ist immer dasselbe mit euch.“
Hier aus der Küche könnte ich ganz gut türmen.
Die Frau gibt mir einen Teller Mehlsuppe und dazu ein Stück Brot. Die Mehlsuppe ist süß. Die Frau riecht nach Seife und Abwaschwasser und setzt sich neben mich auf die Bank.
„Was wird denn dein Vater sagen?“, fragt sie.
„Hab keinen Vater.“
Sie schüttelt wieder den Kopf.
„Wie alt bist du denn?“, fragt sie weiter. Ich kaue mit vollen Backen das krümelige Schwarzbrot.
„Schon ganz schön alt bin ich“, antworte ich ihr und denke, dass sie ruhig wütend werden kann; ich habe meine Suppe gegessen, und mehr als verprügeln kann sie mich nicht.
Die Frau wird aber nicht wütend. Sie füllt mir noch einen Teller Suppe auf und gibt mir wieder einen Kanten Brot dazu.
„Na, iss schon!“, sagt sie.
Die Frau ist gut. Vielleicht weiß sie, was mir passieren wird. Ich erzähle ihr, dass ich stehlen wollte, weil Großmutter und ich wenig zu essen haben. Sie schaut mich nur nachdenklich an und sagt nichts.
„Schicken die mich nach Sibirien?“, frage ich.
Die Frau macht ein erstauntes Gesicht. „Nach Sibirien? Wer sagt denn das?“
Ich sage, dass man so was eben wisse.
Sie lacht böse. Dann spricht sie sehr viel.
Ich sei noch zu jung, ein Kind noch, und man würde mich überhaupt nicht einsperren. „Einsperren müsste man ganz andere, die, die das alles auf dem Kerbholz haben, die schuld daran sind, dass es so schlecht ist auf der Welt.“
Ich löffle die Mehlsuppe und kaue Brot.
Die Frau redet bald wie Ente im Krankenhaus. Ich höre zu und kann mir ja mein Teil denken.
Ich gehe durch die Tür und sehe Großmutter. Sie sitzt auf einem Stuhl und sieht mich an, und ich möchte schnell wieder zur Tür hinaus. Aber ich gehe zu ihr, und sie drückt mich. Dabei spüre ich, wie ihre Arme zittern.
Das ist so gemein, dass sie Großmutter geholt haben. Sie weiß doch nichts, sie weiß nichts von Bruno, nichts von der Laube, nichts vom Geheimbund.
An einem großen Schreibtisch sitzt ein Mann, dessen Augen sich hinter einer Brille mit dunklem Rand verbergen. Er sagt: „Setz dich, Peter.“ Seine Stimme ist tief und knarrt ein wenig. Der Mann will wissen, mit wem ich im Konsum einbrechen wollte. Ich habe diese Frage voll Angst erwartet. Ich denke an Bruno und an unseren Schwur. „Ich hab da ein paar Jungen getroffen, ich kenn sie aber nicht“, sage ich stockend. Das will der Mann nicht glauben und Großmutter wahrscheinlich auch nicht.
Der Mann nimmt die Brille ab. Er hat Augen, dass ich nicht wegsehen kann.
„Nun gut“, sagt er, „nun gut.“
Er schreibt etwas und reicht es Großmutter. Sie nimmt es mit zitternden Händen. Ich denke, dass dies bestimmt das Urteil ist, und mir wird mulmig im Magen.
„Großmutter muss gesund werden“, sagt der Mann dann zu mir. „Sie wird ihre Krankheit im Krankenhaus auskurieren. Und du kommst solange in ein Kinderheim.“
Großmutter lächelt und weint ein bisschen. Der Mann hinter dem Schreibtisch setzt seine Brille wieder auf.
Eingesperrt werde ich nicht, und den Schwur habe ich nicht gebrochen. Erst auf der Straße fällt mir ein, dass ich in ein Kinderlager soll.
Ich bleibe stehen.
„Ich gehe nicht von dir weg“, sage ich zu Großmutter. Großmutter zieht mich weiter, das Laufen fällt ihr schwer.
„Du musst schon …, ich muss doch ins Krankenhaus …, du kannst nicht allein bleiben“, murmelt Großmutter traurig, „vielleicht sterbe ich bald – mach mir keinen Kummer, Peterle.“
Ich will ihr keinen Kummer machen.
Die alte Wanduhr tickt. Ich kann nicht schlafen. Großmutter atmet schon ruhig. Der Mond leuchtet in unsere Stube, und er leuchtet genau auf das Bild von Großvater. Großvater sieht mich streng an, obwohl ich Großvater nie in meinem Leben gesehen habe.
Ich habe schon probiert; wo ich mich auch in der Stube hinstelle, immer guckt Großvater mir nach.
Morgen muss ich in ein Kinderlager. Ich will nicht.
Aber Großmutter kann sterben, wenn ich nicht hinfahre. Als ich noch sehr klein war, musste ich schon einmal in ein Kinderlager, und das habe ich noch nicht vergessen. Das war im Krieg. Ich wäre nie ins Kinderlager gekommen, wenn das nicht mit meinem Vater gewesen wäre.
Ich erinnere mich noch.
In einer Nacht wurde ich plötzlich wach. Es bummerte und krachte, und ich dachte zuerst, dass es wieder die Bombenflieger wären. Damals kamen die fast in jeder Nacht. Aber es waren keine Bombenflieger. An unserer Tür hatte jemand geklopft. Ich lief zur Zimmertür und schaute ängstlich in den Flur. Draußen stand Vater mit zerzaustem Haar, so wie er aus dem Bett gekommen war, und um ihn herum standen drei Männer. Sie sprachen laut, und ich habe nicht verstanden, was sie eigentlich wollten.
Einer sagte: „Machen Sie keine Scherereien, sonst …“
Dann packten sie Vater plötzlich und stießen ihn zur Tür hinaus. Ich rannte zum Bett zurück und verkroch mich unter der Decke. Vater habe ich nie wieder gesehen. Ich weiß auch nicht mehr, wie Vater eigentlich aussah, nur dass er groß war und blonde Haare hatte, weiß ich noch.
Mutter weinte viel, aber das nützte nichts, denn Vater kam doch nicht wieder. Wir zogen zur Großmutter, denn im Hause sahen uns alle schief an, weil Vater im Gefängnis saß. Großmutter weinte nicht, sie schimpfte auf Vater. Ein gewissenloser Mensch sei er, meinte sie, und es lohne gar nicht, um ihn zu weinen, weil er ja auch die ganze Zeit nur an sich gedacht hätte.
Wenn Großmutter so schimpfte, weinte Mutter noch mehr. Ich verstand nichts, aber ich grübelte oft darüber nach, wieso Vater etwas Schlechtes getan haben sollte.
Viele Wochen später kam dann ein Brief. Ich weiß es noch genau, weil ich ihn der Mutter ins Zimmer brachte. Als Mutter diesen Brief las, wurde ihr Gesicht ganz weiß, dann schrie sie:
„Sie haben ihn umgebracht …“
In diesem Brief stand geschrieben, dass Vater gestorben sei. Das erzählte mir Großmutter später.
Mutter wurde krank. In den Nächten schrie sie laut, und mich erkannte sie oft nicht mehr. Ich hatte große Furcht vor ihr. Ich kroch immer in Großmutters Bett. An einem Morgen wachte ich auf; da sah ich, dass Großmutter vor Mutters Bett stand und weinte.
Mutter war gestorben. Ich war mit Großmutter allein.
Es kam eine schlimme Zeit. Immer weniger gab es zu essen, und fast keine Nacht verging, in der nicht die Flieger über die Stadt brummten. In unserer Straße brannten viele Häuser ab.
Eines Tages besuchte uns ein fremder Mann. Er sprach mit Großmutter, und drei Tage später musste ich weg. Ich wollte nicht, aber es half nichts. Viele Kinder wurden damals wegen der Flieger aus der Stadt gebracht. Wir fuhren lange mit der Eisenbahn, bis wir in dem großen Kinderlager ankamen.
Dort hat es mir nicht gefallen.
Am Vormittag mussten wir zur Schule gehen, am Nachmittag arbeiteten wir bei den Bauern im Dorf. Ich war bei einem Bauern, der hieß Kunkel! Zum Frühstück haben er, seine Frau und der Knecht Speckstullen gegessen; ich bekam nur Sirupbrot. Wenn der Bauer böse war, er war oft böse, schimpfte er mich „faules Stadtpack“. Ich wollte weg, aber der Bauer war ein Freund des Lagerleiters, und vor dem hatten wir alle Angst.
Hinter dem Haus war ein großer Obstgarten. Einmal pflückte ich mir ein paar Äpfel, weil ich sonst keine bekam. Der Knecht erwischte mich und schleppte mich zum Bauern.
„Du verfluchter Saukerl, gehst mit deinen langen Fingern an mein Spalierobst. Na warte!“, sagte er.
Er brachte mich zum Lagerleiter.
Der schlug mir ins Gesicht und schrie: „Du Kommunistenbalg, eines Tages wirst du genauso im Zuchthaus landen wie dein Vater.“
Viele Kinder waren dabei, als ich die Schläge bekam. Seit diesem Tage ging es mir sehr schlecht. Niemand wollte sich mit mir abgeben, alle quälten und ärgerten mich, weil ich ein Kommunistenbalg war. Was konnte ich dafür, dass mein Vater etwas Schlechtes getan hatte? Damals lernte ich, dass alle Menschen schlecht sind, außer Großmutter.
Später, als Großmutter zu Besuch kam, erzählte ich ihr alles, und sie nahm mich heimlich mit nach Hause.
Damals wurde im Kinderlager nicht mehr so aufgepasst, weil die Russen näher kamen und alles schon durcheinanderging. Der Leiter ließ sich nicht mehr viel sehen, und der Bauer Kunkel spannte schon seine Pferde an. So war das damals.
Und jetzt soll ich wieder in ein Kinderlager. Der Mond ist weiter gewandert. Großvaters Bild sehe ich nicht mehr.
Die Wanduhr tickt immer leiser …
Dagmar ist ein komischer Name
Der Mann mit der Brille ist gekommen. Großmutter war schon ziemlich zeitig aufgestanden und hatte, leise vor sich hin sprechend, meine Sachen in den alten, abgeschabten Koffer gepackt.
Sie gab mir ein Portemonnaie. Es ist aus gelbem, rauem Leder und gehörte früher Großvater. Dahinein legte sie ein kleines silbernes Kreuzchen mit einer silbernen Kette. Das soll mich schützen.
Ich glaube nicht daran, dass es mich schützen kann, aber es ist von Großmutter.
Der Mann mit der Brille will mich in das Kinderlager bringen. Vielleicht ahnt er, dass ich keine Lust habe, dort hinzufahren. Er hat so einen Blick. Er sitzt in dem alten Sessel und sagt nichts. Ich gucke ihn mir von der Seite an. Wenn man nicht in seine Augen schauen muss, geht das ganz gut.
Großmutter sagte mir, dass er einer vom Amt ist, so ein Hoher. Danach sieht er aber nicht aus. Ein Hoher hat doch nicht so einen schäbigen Mantel an. So einer vom Amt, der muss doch ein Auto haben. Wenn ich ein Hoher wäre, ich würde mir einen guten Tag machen.
Brunos Vater war früher auf dem Amt, in der Hitlerzeit. Bruno erzählt davon und dass er es deshalb damals auch gut gehabt hat. Er konnte viel mit dem Auto fahren und brauchte nie hungern. Brunos Vater wird bald wieder so ein Hoher werden, der mit dem Auto fährt. Das erzählte mir Bruno auch einmal.
Mein Vater war kein Hoher, und deshalb hatte ich es immer schlecht. Großmutter sagt oft, dass Vater an unserem Elend schuld sei, weil er immer ein Dickkopf gewesen wäre. Mutter könnte noch leben und er auch, aber er musste ja in der Politik herumkramen.
Zuletzt wird sie dann meistens zornig, schüttelt die Faust und sagt: „Hätte sie ihn bloß nicht geheiratet!“
Großmutter hat nun alles eingepackt, und wir können losgehen. Ich will nicht heulen, weil der mit der Brille dabei ist. Großmutter weint aber. Sie wird im Krankenhaus nicht sterben, denn ich fahre ja ins Kinderlager.
Die Straße zum Bahnhof ist endlos lang. Ob Bruno auch weiß, dass ich nichts verraten habe?
Der mit der Brille trägt meinen Koffer. Er hat gesagt, dass wir uns abwechseln werden. Wir steigen in die S-Bahn, und der mit der Brille erzählt mir jetzt, wohin unsere Reise geht.
In die Schweiz fahren wir. Ich bleibe stehen.
„So weit fahre ich nicht mit“, sage ich erschrocken. Da lacht er. „Bis in die Schweiz ist es nicht so weit, ich meine doch die Märkische. Aber dort ist es auch sehr schön.“
Was soll ich davon halten. Von der Märkischen Schweiz habe ich noch nie etwas gehört.
Ich habe die Lust verloren, mich mit ihm zu unterhalten. Ich will nicht ausgelacht werden. Er zieht eine Zeitung aus der Manteltasche und liest.
Meine Joppe ist besser als sein Mantel, und das will ein Hoher von der Jugendhilfe sein. Ich drücke meine Nase lieber an der Fensterscheibe platt.
„Strausberg!“, schreit ein Lautsprecher, und wir müssen umsteigen. Auf dem Bahnsteig ist allerhand los. Viele Leute stoßen und drängeln. Alle schimpfen und schreien durcheinander. Mittendrin steht eine starke Kette von Blauen.
Das ist ja genauso wie auf dem Schwarzen am Potsdamer. Das ist aber ein Spaß. Die Blauen durchsuchen alle Leute, die viel Gepäck mitschleppen. Sie schwitzen dabei und müssen sich manches anhören. Ich schiele zu meinem Jugendhelfer. Der ist ganz blass und sagt kein Wort. Wir drängeln uns gerade durch die Kette. Die Blauen lassen uns durch, weil wir vom Amt sind.
Da beginnt hinter uns ein mächtiger Krach.
Ein Junge heult und schreit: „Lassen Sie mir doch mein bisschen, Herr Wachtmeister. Wir sind acht Kinder zu Hause …, seien Sie doch nicht so …“
Viele Leute drehen sich um, bleiben stehen und schimpfen noch mehr. Ich habe so meine Gedanken. Es ist ein schönes Durcheinander, und die Blauen wissen nicht, was sie tun sollen. Ich sehe mir die Sache richtig an, und da weiß ich Bescheid. Ich ziehe meinen Jugendhelfer weiter. Er sieht böse drein, und seine Lippen sind ganz fest zusammengepresst.
„Immer schimpfen sie auf die Falschen. Hunger haben viele, und jeder will essen. Die Schmarotzer werden dabei fett. Aber wer soll den Karren aus dem Dreck ziehen?“
Ich staune, wie mein Jugendhelfer sprechen kann. Ich stoße ihn an und lache.
„Sie können sich schon beruhigen, bei dem steckt kein Karren im Dreck.“
Der Mann sieht mich an.
„Das ist alles traurig, und du lachst?“
„Das ist doch nicht traurig, das ist ganz schön zum Lachen. Die haben den Dreh fein weg. Einer macht Spektakel, und fünf andere laufen durch, und die Blauen sind angeführt.
Ich freue mich über das Gesicht vom Jugendhelfer. Er sagt aber nichts, und böse ist er anscheinend auch nicht.
Im Dampfzugabteil gibt es keine Fensterscheiben. Aber es ist ja Mai, und da ist das nicht schlimm. Der Dampfzug rumpelt los, in die Schweiz, die aber nicht die richtige Schweiz ist.
Der Dampfzug fährt langsamer.
„Wir steigen jetzt aus“, sagt der Jugendhelfer.
Während der ganzen Fahrt hat er mit mir nicht viel gesprochen. Er nahm Bücher aus seiner Aktentasche und studierte in ihnen herum. Er las drei Bücher auf einmal.
Mir war das ganz recht. Ich stand am Fenster, und draußen ist auch immer viel zu studieren. Erst war das Land flach, und ich konnte weit über die Felder sehen. Felder und Wiesen sind so schön grün. Ich könnte immerzu hinschauen. In der Stadt sind nur Steine und Trümmer und schwarze Mauern. Der Jugendhelfer gab mir eine Leberwurststulle. Dann schlängelte sich der Zug zwischen kleinen Bergen hindurch.
Der Jugendhelfer steckt seine Bücher in die Tasche. Der Dampfzug hält.
Das Bahnhofsgebäude ist aus roten Ziegeln gebaut. Im Kriege müssen sie hier viel geschossen haben. Das halbe Bahnhaus ist ausgebrannt.
Wir klettern aus dem Abteil. Nur wenige Leute steigen aus.
Der Eisenbahner mit der roten Mütze auf dem Kopf ruft „Zurücktreten!“ und pfeift.
Der Koffer in meiner Hand wird schwer. Die Lokomotive zischt und ruckt an. Großmutter liegt sicher schon im Krankenhaus.