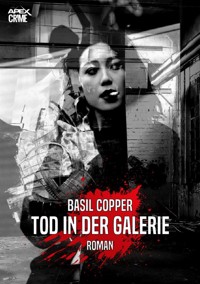5,99 €
Mehr erfahren.
Mike Faraday, der Privatdetektiv aus Los Angeles, hat keine Ahnung, weshalb er vom »Syndikat« ausgetrickst werden soll.
Aber an der Tatsache gibt es keinen Zweifel. Vor allem dann, als man die Leiche des Bürgermeisters von Los Angeles in Faradays Wagen praktiziert...
Der Roman Der Schwarze Ritter des britischen Schriftstellers Basil Copper (*5. Februar 1924; † 3. April 2013) erschien erstmals im Jahr 1972; die deutsche Erstveröffentlichung folgte 1973.
Der Signum-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
BASIL COPPER
Der Schwarze Ritter
Roman
Signum-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
DER SCHWARZE RITTER
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Das Buch
Mike Faraday, der Privatdetektiv aus Los Angeles, hat keine Ahnung, weshalb er vom »Syndikat« ausgetrickst werden soll.
Aber an der Tatsache gibt es keinen Zweifel. Vor allem dann, als man die Leiche des Bürgermeisters von Los Angeles in Faradays Wagen praktiziert...
Der Roman Der Schwarze Ritter des britischen Schriftstellers Basil Copper (*5. Februar 1924; † 3. April 2013) erschien erstmals im Jahr 1972; die deutsche Erstveröffentlichung folgte 1973.
Der Signum-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur.
DER SCHWARZE RITTER
Erstes Kapitel
Es schlug gerade fünf Uhr morgens wohlgemerkt - als ich meinen alten, himmelblauen Buick zur Küstenstraße hinaufsteuerte. Meine beste Zeit war das gerade nicht; normalerweise liege ich um diese Zeit noch auf dem Ohr. Doch hier handelte es sich um einen besonderen Anlass.
Die zunehmende Wärme des Tages begann langsam die Nebelschwaden aufzusaugen, und hier und dort glitzerten Lichtreflexe auf dem Pazifischen Ozean. Die im spanischen Stil erbauten Häuser hoben sich scharf Umrissen in dem harten Licht des frühen Morgens ab.
Die Leiche des großen, schweren Mannes, die zugedeckt auf dem Rücksitz des Kabrioletts lag, rutschte hin und her, wenn ich um die Haarnadelkurven bog. Ich hatte schon viel zu viel Zeit verloren, aber mir blieb keine andere Wahl. Ich konnte mir die Zeit nicht aussuchen. Diejenigen, die mir an den Kragen wollten, ließen mir keine Atempause oder Zeit zu irgendwelchen Abwehrmanövern. Allerdings hätte ich nicht angenommen, dass die Leute, die mir nach dem Leben trachteten, mir in der Nacht einen Toten aufhalsen würden. Das wäre ja auch zu einfach gewesen. Für mich, meine ich.
Ich hatte mir ausgerechnet, dass mir gerade noch eine halbe Stunde bleiben würde, um das zu tun, was ich tun wollte. Dann würde der übliche Morgenverkehr einsetzen. Ich schaltete wieder in den zweiten Gang zurück. Brummend kroch der Wagen einen Felshang hoch. Dann wurde das Terrain flacher, und ich fuhr zwischen Föhren und anderen immergrünen Gewächsen dahin. Da und dort schimmerten Sandpfützen zwischen Felsbrocken. Ich wusste, was ich wollte, mir blieben noch knapp zwanzig Minuten Zeit.
Nach einer Weile gelangte ich zu einem schmalen Streifen glatten Rasens. Von dort führte ein Felspfad zum Meer hinunter. Ich warf einen Blick in den Rückspiegel. Aus der Richtung von Los Angeles kam-nichts. Ich steuerte den Buick von der Straße und ließ ihn zwischen Steilhängen und Felsvorsprüngen den Pfad hinunterrollen. Wenn ich mich recht erinnerte, war am Ende gerade genug Raum, um den Wagen zu wenden; den Pfad im Rückwärtsgang wieder zu erklimmen hingegen war ein Ding der Unmöglichkeit. Ich lächelte trübe vor mich hin. So, wie sich die Dinge in der vergangenen Woche entwickelt hatten, würde es am Ende des Pfads keinen Wendeplatz geben. Und wenn ich den Wagen nicht wieder zur Straße hinauf bugsieren konnte, dann konnte ich mein Testament machen.
Steil neigte sich der Pfad in die Tiefe. Das blasse Grün des Wassers schimmerte durch das Laub. Gerade als ich bereit war, mich damit abzufinden, dass ich aus dieser Sackgasse nie mehr herauskommen würde, flachte das Gelände langsam ab, bis es schließlich fast eben war. Der Pfad wand sich über ein weites Felsplateau, das von niedrigen Büschen und Sträuchern bewachsen war. Ich hielt den Buick an und schaltete den Motor aus. Ich stieg aus und ging zum Rand des Plateaus und blickte hinunter zum Meer.
Ja, das war die richtige Stelle. Dunkel und abschreckend gähnte eine schmale Schlucht. Ich kehrte zum Wagen zurück und hob die Decke hoch. Die starren Augen des blonden Mannes blickten mich leer an. Ich faltete die Decke und legte sie auf den Rücksitz. Dann fasste ich den blonden Mann unter den Achseln. Seine Taschen hatte ich vorher schon durchsucht. Ich hatte nichts gefunden, was über seine Identität Aufschluss gegeben hätte. Vorsichtig zog ich ihn durch die Tür auf die sandige Oberfläche des Felsplateaus. Ich ließ ihn auf dem Rücken liegen und prüfte das Wageninnere auf Blutflecken und dergleichen. Ich fand nichts. Zumindest nichts, was man mit bloßem Auge hätte sehen können.
Ich schlug die Tür zu und kehrte zu dem Toten zurück. Ich packte ihn aus dem braunen Papier, das ich um seinen Körper gewickelt hatte. Er hatte nicht mehr geblutet, doch das Papier hatte verhindert, dass sein Blut zur Decke und zu den Wagenpolstern durchgedrungen war. In der Brust klaffte eine große Wunde. Rundherum waren Pulverspuren zu erkennen. Das bedeutete, dass der Schuss aus nächster Nähe abgefeuert worden war. Der große, blonde Mann sah nicht überrascht aus. Ich schloss daraus, dass er unter Freunden gewesen sein musste, als es ihn erwischt hatte. Nette Freunde. Er war tadellos gekleidet, trug einen zweifellosteuren, grauen Anzug mit einer rot-grün gestreiften Krawatte, die mir nach einer Art Clubkrawatte auszusehen schien.
Ich knüllte das braune Papier zusammen und steckte es ein.
Ich bückte mich und fasste den blonden Mann wieder unter die Achseln. Seine Füße hinterließen dünne Schleifspuren im Staub, als ich ihn in die Schlucht hinunterzog. Das würde ich nachher erledigen. Bald hörte ich von unten das gedämpfte Rauschen der Brandung. Unter den Felsen war es dunkel und kühl, trotzdem schwitzte ich. Der Mann war schwer. Schließlich hatte ich es geschafft und ließ den Toten auf einen Felsvorsprung fallen, der steil zum Wasser abfiel.
Ich zog den braunen Papierball aus der Tasche und schleuderte ihn hinaus. Der Wind erfasste ihn und trug ihn zum Wasser hinaus. Ich blickte ihm nach, bis er auf der Wasseroberfläche aufschlug. Dann setzte ich den Toten am Rand des Felsvorsprungs auf, stellte mich hinter ihn und stieß ihn in die Tiefe. Er überschlug sich zwei-, dreimal, ehe er ins Wasser tauchte. Die kleinen Kräuselwellen schlossen sich über seinem Kopf. Ich spähte angestrengt hinunter, doch er tauchte nicht wieder auf.
Darauf kletterte ich zum Plateau hinauf und verwischte so gut ich konnte mit meinen Füßen die Schleifspuren. Oben brach ich einen kleinen Ast von einem Busch und fegte den Sand auf dem Plateau glatt. Ich sah auf meine Uhr. Kurz nach halb sechs. Ich warf den Ast ins Gebüsch, wischte meine Hände ab und warf noch einen letzten Blick in die Runde. Dann setzte ich mich in den Buick.
Es war einfacher, als ich gedacht hatte. Im ersten Gang kroch der Wagen, die Nase himmelwärts gerichtet, die Steigung hinauf. Nur oben am Straßenrand wurde es einen Moment brenzlig, als das eine Vorderrad des Kabrioletts im Sand durchdrehte. Doch dann fassten die Reifen, der Wagen sprang ruckartig zur Straße hinauf, und gleich darauf stand er auf dem Rasenstreifen. Ich trat auf die Bremse und schaltete auf Leerlauf. Noch einmal sah ich mich gründlich um. Ich wollte sichergehen, dass ich nicht irgendeine Spur hinterlassen hatte. Natürlich waren die Abdrücke meiner Reifen zu sehen, aber Reifenspuren am Straßenrand sind nichts Besonderes.
Ich schaltete in den ersten Gang und lenkte den Buick zur Straße. Da tauchte ein Fahrzeug auf. Die dunkle Limousine trug auf der Tür das Zeichen der Polizei von Los Angeles.
Ein uniformierter Beamter mit einem harten, kantigen Gesicht und einer Sonnenbrille auf der Nase streckte den Kopf zum Fenster heraus.
»Haben Sie etwas Besonderes vor, Mr. Faraday?«, fragte er.
Ich schaltete meinen Motor aus und stieg aus, bemüht, nonchalant zu erscheinen.
»Ich wollte gerade nach Los Angeles zurück«, erwiderte ich. »Sie sind doch O’Rourke, nicht wahr?«
Der hochgewachsene Mann stieg aus dem Wagen. Er grinste plötzlich und nahm seine Sonnenbrille ab,
»War ja nur ein Witz, Mr. Faraday«, sagte er und schüttelte mir die Hand. »Aber Sie müssen zugeben, dass Ihr plötzliches Auftauchen hier verdächtig wirken muss. Wir haben vor einer Weile im Präsidium eine Meldung bekommen. Es hieß, hier oben ginge etwas vor. Sollte etwas mit einer Leiche zu tun haben.«
Ich spielte den Verwunderten und vergrub meine Hände in den Hosentaschen.
»Ich habe hier nur ein bisschen Müll abgeladen«, erklärte ich, froh, dass mir so rasch etwas eingefallen war. »Ich war über Nacht bei Freunden in Santa Monica, und weil ich auf der Heimfahrt hier vorbei musste, baten sie mich, ob ich nicht eine Ladung Sperrgut mitnehmen könnte.«
Der Polizeibeamte schob seine Mütze noch tiefer in die Stirn und kratzte sich am Hinterkopf.
»Ja, das ist wirklich ein Problem«, meinte er. »Ich habe einen Onkel, der hat ein privates Müllabfuhrunternehmen aufgezogen. Ursprünglich wollte er mich mit ins Geschäft hereinnehmen. Aber ich lehnte ab. Ich fühlte mich für Höheres geboren.« Er prustete. »Letztes Jahr hat er einen Reingewinn von 165.000 Dollar gemacht.« Er pfiff durch die Zähne und starrte ins Leere, mit den Gedanken offensichtlich weit weg. »165.000«, wiederholte er. »Da fragt man sich wirklich.«
»Und was ist mit der Leiche?«, erkundigte ich mich.
O’Rourke grinste wieder.
»Das war wahrscheinlich mal wieder so ein Irrer, der sich wichtigmachen wollte. Ich fahre hier jetzt einmal auf und ab und dann rufe ich das Präsidium an. War nett, Sie mal wieder zu sehen, Mr. Faraday. Wie geht denn das Detektivgeschäft zur Zeit?«
»Mittelprächtig«, erwiderte ich. »Aber man kann davon leben.«
O’Rourke winkte mir zu und kehrte zu seinem Wagen zurück. Ich setzte mich wieder in den Buick und trat die Fahrt nach Los Angeles an. Der unbekannte Tote, hoffte ich, würde inzwischen schon auf halbem Weg zum Golfstrom sein.
Ich stellte meinen Wagen wie gewohnt in der Parkgarage in der Nähe meines Büros ab und setzte mich ins nächste Café. Nachdem ich gefrühstückt und eine Zigarette geraucht hatte, fühlte ich mich wesentlich wohler. Es war inzwischen fast neun Uhr geworden. Ich rief in meinem Büro an. Stella war noch nicht da. Ich marschierte hinüber zu dem Gebäude, in dem sich mein Büro befand, und fuhr mit dem knarrenden, alten Aufzug nach oben. Durch das winzige Vorzimmer schlenderte ich in mein Allerheiligstes und ließ mich hinter meinem Schreibtisch nieder. Da blieb ich erst mal sitzen und rauchte eine Zigarette nach der anderen und starrte die Sprünge in der Decke an, bis schließlich Stella frisch und munter den Kopf zur Tür hereinsteckte.
»Kaffee gefällig?«, rief sie.
Ich nahm die Füße vom Schreibtisch und sah sie an.
»Was ist los?«, fragte sie.
Für Stella bin ich nämlich ein offenes Buch.
»Erzähle ich dir gleich«, antwortete ich. »Nach dem Kaffee.«
Sie sagte nichts, warf mir aber einen forschenden Blick zu und eilte dann davon, um den Kaffee zu kochen. Ich wartete, bis ich das Blubbern der Kaffeemaschine hörte und drückte meine Zigarette aus. Niemand kochte so guten Kaffee wie Stella. Ich wollte mir den Genuss nicht verderben.
An diesem Tag trug sie einen weißen Minirock mit breitem, rotem Ledergürtel und eine knapp sitzende Bluse. Mein Blutdruck stieg.
»Hast du den Examiner heute schon gesehen?«, rief Stella aus der Kaffeeküche.
»Nein.«
Sie brachte mir die Zeitung herein. Ohne besondere Neugier faltete ich sie auseinander und lehnte mich zurück. Doch gleich fuhr ich hoch. Fette Schlagzeilen sprangen mir ins Auge.
Bürgermeister Cartwright von Los Angeles verschwundene
Ich beschloss, den Bericht später zu lesen. Erst brauchte ich den Kaffee.
Wieder starrte ich auf die Riesenaufnahme des Bürgermeisters. Es gab keinen Zweifel. Bürgermeister Dwight D. Cartwright war der große blonde Mann, den ich an diesem Morgen in den Pazifischen Ozean befördert hatte.
Zweites Kapitel
Man wollte mich umbringen. Angefangen hatte es eine Woche zuvor. Ich war zum Zeitungsstand in der Nähe meines Büros hinuntergegangen, um mir einen Examiner zu holen. Es war etwa fünf Uhr nachmittags. Die Straßen waren, wie üblich, verstopft, die Luft war schwer von Auspuffgasen. Es war ein Tag wie jeder andere. Ich stand da und sog genüsslich den Smog ein und erfreute mich am Verkehrsgewühl, an dröhnenden Hupen und an dem Gedränge auf den Bürgersteigen.
Und da hatte jemand Gimpy, den Krüppel, erschossen. Gimpy war eine in dieser Gegend von Los Angeles wohlbekannte Type. Er war ein schmächtiger, kleiner Mann, verkaufte Tag für Tag seine Zeitungen, war ehrlich und anständig und immer bereit zu helfen, während er eisern sparte, um seiner verwitweten Mutter ein Häuschen auf dem Land kaufen zu können. Klar, dass so ein sympathischer Zeitgenosse umgebracht werden muss. Ich hatte gerade beschlossen, in mein Büro zurückzukehren, als aus dem Verkehrsgetümmel eine ganze Serie von Fehlzündungen donnerte. Ich blickte auf, und da prallte etwas mit bösartiger Wucht vom Bürgersteig ab und eine silberne Narbe glänzte im Granit.
So etwas hatte ich schon früher erlebt; deshalb warf ich mich zur Seite und suchte Deckung hinter einer Mülltonne, wo ich nicht so auffallen würde. Ich packte eine alte Frau bei den Beinen und zog sie mit mir zu Boden. Dank allerdings erntete ich dafür nicht. Inzwischen hatten auch andere Passanten begriffen; Panik brach aus, Leute warfen sich zu Boden, Frauen kreischten, alles ging drunter und drüber. Ich sah, wie ein rotgesichtiger Polizist auf einen rostroten Wagen schoss, der die in drei Bahnen gestaffelten Autokolonnen überholen wollte, und dann sah ich Gimpy. Er lehnte an seinem Stand und blickte auf das Blut, das zwischen den Fingern seiner Hand, die er auf die Brust gedrückt hielt, hindurchquoll. Er glitt zu Boden und stürzte nach rückwärts, als in der Ferne Polizeisirenen zu heulen begannen.
Als ich zu ihm gelangte, war es schon zu spät. Ich nahm eine seiner Zeitschriften und breitete sie über sein Gesicht. Der rostrote Wagen war verschwunden. Der ganze Zwischenfall hatte nicht länger als fünfzehn Sekunden gedauert. Der rotgesichtige Polizist hieß De Salvo. Ich kannte ihn und brauchte mich deshalb nicht auszuweisen. Die Zeugenaussagen waren dürftig und erbrachten nichts. De Salvo und ich gelangten zu dem Schluss, dass die Schießerei völlig sinnlos gewesen war. Dass Gimpy in dunkle Machenschaften verwickelt gewesen sein sollte, erschien uns beiden höchst unwahrscheinlich.
Ich kehrte in mein Büro zurück. Stella war bereits nach Hause gegangen. Ich braute mir einen Kaffee und hockte mich zum Nachdenken hinter meinen Schreibtisch. Doch es kam nichts dabei heraus. Gerade, als ich den Laden schließen wollte, läutete das Telefon. McGiver, ein junger Lieutenant von der Kriminalpolizei, meldete sich. Ich kannte ihn schon seit langem. Wir sprachen natürlich über Gimpy. Keiner von uns beiden hatte eine Ahnung, warum jemand ihn hätte töten sollen.
»Vielleicht hat man ihn mit jemandem verwechselt«, meinte ich.
»Kann sein«, antwortete McGiver, offensichtlich nicht überzeugt.
Ich versicherte ihm, meine kleinen, grauen Zellen stünden ihm jederzeit zur Verfügung und verabschiedete mich.
Das war am Donnerstag gewesen. Bis Samstag ereignete sich nichts mehr. Doch was dann geschah, war durchaus merkwürdig. Ich war in der Stadt unterwegs, und zwar im Auftrag eines Mannes, der den Verdacht hegte, dass seine Frau ihn betrog. Im Allgemeinen habe ich für solche Aufträge nichts übrig, doch mein Klient war ein Schauspieler, der im Geld schwamm, und die Frau war eine gutaussehende Blondine skandinavischen Typs. Das machte die Arbeit erträglich. Sie ging in teure Restaurants und exklusive Geschäfte, und es fiel nicht schwer, ihr auf der Spur zu bleiben.
An dem fraglichen Samstagnachmittag fuhr sie mit ihrem Wagen hinaus in die Vorstadtslums. Ich habe keine Ahnung, warum, kam auch niemals dahinter; vielleicht tat sie es nur, um mich abzuschütteln. Sie betrat ein heruntergekommenes Mietshaus, an dessen Feuerleitern Wäschestücke wie traurige Wimpel im Wind flatterten. Ich trieb mich eine Weile vor dem Haus herum, und als sie nicht wieder auftauchte, wollte ich wissen, warum nicht. Ich stolperte im dunklen Treppenhaus herum und stieß schließlich auf eine Tür, die in eine Hintergasse führte. Mir kam der Gedanke, dass sie vielleicht gar niemanden im Haus aufgesucht hatte, sondern durch die Hintertür entwischt war. Ich kehrte noch einmal zur Haupttür zurück und spähte hinaus. Ihr Packard stand noch auf der gegenüberliegenden Straßenseite.
Also marschierte ich durch den Hausflur wieder zur Hintertür und auf die Gasse hinaus. Es war dunkel dort und schmutzig, und die Mülltonnen stanken. Ich hatte nicht die Absicht, mich hier lange aufzuhalten. An einer der Tonnen stand eine alte Frau. Ich konnte nicht genau sehen, ob sie etwas hineinstopfte oder herausholte. Ich ging zu ihr hin, um sie zu fragen, ob sie eine junge, blonde Frau gesehen hätte. Es bereitete mir Schwierigkeiten, ihr begreiflich zu machen, was ich wollte.
Als ich immer noch eifrig bemüht war, ihr auseinanderzusetzen, worum es mir ging, veranlasste mich plötzlich etwas aufzublicken. Ein Schatten, der vielleicht von den Wäscheleinen herrührte; vielleicht aber auch nicht. Jedenfalls war es ein Schatten, auf einem der Stufen auf der Feuerleiter. Dann noch ein Schatten. In der Luft. Ich packte die alte Frau, und wir stürzten beide zur Seite. Sie stieß einen erschreckten Schrei aus. Dann schlug ganz in der Nähe etwas mit großem Getöse auf den Boden auf. Scheppernd holperte es über das Kopfsteinpflaster.
Ich rappelte mich auf. Die alte Frau zeterte. Die Mülltonne rollte immer noch durch die Gasse und verstreute ihren Inhalt über das Pflaster. Ich sah auf. Der Schatten auf der Feuerleiter war verschwunden. Da wusste ich, dass man es auf mich abgesehen hatte. Die Schießerei zwei Tage zuvor, bei der Gimpy ums Leben gekommen war, war keineswegs Zufall. Die Schüsse waren auch für mich gedacht gewesen. An diesem Nachmittag trug ich keine Waffe; doch ich beschloss, von nun an eine einzustecken. Ich klopfte der alten Frau den Staub von den Kleidern und versuchte, ihr zu erklären, was vorgefallen war. Ich glaube, sie dachte, ich hätte die Mülltonne selbst auf uns losgelassen. Ich verschwand, ehe die Gasse sich mit Menschen füllte.
Die Frau meines Auftraggebers ging an mir vorbei, als ich auf die Straße trat. Sie war gerade aus dem Haus gekommen, doch ich glaubte nicht, dass sie mit dem Zwischenfall etwas zu tun hatte. Sie stieg in ihren Wagen und fuhr davon. Ich kehrte in mein Büro zurück und erledigte ein paar Anrufe.
Das war am Samstag. Aber diesmal gönnte man mir keine zweitägige Ruhepause. Man ließ mir gerade vierundzwanzig Stunden Zeit. Ich hatte Stella am Sonntagabend ins Kino eingeladen, und hinterher waren wir noch auf einen Drink an die Küste gefahren. Es war fast zwei Uhr morgens, als ich meinen Wagen auf dem überdachten Abstellplatz neben dem Haus, das ich mir gemietet hatte, parkte. Seit dem Vortag war ich auf der Hut, doch rundherum war alles still, ich konnte nichts Verdächtiges bemerken. Nachdem ich eine Dusche genommen hatte, legte ich mich schlafen. Ich musste höchstens zwei Stunden geschlafen haben, als ein Geräusch mich weckte. Ich lauschte. Es klang, als machte sich jemand an der Terrassentür zu schaffen. Ich schlich zu meinem Schrank im Schlafzimmer und holte den Smith & Wesson heraus. Nachdem ich mich vergewissert hatte, dass er geladen war, tastete ich mich auf Zehenspitzen die Treppe hinunter. Durch das Fenster auf dem Treppenabsatz blickte ich hinunter zum Abstellplatz meines Wagens. Ich sah einen Schatten, der über die betonierte Einfahrt zur Straße huschte.
Dann rollte geräuschlos ein Wagen davon, den Hang hinunter, der von meinem Haus wegführt. Ich hörte, wie ein Stück abwärts der Motor angelassen wurde, indem der Fahrer den Gang einlegte. Ich knipste das Licht an. Ich war ziemlich sicher, dass jetzt niemand mehr da war. Ich öffnete die Terrassentür und untersuchte sie. Das Holz des Türrahmens war aufgekratzt und gesplittert. Ich ging nach oben und zog mich an. Da stimmte etwas nicht. Ein geübter Einbrecher hätte die Tür schnell und geräuschlos geöffnet. Und diese Burschen waren verschwunden, ohne etwas erreicht zu haben.
Oder sollten sie vielleicht den Buick in der Mache gehabt haben? Der Gedanke war mir nicht sogleich gekommen.
Ich steckte den Smith & Wesson ins Schulterhalfter und knotete meinen Schlips. Fast zehn Minuten waren verstrichen.
Die ersten Lichtstreifen leuchteten am Himmel. Ich ging hinaus zum Abstellplatz. Und da sah ich den blonden Mann auf dem Rücksitz. Ein höchst unerfreulicher Anblick. Und er wurde noch unerfreulicher, als ich die Scheinwerfer eines Fahrzeugs sah, das tief unten die Straße heraufzukriechen begann.
Man hatte mir den Toten in den Wagen gesetzt und dann die Polizei alarmiert. Das Fahrzeug dort unten war zweifellos ein Polizeiauto. Ich glaubte nicht, dass der Denunziant meine Adresse angegeben hatte. Das wäre zu auffällig gewesen.
Ich raste ins Haus, holte eine Decke, verpackte meinen toten Insassen, deckte ihn zu und ließ dann den Wagen ohne Licht bergab rollen. Ein ganzes Stück weiter unten hielt ich am Straßenrand, die Scheinwerfer immer noch ausgeschaltet, und wartete. Es dauerte lange, ehe der Wagen, den ich zuvor gesehen hatte, vorüberkam. Ich hielt den Atem an. Ohne zu zögern, fuhr der Wagen vorbei, als suchte der Fahrer etwas ganz Bestimmtes. Durch den Rückspiegel sah ich ihm nach. Als er die Kreuzung passierte, atmete ich auf.
Ich löste die Handbremse und fuhr weiter bergab. Als ich außer Sichtweite war, schaltete ich das Abblendlicht ein und ließ den Motor an. Nach einer Weile entdeckte ich einen durch Bäume geschützten Parkplatz am Straßenrand. Dort hielt ich an und durchsuchte die Taschen des blonden Mannes. Ich fand nichts. Sogar die Etiketten waren aus seinen Kleidern herausgeschnitten.
Danach fuhr ich hinauf zu den Klippen, um die Leiche des Bürgermeisters von Los Angeles in den Pazifischen Ozean zu stürzen.
Drittes Kapitel
Stella blieb lange stumm, nachdem ich geendet hatte. Sie hatte eifrig mitgeschrieben, und mehrere Seiten ihres Blocks waren gefüllt. Ich ging in die kleine Küche und schenkte mir noch eine Tasse Kaffee ein. Dann setzte ich mich wieder an meinen Schreibtisch und zündete mir eine Zigarette an.
»Und der Bürgermeister schwimmt jetzt also mit unbekanntem Ziel irgendwo im Meer«, stellte Stella schließlich fest.
»So ist es«, bestätigte ich. »Wenn er angetrieben worden wäre, hätten wir das schon im Radio gehört.«
Stella schüttelte den Kopf, als ich ihr eine Zigarette anbot.