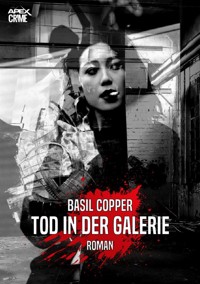4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Signum-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Einer der seltsamsten Aufträge für Mike Faraday, den Privatdetektiv aus Los Angeles: Er soll sich um das »Habichtsnest«, den einsamen Landsitz von Rechtsanwalt Fogel, kümmern. Die hohen Mauern bergen das Geheimnis um den Tod von Fogels Bruder - und Faraday merkt bald, dass sich noch mehr Leute für dieses Geheimnis interessieren... Der Roman DIE MAUER DES SCHWEIGENS des britischen Schriftstellers Basil Copper (*5. Februar 1924; † 3. April 2013) erschien erstmals im Jahr 1975; die deutsche Erstveröffentlichung folgte 1978. Der Signum-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
BASIL COPPER
Die Mauer des Schweigens
Roman
Signum-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Buch
DIE MAUER DES SCHWEIGENS
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Impressum
Copyright © 1975/2023 The Estate Of Basil Copper/Signum-Verlag.
Original-Titel: The High Wall (Robert Hale & Company, 1975).
Übersetzung: Wulf Bergner.
Lektorat: Dr. Birgit Rehberg
Umschlag: Copyright © by Christian Dörge.
Verlag:
Signum-Verlag
Winthirstraße 11
80639 München
www.signum-literatur.com
Das Buch
Einer der seltsamsten Aufträge für Mike Faraday, den Privatdetektiv aus Los Angeles: Er soll sich um das »Habichtsnest«, den einsamen Landsitz von Rechtsanwalt Fogel, kümmern.
Die hohen Mauern bergen das Geheimnis um den Tod von Fogels Bruder - und Faraday merkt bald, dass sich noch mehr Leute für dieses Geheimnis interessieren...
Der Roman Die Mauer des Schweigens des britischen Schriftstellers Basil Copper (*5. Februar 1924; † 3. April 2013) erschien erstmals im Jahr 1975; die deutsche Erstveröffentlichung folgte 1978.
Der Signum-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur.
DIE MAUER DES SCHWEIGENS
Erstes Kapitel
Es war einer dieser feuchtheißen Tage in Los Angeles, an denen die Sonne den Asphalt aufheizt und man all seine Energie dabei verbraucht, Tricks zu erfinden, um bis zur Abendkühle zu überleben. Die Klimaanlage unseres Gebäudes war wie üblich außer Betrieb, und ich hatte die Wahl, ob ich bei geschlossenen Fenstern vor Hitze eingehen oder bei geöffneten im Smog ersticken wollte. Ich hatte mich für die zweite Möglichkeit entschieden.
Ich stand am Fenster, beobachtete die Verkehrsstauungen auf dem Boulevard, spürte, wie mir das Hemd am Rücken klebte, und wünschte mir, ich hätte einen anderen Beruf. Aber da ich etwa zweimal in der Woche von solchen Anwandlungen befallen werde, nehme ich sie nicht allzu ernst. Stella war im Augenblick irgendwo unterwegs, deshalb konnte ich mich nicht einmal auf einen Kaffee freuen. Ich sah zu den Rissen in der Decke auf und seufzte.
Dann ging ich in unseren winzigen Waschraum und ließ mir zum zweiten Mal an diesem Nachmittag lauwarmes Wasser über den Kopf laufen. Dabei klingelte das Telefon. Ich beeilte mich nicht gerade und ließ es ruhig ein paarmal klingeln, bis ich meinen Schreibtisch erreichte.
»Detektivbüro Faraday«, meldete ich mich.
»Wird allmählich Zeit!«, antwortete eine heisere Stimme. »Ich dachte schon, Sie wären eingeschlafen.«
»Was gibt’s denn?«, erkundigte ich mich.
»Sie sind mir empfohlen worden«, knurrte der Anrufer. »Aber ich weiß nicht recht...«
»Bitte, wie Sie wollen«, sagte ich. »Bei dieser Hitze will ich mich auf keinen Fall überanstrengen.«
»Das merkt man, junger Mann«, bestätigte er eisig.
»Sie müssen mich aus einem bestimmten Grund angerufen haben«, stellte ich fest. »Aber Sie sind noch nicht dazu gekommen, ihn mir zu verraten.«
Die Stimme schnappte fast über. Ich grinste.
»Ich heiße Adelbert Fogel.«
»Wollen Sie mir das mitteilen oder sich dafür entschuldigen?«
»Ihre Manieren sind wirklich so schlecht, wie man mir erzählt hat«, knurrte Fogel.
»Anscheinend haben Sie mit jemand gesprochen, der mich gut kennt«, sagte ich. »Aber ich schlage vor, dass wir jetzt zur Sache kommen. Was kann ich für Sie tun?«
»Ich brauche Ihren Rat, Mr. Faraday«, antwortete Fogel. »Darüber möchte ich nicht am Telefon reden. Sind Sie heute Nachmittag frei?«
»Frei wie ein Vogel«, versicherte ich ihm. »Soll ich zu Ihnen kommen oder kommen Sie zu mir?«
»Wo ist da der Unterschied?«, fragte er misstrauisch.
»Wenn ich zu Ihnen komme, kostet es mehr.«
»Nein, nein, ich komme in Ihr Büro, Mr. Faraday! In einer halben Stunde?«
»Okay, ich warte«, bestätigte ich.
Ich legte den Hörer auf und band mir langsam meine Krawatte um. Dann räumte ich meinen Schreibtisch auf. Bis ich damit fertig war, war ich in Schweiß gebadet. Ich dachte noch immer über den geheimnisvollen Mr. Fogel nach, als Stella zurückkam. Ihr schien die Hitze gar nichts auszumachen. Auf ihrem sonnengebräunten Gesicht unter dem blonden Haarschopf standen keine Schweißperlen wie bei mir. Sie warf mir aus ihren leuchtend blauen Augen einen besorgten Blick zu.
»Ziemlich schwül, was, Mike?«, fragte sie.
»Hör zu, ich bin hier der große Komiker«, wehrte ich ab.
Stella lachte und ließ ihren Einkaufskorb auf dem Schreibtisch stehen.
»Möchtest du einen Kaffee oder ist dir zu heiß?«
»Bitte einen Kaffee«, sagte ich. »Viel heißer kann mir davon nicht werden.«
Sie lächelte, schaltete die Kaffeemaschine in der Kochnische ein, kam zurück und packte ein Paket aus ihrem Korb aus. Ich starrte inzwischen wieder auf den Boulevard hinunter. Dann hörte ich ein Summen, spürte einen kühlen Luftzug und drehte mich um. Ich sah einen großen Ventilator auf dem Bücherregal zwischen unseren Schreibtischen, der sich in einem Halbkreis von links nach rechts und wieder zurück bewegte.
»Warum ist mir das nicht selbst eingefallen?«, meinte ich.
»Für solche Ideen bekomme ich schließlich mein Gehalt«, erklärte Stella mir. »Aber bevor du vor Dankbarkeit überschnappst, möchte ich dich daran erinnern, dass ich den Ventilator von deinem Geld gekauft habe.«
»Dann müsste er ausschließlich auf meinen Schreibtisch gerichtet bleiben!«
»Geizhals«, sagte Stella lachend.
Ich sah auf meine Uhr. Fogel musste in etwa einer Viertelstunde eintreffen.
»Wir haben einen Klienten«, erklärte ich Stella. »Er heißt Adelbert Fogel.«
»Für solche Witze ist’s viel zu heiß«, wehrte sie ab.
»Nein, das ist mein Ernst«, versicherte ich ihr. »Vielleicht hat er einen falschen Namen angegeben.«
»Hauptsache, dass sein Geld nicht falsch ist«, sagte Stella. »Wir sind ziemlich abgebrannt, mein Lieber.«
Ich grinste nur. Inzwischen duftete es herrlich nach frischem Kaffee.
»Sehr großzügig scheint er nicht zu sein«, erklärte ich ihr. »Als ich ihm gesagt habe, dass es teurer ist, wenn ich zu ihm komme, hat er gleich gesagt, er komme lieber selbst her.«
Stella runzelte die Stirn, während sie den Kaffee einschenkte und mir meine Tasse brachte.
»Natürlich!«, meinte sie. »Solche Klienten bekommen wir immer. An deiner Stelle würde ich auf einem Honorarvorschuss bestehen.«
Ich schob die Zuckerdose zu Stella hinüber, die jetzt an ihrem eigenen Schreibtisch saß.
»Er will schon von mir gehört haben«, sagte ich.
»Wer hätte das noch nicht?«, murmelte sie. »In dieser Beziehung ist Los Angeles eben doch nur ein Dorf...«
Tatsächlich dauerte es dann doch über eine Stunde, bevor Fogel aufkreuzte. Ich hörte den Summer im Wartezimmer, und Stella ging hinaus. Als sie einige Sekunden später zurückkam, war sie auffällig rot im Gesicht und warf mir einen seltsamen, warnenden Blick zu.
»Mr. Fogel«, meldete sie.
Hinter ihr erschien ein hagerer alter Mann. Ich sah jetzt, warum Stella so rot war. Sie hatte sich bemüht, ein Lachen zu unterdrücken.
»Solche jungen Damen wären zu meiner Zeit nicht beschäftigt worden, Mr. Faraday«, knurrte der Alte.
»Bedauerlich, Mr. Fogel«, meinte ich gelassen. »Aber Sie sind wohl nicht hergekommen, um mir das zu erzählen?«
Fogel starrte mich mürrisch an. Er stand vor meinem
Schreibtisch, als würde er demnächst zusammenbrechen, wenn er nicht bald durch Stützen gehalten werde. Seine Augen glitzerten neugierig.
»Würden Sie bitte aufstehen, Mr. Faraday?«
Ich stand auf und ließ mich von Kopf bis Fuß betrachten.
»Gut, ich bin mit Ihnen zufrieden«, entschied er. »Sie können wieder Platz nehmen.«
»Das freut mich, Mr. Fogel«, antwortete ich. »Die Frage ist nur, ob ich mit Ihnen zufrieden bin. Und Sie dürfen ebenfalls Platz nehmen.«
Fogel hüstelte misstrauisch, setzte sich in den Besuchersessel, lehnte seinen Krückstock gegen die Schreibtischkante und sah zu Stella hinüber.
»Ich würde Sie gern unter vier Augen sprechen.«
»Die junge Dame bleibt«, entschied ich. »Ich habe keine Geheimnisse vor ihr. Außerdem muss sie vielleicht Notizen machen.«
Fogel räusperte sich laut.
»Gut, wie Sie wollen, Mr. Faraday«, stimmte er zu. »Schließlich ist dies Ihr Büro.«
»Solange Sie das nicht vergessen, kommen wir prima miteinander aus«, versprach ich ihm.
Ich lehnte mich zurück und studierte Fogel in aller Ruhe. Der Alte war mittelgroß und auffällig hager; er hatte ein Nussknackergesicht mit glitzernden grauen Augen, einen Backenbart, der um die Jahrhundertwende modern gewesen sein mochte, und eine rote Hakennase, auf der ein Kneifer saß. Trotz der Hitze trug er einen mehrfach geflickten flaschengrünen Anzug mit zerrissener Wollweste, gestopftem Hemd und altmodischem Zelluloidkragen. Das Eigenartigste an ihm waren seine Wollhandschuhe, deren Finger er abgeschnitten hatte, und die abgetragenen Schuhe, deren Schnürbänderdurch Bindfäden ersetzt worden waren. Trotz dieser Aufmachung wirkte Fogel, den ich auf etwa siebzig schätzte, nicht ungebildet, und ich sah eine goldene Uhrkette über seiner grauen Weste.
»Wie hoch ist Ihr Honorar, Mr. Faraday?«, fragte er krächzend.
Ich nannte es ihm. Er zuckte zusammen.
»So viel?«, erkundigte er sich entsetzt.
»Am besten kommen Sie erst zurück, wenn Sie sich’s zusammengespart haben«, schlug ich vor.
Stella bekam einen Hustenanfall. Fogel verzog das Gesicht zu einer Grimasse, die vermutlich ein Lächeln sein sollte.
»Und wie hoch wäre Ihr Vorschuss, Mr. Faraday?«
»Ich habe noch nicht zugestimmt, für Sie tätig zu werden, Mr. Fogel«, sagte ich. »Aber falls es dazu kommen sollte, würde er dreihundert Dollar betragen.«
»Das ist viel, sogar sehr viel.« Er schüttelte den Kopf. »Dafür erwarte ich erstklassige Leistungen, Mr. Faraday.«
»Die kriegen Sie, Mr. Fogel.« Ich musste mich beherrschen, um den Alten nicht einfach rauszuschmeißen. »Was können wir also für Sie tun?«
Fogel hob eine behandschuhte Hand.
»Geduld, Mr. Faraday, nur Geduld! Ich muss Ihnen erst meine Karte geben. Und Ihre Sekretärin kann mir inzwischen eine Quittung ausschreiben.«
Er zog eine alte Brieftasche aus der Jacke. Die Brieftasche wurde von einem Gummiband zusammengehalten. Fogel nahm dreihundert Dollar aus dem Seitenfach und behielt Stella im Auge, während sie an ihren Schreibtisch zurückging, um ihm die Quittung auszuschreiben. Ich studierte inzwischen die altmodische Geschäftskarte, die Fogel mir hingelegt hatte. Zu meiner Überraschung schien der alte Knabe der Seniorpartner einer Anwaltsfirma zu sein. Fogel, Fogel, Fogel & Fogel.
»Nicht leicht auseinanderzuhalten«, meinte ich.
»Leider sind nur noch ich und mein Sohn übrig«, erklärte er mir bedauernd. »Brüder und Cousins. Eine der besten Firmen der Stadt.« Fogel rückte seinen Kneifer zurecht und warf mir einen prüfenden Blick zu. »Sie brauchen wohl keinen Anwalt, der auf Steuerrecht spezialisiert ist? Sonst könnten wir die jeweiligen Honorare miteinander verrechnen...«
»Ich zahle kaum Steuern, Mr. Fogel«, antwortete ich. »Meine Tätigkeit als Privatdetektiv ist mehr eine Art Hobby.«
Fogel lächelte schwach und legte einen mageren Finger an die Nase, während er sich in meinem Büro umsah.
»Unsinn, Mr. Faraday!«, protestierte er. »Ihnen geht’s doch offenbar nicht schlecht.«
Er machte eine Pause, als Stella ihm seine Quittung brachte. Nachdem er sie genau durchgelesen hatte, legte er sie sorgfältig in seine Brieftasche. Er sicherte sie mit dem Gummiband und verstaute sie wieder in seiner flaschengrünen Jacke.
»Wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen«, stellte ich fest. »Um welches Problem geht’s denn?«
Fogel räusperte sich.
»Dazu wollte ich eben kommen«, antwortete er. »Mir gehört ein Grundstück in den Bergen. Es ist mit dem Auto in ungefähr zwei Stunden zu erreichen. Ich möchte, dass Sie sich dort umsehen.«
»Zu welchem Zweck?«, fragte ich.
Fogel sah sich um, als habe er Stella in Verdacht, uns zu belauschen. Er wollte leiser sprechen, aber ich unterbrach ihn sofort.
»Die junge Dame gehört mit dazu«, erklärte ich ihm. »Wie soll sie die wichtigsten Punkte notieren, wenn sie sie nicht richtig hört?«
Fogels blasses Gesicht lief rot an. Aber bevor er ein Wort sagen konnte, löste Stella das Problem. Sie setzte sich mit ihrem Stenoblock in den zweiten Besuchersessel.
»Jetzt braucht Mr. Fogel sich nicht mehr so anzustrengen«, sagte sie lächelnd.
Fogels Kneifer glitzerte, als er sich wieder an mich wandte.
»Können wir jetzt weitermachen?«, erkundigte er sich. »Was wollten Sie vorhin sagen, Mr. Faraday?«
»Ich wüsste gern, was ich dort oben auf Ihrem Grundstück soll.«
»Gewiss, Mr. Faraday. Dazu wollte ich eben kommen. Es ist ein kleiner Besitz, den ich in den zwanziger Jahren geerbt habe. Er heißt Place of Hawks, das Habichtsnest.«
Er diktierte Stella die Adresse und den kürzesten Weg dorthin.
»Sehr malerisch«, warf ich ein. Fogel nickte. »Ich bin seit Jahren nicht mehr dort gewesen. Aber bei den heutigen Preisen muss der Besitz ziemlich wertvoll sein.«
»Warum vermieten Sie ihn nicht?«
»Dabei gibt’s ein kleines Problem, Mr. Faraday. Bis vor zwei Jahren hat dort eine Verwandte gewohnt, die dann leider gestorben ist. Zu dem Besitz gehören ein großes Landhaus, ein Bach und ein Stück Wald.«
»Und das Problem?«
»Ich kann nicht oft hinfahren«, sagte Fogel. »Bei den heutigen Benzinpreisen...«
»Haben Sie einen Verwalter?«, erkundigte ich mich.
Fogel schüttelte den Kopf. Ich brauchte nicht nach dem Grund dafür zu fragen.
»Das Haus ist zugesperrt«, erklärte er mir. »Aber dort gehen seltsame Dinge vor sich.«
»Zum Beispiel?«, wollte ich wissen.
»Das sollen Sie rauskriegen«, antwortete Fogel knapp und machte dabei ein so zufriedenes Gesicht, als habe er einen Punkt gewonnen.
»Irgendeinen Hinweis müssen Sie doch bekommen haben«, sagte ich.
»Auf dem Hügel gegenüber wohnt Colonel Proctor, der nächste Nachbar«, berichtete Fogel. »Er hat mich in letzter Zeit mehrmals angerufen, weil er im Habichtsnest Licht gesehen hat. Und dort sind Leute mit Autos gewesen. Er will die Autos und ihre Spuren gesehen haben.«
»Gibt’s dort oben jagdbares Wild?«, wollte ich wissen.
Fogel schüttelte den Kopf.
»Proctors Warnung nach scheint nichts so Gewöhnliches vorzuliegen.«
»Kann er Ihr Haus von seinem aus sehen?«, fragte ich.
»Nein, es steht hinter Bäumen. Aber die Zufahrt ist beleuchtet, und er müsste den Lichtschein sehen können.«
»Vielleicht hat er irgendwo ein Feuer im Wald gesehen«, meinte ich.
Fogel schüttelte wieder den Kopf.
»Proctor ist sich seiner Sache ganz sicher. Er ist abends hinübergefahren und hat sich davon überzeugt, dass das Licht gebrannt hat. Dann hat er angerufen, um zu fragen, ob ich im Haus sei. Aber dort hat sich niemand gemeldet.«
Ich lehnte mich zurück und sah zu Stella hinüber.
»Das kann länger dauern«, stellte ich fest. »Unter Umständen fahre ich ein paarmal vergeblich hin, ohne jemand zu ertappen.«
»Sie könnten Proctor aufsuchen«, schlug Fogel vor. »Er kann Ihnen erzählen, was er gesehen hat. Und falls ihm wieder etwas auffällt, könnte er Sie sofort anrufen.«
»Das ist eine gute Idee, Mike«, warf Stella ein.
»Na, was halten Sie davon, Mr. Faraday?«, wollte der Alte wissen.
Er stand auf und streckte mir seine ausgezehrte Kralle hin. Ich stand ebenfalls auf.
»Die Sache klingt interessant, Mr. Fogel«, sagte ich. »Erwarten Sie aber bitte nicht zu viel.«
»Ich erwarte überhaupt nichts, Mr. Faraday«, versicherte er mir. »Dafür bin ich schon zu alt.«
Wir schüttelten uns die Hand. Ich hatte das Gefühl, einem Museumsstück die Hand zu geben.
»Ich sehe mich morgen dort oben um«, versprach ich ihm.
Zweites Kapitel
Adelbert Fogel hatte leicht untertrieben. Ich brauchte fast vier Stunden, um Das Habichtsnest zu erreichen. Aber der alte Knabe hatte nicht mit der Verkehrsdichte in der Stadt und auf dem Freeway gerechnet. Wahrscheinlich war er seit zwanzig Jahren nicht mehr dort oben gewesen - per Anhalter, um Geld zu sparen. Ich musste so über diese Vorstellung lachen, dass ich beinahe die richtige Abzweigung verpasst hätte.
In den Bergen machte ich auf einem Rastplatz Pause, aß die mitgebrachten Sandwiches und trank dazu Kaffee aus der Thermosflasche. Das war Stellas Idee gewesen. Sie hatte sich ausgerechnet, dass es unterwegs nicht allzu viele Raststätten geben würde - und das stimmte auch. Ich hatte nur eine gesehen: viel zu nahe bei Los Angeles und viel zu früh fürs Mittagessen. Hier oben hatte ich eine wunderbare Aussicht. Ich stieg aus meinem alten blauen Buick, setzte mich auf einen Felsen und beobachtete die wenigen Autos, die unter mir die Kehren heraufkamen, während ich picknickte.
Die Straße wand sich in Haarnadelkurven zwischen riesigen Kalksteinblöcken bergauf und verschwand schließlich zwischen Bäumen. Die eigentlichen Berge begannen erst in etwa zehn Meilen Entfernung, aber dorthin würde ich nicht mehr kommen. Meinen Berechnungen nach hatte ich nur noch fünf, sechs Meilen weit zu fahren und musste dann auf eine Landstraße abbiegen. Ich schenkte mir Kaffee nach, lehnte mich zurück und ließ die Beine ins Leere baumeln.
Ich hatte meine Smith & Wesson aus dem kleinen Waffenlager im Schlafzimmer meines gemieteten Hauses in Park West geholt, und ihr Gewicht in dem Nylonschulterhalfter war beruhigend zu spüren, als ich mich nach vorn beugte, um nach dem letzten Sandwich zu greifen. Als ich damit fertig war, rauchte ich eine Zigarette, während ich einen Habicht beobachtete, der in den Aufwinden praktisch ohne Flügelschlag segelte.
Ich hätte ihn am liebsten den ganzen Nachmittag lang beobachtet, aber er flog weg und ließ mich mit der Straße, den Hügeln und der Bergkette am Horizont allein. Ich drückte meine Zigarette aus. Irgendwo in der Nähe plätscherte Wasser. Für eine Geschäftsreise war dieser Tag eigentlich viel zu schön.
Ich sah auf meine Uhr. Schon fast zwei Uhr. Ich trank den Kaffee aus, warf meine Abfälle in den dafür aufgestellten Behälter und setzte mich wieder in den Buick. Dann fuhr ich auf die Straße hinaus.
Jetzt musste ich auf die Abzweigung achten. Nach etwa einer Meile erreichte ich eine stählerne Fachwerkbrücke, die einen Fluss überspannte. Hier ergoss sich ein mindestens dreißig Meter hoher Wasserfall in einen kleinen See mit klarem grünem Wasser. Das Ganze sah wie ein Reklamefoto aus, und ich sah mehrere Autos mit Touristen auf einem gegenüber dem Wasserfall angelegten Parkplatz. Ein dicker Mann, der einen weißen Anzug und einen Panamahut trug, machte Aufnahmen mit einem riesigen Teleobjektiv.
Eine halbe Meile nach der Brücke kam endlich die Abzweigung, die ich suchte. Ich bog auf eine mit Schlaglöchern übersäte staubige Straße ab, die sich durch einen Wald bergauf schlängelte, und erreichte nach etwa einer Meile ein weites Tal. Rechts auf dem Flügel stand ein großes Landhaus wie eine Burg am Rand eines Steilhanges. Andere Gebäude waren nicht zu sehen. Nach Fogels Beschreibung musste sein Haus ungefähr gegenüber liegen.
Dann sah ich die Einfahrt und stellte den Buick vor dem Tor ab. Das Grundstück war mit einem zweieinhalb Meter hohen Zaun umgeben, der an dieser Stelle durch ein großes schmiedeeisernes Tor unterbrochen wurde. Das Land dahinter war verwildert; die beiden Fahrspuren waren nur etwa hundert Meter weit zu sehen, bevor sie unter Bäumen verschwanden. Auf einem Schild am Tor stand in ausgebleichten schwarzen Buchstaben:
PRIVATBESITZ - BETRETEN VERBOTEN.
Ich stieg aus, nahm den Schlüsselbund mit, den Fogel mir dagelassen hatte, und ging zum Tor.
Fogel hatte alle Schlüssel mit einem Anhänger versehen. Ich suchte den für das Tor heraus und steckte ihn in das große Vorhängeschloss, mit dem die rostige Kette, die beide Torflügel zusammenhielt, gesichert war. Es ließ sich mühelos aufsperren. Ich runzelte die Stirn, während ich das Schloss betrachtete. Es war erst vor kurzem geölt worden. Ich drehte den Schlüssel noch mehrmals. Er ließ sich glatt und leicht bewegen.
Ich sah mich langsam um. Auf den Hügeln in meiner Umgebung war niemand zu sehen. Ich stieß einen Torflügel auf. Auch er bewegte sich leicht und lautlos. Ich sah mir die Angeln an. Sie waren ebenfalls geölt worden. Wenn Fogel die Wahrheit gesagt hatte, hätten sie seit seinem letzten Besuch festgerostet sein müssen. Und er beschäftigte angeblich keinen Verwalter. Das war interessant.
Ich öffnete das Tor ganz und fuhr mit dem Buick die Einfahrt hinauf. Hohes Gebüsch zu beiden Seiten des Weges bildete einen grünen Tunnel. Ich ließ den Wagen langsam weiterrollen, weil mir mehrmals Kaninchen über den Weg liefen. Und dann hielt ich, stieg aus und betrachtete eine ausgetrocknete Pfütze, die mir aufgefallen war.