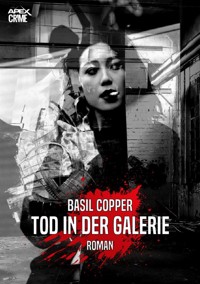5,99 €
Mehr erfahren.
Auch ein Privatdetektiv muss sich einmal Ferien gönnen. Doch für Mike Faraday ist der Traumurlaub auf den Bahamas bald vorbei: Am nächtlichen Strand entdeckt Mike einen Toten. Und dabei stellt er fest, dass Mord und Tourismus einfach nicht zusammenpassen...
Der Roman Nachtfrost des britischen Schriftstellers Basil Copper (*5. Februar 1924; † 3. April 2013) erschien erstmals im Jahr 1966; die deutsche Erstveröffentlichung folgte 1972.
Der Apex-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur in seiner Reihe APEX CRIME.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
BASIL COPPER
Nachtfrost
Roman
Apex Crime, Band 272
Apex-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
NACHTFROST
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Das Buch
Auch ein Privatdetektiv muss sich einmal Ferien gönnen. Doch für Mike Faraday ist der Traumurlaub auf den Bahamas bald vorbei: Am nächtlichen Strand entdeckt Mike einen Toten. Und dabei stellt er fest, dass Mord und Tourismus einfach nicht zusammenpassen...
Der Roman Nachtfrost des britischen Schriftstellers Basil Copper (*5. Februar 1924; † 3. April 2013) erschien erstmals im Jahr 1966; die deutsche Erstveröffentlichung folgte 1972.
Der Apex-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur in seiner Reihe APEX CRIME.
NACHTFROST
Erstes Kapitel
Ich lehnte mich in meinem Strandkorb zurück, trank den letzten Schluck aus dem großen Becherglas, bevor die Eiswürfel schmolzen, und zog mir meinen Strohhut in einem angenehmeren Winkel über die Augen. Das alles hier war tatsächlich genauso gut, wie man es sich erwarten durfte, dachte ich und blinzelte mit halbgeschlossenen Augen auf den weißen Sand, die grünen Wellen mit den weißen Kämmen und die gestreiften Sonnensegel. Stella hatte mich zuletzt doch überredet, mit ihr auf die Bahamas zu fahren, und wir hatten uns in der Obhut einer der kleinen Fluggesellschaften, die hier von Insel zu Insel verkehren, erst einmal in Nassau absetzen lassen - außerhalb des Territoriums von Onkel Sam. Dort allerdings war es uns zu belebt, und wir hüpften noch ein paar Inseln weiter, bis wir uns auf dieser hier endgültig zum Bleiben entschlossen.
Flugverkehr gab es von hier aus nur alle drei Tage, und das war uns recht, denn so hatten wir einigermaßen die Gewähr, dass wir unsere Ferien bis zum Ende ausnützen konnten.
Ich öffnete kurz meine Augen, als eine Blondine, das Haar von der Sonne fast weiß gebleicht, in einem verrückt getupften Bikini vorbeikam. Gleich darauf kniff ich die Lider wieder zu. Mir war ohnehin schon heiß genug.
Selbst das Gequäke aus einem Transistorradio von der plattenbelegten Terrasse drüben beim marmorgefassten Swimmingpool konnte mich nicht aufregen. Wozu man allerdings hier, direkt am Strand, auch noch einen Swimming-Pool brauchte, war mir unklar. Aber so war das eben hier. Ich schloss meine Augen, als ein großer, schwarzer Ober in scharlachroter Jacke und weißer Drillichhose mit einem Tablett voll geeister Getränke zu der Gruppe hinüberging, die sich neben meinem Strandkorb niedergelassen hatte.
Jeder schien sich seines Lebens zu freuen und mit sich selbst zufrieden zu sein in dieser Umgebung. Vielleicht eine Spur zu zufrieden, aber daraus konnte man niemandem einen Vorwurf machen. Die kleine Insel lag mitten in einem Meer, das alle Farbnuancen vom tiefsten Blaugrün bis zum hellen Gelb zeigte, dort, wo es seine Zungen über den seichten Grund und den Sand ausstreckte. Die Insel war zwölf mal fünfzehn Kilometer groß, aber dennoch gab es hier eine kleine Stadt, drei oder vier Dörfer, ein Dutzend Hotels, ebenso viele Clubs und sogar einen kleinen Flugplatz.
Stella war zum Einkaufen gegangen, daher blieben mir ein paar Stunden bis zum Lunch. Ich wollte sie in der besten Art und Weise verbringen, die ich mir unter den herrschenden Voraussetzungen vorstellen konnte: in meinem bequemen Strandkorb und halb dösend, halb genießend. Das war die wichtigste Lebensregel dieser Insel. Eine halbe Stunde später jedoch erwachte ich und hatte das Gefühl, ich läge auf einem Grill. Schweiß tropfte mir vom Körper und tränkte das Rohr meines Strandkorbs, das sich seinerseits in Streifen in meinen Rücken einzubohren schien. Zeit, dass ich mich ein bisschen bewegte.
Ich lief bis hinaus zum Wasser in einem Tempo, das den Einheimischen bei einer derartigen Hitze mörderisch erscheinen musste. Dann sprang ich flach in die Wellen, wurde von dem nächsten großen Brecher erfasst und kam prustend und voller Salzwasser wieder nach oben. Ein herrliches Gefühl, wenn mir auch das Wasser vorkam wie warme Milch. Das Mädchen in dem verrückten Bikini ging bis an die Wassergrenze und sprang von dort aus in einem eleganten Satz nicht weit von mir entfernt ebenfalls in die Fluten. Sie trug keine Bademütze und brauchte auch keine.
Ich planschte und plätscherte und tauchte an die zwanzig Minuten im Meer herum, dann gab ich es auf. Es war einfach zu warm, selbst hier im Wasser. Als ich hinauswatete und in Richtung auf meinen Strandkorb marschierte, um mich abzutrocknen, eilte einer der Ober in den scharlachroten Jacken vom Hotel her auf mich zu.
»Telefon, Sir«, rief er mir schon von weitem zu.
Ich muss ihn einigermaßen überrascht angeschaut haben.
»Ich bin aber nicht ordentlich angezogen, um ins Hotel...«
Er lächelte mich an wie eine Pepsodent-Reklame. »Das macht nichts, Sir. Ich habe den Apparat herausgebracht.«
Als ich bei meinem Strandkorb angekommen war, entdeckte ich den kilometerlangen, weißen Draht bis hinein in die Halle. Das Telefon selbst hatte eine Haltevorrichtung und hing damit an der Seitenwand meines Strandkorbes. Und der Teilnehmer am anderen Ende der Leitung war Stella.
»Tut mir leid, wenn ich dich gestört habe, Mike.«
»Es war mir ein Vergnügen«, sagte ich.
»Was machst du denn gerade?«, fragte sie.
»Nicht der Rede wert«, erklärte ich wahrheitsgemäß. »Wie wär’s, wenn du zur Sache kommen könntest?«
»Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir entgegenfahren und mich unterwegs auflesen könntest«, erklärte sie. »Ich bin drüben in Conch Cay. Mrs. McSwayne hat mich hierher mitgenommen, damit ich ein paar Besorgungen machen kann, und sie wollte mich auch wieder im Hotel abliefern, aber jetzt hat sie hier Bekannte getroffen und ist auf einen Drink eingeladen worden. Ich hoffe, es macht dir nichts aus, oder?«
»Nicht im geringsten«, erwiderte ich verlogenerweise. »Ich bin gleich drüben.«
Mrs. McSwayne war die Frau des Hotelbesitzers, bei dem wir abgestiegen waren, und Conch Cay war das nächstgelegene Dorf, etwa vier Meilen nördlich von hier,. In dieser Hitze kam es mir so weit entfernt vor wie Zentralafrika. Ich warf noch einen sehnsüchtigen Blick hinaus aufs Meer und seufzte. Warum diese Frauen immer und überall, selbst in den Ferien, zum Einkäufen gingen, Besorgungen machen mussten, wie sie es nannten, das wollte mir einfach nicht in den Kopf. Vor allem, da es hier im Hotel einen kleinen Laden mit tausend netten Dingen gab. Aber so war das nun einmal.
Ich zog mir einfach ein blauseidenes Sporthemd über die Badehose, streifte mir Sandalen über die Füße und war auch schon fertig. Die Wagenschlüssel fand ich in der Hosentasche, alles Übrige ließ ich im Strandkorb liegen. Auf meinem Weg zum Parkplatz bat ich den Wächter, er solle ein wenig auf mein Zeug aufpassen, bis ich wieder hier sei. Ein paar Geldscheine steckten in der Brusttasche meines Hemds. Als ich ein paar Minuten später um das Hotel herumkurvte, sah ich gerade noch, wie der Wächter meine Sachen hineintrug ins Haus.
Ich hatte trotz einer bösen Vorahnung einen Cadillac gemietet, in erster Linie deshalb, weil Stella eine solche Unmenge von Koffern mitnehmen wollte, dass ich mir dachte, in einem normalen Wagen bringen wir das ganze Zeug nie unter. Aber so gut der Service der Leihwagenfirma auch war, ich vermisste meinen guten alten Buick sehr, und auf den gefährlich schmalen Straßen hier gab es kaum eine Möglichkeit, mit diesem Straßenkreuzer den entgegenkommenden Fahrzeugen auszuweichen - jedenfalls hatte ich dieses Gefühl, und obwohl schon ein paar andere Wagen an mir vorbeigefahren waren, zweifelte ich immer noch daran, ob es dabei mit rechten Dingen zugegangen war.
Hier, weiter oben, wehte eine sanfte Brise, und der große, schwarze Wagen bahnte sich seinen Weg über die staubige Landstraße, die in die Leisen hineingetrieben worden war. Als mir wieder ein Wagen entgegenkam, fuhr ich so weit an den Straßenrand, dass die üppige Vegetation des Landes die rechte Planke peitschte. Die dunkelhäutige Lenkerin des anderen Wagens schenkte mir dafür ein Lächeln, gegen das selbst ein hiesiger Sonnenaufgang ein sehr dürftiger Anblick war.
Conch Cay war ein Sandstreifen mit einer Reihe blendendweißer Häuser, die sich um eine halbmondförmige, smaragdgrüne Bucht gruppierten, wo Fischerboote und Segel- und Motoryachten in der sanften See vor Anker lagen. Es gelang mir, den Cadillac sanft und in einer erträglichen Staubwolke zum Stehen zu bringen. Als ich mich erhob und ausstieg, tat ich das mit der Grazie eines rheumakranken Achtzigjährigen. Aber in dieser Hitze kam mir Los Angeles so nördlich-kühl wie Alaska vor, ich wollte schließlich auch nichts übertreiben.
Ich sah mich auf dem kleinen Platz um, nickte einem Gentleman zu, der so Palm-Beach-gebräunt war, dass sein Gesicht wie eine Walnuss wirkte. Stella war nirgends zu sehen, also ging ich hinein in die Bonefish Inn.
Im Cocktailraum saßen einige Leutchen herum: eine blonde Frau mit kreischender Stimme in einem gelben Etwas, das ihre Taille betonte wie die Reifen beim Michelin-Reklamemännchen, dazu eine Gruppe von Rotariern, ein paar überfreundliche Engländer, Marke Kolonialbeamter, ein oder zwei Barschnepfen. Die beiden Barkeeper, Einheimische in makellosen weißen Jacketts, waren ganz schön beschäftigt, also setzte ich mich fürs erste an einen Tisch in der Ecke und studierte die anderen Gäste. Während ich noch dabei war, betrat ein großer, breiter Mann in einem perlgrauen Anzug den Raum.
Er trug einen weißen Panamahut, gelbe Socken und Strandschuhe. Die Barkeeper schenkten ihm augenblicklich ihre ungeteilte Aufmerksamkeit. Vielleicht, weil er so groß war. Er musste knapp einsneunzig sein, und seine Schultern waren entsprechend breit. So, wie er aussah, hätte er einen halben Liter Spiritus bestellen müssen, aber stattdessen begnügte er sich mit einem Whisky. Das enttäuschte mich. Schließlich fand der eine der beiden Barkeeper auch Zeit zu einem Blick für mich, also drückte ich mich an den Tresen heran, neben diese Reinkarnation von Primo Camera. Ich muss zugeben, ich fühlte mich wie ein Beiboot neben einem Flugzeugträger.
»Womit darf ich Sie erfreuen, Söah?«, fragte mich der Barkeeper in der wohlmodulierten, leisen Stimme der Leute auf den Inseln. Es klingt angeblich sehr britisch, aber es gefällt mir ganz gut. Ich bestellte einen Limonensaft mit einem Schuss weißen Rum und viel Eis. Dann trug ich mein Glas hinüber zu einem der großen Fenster und setzte mich dort an einen Tisch, nippte an dem kühlen Drink und schaute hinaus auf die beiden verschieden blauen Streifen von Meer und Himmel. Für einen Privatdetektiv wie mich war das sicherlich einer der besten Tage im Leben, stellte ich zufrieden fest.
Ich saß vielleicht eine Viertelstunde da, dachte an gar nichts oder jedenfalls nichts Wichtiges, versuchte, soviel wie möglich von den Eigentümlichkeiten der Insel mitzubekommen, als ich Stella draußen vor meinem Fenster Vorbeigehen sah. Sie war in Gesellschaft von ein paar anderen Leuten, aber sie hatte bestimmt meinen Leihwagen draußen auf dem Parkplatz bemerkt und würde mich hier drinnen vermuten. Ich hatte eben noch Zeit, auch für sie einen Drink zu bestellen, als eine Gruppe von Leuten durch die Vorhalle in das Lokal kam. Stella, ein Ehepaar in mittleren Jahren, die sich bei näherem Hinsehen als Mr. und Mrs. McSwayne erwiesen, und ein hochgewachsener, militärisch dreinblickender Mann, den ich noch nie zuvor gesehen hatte.
Stella machte sich einen Augenblick von den anderen frei und kam zu mir an den Tisch.
»Hallo«, sagte sie. Ich gab ihr eine dementsprechend dämliche Antwort. Stella ist nun schon seit geraumer Zeit meine Sekretärin, aber ich bin es einfach nicht gewohnt, sie in einer derartig aufreizenden Kostümierung zu erleben. Sie trug himmelblaue Minishorts, die ihr passten, als wären sie wie eine zweite Haut mitgewachsen, und dazu ein Oberteil, das mindestens zehn Zentimeter zwischen Höschen und Brustansatz freiließ und zeigte, wie schön bronzebraun ihre Haut schon getönt war. Ihre langen, lasziven Beine endeten in Strandschuhen aus weißem Leder und Korkabsätzen. An sich eine ganz übliche Aufmachung, aber wie sie sie präsentierte, das musste man gesehen haben. Abgesehen davon war sie die beste Sekretärin, die ich mir nur wünschen konnte.
Ich beendete die Inventur meiner Angestellten, weil ich es selbst dafür zu heiß fand, und blickte ihr ins Gesicht. Sie sah mich amüsiert an, als habe sie meine Gedanken erraten, was gar nicht so schwierig war. Das honigblonde Haar hatte sie mit einem Band von der gleichen Farbe wie ihr Höschen nach hinten gebunden. Der schwarze Barkeeper riskierte einen Hitzschlag, so schnell brachte er Stella den vorhin bestellten Drink herüber an den Tisch. Bei den anderen Gästen ging er keineswegs ein ähnliches Risiko ein. Nun, ich konnte es ihm nicht verdenken.
»Komm doch rüber an die Bar«, sagte Stella jetzt. »Da sitzt jemand, der dich kennenlernen möchte.«
Wir ließen unsere Getränke am Tisch stehen. Die McSwaynes grüßten mich mit geräuschvollem Überschwang und ließen sich dann ein Stück weiter die Bar entlang bei Bekannten nieder. Der militärisch wirkende Mann im grauen Flanellanzug hatte eben ein Glas Whisky bekommen, als wir uns ihm von hinten näherten. Er war um die Sechzig, hätte ich gesagt, aber gut erhalten und noch voll drahtiger Energie. Seine Haut war dunkel und gleichmäßig gebräunt, und sein graues Haar trug er makellos von den Schläfen nach hinten gebürstet. Seine grauen Augen waren klar, und ein kleiner, silbergrauer Schnurrbart auf der Oberlippe war ebenso gepflegt wie sein übriges Äußeres. Auch ohne die Regimentskrawatte, die sorgfältig gebunden unter dem Kragen des cremefarbenen Hemds steckte, hätte man ihm angesehen, dass es sich bei ihm nur um einen Offizier Ihrer Majestät der Königin von England handeln konnte.
»Das ist Colonel Clay«, sagte Stella leise zu mir, ehe sie mich vorstellte.
Der Colonel lächelte. Sein Händedruck war trocken und kräftig. »Angenehm«, sagte er in jener die Silben verschluckenden Sprechweise, welche manche Amerikaner zu Lachsalven hinreißt und die ich ganz attraktiv finde. »Entzückt, Mr. Faraday; ich möchte schon seit längerer Zeit Ihre Bekanntschaft machen. Ich glaube, ich habe von dieser Sache in Washington gelesen, mit der Sie kürzlich zu tun hatten, oder täusche ich mich? Furchte, Sie finden es hier bei uns ziemlich langweilig. Ganz anders als in Ihrem Heimatland, nicht wahr?«
»Das ist mir gerade recht«, entgegnete ich. »Wir sind hier, um Ferien zu machen.«
»Das hat mir die kleine Lady schon gesagt«, erklärte er. »Ich übe hier übrigens einen ähnlichen Beruf aus wie Sie drüben in den Staaten.«
»Oh«, war alles, was ich dazu sagen konnte.
»Colonel Clay repräsentiert hier auf den Inseln die britische Regierung«, sagte Stella und steuerte mit uns beiden wieder den Tisch an, den wir vorhin verlassen hatten.
Der Colonel zuckte abwartend mit den Schultern. »So kann man es wohl kaum nennen«, meinte er. »Ein bisschen Diplomatie, ein bisschen Polizeiarbeit - Sie kennen das ja.«
Er trank einen Schluck aus seinem Whiskyglas, das er mitgenommen hatte. Nach einer kurzen Gesprächspause sagte er: »Sie müssen unbedingt an einem der nächsten Abende zum Dinner zu mir kommen - das heißt, wenn Sie die Absicht haben, länger hier zu bleiben.«
»Sehr gerne«, erwiderte ich seine Einladung. Ich saß schräg zur Bar und studierte den Riesenkerl, der sich wegen eines zweiten Drinks an den Barkeeper gewandt hatte und ihn nun in ein Gespräch verwickelte. Dabei fiel mir auf, wie er immer wieder auf die große Uhr über der Tür blickte. Irgendwie kam er mir bekannt vor, doch ich wusste nicht, wo ich ihn in meinem Gedächtnis einordnen sollte.
»Ich sagte schon vorhin zu der kleinen Lady«, berichtete der Colonel eben, »dass wir am kommenden Samstag eine Regatta und eine Militärparade haben werden. Aber vielleicht ist Ihnen das zu typisch britisch, Mr. Faraday?«
»Im Gegenteil. Ich habe gar nichts gegen das typische Britische, wenn Sie das meinen sollten.«
Er lachte. »Gut so«, sagte er. »Aber das habe ich nicht gemeint.«
Wir unterhielten uns noch weitere zehn Minuten, dann schaute er ein paarmal diskret auf seine goldene Armbanduhr und gestand uns, dass er nun gehen müsse. Wir erhoben uns alle drei, und ich versprach ihm, ihn wegen der Dinner-Einladung beim Wort zu nehmen. Er wollte uns im Hotel anrufen.
Dann gingen wir hinaus, nachdem wir den McSwaynes zugewinkt hatten. Stella ließ sich ihren großen Einkaufskorb von einem der Barkeeper geben und reichte ihn an mich weiter. Ich hatte eine bissige Bemerkung auf der Zunge, schluckte sie aber hinunter, weil der Colonel bei uns war. Draußen stieß ich fast mit einem kleinen Mann zusammen, der in großer Eile die paar Treppen heraufhastete. Er trug ein knallrotes T-Shirt, und von seinem Gesicht erkannte ich nicht viel mehr als die weit nach hinten gerutschte Stirn und ein Paar verschlagen und bösartig funkelnde Augen. Doch das genügte mir vollauf. Er murmelte so etwas wie eine mürrische Entschuldigung, ging hinein und sah sich drinnen sofort nach allen Seiten um.
Ich blieb noch ein paar Sekunden oben vor der Glastür stehen und ließ Stella und den Colonel vorausgehen. Durch die Scheiben erkannte ich, dass das Rothemd auf den Riesengorilla zuschoss und ihn sofort aufgeregt beschwatzte. Dann erhob sich Camera Nummer zwei, und die beiden ließen sich an einem der Tische am Fenster nieder. Ich ging die Treppe hinunter und schloss mich wieder Stella und dem Colonel an. Der stieg gleich darauf in einen scharlachroten, kleinen Sportwagen, der mir für die engen Straßen hier geradezu ideal geeignet erschien. Es entging mir nicht, dass der Colonel trotz der unmenschlichen Hitze zum Fahren feine Waschlederhandschuhe überstreifte.
»Es war mir ein Vergnügen, Mr. Faraday«, sagte er und lächelte mich an. »Wir müssen das mit dem Dinner wirklich bald arrangieren.«
Dann nickte er, bedachte Stella noch mit einem sehr wohlwollenden Blick und beschleunigte den Wagen auch schon draußen auf der Straße, ohne dass er hörbar in einen höheren Gang geschaltet hätte. Ein paar Sekunden später war der kleine Wagen mit dem Tempo einer Weltraumrakete in einer mittelgroßen Staubwolke verschwunden.
»Das muss ein toller Bursche gewesen sein, als er noch Mitte Zwanzig war«, sagte ich nachdenklich.
»Er ist auch jetzt noch gar nicht so schlecht«, erwiderte Stella mit großem Nachdruck.
Wir gingen hinüber zu dem Cadillac. Ich zuckte zusammen, als meine hinteren Partien die heißen Lederpolster berührten, und warf Stellas Korb auf den Rücksitz. Stella dagegen setzte sich einfach neben mich wie immer und fummelte an ihrer Handtasche herum. Sie schien die Hitze gar nicht wahrzunehmen, und ich konnte auch keinerlei Schweißperlen auf ihrer Stirn bemerken.
Ehe ich losfuhr, schaute ich noch einmal zurück zu dem Lokal. Die beiden Männer, die meine Aufmerksamkeit so sehr in Anspruch genommen hatten, saßen jetzt an einem der Fenster. Ich konnte mir denken, dass sie zu uns herüberschauten.
»Ich gäbe was drum, wenn ich wüsste, worüber du jetzt nachdenkst«, sagte Stella und blickte mich mit gerunzelter Stirn an.
Ich antwortete ihr nicht gleich. Erst ließ ich den Motor an und fuhr dann so sanft, wie ich das bei dem Engländer gesehen hatte, hinaus auf die Straße.
»Ich möchte nur eines wissen«, erklärte ich nach einer Weile. »Ich frage mich, was ein Gangster aus Chicago ausgerechnet auf dieser Insel zu suchen hat.«
Zweites Kapitel
Das Mittagessen im Hotel war vorzüglich. Stella und ich saßen im Speisesaal und genossen die Kokosnussmilch-Tomatensuppe, danach einen Guavenchutney. Als wir dann auch noch gebackene Paradiesfeigen mit einer Art einheimischem Gulasch hinter uns hatten, lehnte ich mich zurück und wandte mich dem Thema zu, das ich schon vor der Suppe angeschnitten hatte.
»Wo hast du eigentlich diesen Colonel kennengelernt?«, fragte ich sie. Stella zog die Augenbrauen kaum merklich hoch und winkte mit der Hand einem Schatten zu, der draußen vor dem Fenster vorbeiging.
»Ich nehme an, irgendwo in Conch Cay«, antwortete sie dann. »Er war einfach da, ganz ohne große Vorbereitungen. Die McSwaynes sagten, dass er sein Boot inspizieren wollte. Er bat nämlich eine kleine Motoryacht drüben in Conch Cay liegen. Anscheinend ist er ein begeisterter Angler. Und es war ganz selbstverständlich, dass ihn die McSwaynes zu einem Drink einluden.« Sie zog die Nase hoch. »Was soll diese Inquisition, he?«
Ich lachte. »Bilde dir bloß nicht zu viel ein, Puppe. Ich bin nicht eifersüchtig, wenn du das glauben solltest. Höchstens ein wenig neugierig. Ich frage mich, ob der Colonel aus rein persönlichen oder nicht doch auch aus beruflichen Gründen dort war.«
Jetzt ging ihr ein Licht auf. Sie lächelte dünn.
»Du meinst, er war wegen dieser beiden sonderbaren Typen drüben, die wir in der Bonefish Inn gesehen haben?«, fragte sie.
»Schon möglich. Zumindest der eine von den zweien hat ein ganz hübsches Strafregister. Vielleicht sollte ich es dem Colonel sagen, wenn er anruft.«
»Um Himmels willen, Mike, lass die Finger davon«, sagte Stella. »Vergiss nicht, du bist hier in Ferien!«
»Es war ja nur meine Neugier«, beruhigte ich sie. »Ich habe jedenfalls nicht die Absicht, meine Nase außerhalb meines Arbeitsbereichs in anderer Leute Angelegenheiten zu stecken. Schließlich sind wir hier auf britischem Territorium, wissen Sie, meine kleine Lady.«
Sie lachte, als ich den britischen Akzent des Colonels imitierte.
Dann bestellte ich den Nachtisch und zum Abschluss für jeden eine Tasse Kaffee.
Als wir nach dem Essen hinunter auf die Terrasse gingen, blieb ich einen Augenblick stehen und schaute zum Strand hinüber. Ich entdeckte eine mir bereits recht bekannte weibliche Gestalt, die mit einem gestreiften Wasserball spielte. Gegen die grellen Sonnenreflexe des Wassers sahen die Konturen ihrer langen Beine ganz dunkel aus, aber als sie sich bewegte, fing sich das Licht in ihrem Haar und ließ es golden schimmern. Dann lief sie ein Stück am Strand entlang, und ich sah, dass sie noch immer den getupften Bikini von heute Morgen trug.
Ich schaute mich nach Stella um, die schon wieder hinauf gegangen war zur Halle des Hotels. In diesem Augenblick stellte sich die getupfte Blondine mit einer herausfordernden Pose in den Sand und winkte mir zu. Ich winkte zurück. Sie warf den Ball in meine Richtung und wartete. Es war klar: Ich hätte hinlaufen und ihn ihr zurückwerfen sollen. Aber ich deutete nach hinten auf die bereits unter der Tür verschwindende Gestalt Stellas und zuckte mit den Schultern. Selbst von hier konnte ich sehen, wie sie hämisch grinste.
Am Nachmittag legte sich Stella ein paar Stunden nieder. Ich dagegen ging hinunter zum Wasser und blieb eine ganze Weile im nassen Sand sitzen. Ich dachte über die beiden Männer in der Bonefish Inn nach, dann sprang ich ins Wasser, und die Bewegung und das salzige Naß schwemmten meine düsteren Gedanken einfach weg. Das Meer war noch wärmer als am Vormittag. Ich borgte mir vom Hotel Schnorchel, Taucherbrille und Flossen und paddelte ein Stück weiter hinaus, um die Fische zu beobachten.
Nach einer Weile war ich auch dieser Beschäftigung überdrüssig, denn zwischen den Korallen gab es nicht sonderlich viel zu entdecken. Ich wollte gerade zurückschwimmen, als ein rosafarbener Blitz quer am oberen Rand meines Blickfelds vorbeischoss. Ich folgte ihm durch einen Vorhang von Seegras und sah gerade noch, wie ein undefinierbares Etwas zwischen den ebenfalls rosafarbenen Korallen und dem gelben Sand verschwand. Ich folgte der Bewegung, aber was es auch gewesen sein mochte, es kam sehr schnell voran und wollte keinesfalls auf mich warten. Als ich dort angekommen war, wo ich es zuletzt gesehen hatte, fand ich nichts mehr als ein paar Luftblasen, die langsam nach oben schwebten.
Ich dachte nicht an Gefahren irgendwelcher Art, aber als ich plötzlich fühlte, wie das Etwas meinen rechten Fußknöchel erfasste, der zwischen dem dichten Tang verborgen war, erstarrte ich und schauderte. Es war ein sanfter Griff, und als ich nach unten tauchte, reagierte ich einfach eine Spur zu langsam. Gleich darauf sausten verrückte Tupfen an meiner Brille vorüber. Dann erblickte ich fünf rotlackierte Zehennägel, als das Mädchen im getupften Bikini mühelos nach oben schwamm und schon bald danach die Oberfläche erreichte. Soweit man das unter Wasser feststellen konnte, möchte ich behaupten, dass sie mich herzlich auslachte.