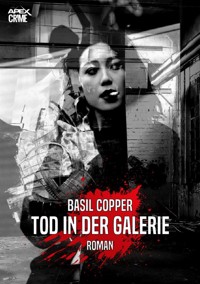
4,99 €
Mehr erfahren.
Die englische Presse urteilt: »Spannender Thriller, hart und poetisch zugleich.«
Der Privatdetektiv Mike Faraday vertritt Monica van Vooren in einem Erbstreit der Millionärsfamilie. Ihr Vetter will Faraday ein paar gute Tips geben - da bricht er sich in der van-Vooren-Galerie das Genick.
Und dann ereignet sich ein hinterhältiger Mord in der ägyptischen Abteilung des Museums...
Der Roman Tod in der Galerie des britischen Schriftstellers Basil Copper (*5. Februar 1924; † 3. April 2013) erschien erstmals im Jahr 1972; die deutsche Erstveröffentlichung folgte 1973.
Der Apex-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur in seiner Reihe APEX CRIME.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
BASIL COPPER
Tod in der Galerie
Roman
Apex Crime, Band 222
Apex-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
TOD IN DER GALERIE
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Das Buch
Die englische Presse urteilt: »Spannender Thriller, hart und poetisch zugleich.«
Der Privatdetektiv Mike Faraday vertritt Monica van Vooren in einem Erbstreit der Millionärsfamilie. Ihr Vetter will Faraday ein paar gute Tips geben - da bricht er sich in der van-Vooren-Galerie das Genick.
Und dann ereignet sich ein hinterhältiger Mord in der ägyptischen Abteilung des Museums...
Der Roman Tod in der Galerie des britischen Schriftstellers Basil Copper (*5. Februar 1924; † 3. April 2013) erschien erstmals im Jahr 1972; die deutsche Erstveröffentlichung folgte 1973.
Der Apex-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur in seiner Reihe APEX CRIME.
TOD IN DER GALERIE
Erstes Kapitel
Es war ein warmer Frühlingsnachmittag, einer jener milden, dunstigen Tage, wie man sie in Los Angeles genießen kann, solange die Stadt noch von der sommerlichen Glut der Sonne verschont bleibt. Ich saß an meinem Schreibtisch und warf zu kleinen Bällen zusammengeknüllte Briefumschläge in den Papierkorb; er stand gut drei Meter von mir weg, und ich bekam allmählich Routine. Siebzig Prozent der Papierbälle landeten im Korb. In ein Basketball-Team hätte man mich trotzdem nicht aufgenommen.
Ich seufzte, verschränkte die Hände hinter dem Kopf und lauschte dem Summen der Klimaanlage. Stella war unterwegs, also war mit Kaffee nicht zu rechnen. Ich seufzte wieder. Das moderne Leben kann manchmal schon zu einem teuflischen Problem werden, Faraday, sagte ich mir und legte die Beine auf meinen abgeschabten alten Schreibtisch. Nachdem ich mir eine Zigarette angesteckt hatte, saß ich da und sah zu, wie der blaue Rauch in Kringeln zur Decke aufstieg. Abgesehen von zwei Routineaufträgen eines Inkassobüros und einer unverbindlichen Anfrage eines alten Knaben, der einen Erben ausfindig machen lassen wollte, hatte sich in den vergangenen vierzehn Tagen nichts getan. Ich hatte nichts als Unkosten.
Ich blickte auf meine Schuhspitzen hinunter und stellte fest, dass sie arg abgestoßen waren. In meinem Beruf muss man ständig auf den Beinen sein, da halten die besten Schuhe nicht lange. Ich saß da, rauchte, klopfte hin und wieder meine Zigarette in dem Keramikaschenbecher auf meinem Schreibtisch ab und dachte an Stella. Das brachte mir jedoch auch keinen Trost, und so ging ich schließlich hinaus in die kleine, durch eine Glaswand abgetrennte Kochnische und schaltete die elektrische Platte ein. Normalerweise ist mir der Zutritt verboten, doch ich brauchte dringend eine Tasse Kaffee. Das Protokoll konnte mir gestohlen bleiben.
Als ich den Kaffee fertig hatte, trug ich die Tasse zu meinem Schreibtisch und ließ mich wieder nieder. Dafür, dass ich den Kaffee gebraut hatte, war er gar nicht schlecht, aber an Stellas kam er natürlich nicht heran. Ich stand auf und schenkte mir noch eine Tasse ein. Als ich ins Zimmer zurückkam, blieb ich am Fenster stehen und blickte auf die Straße hinunter. Der Verkehr war für diese Tageszeit schwach und der für Los Angeles typische Geruch nach Blumen, Autoabgasen und Smog nicht so intensiv wie gewöhnlich.
Als ich dort stand, fiel mir das merkwürdige Verhalten eines alten Herrn am Rand des Bürgersteigs auf. Er war groß und mager, hatte langes, graues Haar und einen altmodischen Backenbart. Die Sonne spiegelte sich in den Gläsern seines goldenen Kneifers. Er trug einen perlgrauen Cut und eine gestreifte Hose und schien über irgendetwas äußerst erregt zu sein. Er schoss auf die Fahrbahn hinaus und pfeilschnell wieder zurück auf den Bürgersteig, als die Trillerpfeife eines Verkehrspolizisten drohend schrillte.
Schließlich gelang es ihm jedoch, die Fahrbahn zu überqueren, und er verschwand unterhalb meines Fensters aus meinem Blickfeld. Ich wischte mir ein Lächeln vom Gesicht und kehrte an meinen Schreibtisch zurück. Gerade als ich mir eine neue Zigarette anstecken wollte, läutete draußen an der Tür zum Vorzimmer jemand Sturm. Ich blieb sitzen und wartete auf das Schnappen des Schlosses. Noch ehe ich mich’s versah, trommelten erregte Hände an die Tür zu meinem Büro, und eine hohe, gereizte Stimme rief: »Kommen Sie heraus, Faraday! Ich lasse mir das nicht bieten! Ich lasse es mir nicht bieten.«
Ich schlenderte zur Tür und öffnete sie. Der alte Knabe, der sich unten so todesmutig ins Verkehrsgetümmel gestürzt hatte, stand zornbebend auf der Schwelle.
Das magere, schmale Gesicht war tiefrot. Wütend hüpfte der Mann Von einem Bein aufs andere und fuchtelte mir dabei mit einem kleinen Malakkastock vor der Nase herum. Der Kneifer sprang auf seinem Nasenrücken auf und ab, und ich hatte Angst, er würde jeden Moment hinunterfallen.
»Michael Faraday?«, fuhr mich der alte Knabe schrill an. »Privatdetektiv?«
Ich bestätigte es.
»Ich lasse mir das nicht bieten, Mr. Faraday«, wiederholte er. »Das sind alles nichts als Lügen. Eine Schande für den guten Namen unserer Familie.«
»Ich habe den Namen leider nicht verstanden«, bemerkte ich.
Er machte ein etwas überraschtes Gesicht, als könne er nicht glauben, dass seine einzigartige Persönlichkeit jemandem unbekannt sei.
»De Camp«, erwiderte er. »Benson de Camp.«
»Vielleicht möchten Sie hereinkommen, wenn Sie geschäftlich hier sind.«
Ich kehrte in mein Büro zurück und wies auf einen Sessel.
»Ich schlage vor, Sie beruhigen sich ein wenig, Mr. de Camp, damit wir zur Sache kommen können«, sagte ich. »Im Moment weiß ich weder, wer Sie sind, noch was Sie herführt.«
Ein verschlagener Ausdruck erschien auf de Camps Gesicht. Vorsichtig trat er ein und schloss die Tür hinter sich. Er legte das Malakkastöckchen auf meinen Schreibtisch und schlug mit abgezirkelter Bewegung die Beine übereinander, als er sich setzte. Er ähnelte einem bösartigen Insekt, als er sich vorbeugte und die dünnen Lippen zusammenkniff. Seine Hände machten sich nervös an der blauen Fliege zu schaffen, die lose um seinen faltigen Hals hing.
»Sie verstehen offenbar nicht, Mr. Faraday«, erklärte er. »Ich bin Archivar. Ich führe ein recht weltfernes Leben.«
»Das gibt Ihnen noch längst nicht das Recht, Ihre schlechte Laune an mir auszulassen«, entgegnete ich. »Ich habe Sie nie zuvor gesehen, ich kenne Sie nicht und weiß nicht, was Sie wollen.«
Die Hand des alten Herrn flog zum Rohrstöckchen. Rote Flecken brannten auf seinen Wangen.
»Das ist eine Lüge, Sir«, rief er. »Ich weiß, dass meine Cousine hier gewesen ist.«
Er sprang auf und ergriff das Stöckchen. Ich streckte den Arm aus und packte sein Handgelenk. Er stieß einen Schmerzensschrei aus und ließ das Stöckchen auf den Schreibtisch fallen. Ich nahm es und brach es in der Mitte durch. Dann lehnte ich mich wieder in meinem Sessel zurück und ließ de Camp toben.
»Das war ein Geschenk meines Vaters«, kreischte er mit schriller Stimme.
Ich fing an, mich zu langweilen.
»Damit hat er Ihnen wohl in Ihrer Jugend das Fell gegerbt?«, entgegnete ich. »Wie hieß er denn? Marquis de Sade?«
»Wie können Sie es wagen!«, zischte er zwischen blutleeren Lippen hervor. »Mein Vater war ein ehrenwerter Mann.«
»Was man vom Sohn nicht behaupten kann«, meinte ich. »Entweder erklären Sie mir jetzt ruhig und höflich, was Sie von mir wollen, oder verschwinden augenblicklich.«
Ich dachte, er würde einen Schlaganfall bekommen, doch es gelang ihm, seine Wut zu zügeln. Er war wahrscheinlich an die sechzig Jahre alt, doch in seiner gegenwärtigen Stimmung sah er aus wie neunzig.
»Es besteht keinerlei Veranlassung, einen solchen Ton anzuschlagen, Mr. Faraday«, sagte er schließlich beschwichtigend.
»Was für einen Ton erwarten Sie denn von mir, Mr. de Camp? Sie haben mich bereits einmal einen Lügner genannt.«
Der alte Knabe lief rot an. Er griff nach den beiden Teilen seines Stückchens und wirbelte sie zwischen den Fingern herum.
»Schön, schön, Mr. Faraday«, sagte er, »ich bin durchaus bereit zuzugeben, dass ich ein aufbrausendes Temperament habe, aber diese Geschichte liegt mir wirklich im Magen. Sie sagen, meine Cousine ist nicht bei Ihnen gewesen?«
»Ganz recht«, bestätigte ich und blickte ihm ruhig in die Augen.
»In unserer Familie hat es einige Missverständnisse gegeben. Es wäre besser, wenn davon nichts publik würde. Worum es dabei geht, braucht Sie nicht zu kümmern. Meine Cousine sagte, sie wollte Sie konsultieren. Ich bin hergekommen, um das zu verhindern.«
»Aha, so einfach ist das«, meinte ich.
Er nickte. »Ganz einfach, Mr. Faraday. Meine Cousine ist ein energisches Mädchen. Jung und ausgesprochen eigenwillig.«
»Das scheint in der Familie zu liegen«, stellte ich fest.
De Camp gestattete sich ein dünnes Lächeln.
»Und sie war nicht hier?«, fragte er.
»Das habe ich Ihnen doch schon gesagt, Mr. de Camp«, antwortete ich. »Die Dame hat sich nicht blicken lassen. Und wenn Sie nicht Vorhaben, mir einen Auftrag zu geben, schlage ich vor, Sie machen sich jetzt auf den Heimweg.«
Wieder errötete der alte Herr und sprang von seinem Stuhl auf. Dann besann er sich eines Besseren und setzte sich wieder. Der verschlagene Ausdruck erschien erneut auf seinem Gesicht.
»Nicht so hastig, Mr. Faraday. Was für Honorare haben Sie?«
Ich nannte ihm die Zahlen.
Er blies die Backen auf, als finde er meine beileibe nicht übertriebenen Honorarforderungen maßlos.
»Zuzüglich Spesen?«
»Zuzüglich Spesen«, bestätigte ich.
Er gab einen leisen Pfiff von sich. Dann zog er eine alte Seidenbörse aus der Gesäßtasche seiner gestreiften Hose. Er legte ein paar Banknoten auf den Schreibtisch und blickte auf sie nieder, als seien es die gesamten Ersparnisse seines Lebens.
»Warum sparen Sie nicht erst eine Weile und kommen dann wieder?«, meinte ich.
Der alte Knabe schnaubte wütend.
»Das ganze Geld hier gehört Ihnen, wenn Sie den Auftrag meiner Cousine nicht annehmen«, sagte er. »So leicht werden Sie Ihr Geld nie wieder verdienen.«
Ich lehnte mich in meinem Sessel zurück und verschränkte die Hände hinter dem Kopf. Das mache ich immer so, wenn ich nicht gewalttätig werden will. Ich schüttelte den Kopf.
»So arbeite ich nicht«, erklärte ich.
Der alte Knabe wackelte mit dem Kopf, als traute er seinen Ohren nicht.
»Ich verstehe Sie nicht, Mr. Faraday.«
»Ich bin Privatdetektiv, Mr. de Camp, und wenn ich jemandem helfen kann, dann helfe ich. Wenn Ihre Cousine ein Problem hat, steht es ihr frei, zu mir zu kommen. Ich werde sie bestimmt nicht zurückweisen, nur weil Sie glauben, mich mit ein paar lumpigen Dollars bestechen zu können.«
Dem alten de Camp traten die Augen aus den Höhlen.
»Ist das Ihr letztes Wort, Mr. Faraday?«, fragte er wutschnaubend.
Ich nickte. Düster blickte er auf die Banknoten nieder, die er auf dem Schreibtisch ausgebreitet hatte.
»Sie können es sich immer noch anders überlegen.«
»Verschwinden Sie, Mr. de Camp«, sagte ich, »ehe ich es mir anders überlege.«
Steif stand er auf und steckte die Geldscheine wieder ein.
»Was wollten Sie mit dieser letzten Bemerkung sagen, Mr. Faraday?«
»Ehe ich es mir anders überlege und Sie mit einem Tritt in Ihren Allerwertesten eigenfüßig hinausbefördere«, erklärte ich.
Der alte de Camp fuhr hoch wie von der Tarantel gestochen. Er packte die beiden Enden seines Rohrstöckchens, als wollte er sie mir ins Gesicht schleudern.
»Wenn Sie den Fall übernehmen, werden Sie in Teufels Küche kommen«, schrie er wütend. »Ich warne Sie.«
Ich lachte immer noch, als draußen krachend die Tür zugeschlagen wurde. Ich lehnte mich zurück und steckte mir eine neue Zigarette an. Ich wartete auf das Mädchen. Lange brauchte ich nicht zu warten.
Zweites Kapitel
Sie kam so still und leise, dass ich erst gar nicht merkte, dass sie da war. Erst als ich ein Hüsteln aus dem Wartezimmer hörte, ging ich hinaus. Sie saß auf einem der Stühle, die wir in Reih und Glied an der Wand auf gestellt haben, so als sei unser Büro ständig überlaufen. Sie war ungefähr achtundzwanzig Jahre alt und hatte ein gutgeschnittenes Gesicht. Das kupferfarbene Haar war betont einfach frisiert, und sie war dezent, doch teuer gekleidet.
»Mein Büro ist nebenan«, bemerkte ich. »Oder warten Sie auf meine Sekretärin?«
Sie stand schnell auf.
»Ich dachte, Sie sind vielleicht beschäftigt«, sagte sie mit gedämpfter, kultivierter Stimme.
»Um diese Jahreszeit nicht«, erwiderte ich. »Kommen Sie herein.«
Ich führte sie in mein Büro und schloss die Tür hinter uns. Dann ließ ich mich ihr gegenüber nieder und betrachtete ihr Gesicht.
»Sie haben mir Ihren Namen noch nicht genannt«, sagte ich.
Sie kramte in einer beigefarbenen Handtasche, die farblich auf ihren Hosenanzug abgestimmt war, und reichte mir eine Karte. Es war eine ziemlich große Karte, auf der in gestochener Schrift Monique van Vooren stand. Darunter war eine Geschäftsadresse auf einem der großen Boulevards angegeben mit dem Zusatz Antiques – Objets d’art.
»Sie sind also Antiquitätenhändlerin, Miss van Vooren«, stellte ich fest. »Schön. Und was kann ich für Sie tun?«
»Verflixt«, murmelte sie unterdrückt und begann wieder in ihrer Tasche zu kramen. Schließlich gab sie auf und blickte mich mit einem entschuldigenden Lächeln an. »Sie müssen verzeihen«, sagte sie. »Das passiert mir immer wieder. Ich wollte Ihnen meine Privatkarte geben. Mein Anliegen hat mit meinem Geschäft nichts zu tun.«
»Das freut mich«, sagte ich. »Antiquitäten fallen wirklich nicht in mein Ressort.«
Monique van Vooren beugte sich in ihrem Sessel vor. »Ich bin hergekommen, weil ich jemanden brauche, auf dessen Diskretion ich mich verlassen kann.«
»Da sind Sie bei mir an der richtigen Adresse«, versicherte ich ihr. »Schweigen ist Gold, ist meine Devise.«
Sie lächelte schwach, als habe sie sich solche Phrasen schon öfter anhören müssen.
»Was haben Sie für Honorare, Mr. Faraday?«
Ich seufzte und nannte nochmals die Zahlen. Sie notierte sie sich mit einem goldenen Stift in einem goldgebundenen Notizbuch.
»Einverstanden, Mr, Faraday.«
»Ich habe noch nicht gesagt, dass ich Ihren Auftrag übernehmen werde, Miss van Vooren«, wandte ich ein. »Sie haben mir noch nicht einmal erklärt, weshalb Sie einen Privatdetektiv brauchen. Ich kann mir, ehrlich gesagt, auch nicht recht vorstellen, dass Sie einen brauchen.«
»Sie werden sich wundern, Mr. Faraday«, gab das Mädchen zurück. »Haben Sie schon einmal vom Van-Vooren-Museum gehört?«
Ich nickte.
»Und von der Van-Vooren-Stiftung?«
Ich nickte wieder.
»Und der Familie van Vooren?«, fuhr sie fort.
Ich fand, es sei an der Zeit, mit dem Nicken aufzuhören.
»Natürlich«, sagte ich. »Halb Los Angeles gehört den van Voorens. Plastikfabriken, Kinos, Filmkameras, Glühbirnen, Hoch- und Tiefbau...«
»Es reicht, Mr. Faraday«, unterbrach mich das Mädchen belustigt. »Ich sehe schon, dass Sie nicht mit geschlossenen Augen durchs Leben gehen.«
»Und Sie sind ein Mitglied dieser Familie?«, fragte ich.
Das Mädchen neigte den Kopf.
»Deshalb brauche ich jemanden, auf dessen Diskretion ich mich verlassen kann und der nicht so leicht zu beeindrucken ist.«
»Nun, sechzig Millionen Dollar finde sogar ich beeindruckend, Miss van Vooren«, antwortete ich.
Das Mädchen zuckte die Achseln.
»Ich brauche Ihre Hilfe, Mr. Faraday. Das Leben ist nicht immer einfach, wenn so viel Geld im Spiel ist.«
Ich breitete meine Hände auf dem Schreibtisch aus und betrachtete meine Fingernägel.
»Das kann ich mir denken«, sagte ich.
Das musste sarkastischer geklungen haben, als ich beabsichtigt hatte, denn Miss van Vooren schüttelte ungeduldig den Kopf.
»Sie scheinen es darauf anzulegen, mich misszuverstehen, Mr. Faraday. Mein Vater starb vor drei Jahren. Ich bin das einzige Kind. Für meine Mutter ist gesorgt. Sie werden es nicht glauben, aber der Nachlass ist immer noch nicht geregelt. Bei dem Streit hat ungefähr ein Dutzend Familienmitglieder die Hand im Spiel, und jeder vertritt andere geschäftliche Interessen.«
»Wobei auch Vettern eine Rolle spielen«, sagte ich.
»Richtig«, bestätigte das Mädchen. »Wie kommen Sie darauf?«
»Ich hatte heute Nachmittag Besuch von einem älteren Herrn«, erklärte ich. »Er teilte mir mit, dass mich eine junge Dame aufsuchen würde, und riet mir, ihren Auftrag nicht zu übernehmen. Sollten Sie diese junge Dame sein?«
Monique van Vooren nahm ein goldenes Feuerzeug aus ihrer Handtasche und eine Packung Zigaretten. Nachdenklich steckte sie sich eine Zigarette zwischen die Lippen und bot mir auch eine an.
»Danke, ich rauche lieber meine eigenen«, sagte ich. »Sonst werde ich nur verwöhnt.«
»Wie hieß der Mann, der heute Nachmittag hier war, Mr. Faraday?«, fragte das Mädchen.
»Benson de Camp«, antwortete ich.
Sie neigte den Kopf.
»Mein Vetter«, stellte sie fest. »Ich hoffe, Sie haben ihm klargemacht, dass er bleiben kann, wo der Pfeffer wächst.«
»So ungefähr«, gab ich zu. »In meinem heiligen Zorn über seine Unverschämtheit habe ich ihm sein Familienerbstück zerbrochen und ihn vor die Tür gesetzt.«
Das Mädchen lachte. »Gut gemacht, Mr. Faraday. Ich sehe schon, wir werden gut miteinander auskommen. Aber was war denn das für ein Familienerbstück?«
»Sein Rohrstock. Ich hielt es für besser, ihn ihm wegzunehmen, sonst wäre der gute Mr. de Camp womöglich noch gewalttätig geworden. Er behauptete, der Stock sei ein Geschenk seines Vaters gewesen.«
»Ich bezweifle, dass dieser Mensch je einen Vater gehabt hat«, meinte das Mädchen ruhig. Dann lachte sie wieder. »Da sehen Sie, mit was für Leuten ich mich herumschlagen muss.«
»Worauf wollte er eigentlich hinaus?«, erkundigte ich mich.
Das Mädchen zuckte die Achseln.
»Das Testament, Mr. Faraday. Irgendetwas geht da vor, aber ich weiß nicht, was. Ich gebe Ihnen Carte blanche. Sie sollen einfach ein wenig im Wespennest herumstochern und sehen, was sich dann tut.«
»Und worauf soll ich mich besonders konzentrieren?«, wollte ich wissen.
»Ich werde Ihnen einige Hinweise geben«, versprach das Mädchen. »Ich finde, wir sollten uns einmal in Ruhe zusammensetzen. Ich habe verschiedene Unterlagen, die ich Ihnen zeigen möchte. Können Sie morgen Nachmittag gegen drei Uhr zu mir kommen? Ich habe eine Stadtwohnung über dem Geschäft.«
»Geht in Ordnung, Miss van Vooren«, sagte ich.
Das Mädchen stand auf und reichte mir eine kühle, sonnengebräunte Hand.
»Dann darf ich also davon ausgehen, dass Sie jetzt für mich tätig sind«, meinte sie.
»Wir können fürs erste einmal davon ausgehen«, erwiderte ich. »Aber ich erwarte natürlich umfassendere Informationen.«
»Selbstverständlich, Mr. Faraday«, sagte das Mädchen. »Bis morgen also.«
Sie schloss leise die Tür hinter sich.
»Wenn ich Einkäufe mache, entgehen mir doch immer die interessantesten Leute«, sagte Stella.
»Kommt darauf an«, meinte ich.
Stella zog einen Flunsch. Das ist eine Gewohnheit von ihr. Eine ihrer Gewohnheiten, die ich besonders gern habe.
»Worauf?«, fragte sie.
»Ob weiblich oder männlich«, antwortete ich. »Damen dürften dich kaum interessieren. Und diese schon gleich gar nicht.«
»Vielleicht doch«, sagte Stella. »Wenn sie in deiner Nähe sind.«
Ich grinste und drückte meine Zigarette aus. Stella ging zur Kochnische hinüber.
»Ich stelle fest, dass sich hier ein Unbefugter zu schaffen gemacht hat«, sagte sie.
»Zweimal darfst du raten, wer. Aufgrund der vorhandenen Anhaltspunkte dürfte es dir nicht allzu schwerfallen, das Rätsel zu lösen.«
Stella gab einen Laut von sich, der einem verächtlichen Schnauben recht nahe kam, und hantierte geräuschvoll mit dem Geschirr. Dann streckte sie den Kopf um die Ecke.
»Du hast doch jetzt, wo ich zurück bin, sicher nichts gegen eine anständige Tasse Kaffee?«, fragte sie.
»Im Gegenteil!«, versicherte ich.
In dem kurzen, marineblauen Rock mit der blau-weiß gestreiften Jacke sah Stella zum Anbeißen aus. Ihr Anblick war meinem Konzentrationsvermögen gar nicht zuträglich. Allerdings gab es im Moment sowieso nicht viel, worauf ich mich hätte konzentrieren müssen.
Sie kam mit ihrer Einkaufstüte ins Büro und stellte sie auf den Schreibtisch. Einen Moment kramte sie darin herum und stellte dann ein dezent verpacktes Paket vor mich hin.
»Für das Büro«, bemerkte sie.
Ich sah es mir näher an.
»Unser wöchentlicher Heroinvorrat?«, fragte ich.
Stella lachte. »Toilettenpapier. Mach dich nützlich, und bring es dorthin, wo es hingehört.«
Als ich zurückkam, strömte angenehmer Kaffeeduft aus der Kochnische. Ich machte es mir in meinem Sessel bequem. Auf meinem Schreibtisch lagen drei Briefe.
»Unterschreib sie, dann kann ich sie heute Abend auf dem Heimweg aufgeben«, sagte Stella.
Ich las sie durch. Drei Routinesachen, die mich kein Geld kosten würden. Ich Unterzeichnete sie und legte sie Stella wieder auf den Schreibtisch.
»Was wollte denn dieses Mädchen nun eigentlich?«, fragte Stella, als sie den Kaffee hereinbrachte. »Oder ist das eine dumme Frage?«





























