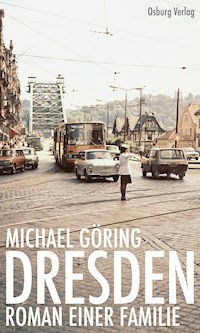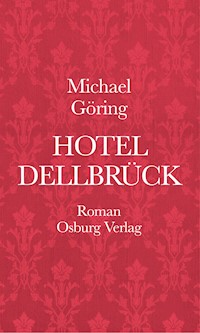8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
"Warum hast du diesen Weg eingeschlagen? Was fasziniert dich an der Welt der Riten, der Heiligen und des Kreuzes?" Voller Sorge und Empörung fordert der Priester Andreas Wingert von der Kanzel herab Konsequenzen aus den Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche - bis er selbst unter Verdacht gerät. Nun sucht er Rat und Hilfe bei seinem Freund aus Kindertagen, aber Thomas liegt mit einem Herzinfarkt im Krankenhaus. Auf der Rückfahrt von einem Besuch bei Thomas erinnert sich Andreas: An eine Kindheit und Jugend in der westfälischen Provinz, als Thomas und er unzertrennlich waren, an die siebziger Jahre in Berlin und Köln, Wales und München. Danach schlägt Andreas einen ungewöhnlichen Weg ein: Fasziniert von den Ritualen der katholischen Kirche, geht er ins Priesterseminar, während Thomas heiratet und als Geisteswissenschaftler Karriere macht. Die Anfechtungen des Alltags und des modernen Lebens, das Verzicht kaum noch kennt, werden Andreas zur ständigen Herausforderung. Michael Göring erzählt von einer großen, lebenslangen Freundschaft, von religiöser Berufung und von der Gratwanderung eines Priesters heute.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 483
Ähnliche
Foto: Elfriede Liebenow
Michael Göring, geboren 1956 in Lippstadt /Westfalen, leitet seit 1997 die ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius in Hamburg und ist zugleich Honorarprofessor am Institut für Kultur- und Medienmanagement der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Nach zwei Fachbüchern 2007 und 2009 ist Der Seiltänzer sein erster Roman.
Michael Göring
Der Seiltänzer
Roman
Danksagung
Ich danke Frau Dr. Kerstin Schüßler-Bach, Leitende Dramaturgin der Hamburger Staatsoper, für ihre fachkundigen Repliken zu meinen »Meistersinger«-Überlegungen. Meiner Tochter M. danke ich für ihre kritische und unterstützende Begleitung, Jürgen Abel für das konstruktive Lektorat.
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
1
Es hatte zu regnen begonnen. Ein gleichmäßiger Landregen mit großen Tropfen, wie er diesen Teil Westfalens immer wieder heimsucht. Entgegenkommende Wagen, die das Licht eingeschaltet hatten, blendeten ihn. Die Scheibenwischer schlugen gleichmäßig im Takt. Langsame Herzfrequenz.
Andreas hatte Langenheim bereits hinter sich gelassen, als im Autoradio noch die 17-Uhr-Nachrichten liefen. Ein Journalist des WDR beendete seinen ausführlichen Kommentar über die Wahl des neuen und den überraschenden Abgang des alten Bundespräsidenten mit der ironischen Floskel: »Ich bin dann mal weg.« Als ob das so einfach wäre. Viel Zeit für den Besuch bei seinem Vater würde Andreas nicht bleiben, schon am Vormittag musste er zur Beerdigung von Maria Strate zurück in Waldenburg sein, in den Diensten seiner Gemeinde St. Laurentius. Er stellte das Radio ab, lauschte dem Takt der Scheibenwischer und beschleunigte den Wagen. »Ich bin dann mal weg«, dachte er und sah vor seinem inneren Auge den Sarg von Frau Strate in der Friedhofskapelle, die Trauergemeinde in den Bankreihen, doch sein Platz am Altar war leer. Da schlurfte die alte Strate mit ihrem Rollator nach vorn, reckte ein Holzkreuz in die Höhe und rief: »Wo ist er denn, unser Herr Pfarrer, wo versteckt er sich denn?« Andreas lachte über sein Phantasiebild. Endlich konnte er sich einmal seinen Tagträumereien hingeben, jetzt, wo er sich dazu entschlossen hatte, mit seinem Vater zu reden. Er hätte dem Achtzigjährigen die Aufregung und sich selbst all die unschönen Erklärungen gern erspart. Aber wen konnte er sonst um Rat fragen? Diese verrückten Vorwürfe der Frau Wahnmut! Und er musste ihm von Thomas berichten. Gleich nach seinem Besuch in der Uniklinik in Münster, das Bild des Freundes im Krankenbett auf der Intensivstation noch vor Augen, hatte er den Entschluss gefasst, direkt zum See zu fahren, um seinen Vater zu besuchen, statt den Abend allein in seinem Pfarrhaus in Waldenburg zu verbringen. Allein mit diesen Krankenhausbildern und diesen Ängsten. Thomas war gerade erst fünfzig geworden, und er hatte auch sonst im Leben nicht nur Glück gehabt. Ausgerechnet er musste nun so früh einen Infarkt bekommen.
Doch zuerst hatte Andreas mit Lisa gesprochen. Sie war überrascht, ihn so unerwartet an ihrem Arbeitsplatz in der Jugendpsychologie in Brilon am Telefon zu haben, und sie war leider nicht allein in ihrem Dienstzimmer, sodass sie sich nur schnell, ohne große Erklärungen, für 18.30 Uhr am Höhleneingang der Warsteiner Tropfsteinhöhle verabredeten. Das lag auf dem Weg zu seinem Vater, der mit Regine ins Sauerland gezogen war, nachdem er seine Praxis in Langenheim aufgegeben hatte. Das Haus seines Vaters, das »Haus mit Seeblick«, wie Regine immer wieder betonte, lag am Hennesee. Es war nur ein schlichter Stausee, aber immerhin ein See mit Segelbooten, einer bescheidenen Anmutung von Eleganz in dieser doch eher spröden Region Deutschlands. Zehn Jahre lebte sein Vater mit Regine nun schon dort, gut siebzig Kilometer von Andreas entfernt.
»Ist was nicht in Ordnung? Bist du krank?«, hatte er gefragt, als Andreas seinen überraschenden Besuch ankündigte. Andreas war im letzten Jahr selten dort gewesen und kein einziges Mal über Nacht geblieben, weil sich Regines fortschreitende Demenz kaum länger als einen halben Tag ertragen ließ. Sein Vater hatte einen Fehler gemacht, damals mit ihr an den Hennesee zu ziehen, doch es war Regines sehnlichster Wunsch gewesen. In Langenheim hätten sie sehr viel mehr Abwechslung gehabt. Jetzt war es nur eine Frage der Zeit, bis Regine nicht mehr zu Hause gepflegt werden konnte.
»Ich komme gerade aus dem Krankenhaus, Vater. Thomas hatte einen Herzinfarkt. Die Ärzte sind zuversichtlich, aber er sieht schlimm aus!«
»Einen Herzinfarkt! Thomas? Das ist ja furchtbar! Kann ich etwas tun? Weißt du, wie schlimm es ist? Ich werde gleich morgen versuchen, den behandelnden Arzt zu erreichen«, sagte er in alter Entschiedenheit, obwohl er ja schon lange nicht mehr praktizierte.
»Er ist in Münster in der Uniklinik, Vater, die wissen dort, was sie tun«, sagte Andreas und hoffte, dass er seinen Vater damit von einem Anruf würde abhalten können.
»Ihr seid doch noch so jung, viel zu jung für einen Herzinfarkt. Hatte Thomas beruflich zu viel Stress?«
»Glaub’ ich nicht, Vater, er hatte sich längst mit der Fachhochschule arrangiert, er hat an einer größeren Publikation gearbeitet.«
»Hatte er vorher schon Beschwerden?«
»Nicht dass ich wüsste, Vater, der Infarkt kam wohl völlig überraschend. «
Insgeheim wartete sein Vater seit Monaten auf ein Signal von ihm, ein Signal, ob er zu ihm nach Waldenburg ziehen könne, sobald sich Regines Zustand verschlechtern würde. Andreas hatte sich bisher vor einer Entscheidung gedrückt, und Annette hatte es gleich abgelehnt, ihren Vater bei sich aufzunehmen. Als Andreas kurz nach Ostern bei ihr in München war und sie über Vaters Zukunft sprachen, sagte sie nur: »Wir haben gar nicht den Platz.« Das war nur die halbe Wahrheit. Annette hatte seit Mutters Tod und erst recht seit Vaters Hochzeit mit Regine kein inniges Verhältnis mehr zu ihm gefunden.
Andreas überholte einen Bierlastzug. Er drückte das Gaspedal ganz durch. Der Laster war länger als gedacht, sein Golf eher brav motorisiert. Vor ihm lag die erste längere Steigung. Der erste Höhenzug des Sauerlandes zwang die Bundesstraße jetzt zu einigen Windungen. Immer wieder gab es Überholverbote und Geschwindigkeitsbegrenzungen. Die parallel laufende Bahnstrecke trennte sich vom Straßenverlauf, nahm größere Kurven, längere Anläufe, um von 75 auf gut 400 Höhenmeter zu gelangen. Mehrfach würde die Bahnstrecke die Bundesstraße kreuzen. Vor dreißig Jahren hatte er Silke mit seinen Überholmanövern auf dieser Straße oft erschreckt. Der rote Käfer, den er damals fuhr, hatte kaum Reserven, aber die Lastwagen waren auch um einiges langsamer und kürzer. Für einen Moment stellte er sich vor, er würde seinen fünfzigsten Geburtstag in zwei Wochen mit Silke an seiner Seite feiern, auf der Terrasse eines kleinen bescheidenen Reihenhauses und umgeben von ihren drei oder vier Kindern, statt im großen Garten des Pfarrhauses in Waldenburg mit dem Pfarrgemeinderat und den treuen Mitgliedern der Laurentiuskirche. Vielleicht würde es aber gar keine Geburtstagsfeier geben, wenn diese verrückten Missbrauchsvorwürfe der Wahnmut erst einmal in die Welt getragen wären.
Thomas und er waren für kommenden Mittwoch verabredet gewesen, um die Vorwürfe in Ruhe durchzugehen und Strategien zu entwickeln. Jetzt würde Thomas nicht einmal zu seinem Geburtstag kommen können, er würde in zwei Wochen sicher noch im Krankenhaus liegen oder bestenfalls gerade eine erste Rehamaßnahme beginnen. Als Ratgeber waren ihm nur sein Vater und Lisa geblieben, die er beide nur ungern belästigte. Doch die Gespräche waren dringlich, nachdem vor einigen Tagen auch noch diese unseligen Fotos aus dem Jungencamp aufgetaucht waren. Alles völlig harmlos, aber was galt in dieser aufgepeitschten Atmosphäre schon als harmlos?
Silke hatte er zu seinem Geburtstag nicht eingeladen. Genauso wenig wie Lisa, mit ihr würde er etwas später allein feiern, in einem Hotelzimmer, wie immer. Aber warum hatte er nicht an Silke gedacht? Der Fünfzigste war doch eine wunderbare Gelegenheit für solche Treffen. Und eine alte Freundin, eine Schulkameradin einzuladen, galt auch beim Geburtstag eines katholischen Priesters als unverfänglich. Sie hatten sich seit zehn Jahren nicht mehr gesehen, aber Jahr für Jahr Weihnachtskarten ausgetauscht, denen Silke immer eine Seite mit knappen Familiennachrichten beigefügt hatte.
Thomas und er waren achtzehn und bereiteten sich auf das Abitur vor, als sie Silke eines Abends im Chassis kennenlernten, der wichtigsten Disco der Stadt. Andreas wollte gerade gehen, als Thomas das auffallend blonde Mädchen auf der Tanzfläche ansprach. Thomas und Silke tanzten dann wie zwei Derwische aus Tausendundeiner Nacht noch eine Stunde lang, und er sah ihnen dabei zu. In den kommenden Monaten trafen sie sich oft zu dritt, im Café, im Chassis, im Kino.
Als sie das Abitur in der Tasche hatten und Andreas kurz vor Beginn seines Zivildienstes stand, machten Silke und er eine große Radtour. Fünf Tage fuhren sie durch Schleswig-Holstein. Thomas wollte eigentlich mitkommen, hatte sich aber zwei Tage vorher den Fuß verstaucht. Silke entschied, dass sie dennoch fahren würden, und ihre Eltern hatten nichts dagegen, obwohl sie noch keine achtzehn war. Sie fuhren mit dem Zug nach Plön und übernachteten in der Jugendherberge. Gleich am nächsten Tag, ihrem ersten Radeltag, überraschte ihn Silke mit einem weiten weißen Rock. Die blaue Latzhose, die sie sonst immer trug, war im Gepäck geblieben. Für Regentage. Andreas ließ sie vorfahren. Silke hatte ihre halblangen blonden Haare für die Radtour zu einem Zopf gebunden, der ihr großartig stand. Ein hellgolden leuchtender Zopf, ein blaues T-Shirt und ein weiter weißer Rock! Als er hinter ihr herradelte, spürte er eine große Sehnsucht: Mit dieser Frau würde alles leicht werden. Da war es doch, dieses große Gefühl zu einer Frau, das er oft vermisst hatte und das doch alles ändern konnte. Er hatte sich geirrt! Hier, vor ihm, fuhr das Leben. Es gab keinen Zweifel!
In Heiligenhafen gingen sie nicht in die Jugendherberge, sondern in eine kleine Pension. Die Wirtsleute wollten Silkes Personalausweis gar nicht erst sehen. Am nächsten Tag schrieb Andreas eine Postkarte an Thomas. »Gestern Nacht war es so weit« war alles, was auf der Karte stand.
Silke hatte ihm zu Weihnachten geschrieben, dass ihre Älteste nun im Staatsexamen stand, der Junge machte ein Auslandsjahr in Australien. Sie hatte einen Mathematiker geheiratet und lebte seit zwanzig Jahren in München, gar nicht weit von seiner Schwester Annette entfernt. Ein gutes Jahr nach der Radtour, kurz bevor er den Zivildienst beendete, hatte er ihr gesagt, es hätte keinen Sinn, es ginge doch nicht, es habe keine Perspektive, es würde ihm alles zu eng. Auch nach diesem fürchterlichen Gespräch mit ihr war er diese Strecke gefahren, die Bundesstraße von Langenheim Richtung Süden, allein, an einem dunklen Herbsttag. Auch damals hatten ihn entgegenkommende Autos geblendet, aber nicht, weil es regnete, sondern weil er heulte. Silke hatte es nicht verstanden, hatte es nicht glauben können: »Das kann doch nicht sein, das glaube ich dir einfach nicht!«
Ich bin dann mal weg. Weg! Vielleicht wäre es ja doch gut gegangen. Das hatte er sich schon damals gesagt, in seinem Käfer, auf der Straße. Er hatte das Gaspedal immer wieder bis zum Anschlag durchgetreten, und wenn der weiße Bulli damals nicht in letzter Sekunde ausgewichen wäre, wer weiß. Ich bin dann mal weg.
Als er heute bei Thomas in der Universitätsklinik war, hätte er zu gern mit ihm gesprochen. Vor allem natürlich über diese zermürbenden Vorwürfe der Wahnmut und über die Schwierigkeiten, in die er seit seiner kritischen Predigt über die Kirche und deren Notwendigkeit zu grundlegenden Reformen gekommen war. Aber vielleicht auch über die Vergangenheit, nicht so sehr über den großen Streit damals, über ihr Zerwürfnis nach der Radtour. Thomas hatte ihn als hinterhältigen Verräter beschimpft und ihm die Freundschaft gekündigt. Erst drei Monate später hatten sie sich wieder getroffen und noch später erst wieder versöhnt. Als er ihn heute in der Klinik im Krankenbett liegen sah, kam es ihm so vor, als wäre auch sein eigenes Leben bedroht. Thomas, mit Schläuchen in der Nase, ließ ihn mit den Augen, mit leichtem Nicken und mit Wimpernschlägen wissen, dass er ihn erkannte und verstand.
Als der Arzt das Zimmer betrat, sah er, dass Andreas Tränen in den Augen hatte. »Er ist ein guter Freund von mir«, sagte Andreas, »mein wichtigster Freund seit vierzig Jahren.«
»Er wird es schaffen, Herr Pfarrer«, sagte der Arzt, »ganz bestimmt. Wir tun alles, was wir können!«
Andreas hatte dem Arzt seine Mobilnummer gegeben, sodass er immer zu erreichen wäre. Dann war Merle in die Klinik zurückgekehrt, und sie verabredeten, dass er morgen am Nachmittag wieder nach Münster kommen würde. Heute, so hatte der Arzt gesagt, würde Thomas nur noch schlafen. Als sich Andreas am Krankenbett von Merle verabschiedete, schaute er noch einmal auf Thomas. »Herrgott, hilf ihm, dass er den Infarkt gut und schnell übersteht, lass ihn bitte wieder gesund werden!« Er hatte wie ein Kind gebetet.
Ein entgegenkommender Lkw blendete zweimal auf. Andreas war versehentlich zu weit auf die linke Spur gekommen. Jetzt fiel ihm auf, dass er in den letzten Minuten ganz automatisch gefahren war, ohne jede Sorgfalt. Es stürmten so viele Gedanken, Erinnerungen und Bilder gleichzeitig auf ihn ein. Der Lastwagenfahrer hupte, zeigte ihm einen Vogel. Andreas scherte auf die rechte Fahrspur zurück, bremste kurz darauf hinter einem Sattelschlepper, der sehr langsam vor ihm die nächste Anhöhe nahm, und suchte nach einem Taschentuch; er würde nur ein klein wenig loslassen müssen, um den Tränen freien Lauf zu lassen. Er stellte das Radio wieder an. Er wollte nicht loslassen. Noch knapp dreißig Kilometer, dann würde er Lisa treffen und zwei Stunden später bei seinem Vater am Hennesee sein.
2
»Du fährst mir ja den Arsch ab, du Fuzzi«, sagte der Große im gelben T-Shirt, den Thomas zwar schon auf dem Schulhof gesehen, aber nie kennengelernt hatte. Er stellte sich einfach vor ihn hin und rüttelte den Lenker seines Rollers. Thomas war wie gelähmt. »Erst mir den Arsch abfahren und dann einfach abhaun, was, du Fuzzi?«
»Ich, nein, ich, ich muss zur Schule.« Thomas war froh, dass ihm ein ganzer Satz gelungen war. Aber dieser Erfolg blieb ohne Wirkung. Der große Junge kniff ihn in die Handrücken, während Thomas die Griffe des Lenkers fest umklammert hielt. Es tat lausig weh. Dann spuckte der Große ihm auf die Haare. »Verpiss dich, Kleiner, mach schon, und lass dich bloß nicht mehr blicken.« Er drehte sich um und stapfte Richtung Schule davon. Thomas rollte los, schnell an dem Großen vorbei, wischte sich den klebrigen Rotz aus seinem dichten schwarzen Haar und konnte es doch nicht verhindern: Er weinte. An der Schule angekommen, stellte er seinen Roller ab und wischte sich hastig mit dem Taschentuch die Tränen aus dem Gesicht; da schellte es schon, und er rannte in den Klassenraum der 2b. Mit irgendjemandem aus der Klasse über den scheußlichen Morgen zu reden, traute er sich nicht.
Auch zu Hause sprach er nicht über den Großen und seine Angst vor ihm und das Kneifen und den Rotz im Haar. Seine Mutter war ja immer so ängstlich. Im Kindergarten durften die anderen morgens bereits allein mit dem Tretroller kommen, während ihn seine Mutter brachte, auch noch, als er schon sechs war. Dabei gab es in der Neubausiedlung doch kaum Verkehr, und es waren nur zwei kleine Nebenstraßen zu überqueren, um von zu Hause in den evangelischen Martin-Luther-Kindergarten zu gelangen. Als er dann 1966 in die Schule kam, bettelte er so lange, bis seine Mutter ihn endlich allein gehen ließ.
Doch jetzt, wo der Große plötzlich da war, jetzt am Ende der zweiten Klasse, als er schon bald acht war, da hätte er seine Mutter am liebsten gebeten, ihn wieder zu begleiten. Aber das kam natürlich nicht in Frage.
Am nächsten Tag, als er von der Schule nach Hause rollte, sah er, dass der Große in seinem gelben T-Shirt hinter einem Baum neben dem Gehweg lauerte. Er stockte. Sollte er umkehren? Er spürte sein Herz schlagen. Nein, einfach weiterfahren, schnell noch Anschluss finden an die anderen Kinder, die nicht weit vor ihm fuhren. Doch es war zu spät. Geübt sprang der Große hinter dem Baum hervor, stellte sich vor den Roller und griff Thomas in den Lenker. »Willst wohl die Biege machen, was, Kleiner?« Und schon wieder begann er mit der schmerzhaften Kneiferei. Jetzt hatte er noch seinen linken Fuß mit dem dicken Turnschuh auf Thomas’ rechten Fuß gesetzt. Die dünne Sandale bot keinen Schutz, als der Große kräftig drückte. Thomas weinte. »Lass das, lass mich, ich sag das meiner …«
»Du sagst deinen Alten gar nichts, ich mach dich sonst fertig, richtig fertig, verstanden, du Fuzzi?« Und damit spuckte er ihm wieder auf den Kopf, ließ ihn los und stapfte davon.
Auch von dieser Begegnung mit dem Großen erzählte Thomas zu Hause nichts. Seine Eltern diskutierten über den Vietnamkrieg und die Studenten in Frankfurt und Berlin. Vater mochte offenbar keine Studenten. »Es ist 1968, gerade einmal dreiundzwanzig Jahre nach dem Krieg, und die haben nichts Besseres zu tun, als gegen die Amerikaner zu demonstrieren. Diese Studenten wären doch ohne Carepakete gar nicht groß geworden«, sagte er. Mutter war anderer Meinung. »Recht haben sie«, rief sie, »die Amis müssen raus aus Vietnam!« Dass sein rechter Fußrücken ganz blau war und er etwas humpelte, war ihnen nicht aufgefallen.
Am Tag darauf schloss er sich auf dem Schulweg einer Gruppe von Kindern seines Alters an, die er sonst mit dem Roller einfach überholt hatte. Heute hielt er an und schob den Roller im Gleichschritt mit den anderen Kindern. Der Große kam hinter einem Baum hervor und nestelte an seinem Hosenschlitz, er hatte wohl gerade gepinkelt. Er schaute Thomas an, formte mit den Lippen »Verpiss dich, Fuzzi« und ließ ihn und sein Grüppchen passieren. Das Wochenende verbrachte er trotzdem voller Angst. Was würde der Große nächste Woche tun? Als er am Sonntag in Gedanken an den Schulweg im Bett lag, sah er ihn vor sich, hörte, wie er den Rotz im Mund zusammenzog, um ihn dann auf seinen Kopf zu spucken, diesen ekligen, schmierigen Rotz.
Doch am Montag geschah nichts. Auch am Dienstag rollte Thomas unbehelligt zur Schule und nach Hause. Vielleicht hat er mich schon vergessen, vielleicht ist alles wieder wie früher, dachte er, atmete erleichtert auf und fühlte, wie langsam, ganz langsam die Angst zurückwich. Am Mittwoch sah er den Großen wieder. Er trug ein rotes Fußballhemd von Bayern München. Vor ihm stand ein Junge aus seiner Parallelklasse mit einem schönen blauen Fahrrad. Thomas hatte diesen Jungen schon ein paarmal auf dem Schulhof gesehen, sich seinen Namen aber nicht gemerkt. Er erinnerte sich nur daran, dass der Junge zur Gruppe der katholischen Kinder gehörte, die jeden Dienstag eine Extrastunde Religion zur Vorbereitung auf die Erste Heilige Kommunion hatten. Die evangelischen Kinder schauten dann immer schadenfroh auf das Häuflein Katholiken, das sich dienstags pflichtschuldig in den Religionsraum begab.
Jetzt stand dieser Junge mit weit aufgerissenen Augen da, während der Große auf ihn einredete und ihn dabei immer wieder in die nackten Oberarme kniff. Es war ihm, als würde er selbst das Kneifen in seinen Armen spüren. Thomas bemerkte, wie der Junge zu ihm herübersah, ängstlich und beschämt zugleich. Er hätte da jetzt eigentlich hingehen müssen, gemeinsam hätten sie den Großen vielleicht verhauen, ihn wegjagen können, aber der war ja vierzehn oder fünfzehn, viel größer als sie und viel stärker. Dann sah er, wie der Große seinen Kopf nach hinten warf, all seinen Rotz dabei zusammenzog, um ihn auf den Kopf des Jungen zu schleudern. Danach ließ er von ihm ab und ging weiter.
Thomas ging auf den Jungen zu. Er sah, dass er weinte.
»Ich hab ihm doch gar nichts getan«, sagte er.
»Mit mir hat er das auch schon gemacht«, sagte Thomas und holte ein Tempotaschentuch aus seiner Hosentasche. »Hier«, sagte er, »für die Spucke.«
Der Junge begann zu schluchzen. Mühsam wischte er den Rotz aus seinem blonden Haar. Thomas sah, dass der Junge einen großen braunen Fleck am Hals hatte, ein Muttermal. »Wie heißt du eigentlich?«, fragte er.
»Andreas, Andreas Wingert«, sagt er.
»Ich bin Thomas.«
Sie fuhren nebeneinander zur Schule, Thomas auf seinem weißen Roller und Andreas mit den roten Kneifspuren am Oberarm auf seinem blauen Knabenfahrrad.
In der Pause spielten die Kinder einer Klasse in der Regel nur untereinander und mischten sich kaum, nicht einmal mit den Kindern der Parallelklasse. Die galten als blöd oder komisch. Auf dem Schulhof hatten die Kinder der zweiten Klasse sogar Areale mit Schulkreide abgezeichnet, die kein Kind einer anderen Klasse betreten durfte.
An diesem Tag war das anders. Andreas kam gleich in der ersten Pause auf Thomas zu: »Sieht man noch was von der Spucke?«, fragte er.
Dann überboten sie sich mit schrecklichen Dingen, die sie dem Großen gern antun würden. Am Ende sagte Andreas: »Wir sollten es Herrn Böge erzählen!«
Herr Böge war der Rektor der Schule, ein großgewachsener, hagerer Mittfünfziger, den alle Kinder sehr respektierten. Zuerst war es nur ein Satz. Dann begannen die beiden Jungen sich auszumalen, wie sie es sagen, was sie erzählen würden und was Herr Böge wohl antworten würde. Vielleicht würde er den Großen ja von der Schule werfen, vielleicht aber auch auf sie herabblicken und sagen: »Stellt euch doch nicht so an!«
In der zweiten Pause hatten sie den Vorsatz gefasst. Thomas sollte derjenige sein, der sprach. Er kannte Herrn Böge vom Abschlusskonzert des Sommerfestes, das vor zwei Wochen stattgefunden hatte. Thomas war der Bräutigam in der Vogelhochzeit gewesen. Er und seine Braut Reinhild hatten am Ende des Musikstückes von Herrn Böge jeweils eine Tafel Vollmilchschokolade bekommen. »Du hast eine schöne Stimme, weiter so«, hatte Herr Böge gesagt.
Nach der fünften Stunde gingen sie die Treppen hoch zum Rektoratszimmer. Beiden klopfte das Herz. Vor der Tür stand eine ältere Lehrerin. »Was wollt ihr denn hier?«, fragte sie erstaunt.
»Wir wollen zu Herrn Böge«, antwortete Thomas.
»Na, dann muss es ja was Wichtiges sein!«, sagte die Lehrerin mit einem Lächeln und öffnete die Tür.
»Werner, du hast Besuch!« Sie ging gleich mit hinein.
»Sprich du«, zischte Thomas.
»Nein, du, du wolltest doch …«
»Ich kann nicht«, sagte Thomas.
Herr Böge ging auf die beiden zu.
»Du bist doch der Thomas Johannmeyer mit der schönen Stimme. Was habt ihr denn auf dem Herzen?«
Thomas gab Andreas einen kleinen Stoß mit dem rechten Unterarm, und Andreas legte los. Erst verhaspelte er sich ein wenig, doch dann wurde er immer klarer. Auch Thomas fasste Mut und berichtete. Wie gut es tat, die Demütigungen zu erzählen!
Frau Walther kannte den Jungen, um den es ging. Es war ein fünfzehnjähriger Achtklässler, der die Schule in zwei Wochen mit Ende des Schuljahres verlassen würde. Sie würde mit ihm und seinen Eltern sprechen. Herr Böge empfahl Andreas und Thomas, ab sofort nur zusammen den Schulweg anzutreten. Zusammen seien sie stark, da würde der Große sie nicht angreifen, da bräuchte keiner von ihnen Angst zu haben. Also, von nun an zu zweit! Dieser Aufforderung hätten die beiden kaum bedurft. Am Dienstag wartete Thomas, bis Andreas den Kommunionunterricht beendet hatte. Nach zwei Wochen begannen die Ferien. Thomas bekam zum Geburtstag, der mit dem Schuljahresende zusammenfiel, ein Fahrrad, so wie er es sich gewünscht hatte. Ein blaues Knabenrad. Den weißen Roller gab er an seinen kleinen Bruder weiter.
3
Andreas hatte eine alte hellgrüne Tischdecke mit einem breiten weißen Streifen in der Mitte seines Zimmers deponiert. Die Decke benutzte seine Mutter schon seit Jahren nicht mehr. Wenn sie nachmittags zum Tennis fuhr, holte er manchmal die alte, hohe Porzellanschale aus dem Vasenschrank, nahm eine steif gestärkte Serviette aus dem Serviettenvorrat im Esszimmer und machte seinen Schreibtisch oben in seinem Zimmer zu einem Altar. Er legte die grüne Tischdecke um seine Schultern, achtete genau darauf, dass der Streifen in der Mitte der Tischdecke auch in der Mitte seines Rückens lag und begann mit einem tiefen Kniefall vor seinem Schreibtisch den Gottesdienst. Vor ihm auf dem Tisch lag das Gesangbuch, die Porzellanschale hatte er mit der Serviette bedeckt. Nachdem er von einer alten Großtante zur Vorbereitung auf seine erste Heilige Kommunion eine Marien-Ikone und ein gut zwanzig Zentimeter hohes Holzkreuz mit Corpus bekommen hatte, das auf einem schweren Standfuß aufgesteckt war, verzierten auch diese beiden Gegenstände seinen Schreibtisch. Die Tür schloss er ab. Waren sowohl seine Mutter wie auch seine Schwester Annette nicht zu Hause, holte er Mozarts Requiem aus dem Plattenschrank seines Vaters. Er hatte vor einem Jahr zum neunten Geburtstag einen eigenen kleinen Plattenspieler mit eingebautem Lautsprecher bekommen. Der Rausch des Gottesdienstes war vollkommen, wenn Karl Richters Münchner Bach-Chor mit Auszügen des berühmten Mozart-Requiems aus einem völlig überforderten kleinen Philips-Lautsprecher erklang und er, ein neunjähriger Junge, der mit einer kurzen Lederhose unter einem hellgrünen, viel zu langen Umhang nahezu gänzlich verschwand, langsam die Porzellanschale anhob. Andreas segnete die unter der weißen Serviette liegenden Brauseplättchen, die als Ersatz für die Hostien dienten, kniete und erhob sich wieder, wie er es in den Messen in St. Barbara so oft beobachtet hatte. Er betete laut, sang »Ite missa est« und gab der Gemeinde am Ende feierlich seinen Segen: »Gehet hin in Frieden! « Dann schob er schnell den Arm des Plattenspielers nach rechts, damit der Plattenteller sich drehte, senkte die Nadel sachte auf die Stelle nieder, an der das »Agnus Dei« erklingen würde, schaute wohlwollend auf seine imaginäre Gemeinde und lauschte dem Münchner Bach-Chor bis zur letzten Silbe des »Dona nobis pacem«.
Andreas achtete peinlich darauf, dass nach seinem Gottesdienst wieder alle Utensilien gut versteckt waren. Seine Mutter sollte nichts von seinen Spielen erfahren. Nicht einmal Thomas gegenüber hatte er eine Andeutung gemacht. Thomas war ja evangelisch und ging nur zu Weihnachten in die Kirche. Wenn er nachmittags zum Spielen kam, überzeugte sich Andreas vorher genau, dass das Kreuz und die Ikone weit hinten in der Schublade verstaut waren.
Mutter schien nichts zu ahnen. Sie war nie besonders interessiert an seinen Erzählungen aus dem Kommunionunterricht, und er hatte schnell bemerkt, dass sie eher widerwillig mit zu den Sonntagsmessen ging. Wenn eben möglich, hatte sie ihn allein mit Annette gehen lassen. Annette war zwei Jahre älter, bereits auf dem Gymnasium und hatte keine große Lust mehr auf den Gottesdienst. Vor allem wollte sie nicht neben ihrem kleinen Bruder sitzen.
Bei der Kommunionfeier an einem sonnigen Maisonntag hatte Mutter allerdings gestrahlt. Sie trug ein neues Kleid, ganz weiß, mit Spitzen an den Armen, und einen neuen Hut, passend zum weißen Kleid. Er war groß, von einem zarten weißen Schleier umgeben. Andreas sah, dass sich die Eltern der anderen Kinder nach ihr umsahen. Sie war die schönste Frau auf der Feier.
Andreas spürte, dass sie zu schön war, als dass er sie nun bei der Feier fragen konnte, was ihm schon seit drei Tagen auf der Seele lag. Am Donnerstag vor dem Kommunionsonntag hatten alle Kommunionkinder zur Beichte gehen müssen. Der Pastor hatte ihnen gesagt, danach seien sie völlig rein, von aller Schuld befreit. Und wenn sie sterben würden, kämen sie direkt in den Himmel. Unschuldig. Ohne Fegefeuer.
Andreas hatte Thomas von der bevorstehenden Beichte erzählt. »Und was heißt rein und ohne Schuld? Was ist denn deine Schuld?«, hatte Thomas gefragt. »Musst du da wirklich alles erzählen, was du an Mist gebaut hast?«
»Nur die Sünden, wenn ich gelogen habe oder dass ich Annette das Mars weggenommen habe und so was.«
»Auch dass du für mich den Aufsatz geschrieben hast? Vielleicht erzählt der Pfarrer es der Schule weiter?«
»Weiß nicht, dann erzähle ich das lieber nicht.«
Als er zur Beichte kam, entschied er sich für den Beichtstuhl des jungen Kaplans statt für den des alten Pastors. Der Kaplan würde ihn gar nicht kennen, das würde sicher schnell gehen.
Seine Mutter hatte ihm noch geraten, einfach ein paar Dinge zu sagen, dass er manchmal vergessen hätte zu beten oder schadenfroh gewesen sei.
Genau diese Sätze hatte er sich gemerkt und sagte sie nun vor dem Gitter im Beichtstuhl kniend auf. Doch der Kaplan stellte Fragen. Wollte wissen, wie alt er sei, ob er Geschwister hätte, ob er manchmal unkeusche Gedanken habe. Andreas schaute durch das Gitter auf den jungen Mann. Er hatte einen Kurzhaarschnitt, wache blaue Augen, und eine reich verzierte Schärpe lag über seinen Schultern. Der Kaplan wiederholte seine Frage, ob er unkeusch gewesen sei.
»Was ist das?«, flüsterte Andreas.
»Na, wenn du mit dem da unten spielst und dann an Mädchen denkst. Oder wenn du auf Mädchen guckst und dir denkst, sie seien nackt. Oder wenn du mit einem Freund zusammen bist und ihr euch da unten gegenseitig am Pimmel anfasst. Das ist Sünde! Tust du das?«
»Nein«, sagte Andreas laut, »nein, das tun wir nicht!«
Andreas hätte gern seine Mutter dazu befragt. Warum es Sünde sei, wenn man sich da anfasste. Man konnte doch gar nicht Pipi machen, ohne sein Glied anzufassen. Und was das mit den nackten Mädchen wohl bedeutete? Vielleicht hatte Annette ihm deshalb erst kürzlich untersagt, ins Badezimmer zu kommen, wenn sie in der Badewanne lag? Sie war ja jetzt zwölf. Ihm machte es nichts aus, wenn sie reinkam und er badete. Müsste er jetzt immer so pinkeln wie Annette, im Sitzen auf der Kloschüssel? Aber sein Vater pinkelte doch auch im Stehen. Und was meinte der Kaplan mit dem Freund?
Seine Mutter konnte er jetzt nicht fragen. Sie war so schön und strahlte. Auch Vater lachte, schaute zu Mutter hinüber und gab ihr mit den Augenlidern kleine Zeichen.
Zwei Wochen vor der Ersten Heiligen Kommunion hatte Andreas seinen Eltern erzählt, dass er gern Messdiener werden würde. Er hatte solche Lust, diese weißen oder weiß-roten Gewänder anzuziehen und vorn am Altar zu stehen. Dann würde er auch manchmal, bei besonders festlichen Messen, auf Latein antworten müssen: »Et cum spiritu tuo.« Das hatte er schon gelernt, für zu Hause, hinter der verschlossenen Tür: »Dominus vobiscum – et cum spiritu tuo!« Aber seine Mutter war dagegen.
»So dicke brauchen wir ja nicht aufzutragen, dass wir katholisch sind. Hinterher gehen die evangelischen Patienten alle zu Dr. Trempel, so weit kommt es noch.« Dr. Trempel war der andere Orthopäde in der Stadt, dessen Praxis, wie die seines Vaters, als besonders gut gehend bekannt war.
Andreas war enttäuscht. Er hätte so gern den Kelch angefasst und den Wein mit Wasser gemischt. Aber dann war er auch erleichtert. Er hätte nicht gern mit dem Kaplan die Messe gefeiert, weil der so komische Fragen stellte. Und er hätte ungern einen Nachmittag in der Woche und jeden zweiten Samstag für die Messdienerstunden abgegeben. Jetzt, wo er sich manchmal drei-oder viermal in der Woche mit Thomas traf und sie gemeinsam im Knabenchor der städtischen Philharmonie sangen, der sie zweimal in der Woche nachmittags zu langen Chorproben heranzog.
Nun würde er also ab August auf dem Magister-Justinus-Gymnasium Latein lernen, mehr als nur »Dominus vobiscum« und »Ite missa est«. Das würde auch seinen geheimen Gottesdienst bereichern.
4
Vielleicht lag das Schreiben des Staatsanwalts schon im Briefkasten des Pfarrhauses. Was würde er der Gemeinde sagen? Würde seiner so offen progressiven Predigt im Mai nun eine weinerliche Verteidigungspredigt folgen müssen? »Glaubt mir doch bitte, Brüder und Schwestern, dass diese Vorwürfe völlig haltlos sind!« Eine schreckliche Vorstellung.
Andreas sah, dass der Tanklastzug hinter ihm aufblendete. Der Tacho des Golfs zeigte knapp siebzig Stundenkilometer, obwohl die Straße vor ihm frei war. Andreas hob die rechte Hand, um sich bei dem Lkw-Fahrer zu entschuldigen, und beschleunigte wieder.
Er hatte doch wirklich nichts getan, was diese Vorwürfe rechtfertigen konnte. Gut, er hatte sich zu ihm hin gebeugt, der weinende Marcel tat ihm leid, ja, vielleicht hatte sein Mund dabei sogar seine Stirn berührt, ganz zufällig, aber es war sicher kein Kuss gewesen, höchstens eine flüchtige, leichte Berührung. Würde man Marcel befragen? Er hatte ihn nur trösten wollen, nachdem der Junge ihm von der bevorstehenden Scheidung seiner Eltern erzählt hatte. Einen Dreizehnjährigen, der seit Jahren Messdiener bei ihm war, der Vertrauen zu ihm hatte! Was würde der Junge einem Polizeibeamten sagen? Aber da war ja nie etwas gewesen, er konnte also gar nichts Belastendes sagen. Und jetzt waren noch diese Fotos aufgetaucht! Lächerlich, absolut lächerlich. Fotos von einem Zeltlager, auf denen zwei oder drei nackte Jungs zu sehen waren. Lächerlich! Aber wenn jemand sie an das Waldenburger Tagblatt schickte? Die würden das nicht drucken. Aber sie würden die Fotos vielleicht an die Staatsanwaltschaft weiterleiten. Oder direkt nach Paderborn zum Erzbischof? Sollte die Wahnmut diese Fotos bekommen, musste er mit dem Schlimmsten rechnen. Möglicherweise würde sie sogar so weit gehen, die Fotos ins Internet zu stellen, unter der Überschrift: »Pfarrer Wingerts heimliche Spiele mit seinen Messdienern«.
Andreas hatte Schweiß auf der Stirn. Wie hatte er in so eine Situation kommen können, wie konnte sein Leben, dieses mit kleinen Einschränkungen wohlgeordnete Pfarrersleben, solch eine Wendung nehmen, dass er jetzt Angst vor der Staatsanwaltschaft haben musste, Angst vor falschen Vorwürfen, Angst vor seiner eigenen Gemeinde? Gut, er hatte schon manchmal Sorge gehabt, jemand könnte seine Liaison mit Lisa oder davor mit Simone entdecken und ihn denunzieren, aber es war immer gut gegangen, diese Befürchtungen waren nichts im Vergleich mit der tiefen Unsicherheit, die er jetzt verspürte.
Vor ihm fuhr einer der cremefarbenen Busse der regionalen Verkehrsgesellschaft. Ein kleines Mädchen, vielleicht acht Jahre alt, hatte sich entgegen der Fahrtrichtung auf die Rückbank gekniet und winkte ihm aus dem Rückfenster entgegen. Andreas verzog den Mund zu einem kleinen Lächeln. Das Mädchen reagierte sofort. Es lächelte zurück, breit, mit dieser für Kinder so typischen Offenheit. Er hob den rechten Arm und winkte.
Andreas musste an den letzten Samstag denken, als er morgens nach Langenheim ins Hallenbad gefahren war. In der Umkleide und im Duschraum waren vier oder fünf Väter, alle einige Jahre jünger als er, alle mit ein oder zwei Kindern. Wieder hatte er diesen Stich verspürt. Wie liebevoll die Väter zu ihren Kindern waren, selbst wenn das Geschrei beim Duschen und Haarewaschen manchmal groß war. Wie sich ein ganz kleines Mädchen an das Bein des kräftigen Vaters schmiegte, ein anderes plötzlich seinen Vater umarmte und ein Junge im Kindergartenalter unaufhörlich plapperte, um seinem Vater alle Details vom Schwimmkurs zu berichten. Mit wie viel Geduld die Väter ihren Kindern beim Auskleiden halfen, wie lange es dauerte, bis ein Sechsjähriger endlich die Badehose ausgezogen, sich abgetrocknet und angezogen hatte. Kleine Stiche, und ein nagendes Gefühl, etwas ganz Wichtiges versäumt zu haben. Seit über fünfundzwanzig Jahren kannte er dieses Gefühl. Im Umkleideraum hatte er sich an Rupert erinnert, diesen zwei Meter großen Mann im Priesterseminar, der eines Nachmittags, nur zwei Wochen vor seiner Weihe, in sein Zimmer gekommen war. »Ich werde gehen, Andreas, ich schaffe es nicht. Gestern habe ich mit Britta telefoniert, wir werden heiraten und eine Familie gründen.« Am Tag darauf herrschte helle Aufregung im Seminar. Die beiden geistlichen Begleiter von Rupert, der Regens und der Spiritual, verbrachten Stunde um Stunde mit dem abtrünnigen Kandidaten. Dass so kurz vor der Weihe ein Seminarist absprang, war heikel, es würde Ärger mit dem Bischof geben. Doch Rupert hatte sich entschieden und verließ das Priesterseminar. Andreas hatte in den Tagen danach mit einigen Seminaristen über Ruperts Weggang gesprochen. Die meisten aber wollten nicht lange darüber nachdenken; Rupert war nun wahrlich nicht der Erste gewesen, der das Handtuch geworfen hatte. Es kam ja so häufig vor. Dennoch war Andreas überrascht, als keiner seiner Kollegen über das Familienargument von Rupert reden wollte und sie auf seinen Hinweis, dass ihnen später eigene Kinder sehr fehlen könnten, eher gleichgültig reagierten. Jetzt in der Umkleide im Langenheimer Hallenbad gab es keine Gleichgültigkeit, der Stolz der jungen Väter auf ihre Leos und Benedikts war kaum auszuhalten. Andreas beeilte sich mit dem Umziehen und war froh, als er das Hallenbad verlassen konnte.
Wieder winkte das Mädchen aus dem Busfenster, sah ihn mit großen Augen an, und einmal mehr winkte Andreas zurück. Simone hatte ihm vor einigen Jahren vorgeschlagen, ein Kind zu bekommen. Alles andere würde bleiben, wie es war. Er hatte seinen Ohren nicht getraut. Solch ein Unsinn! Nichts würde bleiben, wie es war. Es gäbe doch viele Priester, die heimlich ein Kind hätten, hatte sie hinzugefügt. Sie wisse genau, dass er insgeheim auch ein Kind wolle. Das stimmte zwar, aber es war dennoch Quatsch. Kurze Zeit später waren sie auseinander. Er hatte Simone noch ein paarmal wiedergesehen. Sie hatten nie wieder darüber gesprochen. Simone war kinderlos geblieben. Wie er.
Der Bus vor ihm verlangsamte das Tempo und fuhr rechts in eine Haltebucht. Das rothaarige Mädchen auf der Rückbank winkte. Andreas fuhr links an dem Bus vorbei und beschleunigte den Golf.
5
Thomas wäre es viel lieber gewesen, sie hätten an diesem heißen Junitag 1972, seinem zwölften Geburtstag, irgendwo draußen feiern können, so wie bei Andreas, wo sie im letzten Jahr Federball, Völkerball, sogar Verstecken gespielt hatten. Blöd, dass sie keinen Garten hatten, nur eine Wohnung mit einem kleinen Balkon, auf dem gerade einmal drei Personen Platz fanden. Er hätte für seine Geburtstagsfeier gern ein richtig großes Haus mit Garten gehabt, so ein Haus wie die Wingerts. Wenn Mutter nur nicht so stur wäre, hätte er mit seinen Klassenkameraden auch einfach draußen spielen können, die Straße vor der Tür war eine Sackgasse, da gab es kaum Verkehr.
»Kommt, jetzt singen wir das Geburtstagslied ›Viel Glück und viel Segen‹.« Seine Mutter klatschte in die Hände. Sie war eine große Frau mit dunkelbraunem Haar und dunkelbraunen, sehr warmen Augen, die jetzt auf Thomas blickten. Die fünf Jungen, die Thomas neben Andreas eingeladen hatte, stellten sich im Kreis um ihn. Mutter bestand darauf, dass auch die beiden Zwillinge Wolfgang und Uschi mitsangen. »Müssen die Kleinen unbedingt dabei sein? Die sind doch erst neun!«, maulte Thomas. Aber Mutter nickte ihm energisch zu.
»Ich kann nur ›Happy Birthday‹«, sagte Martin.
»Ich auch«, stimmte Peter ein.
Thomas wusste, dass seine Mutter auch hier nicht nachgeben würde. Sie sagte den Text vor: »Viel Glück und viel Segen / Auf all deinen Wegen, / Gesundheit und Frohsinn / Sei auch mit dabei«. Zweimal, ganz langsam wiederholte sie das Lied und stimmte dann mit kräftiger Stimme die Melodie dazu an. Sie sangen zuerst zweimal einstimmig, dann im Kanon. Bei Andreas, der einen knappen Monat später, im Juli, zwölf werden würde, überschlug sich beim zweiten »Glück« seine Stimme, Peter lachte laut auf, und Thomas sah, wie Andreas rot wurde. Er schämte sich. Orgel-Müller, der Chorleiter an der Schule und Musikdirektor der Städtischen Philharmonie von Langenheim, hatte schon in der letzten Chorprobe zu ihnen gesagt, er wisse nicht, wie lange Andreas noch mitsingen könne. Da rieche man ja schon den Stimmbruch.
»Und jetzt gibt’s endlich Kuchen!«, rief Martin in die Gruppe. Der Wohnzimmertisch war festlich gedeckt. An jedem Platz lag eine mit roten Punkten bedruckte Papierserviette. Thomas war froh, dass keiner der Jungen lachte, als seine Mutter den Kuchen aus der Küche brachte. Er war mit farbigem Zuckerguss garniert. In ihm steckten eine blaue Eins und eine rote Zwei aus Plastik und zwölf Kerzen. Er hatte Angst, die Klassenkameraden könnten den bunt geschmückten Kuchen zu kindlich für einen Zwölfjährigen finden. Stattdessen forderten sie ihn dazu auf, sich beim Auspusten der Kerzen etwas zu wünschen. Seine Mutter zündete die kleinen Lichter an, die Thomas, wie erhofft, mit einem einzigen lauten Atemzug und mit aller Kraft pustend wieder ausblies. Was er sich dabei gewünscht hatte, blieb sein Geheimnis.
Martin schaufelte sich, ohne auf die anderen zu warten, gleich zwei Kuchenstücke auf den Teller. Drei Jungen saßen auf dem grüngepolsterten Sofa, über dem eine breitgerahmte Heidelandschaft hing. Seine Mutter hatte genügend Kissen besorgt, sodass sie auf Tischhöhe sitzen konnten. Die anderen Jungen und die beiden Kleinen saßen auf Stühlen, eng um den runden Tisch gedrängt. Thomas hatte Andreas gebeten, sich neben ihn zu setzen. Von Andreas hatte er einen Kompass geschenkt bekommen, den er gleich durch die ganze Wohnung getragen hatte. Die Nadel zitterte, wann immer sie die Position veränderten, und nahm dann schnell wieder Kurs auf Norden. Jetzt stand der Kompass vor seinem Kuchenteller auf dem Tisch und zeigte stur nach rechts auf Peter.
Thomas freute sich, dass so viele seiner Freunde gekommen waren. Er hatte in der letzten Zeit vor allem mit Andreas und nur wenig mit den anderen Jungen gespielt. Da war er sich nicht sicher gewesen, wie viele Klassenkameraden seiner Einladung tatsächlich folgen würden. Er war froh, als von den insgesamt sieben Jungen, die er eingeladen hatte, sechs zusagten. Dass Andreas kommen würde, stand nie in Frage.
Seit dem Wechsel auf das Gymnasium vor zwei Jahren waren Andreas und er nun in derselben Klasse, der a-Klasse, die mit Latein anfing. Thomas sollte eigentlich in den neusprachlichen Zweig, aber Andreas hatte ihm eingeredet, er müsse unbedingt mit ihm auf den Lateinzweig. Unbedingt!
Doch seine Eltern waren nicht begeistert gewesen. Der Lateinzweig galt als der schwierigste. Es war nicht einmal klar, ob sein Zeugnis ausreichen würde, ob das Gymnasium ihn für die a-Klasse zuließ. Erst nachdem seine Mutter erfahren hatte, dass die a-Klasse auch mehr Musik- und Kunstunterricht haben würde, war sie auf der Seite von Thomas und Andreas. Als das Gymnasium bei ihr anrief und Zweifel anmeldete, weil das Abgangszeugnis der vierten Klasse von Thomas zwar gut, aber nicht sehr gut war, überschlug sie sich geradezu vor Lob für seine musischen Begabungen. Thomas hörte in seinem Zimmer, wie sie seinen Beitrag im Knabenchor der Städtischen Philharmonie beschrieb, wie sie sein Flötenspiel hervorhob und immer wieder betonte, dass ein so musischer Junge sicherlich die beste Voraussetzung für das Erlernen alter Sprachen habe. Thomas schämte sich, dass seine Mutter ihn derart anpries.
Doch offenbar war es ihr gelungen, die Sekretärin des Oberstudiendirektors zu überzeugen. Einige Tage später kam der Brief des Gymnasiums. Andreas jubelte, als Thomas noch am gleichen Nachmittag zu ihm fuhr und ihm von dem Brief berichtete. Von nun an würden sie beide in die gleiche Klasse gehen!
Thomas kam an den Nachmittagen nun noch häufiger zu Andreas. Sie fragten sich dann gegenseitig die Lateinvokabeln ab, und auch die meisten Mathematikaufgaben lösten sie gemeinsam. Andreas hatte ein großes schönes Zimmer im ersten Stock des geräumigen Einfamilienhauses, das sein Vater kurz nach Eröffnung seiner Praxis hatte bauen lassen. Inzwischen war es umgebaut und vergrößert worden. Seine Mutter nannte es gern »unsere Villa«. Und auch Thomas mochte dieses Haus. Welch ein Unterschied zu ihrer kleinen Vierzimmerwohnung in der Siedlung, die gehörigen Abstand zum Perlenkranz dieser eleganten Einfamilienhäuser mit ihren großen Gärten hielt.
Auch genoss Thomas die Ruhe im Haus der Wingerts. Seine Geschwister, die Zwillinge Uschi und Wolfgang, spielten am liebsten stundenlang »Hoppe, hoppe Reiter« und jagten nur so durch die kleine Wohnung. Thomas konnte sie auch dann nicht stoppen, wenn Andreas ausnahmsweise einmal zu ihm gekommen war und sie sich gerade in seinem kleinen Zimmer die o-Deklination oder die e-Konjugation aufsagten, Dame, Mühle, Stadt – Land – Fluss oder Schiffe-Versenken spielten.
Bei Andreas im Haus gab es keine kleinen Kinder, nur Annette, seine ältere Schwester, die ein ausgesprochen ruhiges Mädchen war. Im Gästezimmer oben unter dem Dach stand eine elektrische Fleischmann-Bahn, die Andreas mit zehn Jahren von seinem Vater zu Weihnachten bekommen hatte. Die beiden Jungen liebten es, an der Bahn herumzubasteln. Gemeinsam klebten sie die Faller-Häuser zusammen, veränderten den Gleisplan, fügten Weichen ein, entwarfen einen Straßenplan für das Dorf, um das herum die kleine Dampflok mit ihren drei Waggons und der rote Schienenbus beständig ihre Fahrten machten. Das Gästezimmer unter dem Dach, das nur selten von einem Gast bewohnt wurde, war ihr Lieblingsplatz und verstärkte Thomas Wunsch, möglichst viele Nachmittage bei Andreas zu verbringen.
Waren Andreas und er allein, sangen sie manchmal auch ihre Partien für die nächste Choraufführung. In der Bibliothek des Hauses, einem kleineren Zimmer zwischen dem großen Wohnzimmer und dem Esszimmer, stand ein weißer Stutzflügel. Andreas hatte schon am Ende der Grundschulzeit mit dem Klavierunterricht begonnen. Wenn sie gemeinsam probten, spielte Andreas zunächst einzeln die Sopran- und die Altstimme auf dem Klavier, die sie so lange nachsangen, bis sie beide sicher waren. Als sie vor zwei Jahren auf das Gymnasium gekommen waren, probte Orgel-Müller gerade mit dem Knabenchor der Schule die Sopran- und Altstimmen für die geplante große Aufführung von Heinrich Schütz’ »Exequien«. Andreas sang Sopran, Thomas Alt. Schon nach einigen Wochen in der fünften Klasse, der Sexta, hatte der Chorleiter Thomas die ersten Solostellen übertragen. Thomas hatte zudem auf Wunsch seiner Mutter in der fünften Klasse die Flöte gegen die Klarinette eingetauscht und ging nun einmal die Woche zum Klarinettenunterricht. Die Nachbarn im Mietshaus der Johannmeyers hatten seiner Mutter ganz offen gesagt, wie glücklich sie seien, wenn Thomas zum Üben zu Andreas ginge. War Frau Wingert zu Hause, fragte Thomas stets höflich an, ob er sie auch nicht mit seinem Proben störe. »Mach nur, ich muss ohnehin noch in die Stadt«, war zumeist ihre Antwort. Andreas’ Schwester Annette machte deutlich, dass ihr alles egal war, was die beiden Jungen taten. Sie war ja schließlich zwei Jahre älter und bestand nur darauf, in ihrem Zimmer im ersten Stock in Ruhe gelassen zu werden.
Andreas ließ Thomas oft allein in der Bibliothek üben. Wenn Thomas dort die Klarinette ansetzte, schweifte sein Blick über die weißen Regale. Er wanderte an den Buchrücken entlang, und er stellte sich vor, er würde das alles einmal lesen, das wären alles einmal seine Bücher. Dr. Wingert und seine Frau schienen besonders gern große, dicke Kunstbände zu kaufen. Einige lagen aufgeschlagen auf einem kleinen weißen Tischchen, das vor dem geschwungenen Erkerfenster stand. Manchmal wanderte Thomas mit der Klarinette durch den Raum, spielte die Tonleitern über zwei oder drei Oktaven in allen Tonarten und schaute dabei auf die großformatigen Seiten mit den Bildern von Rubens und Rembrandt, von Cranach und Schmidt-Rottluff. Er sah auf den Fensterbänken der drei Fenster, was Frau Wingert dort in Porzellanvasen sorgsam aufgestellt hatte, meist waren es Orchideen oder Hortensien, immer in den gleichen Farben oder farblich aufeinander abgestimmt. Mutter holte dagegen immer bunte Sommer- oder Herbststräuße, wenn sie überhaupt einmal Geld für Blumen ausgab.
Erst vor wenigen Tagen war es aus Thomas herausgeplatzt. Ganz plötzlich, als sie wieder einmal beide in der Bibliothek übten und sein Blick auf zwei neue rote Keramikschalen auf dem Erkertisch gefallen war, sagte er bewundernd zu Andreas: »Deine Mutter hat einfach einen super Geschmack, Andy, alles ist immer so wahnsinnig gepflegt bei euch!«
Andreas schaute Thomas mit großen Augen an. »Kann schon sein! Mir geht es ziemlich auf den Geist, alles ist immer so arrangiert, und wehe, man verrückt etwas. Stellst du die Vase von der linken Fensterbank weg auf den Tisch, ist Mutter völlig fertig.«
Thomas haderte zwar mit sich selbst und tat alles, damit seine Eltern nichts davon merkten, doch tief in seinem Innern beneidete er Andreas um all den Platz und all die Eleganz im Wingert’schen Haus. Nie hätte er seinen Eltern davon erzählt, aber er spürte deutlich, wie sehr er sich solch ein Haus, solche Möbel, so viele wunderbare Bücher, solch edle Bilder an den Wänden, solche Großzügigkeit wünschte.
Kurz vor seinem zwölften Geburtstag fiel allerdings auf, dass Andreas’ Mutter häufig nicht zu Hause war, wenn sie sich trafen. »Sie hat eine neue Tennispartnerin, die sie sehr fordert«, erklärte Andreas, als Thomas nach ihr fragte.
Thomas hatte seit seinem Soloeinsatz bei Schütz’ »Exequien« eine besondere Stellung im Knabenchor. Wenn Orgel-Müller ihn vor den anderen Jungen lobte, war es ihm zwar auch ein wenig peinlich, doch gleichzeitig genoss er seinen Erfolg. Er wusste, wie wichtig seine Proben mit Andreas für ihn waren. Ohne sie wäre er nie zum Solo-Alt aufgestiegen, denn er hatte zwar ein gutes, aber kein absolutes Gehör. Durch den Zweiklang mit dem Sopran von Andreas wurde er melodiesicher, sodass Orgel-Müller sich in seinen Proben mit ihm auf Ausdruck, Dynamik und Phrasierung konzentrieren konnte. Die Solisten nahm Orgel-Müller besonders hart ran. Da setzte es auch schon einmal Ohrfeigen. Ab dem Frühjahr, wenn die Jungen wieder in ihren kurzen Lederhosen zu den Proben erschienen, konnte die Strafe für falsche Einsätze in den Proben auch darin bestehen, dass Herr Müller in seiner Wut zu dem zu strafenden Solisten lief, ihn mit dem Rücken vor sich stellte und mit seiner flachen Hand scharf und schnell mehrfach auf dessen hintere Oberschenkel schlug, was sehr wehtat. Thomas hatte das schon drei Mal erlebt und jedes Mal Angst gehabt, seine Mutter würde ihn zu Hause fragen, warum seine Beine hinten plötzlich so rot seien. »Weißt du noch, die rotgekniffenen Handrücken von dem Großen aus der Hauptschule?«, erinnerte ihn Andreas, als Thomas einmal mit hochroten Oberschenkeln nach der Probe aufs Fahrrad stieg. Doch es war klar, über die Schläge von Orgel-Müller würden die Jungen mit niemandem sprechen. Mit keinem Rektor, keiner Lehrerin und auch nicht mit ihren Eltern.
Orgel-Müller hatte gelegentlich ja auch einige Tafeln Sarotti-Schokolade im Gepäck. Die gab es immer dann, wenn ein Solist oder einzelne Stimmgruppen besonders gute Leistungen erbrachten. Thomas strahlte jedes Mal vor Freude, wenn er wieder einmal eine Tafel Schokolade mit nach Hause bringen konnte, seine Mutter die Tafel hochhielt, ihn an sich drückte und sagte: »Du wirst noch mal ein großer Künstler.«
Auch heute beim Geburtstagsfest war sie sichtlich stolz auf ihn. Sie versuchte, nach dem Kuchen essen die Jungen noch zu ein oder zwei Spielen in der Wohnung zu animieren, bot die »Reise nach Jerusalem« oder das Pantomime-Erraten an, doch sie weigerten sich. Das Wohnzimmer war für so viele spielende Kinder einfach zu klein und zu stickig an diesem warmen Nachmittag.
Erst als sie auf die Straße durften und Völkerball spielten, stieg die Stimmung unter den Jungen. Thomas war in glänzender Form. Er parierte jeden Ball. Andreas hingegen war oft schon sehr schnell wieder aus dem Spiel, weil ihn wieder einmal einer der sechs Jungen mühelos mit dem Ball getroffen hatte. Thomas sah, dass Andreas litt. Er achtete nun darauf, ihn nicht abzuwerfen, und zielte vor allem auf andere Kameraden. Die jedoch schonten Andreas nicht.
Wenige Tage nach dem Geburtstagsfest hatte sich Thomas mit Andreas im Schwimmbad verabredet. Er hoffte sehr, dass an diesem Nachmittag der Dreimeterturm geöffnet würde. Er liebte die Kopfsprünge vom Dreimeterbrett, den Moment, wenn er mit dem Kopf voran eintauchte und tief hinunter, fast bis zum Grund des blaugefliesten Beckens kam. Andreas war ihm erst ein einziges Mal auf das Dreimeterbrett gefolgt, hatte aber keinen Kopfsprung gewagt. Ein paar Jungen aus seiner Klasse hatten ihn dabei beobachtet und ihn für seine Mutlosigkeit gehänselt, aber es schien ihm nichts auszumachen.
Thomas konnte es kaum erwarten, endlich loszuradeln, und wartete ungeduldig auf seine Mutter, die ihn gebeten hatte, auf die Zwillinge aufzupassen, bis sie von einem Arzttermin zurück sein würde. Es war mindestens achtundzwanzig Grad heiß, die Zwillinge planschten nackt in einer großen Plastikwanne auf dem Balkon, die seine Mutter schon am Vormittag mit Wasser gefüllt hatte.
Endlich sah er vom Balkon aus den Bus am Ende der Straße halten und erblickte seine Mutter, wie sie langsam die Straße herunterkam. Sie trug ein rotes Sommerkleid und ging auffallend langsam, ganz anders als sonst, wo sie stets forsch auftrat und eher schnelle Schritte machte. Thomas ahnte schon in diesem Moment, dass etwas nicht stimmte.
Als sie die Treppe zur Wohnung heraufkam, sah er, dass sie sehr bedrückt war. Sie erkundigte sich nach den Zwillingen, nahm ein Glas Wasser, ging ins Schlafzimmer und schloss die Tür. Thomas war wie gelähmt. Mutter ging nie nachmittags allein ins Schlafzimmer. Er öffnete die Tür. Mutter saß auf ihrem Bett und hielt ein Taschentuch an ihre Augen.
»Mama, was ist?«, sagte Thomas.
Mutter schaute ihn an. »Setz dich zu mir«, sagte sie. Und Thomas hörte, dass sie beim Frauenarzt gewesen sei, schon am Tag nach seinem Geburtstagsfest, und da sei etwas in ihrem Unterleib, das sei nicht in Ordnung. Heute habe sie erfahren, dass sie ganz schnell operiert werden müsse, weil dieses Etwas ganz fies sei und sich ausbreite. Im Krankenhaus müsse man ihr dieses Organ entfernen. Das sei nicht schlimm, er solle sich keine Sorgen machen, aber sie sei eben doch traurig, weil sie von der Familie weg und ins Krankenhaus müsse. Schon in drei Tagen würde sie ins Krankenhaus gehen. Oma würde kommen. Dann weinte sie, und Thomas konnte nicht glauben, dass es nicht schlimm sei. Wenig später kam sein Vater nach Hause, viel früher als sonst. Mutter hatte ihn nach dem Arztbesuch im Finanzamt angerufen. Vater sprach lange allein mit ihr im Schlafzimmer. Dann kam er heraus. »Wir werden das schon schaffen«, sagte er, doch Thomas konnte nicht überhören, wie wenig überzeugend das klang.
Er fuhr an diesem Tag nicht mehr ins Freibad. Als Andreas am nächsten Morgen zu ihm kam, um ihn zu fragen, warum er denn gestern nicht ins Schwimmbad gekommen sei, verriet ihm sein Gesicht schon in der Tür, dass etwas Trauriges geschehen sein musste. Thomas erzählte ihm von der Krankheit seiner Mutter und dem bevorstehenden Krankenhausaufenthalt. Die Großmutter aus Neumünster würde kommen, sie würde sein kleines Zimmer benutzen, er müsste für die zwei oder drei Wochen mit ins Zimmer der Zwillinge ziehen. Thomas drehte sich um und fing an zu weinen. »Nicht, weil ich zu den Zwillingen muss, sondern wegen Mama«, sagte er. Andreas stellte sich hinter ihn, drehte ihn zu sich und nahm ihn in den Arm. Thomas schluchzte laut, und es lösten sich alle Schleusen.
Am Nachmittag kam Andreas erneut zu Thomas. Andreas hatte mit seiner Mutter gesprochen. Sie hatte zugestimmt. Thomas würde für die Zeit des Krankenhausaufenthalts zu ihnen kommen und im Gästezimmer wohnen können. Was Andreas Thomas nicht erzählte, war, dass seine Mutter gleich mit seinem Vater telefoniert hatte. Vater hatte schon eine Viertelstunde später aus der Praxis zurückgerufen. Andreas’ Mutter sprach dann mehrfach von Totaloperation, was für Andreas schrecklich klang. Er spürte, dass er dieses Wort gegenüber Thomas besser nicht erwähnen sollte.
Thomas hörte das Wort Totaloperation erst, als Mutter schon auf dem Weg in die Klinik war. Er zog tatsächlich an dem Tag, an dem Großmutter kam, zu den Wingerts in die Villa. Seinem Vater kam dies recht gelegen, so konnte Großmutter das Zimmer von Thomas beziehen, und das ohnehin nicht gerade geräumige Zimmer der Zwillinge blieb unverändert. Die Zwillinge waren traurig, dass nun neben der Mutter auch noch Thomas weggehen würde, aber Thomas versprach, jeden Tag vorbeizuschauen. Sein Vater brachte ihn zu den Wingerts. Es war das erste Mal, dass er für längere Zeit von zu Hause fort sein würde. Zuvor war er erst ein einziges Mal allein für eine Woche bei Großmutter in Neumünster gewesen und hatte sich nichts sehnlicher herbeigewünscht als den Tag, an dem er wieder abgeholt würde. Aber jetzt wäre da Andreas, sein Freund. Doch als er mit seinem Vater vor dem großen, vornehmen Haus der Wingerts stand, das er ja seit drei Jahren gut kannte und das er so sehr mochte, spürte er doch einen dicken Kloß im Hals und konnte nicht sprechen. Sein Vater bedankte sich sehr herzlich bei Frau Wingert und übergab ihr eine Pralinenschachtel. Andreas’ Mutter reichte ihm einen Briefumschlag und einen Blumenstrauß. »Für Ihre Frau«, sagte sie, »wir denken an sie.«
Dann nahm sein Vater ihn lange in den Arm. »Wir werden das schaffen, Tom«, murmelte er, »wir werden uns täglich sehen, und telefonieren tun wir ja sowieso. Benimm dich gut!« Thomas sah, dass auch sein Vater Tränen in den Augen hatte.
Es war noch eine Woche bis zum Ende der Sommerferien, die in diesem Jahr sehr früh begonnen hatten. Thomas ging mit Andreas nach oben, packte seinen Rucksack aus und legte die Kleidungsstücke in den kleinen Schrank im Gästezimmer. Die Fleischmann-Eisenbahn stand spielbereit aufgebockt auf den drei Hockern. Doch weder Thomas noch Andreas hatten Lust, mit der Modelleisenbahn zu spielen. »Ich habe Angst, dass meine Mutter stirbt«, sagte Thomas.
»Himmlischer Vater, hilf Thomas’ Mutter«, sagte Andreas laut, »lass sie die Operation überleben.«
»Glaubst du, dass Beten hilft?«, fragte Thomas.
»Ja, ganz bestimmt. Der liebe Gott lässt deine Mutter nicht sterben!«
»Ich weiß nicht, ob der liebe Gott das wirklich kann. Gestern hörte ich, wie Papa zu Großmutter sagte, es sei eindeutig Krebs, und man müsse alles wegschneiden!« Thomas biss die Lippen zusammen. »Und heute Morgen sagte unsere Nachbarin, es sei eine Totaloperation. Was heißt das, Andy? Totaloperation?« Thomas drehte sich weg.
»Ich frage Vater, was das bedeutet«, antwortete Andreas und ließ Thomas allein im Zimmer.
Am Abend erklärte Herr Wingert den beiden, was ein Gynäkologe unter Totaloperation verstand und dass dies keineswegs ein Todesurteil sei. Im Gegenteil, sie sollten guter Hoffnung sein. Solche Operationen gäbe es sehr oft, und sie gingen in aller Regel gut aus. Die Krankheit sei dann ganz und gar besiegt, deshalb Totaloperation, und Thomas’ Mutter könne danach uralt werden.
»Vielen Dank, Herr Wingert«, sagte Thomas und war in der Tat ein wenig erleichtert. Andreas’ Vater hatte sehr sicher geklungen, und er war ja Arzt, er würde es ganz sicher wissen. Doch als Thomas abends um halb zehn im Gästezimmer allein in seinem Bett lag, überfiel ihn ein großer, ein unendlich großer Schmerz. Er konnte nicht aufhören zu weinen. Andreas’ Mutter hatte das offenbar vermutet. Sie klopfte an der Tür, Thomas versuchte sich noch schnell die Augen zu trocknen und schnäuzte sich, da setzte sie sich schon zu ihm ans Bett und bot ihm an, die Nacht auf der Couch im Zimmer von Andreas zu verbringen. Die Couch sei schnell zurechtgemacht, und dann sei er nicht allein. Thomas nickte. Morgen würde Mutter operiert. Morgen würde sich entscheiden, ob die Totaloperation gelingen würde, ob man all den Krebs würde entfernen können und Mutter dann wieder so sei wie immer. Morgen konnte sie aber auch sterben!
Als Thomas auf der Couch in Andreas’ Zimmer lag, fühlte er sich ein wenig besser. Andreas schlief nicht. »Glaubst du wirklich, Andy, dass Beten hilft?«, fragte Thomas.
»Aber ganz sicher.«
»Dann lass uns für meine Mutter beten, wie in der Kirche«, bat Thomas.
»In zwölf Stunden wird sie operiert. Das wird drei Stunden dauern, meinte Vater eben, also lass uns für jede Stunde ein Vaterunser beten. Fünfzehn Vaterunser!«
»Fünfzehn Vaterunser?«, fragte Thomas nach.
»Für jede Stunde von jetzt an eins. Aber warte noch«, warf Andreas ein. Er stieg aus dem Bett und nahm aus einer der unteren Schubladen des Kleiderschrankes ein Kruzifix, eine weiße Kerze auf flachem Chromständer und eine Marien-Ikone heraus. Er stellte alles auf den Schreibtisch. »Wir müssen uns hier zum Gebet hinknien! «, sagte Andreas.
Thomas stieg aus dem Bett. Andreas entzündete die Kerze. Dann knieten beide in ihren Schlafanzügen vor dem Schreibtisch, richteten ihre Blicke auf das Kreuz vor ihnen und beteten halblaut hintereinander fünfzehn Vaterunser. Als sie fertig waren, sagte Andreas: »Wir müssen dem lieben Gott noch etwas versprechen.« Thomas nickte. »Lieber Gott«, sagte Andreas nach ein paar Sekunden, »wenn du Thomas’ Mutter wieder gesund werden lässt, werde ich alle deine zehn Gebote halten, immer, das verspreche ich!«