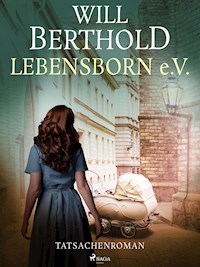Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine genau recherchierte Dokumentation über die Luftwaffe und den Irrsinn des Zweiten Weltkriegs: Als ganzer Stolz der Wehrmacht war die Luftwaffe eine wichtige Einheit, doch durch Fehler bezahlten unzählige der Männer mit ihrem Leben, um die Zivilbevölkerung zu schützen. Die aus den Fugen geratene "Operation Gomorrah" wird hier auf sehr eindrückliche Weise in ihrem ganzen Ausmaß und ihrer Tragik geschildert.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 368
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Will Berthold
Der Sieg der vor die Hunde ging - Tatsachenroman
Der Luftkrieg 1939–1945
Saga
Der Sieg der vor die Hunde ging - TatsachenromanCoverbild / Illustration: Shutterstock Copyright © 1981, 2020 Will Berthold und SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788726444759
1. Ebook-Auflage, 2020
Format: EPUB 2.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit Zustimmung von SAGA Egmont gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk
– a part of Egmont www.egmont.com
Auch der Abend bringt keine Abkühlung. Kurz vor Mitternacht werden noch 28 Grad Wärme gemessen. Hamburgs Häusermeer hat die Sonnenglut wie ein Backofen gespeichert. Die Hitze der Nacht scheint Gespenster auszubrüten.
Zehn Tage lang war kein britisches Flugzeug im deutschen Luftraum aufgetaucht. Plötzlich aber melden die Radargeräte mindestens hundertmal so viele Viermot-Bomber, wie die Engländer und Amerikaner zusammen überhaupt haben. Die Funkmessung ist präzise, doch die Flakbatterien ballern nur Löcher in die Dunkelheit. Und die Nachtjäger – oft bis auf hundert Meter an das vermeintliche Ziel herangeführt – schießen ins Leere. In der Nacht vom 24. auf 25. Juli 1943 werden massige Bomberpulks gleichzeitig über Nordfrankreich, in Holland, im Raum Köln, im Anflug auf das Ruhrgebiet, in Schleswig-Holstein geortet – aber nicht gesichtet.
Die deutsche Luftabwehr ist geblufft und geblendet. In den überhitzten Befehlsständen gibt jeder jedem dafür die Schuld. Noch kann man sich den nächtlichen Spuk nicht erklären. Und Gespenster lassen sich nicht abschießen. In den Großstädten des deutschen Westens heulen die Sirenen, aber der Alarm kostet heute nicht mehr als den Schlaf.
Endlich wird Hamburg als das eigentliche und schließlich einzige Angriffsziel der 746 schweren Bomber ausgemacht. »Expreß Hamburg!« rufen die Leitoffiziere die Nachtjäger. »Achtung . . . Alle Nachtjäger expreß Hamburg!«
Der Befehl ist sinnlos. Die Tanks sind leergeflogen, und die Piloten müssen schleunigst herunter.
19 Minuten nach Mitternacht wird in der Hansestadt Voralarm 30 ausgelöst. Obwohl das heißt, daß in einer halben Stunde die ersten Bomben fallen können, reißt es die Bewohner nicht gleich aus den Betten. Die Luftangriffe auf Hamburg sind bislang glimpflich verlaufen. 54 schwere Flak- und 22 Scheinwerferbatterien schützen es und fügten den Angreifern schwere Verluste zu. Die Bomberbesatzungen konnten sich ausrechnen, daß sie – statistisch gesehen – den zehnten Einsatz über Deutschland nicht überleben würden.
Pfadfinder-Maschinen kurven schon über der Stadt, als die Luftschutzwarte auf den Straßen noch lärmende Betrunkene einkassieren. Auch die ausgelassene Stimmung der Hochzeitsgesellschaft im Hinterhaus 2 der Glashüttenstraße 111 auf St. Pauli läßt sich nicht so einfach abdrehen. Der Bräutigam Willi Schwandner hat einen Koffer voll Schnaps aus Frankreich mitgebracht. Heute morgen um elf Uhr heiratete er die 19jährige Doris Lüders. Die Braut trug Weiß, in der Gnadenkirche gegenüber dem Oberlandesgericht . . . doch Gnade ist bei der ›Operation Gomorrha‹, die der britische Luftmarschall Sir Arthur Harris (›Bomber-Harris‹) in seinem Kommandostand High Wycombe, 50 Kilometer westlich von London und 20 Meter tief unter der Erde, leitet, nicht vorgesehen . . . ›Dann ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen vom Himmel herab auf Sodom und Gomorrha und verderbte die Städte und die ganze Gegend und alle Einwohner der Städte‹.
Aus der Bibel in den Klartext des Befehls übersetzt, heißt das: Hamburg ist von der Landkarte zu streichen, Hafen und Rüstungsbetriebe sind zu zerschmettern, seine Wohnviertel niederzubrennen. Hamburg soll in rollenden Angriffen, die sich auf eine ganze Woche verteilen, vernichtet – oder wie Hitler sagen würde – ›ausradiert‹ werden.
Die Flak feuert aus allen Rohren, aber sie muß ihre Ziele über den Daumen anpeilen. Nach dem Wellensalat auf den Radarschirmen zittern die Lichtkegel der Suchscheinwerfer mit greisen Fingern nutzlos am Himmel entlang.
Ein Gotteshaus wird für die Angreifer zum Orientierungspunkt: Die ›Pfadfinder‹ suchen und finden den Turm der Nicolaikirche, stecken die Todesparzellen mit Leuchtbomben und ›Christbäumen‹ ab. Minuten später öffnen die Viermot-Maschinen der ersten Welle ihre Bombenschächte.
Die brisante Fracht rauscht in die illuminierten Ziele. Barmbek und Umgebung brennen. Die mit brutaler Wucht geführte Angriffsouvertüre verlagert sich auf die rechte Alsterseite. Flächenbombardement auf die Stadtteile Hoheluft, Eimsbüttel, Altona.
Die Katharinenkirche steht in Flammen. Das Gelände des Zirkus Hagenbeck wird zertrümmert. Die gräßlichen Todesschreie der in den Flammen umkommenden Tiere überlagern kurz den Gefechtslärm. Volltreffer im Polizeipräsidium. Die Befehlsstelle des Luftschutzes ist von brennenden Geschäftshäusern umschlossen. Rings um den ›Michel‹, Hamburgs Wahrzeichen, fressen sich die Feuerzungen in die Altstadt. Flammen schlagen aus der Nicolaikirche.
Eine Luftmine beendet die Hochzeitsnacht in St. Pauli. Die Festgäste müssen noch im Treppenhaus ihr blechernes Scheppern gehört haben, bevor ihnen der Explosionsdruck die Lungen zerriß. Menschen, die in Kellern um ihre Habe zittern, werden zu Tausenden von einem schleichenden Tod, dem Kohlenmonoxyd, ereilt. Man findet sie wie schlafend, oft Arm in Arm. Anderswo können die Ärzte der Bergungstrupps die Zahl der Toten nur noch nach der Höhe der Aschenschicht schätzen: 100 Opfer, 200 Opfer, 300 Opfer.
Keller werden zu Massengräbern, Hinterhöfe zu Flammenfallen, Straßen zu Massenexekutionsplätzen. Der Sog reißt fliehenden Müttern die Kinder von der Hand und wirbelt sie ins Feuer. Menschen, denen die Flucht geglückt ist, werden von einstürzenden Fassaden erschlagen, von Bomben mit Zeitzündern zerfetzt, sie ersticken oder sterben doch noch als brennende Fackeln.
Diese Nacht ist die schauerliche Premiere des totalen Luftkriegs. Was Hitler in geifernder Wut fortgesetzt angedroht und versucht hatte – unfähig, es zu verwirklichen –, machen nunmehr die Briten wahr. Militärische Ziele sind nur mehr willkommene Abfallprodukte eines gegen die Zivilbevölkerung gerichteten Terrors. Zuerst fetzen Luftminen, so groß wie Anschlagsäulen, die Dächer von den Häusern, drücken die Scheiben ein und bereiten sie so für ihre Kremation vor. Dann Brandbomben. Dann Sprengbomben, um die aus den Kellern eilenden Löschtrupps zu töten oder zu verjagen.
Das Rezept wurde von britischen Wissenschaftlern erarbeitet: Man nehme 10 000 Tonnen Brisanz, mische Luftminen, Sprenggeschosse und Brandbomben im Verhältnis von 1 : 20 : 200 und werfe sie auf rund 1,7 Millionen Einwohner, die sträflicherweise nicht evakuiert worden sind.
»Die Schlacht um Hamburg vom Juli 1943 hatte Deutschlands ersten Feuersturm hervorgerufen«, schreibt der englische Autor David Irving: »Zwanzig Quadratkilometer der Stadt hatten wie ein einziges Großfeuer gebrannt. Das Phänomen war so schrecklich, daß der Polizeipräsident eine wissenschaftliche Untersuchung der Ursachen des Feuersturms angeordnet hatte, die als Warnung für die anderen Städte dienen sollte:
Der Feuersturm und seine Erscheinungsweise sind feste, aus der Geschichte der Städtebrände bekannte Begriffe. Die Erklärung des physikalischen Vorgangs ist einfach. Durch das Ineinanderfließen einer Zahl von Bränden wird die darüber befindliche Luft so stark erwärmt, daß sie infolge ihres verringerten spezifischen Gewichtes einen gewaltigen Auftrieb erhält, der zu einem stärksten Sog umliegender Luftmengen in radikaler Richtung auf das Zentrum des Brandes führt. Durch diesen Feuersturm, insbesondere die gewaltige Sogwirkung, werden Luftbewegungen von größerer Stärke als die bekannten Windstärken ausgelöst. Wie in der Meteorologie ist also auch bei Feuerstürmen die entstehende Luftbewegung durch den Ausgleich von Temperaturdifferenzen zu erklären. Während diese in der Meteorologie im allgemeinen 20 bis 30 Grad Celsius betragen, handelt es sich bei Feuerstürmen um Temperaturdifferenzen von 600, 800 oder gar 1000 Grad Celsius. Aus diesem Umstande erklärt sich die ungeheure Gewalt der Feuerstürme, die mit bekannten und normalen meteorologischen Vorgängen nicht verglichen werden kann.«
Die düstere Prognose des Polizeipräsidenten lautete, daß ein Feuersturm nach einem Ausbruch durch keinerlei Luftschutzmaßnahmen mehr eingedämmt werden konnte: »Der Feuersturm war offensichtlich ein von Menschenhand geschaffenes Ungeheuer, das kein Mensch je wieder zähmen konnte.«
Als nach zwei Stunden und sieben Minuten der erste Angriff endet, gleicht der Hamburger Hafen einem Schiffsfriedhof, und die Feuerwehr ist nicht mehr in der Lage, die Brände zu löschen. Dabei hatten die Engländer nur ein Viertel der üblichen Verlustrate zu entrichten.
Am Sonntagmorgen herrscht in Norddeutschland strahlendes Wetter, aber in Hamburg geht die Sonne nicht mehr auf. Man findet Berge von Stanniolstreifen und weiß jetzt, durch welchen Trick es den Tommys gelungen ist, der deutschen Flugabwehr die Radaraugen auszustechen. Zum ersten Mal haben sie ihr ›Window‹-Verfahren angewandt: 50 überschnelle Maschinen flogen kreuz und quer, um falsche Spuren auszulegen. Sie warfen 40 Tonnen Stanniolfolien ab, insgesamt 92 Millionen Düppel, jeder 27 cm lang und 15 Minuten lang wirksam. Die Streifen reflektierten die Ortungsstrahlen wie Flugzeuge, und die Bordkanonen der Nachtjäger schossen auf alberne Stanniolwolken. ›Window‹ ist jetzt erkannt, aber im ganzen Jahr 43, in dem schon die Menetekel Stalingrad und Nordafrika an der Wand stehen, wird es noch kein wirksames Abwehrmittel geben.
Der Rauchvorhang über der Hansestadt lichtet sich; jetzt greifen die Amerikaner an. Dann kommen die Engländer wieder. Eine Woche lang herrscht fast stündlich Luftalarm. Bei dem fünften Großangriff in der Nacht vom 27. zum 28. bombt sich Luftmarschall Harris in die Nähe seines Vorhabens, Hamburg auszulöschen.
»Der Schwerpunkt lag jetzt in den Stadtteilen links der Alster: Rothenburgsort, Hammerbrook, Hohenfelde, Borgfelde, Hamm, Eilbek und zum Teil Barmbek und Wandsbek«, stellt die von der Bonner Regierung 1960 herausgegebene Materialsammlung ›Dokumente deutscher Kriegsschäden‹ fest: »Bereits im Verlaufe einer halben Stunde war in diesen Gebieten eine furchtbare Lage entstanden. Durch einen Bombenteppich von unvorstellbarer Dichte wurde eine fast völlige Vernichtung dieser Stadtteile in kürzester Frist erreicht . . . Zehntausende von Einzelbränden vereinten sich zu Großflächenbränden, die zu Feuerstürmen von orkanartiger Gewalt führten. Bäume bis zu einem Meter Durchmesser wurden glatt abgedreht oder entwurzelt, Häuser abgedeckt und Menschen zu Boden gerissen oder in die Flammen hineingezogen. Großen Teilen der in den betroffenen Stadtteilen wohnenden Bevölkerung gelang es nicht mehr, dem Feuersturm zu entkommen.«
Sein Durchmesser beträgt zweieinhalb Kilometer. Funken fliegen bis zu 4500 Meter hoch. Verzweifelte versuchen, aus den Fenstern in die Wasserkanäle zu springen und landen mit zerschmetterten Körpern auf den Straßen. Andere erreichen das Fleet und ertrinken. Bis zu 24 Stunden stehen vorläufig Gerettete im Wasser, bespülen sich das Gesicht, verbrennen sich die Haare, tauchen immer wieder unter, während weiter die Bomben vom Himmel rauschen und Unschuldige wie Unverbesserliche massakrieren.
Bei der Flucht aus den Flammen wird in Hamm Heinrich Johannsen zweimal von brennenden Trümmern getroffen. Er kommt wieder hoch, erreicht einen freien Platz und sucht Schutz unter einem Haufen weißer Ziegelsteintrümmer. Er wühlt sich hinein, schützt den Kopf durch eine nasse Decke, hört einen kleinen Jungen schreien: »Ich will nicht verbrennen!« Johannsen kriecht zu ihm, nimmt ihn unter seine Decke. »Meine Mutti liegt dort unter den Steinen«, sagt der Knirps. »Und mein Bruder ist auch dort verbrannt.«
Im gleichen Stadtteil ist Erika Wilken aus dem Keller ihres Hauses am Grevenweg 83 in die öffentliche Toilette an der Kanalbrücke geflüchtet. Hier sitzen etwa hundert Menschen in der Falle, das rettende Wasser vor Augen. Zwei Soldaten ziehen ihre Pistole und erschießen sich. Die anderen wagen den Sprung durchs Feuer; fast alle kommen dabei um.
Es gibt kein Wasser mehr, keinen Strom, kein Gas, kein Telefon. Momentaufnahmen einer Weltstadt im Todeskampf: Die Hammerlandstraße ist nur noch von Toten bevölkert. Sie hocken auf Treppenstufen, sitzen an Bäume gelehnt, liegen mit ausgestreckten Armen auf dem kochenden Asphalt: »Viele von ihnen hatte die Glut in phantastische, irrsinnige Stellungen gezwungen«, berichtet Gretl Büttner, die mit dem Wagen eines Instandsetzungstrupps unterwegs ist. »Aufgerissene Münder, hervorgequollene Augen . . . Auf einem kleinen freien Platz beim Boonsweg lagen sie, hundert oder mehr, Männer und Frauen, Soldaten in Uniform, Kinder, Greise. Viele hatten sich in der mordenden Glut, kurz vor dem Tod, die Kleider vom Leib gerissen . . . Da eine Mutter, an jeder Hand ein Kind. Sie lagen alle drei auf dem Gesicht, in einer fast anmutigen, gelösten Bewegung.«
Verzweifelte Männer wühlen in Leichenbergen, suchen ihre Frauen, Frauen ihre Männer, Mütter ihre Kinder. Fronturlauber gruben die Trümmer ihrer Elternhäuser um, unfähig zu begreifen, daß die geborgenen Skelette Vater und Mutter sein sollen.
»Im Zentrum der Stadt brannte alles, was brennbar war«, schreibt in seinem Buch ›The lost command‹ der britische Autor Alastair Revie: »Der Rest schmolz in der Hitze. Menschen und Gegenstände wurden in das Inferno hineingesaugt, um Tausende von Metern in dieser Vulkanhitze hochgewirbelt zu werden, in glutheißen Winden mit Geschwindigkeiten von über 200 km/h. Niemand und nichts überlebte im Brandgebiet . . . Es war ein Schicksal von biblischen Ausmaßen, und der schreckliche Einfall, diesen Angriffen den Decknamen ›Gomorrha‹ zu geben, erwies sich als grauenhaft realistisch . . . Tatsächlich hatte Hamburg dabei mehr Verwüstung und Blutvergießen und Feuertod erlitten als das gesamte britische Königreich durch die deutsche Luftwaffe während des ganzen Krieges . . .«
Fast 50 000 Menschen, unter ihnen 7000 Kinder, sind bei den Terrorangriffen umgekommen. 40 000 wurden schwer verletzt. 280 000 Häuser und 191 Fabriken – fast die Hälfte – wurden zerstört, die Hafenanlagen schwer beschädigt. 40 Millionen Tonnen Trümmer. Schäden im Schätzwert von 23 Milliarden RM.
Was veranlaßte die Engländer, ein zivilisiertes Volk, das der Welt den Begriff ›Fairneß‹ geschenkt hat, Not und Tod über Frauen und Kinder zu bringen?
»Ein Krieg durch demoralisierende Angriffe auf die Zivilbevölkerung widerspricht in krasser Form dem Völkerrecht«, hatte Premierminister Neville Chamberlain vor dem britischen Unterhaus erklärt. »Ich möchte hinzufügen, daß es nach meiner Meinung auch eine falsche Politik ist, denn ich glaube nicht daran, daß man jemals einen Krieg durch Angriffe auf die Zivilbevölkerung gewinnen kann.«
Zwischen dieser feierlichen Erklärung vom 21. Juni 1938 und der ›Operation Gomorrha‹ liegt eine erbarmungslose Eskalation des Luftkriegs, wie sie zunächst keine Seite gewünscht hatte.
Von der ersten Minute des Zweiten Weltkriegs an hatte die deutsche Luftwaffe den Himmel beherrscht, die Grenzen gesichert und entscheidend in die Erdkämpfe eingegriffen. Sie nahm in wenigen Tagen die Doktrin des modernen Krieges vorweg: Wer die Luftüberlegenheit hat, gewinnt die Schlacht, wer sie sich auf Dauer erkämpft, gewinnt den Krieg. Mit dem Geheul der Jerichosirenen, mit dem Bersten der Stukabomben, mit den Flächenbombardements der Kampfflugzeuge entstand eine neue Dimension des Tötens.
Der Vertrag von Versailles hatte dem Deutschen Reich jede Art von Motorfliegerei verboten. Erst 1926 konnte – nach der Milderung der härtesten Bestimmungen – die Lufthansa gegründet werden.
Die Reichswehr der Weimarer Republik hatte die Bestimmungen durch ein Geheimabkommen mit der Sowjetunion umgangen. Sie ließ ihre Flugzeugführer schwarz im roten Rußland schulen, zwischen 1923 und 1933 jährlich 240, vorwiegend auf dem Flughafen Lypeck. Als Hitler an die Macht kam und sofort durch das Arbeitsbeschaffungsprogramm Rüstung den Zweiten Weltkrieg vorbereitete, konnte er auf die Rußland-Piloten, auf die Flugzeugführer des Ersten Weltkrieges und auf Tausende begeisterter Segelflugsportler zurückgreifen.
Die blutige Auseinandersetzung in Spanien am Vorabend des Zweiten Weltkriegs hatte ihm in die Hände gearbeitet: er konnte seinem Gesinnungsfreund Franco beistehen, aber wichtiger war für ihn die Erprobung seiner neuen Vernichtungsmaschinen. Die Me 109 zeigte sich allen anderen Jagdflugzeugen überlegen. Die Sturzkampfbomber, deren Konzept Generalluftzeugmeister Ernst Udet aus den USA nach Deutschland mitgebracht hatte, wurden erstmals gegen Punktziele eingesetzt. Die Erfahrungen der deutschen ›Legion Condor‹ – sie hatte sich aus sogenannten Freiwilligen zusammengesetzt – ermöglichten entscheidende Verbesserungen. Kriegsreife durch Feuertaufe.
Gebannt und tatenlos hatte das Ausland Hitlers gigantische Luftrüstung verfolgt. Man nahm an, daß in Deutschland monatlich 1000 Kriegsflugzeuge produziert würden. Diese wilde Übertreibung war der braunen Propaganda nur recht. Im ganzen Jahr 1939 erhielt die Luftwaffe von den Rüstungsbetrieben lediglich 2518 Maschinen. Bei Kriegsausbruch verfügte sie über 4333 Flugzeuge, darunter 1180 Bomber und 336 Stukas. Die Generalprobe der verbesserten Ju 87, in der Flugzeugführer und Bordschützen Rücken an Rücken saßen, wurde 14 Tage vor Kriegsausbruch zu einem Fiasko: Auf dem schlesischen Truppenübungsplatz Neuhammer sollten 30 Stukas vor den Generalen Sperrle und Loerzer ihre Kampfkraft vorführen. In 5000 Meter Höhe flogen die drei Staffeln das Zielgebiet an. Der Wetterdienst hatte Bewölkung zwischen 900 und 2000 Meter gemeldet. Die Maschinen sollten die Waschküche im Sturzflug durchstoßen und Rauchbomben aus 300 Meter Höhe abwerfen.
Es war der 15. August 1939, kurz vor sechs Uhr. Die Meldung, daß inzwischen Bodennebel aufgekommen ist, erreichte Hauptmann Sigel nicht mehr. Er setzte zum Angriff an, kippte ab, jagte seinen Todesvogel mit 600 Kilometer Geschwindigkeit durch das Gewölk. Zehn Sekunden, zwölf, fünfzehn.
Der weiße Dunst wurde schwarz.
Die Erde – das Ende . . .
Hauptmann Sigel riß den Knüppel hoch, brüllte ins Mikrophon: »Ziehen! Ziehen! Bodennebel!« Er fing seine Ju 87 zwei, drei Meter über der Erde ab . . .
»Aber seine verzweifelte Warnung kam zu spät«, schreibt der englische Autor Peter C. Smith in seinem Buch ›The stuka at war‹: »Die meisten konnten nicht mehr gerettet werden. Mit heulenden Sirenen bohrte sich eine Maschine nach der anderen mit hoher Geschwindigkeit in den Boden. Nur wenige Flugzeugführer konnten ihre Maschinen, wie der Gruppenkommandeur, im letzten Augenblick in die Höhe ziehen. Sie blieben dann zum Teil in den Bäumen des Waldes hängen, der das Zielgebiet umgab. 13 Stukas mit ihren Besatzungen gingen in wenigen Sekunden verloren. Ein fürchterlicher Unfall . . . Der erschütterte Udet hatte den Verlust von 13 seiner besten Besatzungen zu beklagen.«
Zwei Wochen später flogen die Vernichtungsmaschinen mit den geknickten Flügeln vor allen anderen Verbänden gegen den Feind: »Den ersten Angriff, 15 Minuten vor Kriegsausbruch«, berichtet in seinem Buch ›Luftkrieg‹ Janusz Piekalkiewicz, »fliegt die 3. Staffel des Stuka-Geschwaders 1 mit einem Sonderauftrag: Die strategisch wichtige Weichselbrükke bei Dirschau soll mit diesem Bombenangriff vor der von den Polen vorbereiteten Zerstörung gerettet werden. Über diese Brücke soll der Nachschub für die Truppen in Ostpreußen rollen. Die drei Ju 87 starten um 4.26 Uhr und donnern im Tiefflug, kaum zehn Meter hoch, über das noch friedliche Land. Die Stukas haben Order, die Zündstellen für die vorbereitete Sprengung der Brücke, dicht neben dem Bahnhof von Dirschau, mit ihren Bomben zu vernichten. Gleichzeitig soll ein Panzerzug zur Brücke vorstoßen und diese sichern. Der Stuka-Angriff gelingt. Die Bomben sitzen genau im Ziel, aber es ist vergebliche Mühe: Die Polen flicken die zerrissenen Kabel, und um 6.30 Uhr fliegt die Brücke in die Luft.«
In seinem Buch ›Blitzkrieg‹ faßt der englische Autor Len Deighton die ersten Kriegshandlungen zusammen: »Am 1. September 4.45 Uhr griffen fünf deutsche Armeen Polen im Norden, Westen und Süden an. Um 6.00 Uhr wurde Warschau ohne jede vorherige Warnung bombardiert. Die deutschen Luftangriffe führten zu einer fast vollständigen Vernichtung der polnischen Flugzeuge am Boden. Die deutschen Verbände griffen sofort die Eisenbahn- und Straßenverbindungen an, um eine Mobilmachung und die Bewegung der polnischen Truppen zu verhindern . . .
Die polnischen Kavalleristen kämpften mit ihren Lanzen mit wahnwitziger Tapferkeit gegen die deutschen Panzer und starben ruhmreich. Erst später wurde vermutet, daß die Polen glaubten, einen großen Teil jener hölzernen, stoffbespannten Panzerattrappen vor sich zu haben, mit denen die Reichswehr in den 20er Jahren im Manöver geübt hatte.
Überall bekämpfte die Luftwaffe die polnischen Truppen mit MG-Feuer und mit Bomben. Jeder Bericht über die Kämpfe, die die Polen fochten, muß unter dem Aspekt gesehen werden, daß die Deutschen den Luftraum völlig beherrschten. Es war ein Krieg ständiger Bewegung, und nirgends kam es zur Bildung einer Frontlinie, die länger bestand als ein paar Stunden . . .
Und wie sah es mit den Russen aus? Am selben Tag, an dem die Deutschen die Umklammerung schlossen, erhielt das OKW die Nachricht, daß Einheiten der Roten Armee über die östlichen Grenzen nach Polen eingedrungen seien. ›Gegen wen geht das?‹ fragte General Jodl, der Chef des Wehrmachtsführungsstabes, alarmiert. Hitlers Geheimabkommen zur Teilung Polens mit den Russen war so ›dicht‹, daß nicht einmal seine hohen Militärs etwas davon erfahren hatten . . .«
Die Polen, den Deutschen hoffnungslos unterlegen, standen überraschend in einem Zwei-Fronten-Krieg. Wenige polnische Piloten und Besatzungen warfen sich der Roten Armee entgegen. Die Luftkämpfe hielten 24 Stunden an, dann erlahmte zusehends der Widerstand der Verteidiger. Der Kommandeur der Fliegertruppe befahl, die noch startklaren Maschinen nach Rumänien zu fliegen, um sie vor den Russen wie vor den Deutschen in Sicherheit zu bringen.
Der 17. September war ein Sonntag, und an der polnischen Westfront erreichte der Einsatz der deutschen Luftwaffe gegen den Kessel an der Bzura eine noch nie gesehene Intensität. An allen Abschnitten wurden die fliegenden Verbände abgezogen und auf diesen Schwerpunkt konzentriert. Der Verteidiger, General Kutrzeba, stellte fest: »Die heftigen Luftangriffe auf die Bzura-Übergänge haben sowohl nach der Zahl der eingesetzten Flugzeuge wie nach der Heftigkeit der Angriffe sowie nach der geradezu akrobatischen Fähigkeit der Flugzeugführer kein Beispiel. Jede unserer Bewegungen, jede Truppenansammlung geriet unter ein alles zermalmendes Bombardement . . .«
Am Montag, dem 25., wurde Warschau von 400 deutschen Bombern in drei- bis viermaligen Angriffen bombardiert: »486 Tonnen Sprengbomben und 72 Tonnen Brandbomben auf Warschau«, zählt der Chronist Janusz Piekalkiewicz: »Die Brände in der Stadt können nicht bekämpft werden, da die Bomben die Wasserleitungen zerstört haben und die Trümmer der eingestürzten Häuser die Straßen blockieren. Die Lage wird vollends hoffnungslos durch das Fehlen der Feuerwehr, die man zwei Wochen zuvor evakuiert hat.«
Warschau stand vor der Kapitulation, und damit war der Polenfeldzug praktisch beendet. Auf polnischer Seite hatten an dem ungleichen Kampf 340 Flugzeugführer, 250 Beobachter und 210 Bordschützen teilgenommen. Einem Teil der polnischen Piloten war es gelungen, ins Ausland zu entkommen. Sie schlugen sich auf Umwegen nach England durch und meldeten sich bei der Royal Air Force zur Fortsetzung des Kampfes. Schon ein Jahr später würden sie bei der Verteidigung der Insel gegen die Deutschen zu den Tapfersten und Besten gehören.
Die meisten Verluste hatten die polnischen Luftstreitkräfte – übrigens nach eigener Angabe – durch selbstverschuldete Abschüsse erlitten. Auch die siegreiche Luftwaffe, der heiße Atem des Blitzkrieges, hatte 285 Maschinen und 734 Besatzungsmitglieder verloren. 279 Flugzeuge waren bei den Kampfhandlungen beschädigt worden.
Im Westen war es ruhig geblieben; die Franzosen hatten den verbündeten Polen nicht zu Hilfe kommen können und zudem recht umständlich ihre Zivilisten mobilisiert. Das Gros ihrer Streitkräfte hielt die Maginot-Linie, wie die Wehrmacht den Westwall. Die Luftkriegführung beschränkte sich im wesentlichen auf Propagandaflüge, Fernaufklärung und auf deutscher Seite auf die Bekämpfung von Schiffszielen.
Göring hatte schon vor dem Krieg laut verkündet, daß er Meier heißen wolle, wenn es auch nur einem Feindflugzeug gelänge, die deutschen Grenzen zu überfliegen. Wenn man diese Großsprecherei nicht ganz wörtlich nahm, schien er zunächst recht zu behalten.
Am 18. Dezember 1939 war es über der Deutschen Bucht zu einem Luftkampf zwischen 22 ›Vickers Wellington‹, 32 Me 109 und 16 zweimotorigen Me 110 gekommen. Bei zwei deutschen Verlusten wurden zwölf britische Maschinen abgeschossen und weitere drei so schwer beschädigt, daß sie später bei der Landung zu Bruch gingen.
Goebbels veranstaltete einen großen Propagandarummel. Auf einer Pressekonferenz stellte der Kommandeur der ersten Gruppe des Zerstörergeschwaders 76 fest: »Die ›Wellington‹ brennt leicht und steht schnell in Flammen.«
Die englischen Flugzeuge hatten damals noch keine selbstabdichtenden Tanks wie die deutschen. Zwar verfügte die Royal Air Force etwa über so viele Maschinen wie die Luftwaffe, aber viele von ihnen waren veraltet und schrottreif. Neben den ›Wellingtons‹ flogen die Engländer noch Bomber des Typs ›Hampden‹ und ›Whitley‹.
»Der Zustand von Beobachter und Funker war zu diesem Zeitpunkt so, daß sie sich alle paar Minuten auf den Boden legen und ausruhen mußten«, heißt es in dem Einsatzbericht einer ›Whitley‹-Besatzung, die in der Nacht vom 27. Oktober Flugblätter im Raum Frankfurt – Düsseldorf abgeworfen hat: »Die Cockpit-Heizung erwies sich als nutzlos. Wir froren scheußlich und besaßen keinerlei Mittel, um das abzuändern. Kommandant und Beobachter stießen die Köpfe gegen Fußboden und Kartentisch, um sich durch diesen andersartigen Schmerz vor dem Sauerstoffmangel und dem Frieren abzulenken.«
Nach der Landung stellte der Kommandant in angelsächsisch kühler und knapper Manier fest: »Die ›Whitley‹ ist nicht gerade das richtige Flugzeug, um die Feinde Seiner Majestät das Fürchten zu lehren.«
Für beide Seiten war es Befehl, Angriffe zu unterlassen, wenn Zivilisten dabei gefährdet würden. Die meisten Kampfhandlungen waren zunächst ›Papierflüge‹, unternommen zum Zwecke von Flugblattabwürfen, die nach Meinung von ›Bomber-Harris‹ jedoch nur den Erfolg hatten, ›die deutschen WCs mit Klopapier zu beliefern‹.
»Das im Dock liegende Schlachtschiff ›Repulse‹ durfte auf ausdrücklichen Wunsch Hitlers nicht angegriffen werden«, schreibt der frühere General der Jagdflieger Adolf Galland in seinem Buch ›Die Ersten und die Letzten‹, »weil dieser damals noch unbedingt vermeiden wollte, daß auch nur eine einzige deutsche Bombe auf englisches Gebiet falle. Die deutschen Luftangriffe mußten sich ausschließlich auf militärische und maritime Ziele beschränken.«
Göring triumphierte, er konnte zunächst halten, was er versprochen hatte. Er glaubte an seine Luftwaffe und diese an ihn: Die jungen Piloten übernahmen begeistert die verwegensten Einsätze und waren dafür reichlich mit größeren Vorrechten ausgestattet, als nur die Drahtgestelle ihrer Uniformmützen in kessem Schwung zu verziehen und mit knallbunten Schals in den Einsatz – und auf Schürzenjagd – zu ziehen.
Sie wurden die ersten Schlipssoldaten, die der Barras duldete und erduldete. Sie hatten die schicksten Uniformen und die üppigste Sonderverpflegung. Die blutigsten Verluste, die sie erlitten, wurden mit den höchsten Orden kompensiert. Offiziere und Soldaten der Luftwaffe erhielten zum Beispiel 1730mal das Ritterkreuz, 192mal das Eichenlaub, 41mal das Eichenlaub mit Schwertern, zwölfmal das Eichenlaub mit Schwertern und Brillanten, einmal das goldene Eichenlaub.
»Göring, der Oberbefehlshaber, der ›getreue Paladin‹ – damals noch nicht so fett, faul und korrumpiert – war die Zentralfigur und das Idol der jungen Männer«, stellte Johannes Steinhoff, Jagdfliegeras und späterer General der Bundeswehr, fest: »Der ›Pour-le-merité‹-Flieger, der Held der Luftschlachten in Flanderns Himmel, riß mit energischer Initiative alle die mit, die sein ›Schwert am Himmel‹ schmieden sollten.«
Wie zweischneidig dieses Schwert war, zeigte ein mörderischer Zwischenfall am 10. Mai 1940.
Seit 5 Uhr 35 rollt die seit dem November des Vorjahres 29mal verschobene deutsche Offensive im Westen. Der ›Fall Gelb‹ ist ausgelöst. 136 deutsche Divisionen treten unter Mißachtung der holländischen und belgischen Neutralität zum Sturm auf Frankreich an. Blitzkrieg. Die Sondermeldungen jagen sich. Zum ersten Mal in der Militärgeschichte erobern Fallschirmjäger im Handstreich eine Festung aus der Luft – das Fort Eben Emael am belgischen Albert-Kanal.
Die beiden Kampfgeschwader ›Greif‹ (KG 55) und ›Edelweiß‹ (KG 51) sind im süddeutschen Raum stationiert und damit weit vom Schuß. In Sandkastenübungen haben sie französische Flughäfen bis zum Überdruß zerbombt, doch der Einsatz läßt auf sich warten. 17mal ist der ›Fall Gelb‹ verschoben worden.
Am Vortag des Frankreichfeldzuges haben die ›Greif‹-Besatzungen dienstfrei. Die Offiziere genehmigen sich in Neuburg/Donau einen Herrenabend. Die Unteroffiziere und Mannschaften in Leipheim und Neu-Ulm aalen sich in der Sonne, dreschen Skat oder klopfen dumme Sprüche. Die in Gablingen stationierten Männer der dritten Gruppe gehen in Augsburg ins Kino – aber der Film hat kein Happy-End: Mitten in der Vorstellung geht das Licht an, und sie werden zu einer Alarmübung herausgeholt.
Kurz vor Mitternacht begreifen sie: Ernstfall.
Die Maschinen werden betankt und mit Bomben beladen.
Die Bordfunker stimmen ihre Geräte ab. Einsatzbesprechung. Die Motoren sind schon vorgewärmt. Die Besatzungen stehen an ihren Mühlen. Es gibt Kaffee, Zigaretten und Latrinenparolen. Alles gratis.
Und dazu noch mieses Wetter; es wird dafür sorgen, daß sich der Sitzkrieg keineswegs fulminant in einen Blitzkrieg verwandelt.
Sie helfen einander beim Anlegen der Fallschirme. Dann klettern je fünf Mann Besatzung in eine He 111. Es ist der zweimotorige Standardbomber der deutschen Luftwaffe, von dem 5656 Stück gebaut wurden. Er ist 435 km/h schnell, braucht 20 Minuten, bis er auf 5200 Meter Höhe kommt und hat eine Reichweite von 2800 km. Damit ist 1940 noch Krieg zu machen, aber bald wird sich herausstellen, daß der Horizontalbomber zu schwach bewaffnet ist, einen zu kurzen Aktionsradius hat und mit 2000 kg eine viel zu geringe Bombenlast schleppt.
Die Motoren werden angelassen. Die schweren Vögel rasen über die Piste, heben ab, steigen mit vollen Touren hoch.
Und dann gibt’s Bruch. Schon beim Start knallt eine Maschine in einen Krautacker. Eine andere bleibt in einem Baumwipfel hängen und schlägt unsanft auf. Eine dritte kommt wegen eines plötzlichen Maschinenschadens erst gar nicht hoch.
Die anderen ziehen westwärts, überfliegen die Grenze. Die französische Flak sorgt für einen heißen Empfang. Über Nancy schießt sie die erste He ab. Die brennenden Trümmer fallen in eine Flugzeughalle. Oberst Stoeckl, der Geschwaderkommodore, erkennt beim Anflug auf Toul Croix de Metz, daß der Nebel einen gezielten Bombenwurf ausschließt. Obwohl er seine beiden Kettenflugzeuge in der Waschküche verloren hat, kreist er 45 Minuten im konzentrierten Flakfeuer, bis er ein Ausweichziel findet.
Auch bei den ›Edelweiß‹-Kampffliegern kommt es bei der Feuertaufe zu Pannen. Die Staffeln starten von Landsberg am Lech und Bad Wörishofen aus. Schon während des Hinflugs können sich die Männer an den zehn Fingern abzählen, daß es besser gewesen wäre, die Offensive auch noch ein achtzehntes Mal zu verschieben.
Dann, über Frankreich, werden die Hes nicht von der Flak, aber von dichtem, milchigem Nebel empfangen. Es gibt kein Oben und kein Unten, kein Vorne und kein Hinten mehr. Gezielter Bombenwurf unmöglich. Weiterflug zwecklos.
Die ersten Maschinen wenden, kehren mit voller Bombenfracht zurück. Die Besatzungen klettern mißmutig aus ihren Mühlen. »Es wollt’ ein Öchslein über’n Rhein«, albert einer der ›Kuttenzwerge‹ vom Bodenpersonal, »und kam als Ochse wieder heim.«
Sie erhalten keinen Anschiß, sondern werden für ihr Verhalten belobigt. »Nun schaut nicht so dämlich aus der Wäsche«, sagt der Staffelkapitän. »Der Krieg dauert schon noch ein paar Tage.«
Beim zweiten Einsatz kommen sie zum Wurf. Und dann wird ihnen noch ein dritter abverlangt. Aber keiner mault, obwohl es kein Vergnügen ist, zwölf Stunden in die enge Kabine eingepfercht zu sein. Sie haben eine Ausbildung in Friedensqualität erhalten. Es fehlt ihnen lediglich die Fronterfahrung. Sie wollen fliegen und nicht töten, aber im Krieg ist das eine von dem anderen nicht zu trennen. Auf keiner Seite.
»Alsdann, Hals- und Beinbruch, Herr Leutnant!« ruft der 1. Bodenwart einem Rottenführer der dritten Gruppe zu. Es ist 14 Uhr 30. Von ihren Basen in Landsberg und Bad Wörishofen starten 20 Kampfflugzeuge zum dritten und letzten Feindflug dieses Tages. Sie sammeln am Memmingerberg, 1500 Meter über Grund, und ziehen in geschlossener Formation in Richtung Schwarzwald und von da weiter zu den Vogesen. Wind und Wetter sprengen den Verband. Dicke Gewitterwolken nehmen die Sicht, und das wird grauenhafte Folgen haben.
Oberleutnant Schifferings – er führt die neunte Kette – verfranzt sich und wird über der schweizerischen Stadt Solothurn von Jagdflugzeugen angegriffen. Im ersten Moment nimmt er an, daß ihn eigene Mes versehentlich beharken. Er flucht wild vor sich hin, dann begreift er, daß es eidgenössische Piloten sein müssen, und haut ab, mit voller Pulle und nach allen Regeln der Kunst. Mit sieben Kanonentreffern, 15 MG-Einschlägen und einem schwerverletzten Funker baut er in Friedrichshafen eine erstklassige Notlandung.
Auch Leutnant Seidel ist mit seiner Kette ganz allein auf sich gestellt. Er muß sehen, wie er blind sein Angriffsziel, den Flughafen Dijon-Longvic, erreicht. Mitunter macht die Waschküche ein Loch auf, kommt ein Dorf in Sicht, Kirche, Häuser, Felder. Aber das ist kein Lichtblick für die Navigation, denn aus großer Höhe gleicht ein Kaff dem anderen.
Der junge Offizier addiert die Uhrzeit. Er ist knapp zwei Stunden unterwegs und erreicht entweder in den nächsten Minuten Dijon oder nie. Er könnte aufgeben, aber man hat ihm bei den Sandkasten-Übungen immer wieder gesagt: Ohne Beherrschung des Luftraums kein Blitzkrieg, deshalb sind in den ersten Stunden die Feindmaschinen schon am Boden zu zerstören.
Da, eine größere Stadt.
Er vergleicht sie mit den Luftaufnahmen, die man ihm vor dem Einsatz gezeigt hatte. Eine ziemliche Ähnlichkeit – und auch eine ziemliche Unähnlichkeit. Aber das ist ja fast immer der Fall: Die Photographien der Luftaufklärung, aus großer Höhe aufgenommen, sind nie so genau. Keine Flak, aber die Franzmänner schlafen ja meistens. Kein Jäger, aber ein Gutes muß diese verdammte Waschküche ja haben.
»Wir sind da!« ruft der Leutnant in sein Bordmikrophon. »Fertigmachen zum Angriff!«
Er ist nicht geradeaus geflogen, sondern einen Kreis. Er ist nicht über Frankreich, sondern über Deutschland.
Und die Stadt unter ihm ist nicht Dijon, sondern Freiburg.
Und das Ziel, das er anspricht, ist kein Flugplatz, sondern ein Kinderspielplatz im Stadtteil Stühlingen, auf dem kurz nach 16 Uhr ganze Scharen übermütiger Kinder herumtollen.
Der Freitag vor Pfingsten wird zum schwarzen Freitag der deutschen Luftwaffe. Die badische Stadt in Deutschlands Freßecke hat sich für die Feiertage schon herausgeputzt. Längst wurden die Motorengeräusche unbekannter Flugzeuge ausgemacht und zur Erleichterung der Luftabwehr richtig als deutsche Maschinen angesprochen. Kein Alarm. Die Menschen sind nicht im Keller, sondern auf der Straße.
In diesem Moment gibt Leutnant Seidel den Befehl, die Todesfracht auszuklinken.
Kurz nach 16 Uhr hängt über Freiburg-Süd ein Gewitter, aber ein ganz anderer Sturm wird über die idyllische Stadt an den Hängen des Schwarzwalds hinwegfegen. Von den Uniformen im Straßenbild abgesehen, herrscht hier im neunten Kriegsmonat noch satter Friede. Die Hausfrauen kaufen für die Pfingstfeiertage ein; es gibt noch beinahe alles in den Geschäften. In den halbdunklen Weinstuben verbrüdert der ›Kaiserstühler‹ Zivilisten und Soldaten. Im Ortsteil Stühlingen tobt sich eine Horde ausgelassener Rangen am Kinderspielplatz aus. Erwachsene lachen oder halten sich die Ohren zu.
Auf einmal starren alle nach oben. Starkes Motorengeräusch. Flugzeuge. Es ist nichts zu sehen. Das Verhängnis fällt aus bewölktem Himmel. Freiburgs Flugwache am Lorettoberg meldet an die Zentrale in Donaueschingen: »Drei He 111 ausgemacht. Anflug aus Richtung Ihringen-Breisach. Höhe 1500 bis 2000 Meter.«
»Verstanden. Ende«, bestätigt Donaueschingen.
Man hat nichts anderes erwartet. Seit einer Stunde ist die Rotte He 111 identifiziert. Es ist zwar merkwürdig, daß sich die Kampfflugzeuge eine deutsche Stadt als Ziel eines Übungsangriffs aussuchen, aber das geht das Flugwachkommando Donaueschingen nichts an. Es hat Kampfstärke und Kurs eingeflogener Feindmaschinen zu beobachten, und heute wurde keine einzige im südwestlichen Luftraum gemeldet.
16 Uhr 11. Die Hes fliegen nicht mehr im Kettenkeil, die linke und die rechte haben sich – es ist die typische Angriffsformation der Kampfflugzeuge – hinter die Führungsmaschine gesetzt.
Ein plötzliches Rauschen frißt jedes Geräusch, verstärkt sich immer mehr. Es hört sich an wie ein Fernzug, der in wilder Fahrt in einen Tunnel hineinbraust.
Die ersten Bomben krepieren am Kinderspielplatz. Die Kleinen hetzen in wilder Panik davon, Richtung Kolmarer Straße, hinein in den Bombenhagel. Sie werden von Volltreffern massakriert, vom Luftdruck an der Häuserwand zerschmettert. Splitter reißen ihnen die Körper auf, zerfetzen die Schlagadern. Passanten werden von fallenden Mauern erschlagen. Als die Sirenen ›Alarm‹ heulen, ist der Spuk, der nicht einmal eine Minute dauerte, vorbei.
Die Angreifer drehen in Richtung Osten ab. Staubwolken hüllen Tote ein. Aus den Rauchschwaden schälen sich Verletzte. Endlich schlucken die Martinshörner der heranjagenden Polizeiautos, Ambulanzen und Bergungstrupps ihre gräßlichen Schreie. Sie werden an Ort und Stelle provisorisch versorgt.
69 Bomben haben 22 Kinder, 13 Frauen und 22 Männer getötet und 20 Kinder, 34 Frauen und 47 Männer schwer verletzt. 22 Bomben waren – Glück im Unglück – Blindgänger, und hier sehen die Feuerwerker auf den ersten Blick, daß sie aus deutscher Produktion stammen. Anhand ihrer Kennzeichnung läßt sich umgehend feststellen, daß sie an den Fliegerhorst Landsberg geliefert wurden.
Dort landet um 17 Uhr 17 – eine Stunde zu früh – Leutnant Seidel, der Führer der Kette, die schuldig-unschuldig eine deutsche 108 000-Einwohner-Stadt bombardiert hat. Es vergehen über siebzig Minuten, bis die anderen He 111 vom Feindflug zurückkehren.
»Wo waren Sie denn bloß, Sie Nachtwächter!« fährt der Gruppenkommandeur seinen Leutnant an.
Es stellt sich schnell heraus. »Leutnant Seidel gab zu«, erklärt sein Kommandeur nach der Vernehmung, »daß der von ihm angegriffene Flugplatz auch der von Freiburg gewesen sein könnte . . . Insbesondere die Zeitberechnung der Rückflugstrecke vom Bombenabwurf an ließen Leutnant Seidel und mich zu der erschütternden Überzeugung kommen, daß Leutnant Seidel nach längerem Herumirren und Suchen die plötzlich vor ihm auftauchende Stadt Freiburg fälschlich als die Stadt Dijon angesprochen hatte. Leutnant Seidel war fassungslos, als ihm diese Tatsache zur Gewißheit wurde.«
Auch Hermann Göring war fassungslos, als bereits in den ersten Abendstunden Beweise auf dem Tisch lagen, daß die Zerstörungen in Freiburg das Werk seiner Luftwaffe waren. Er ordnete eine kriegsgerichtliche Untersuchung an, aber der Propagandaminister Josef Goebbels entwickelte eine ganz andere Idee und setzte sich durch: Das Debakel wurde den Engländern angelastet. Die gleichgeschaltete Propaganda verbreitete Haßtiraden gegen die britischen ›Kindermörder‹ und ›Mordbrenner«, um die Kriegsstimmung gegen England anzuheizen.
»Zur Vergeltung dieses völkerrechtswidrigen Vorgehens wird die deutsche Luftwaffe in derselben Weise antworten«, stand am nächsten Tag als Pflichtartikel in allen deutschen Blättern. »Von jetzt ab wird jeder weitere planmäßige feindliche Bombenangriff auf die deutsche Bevölkerung mit der fünffachen Anzahl deutscher Flugzeuge gegen eine englische oder französische Stadt erwidert werden.«
Die Wochenschau zeigte bis zur Grenze des Erträglichen die Opfer: Kinder, immer wieder Kinder. Die Freiburg-Legende wurde bis Kriegsende aufrechterhalten und immer, wenn es angebracht schien, von neuem aufgewärmt. Die Mitwisser hatten strengstes Stillschweigen zu wahren. Und Leutnant Seidel, der Hauptbeteiligte, ist am 12. August 1940 über Portsmouth abgeschossen worden.
Die britische Propaganda schlug zurück und schoß dabei ihrerseits weit über das Ziel hinaus, als sie behauptete, die Stadt sei von der deutschen Luftwaffe absichtlich bombardiert worden, um eine Begründung für einen schrankenlosen Bombenkrieg gegen die Zivilbevölkerung zu schaffen.
10. Mai 1940. Ein tragischer Zufall bereitete den Luftterror vor. Am gleichen Tag wird der durch das Münchner Abkommen sowie durch seine Nachgiebigkeit gegenüber Hitler schwer belastete Premierminister Chamberlain im britischen Unterhaus gestürzt und an seiner Stelle Winston Churchill zum Regierungschef gewählt.
»Vielleicht wird es sich im nächsten Krieg darum handeln, Frauen und Kinder oder die Zivilbevölkerung überhaupt zu töten«, hatte er bereits 1925 geschrieben. »Und die Siegesgöttin wird sich zuletzt voll Entsetzen dem vermählen, der dies im gewaltigsten Ausmaß zu organisieren versteht.«
Noch waren die kriegführenden Parteien davon weit entfernt. Die Engländer, weil ihnen die deutsche Luftwaffe überlegen war, Hitler, weil er hoffte, nach der Niederwerfung Frankreichs die Briten zu einer Kapitulation bringen zu können. Aber in einem Klima von Haßtiraden und Vergeltungsgeschrei konnten Vernunft und Menschlichkeit jederzeit untergehen. Ein unglücklicher Zufall genügte, um eine Explosion der Barbarei zu zünden.
Er kam prompt. Vier Tage nach Freiburg.
Die Sondermeldungen des deutschen ›Reichsrundfunks‹ feiern einen Vormarsch, wie es ihn in der Kriegsgeschichte noch nie gegeben hat. Panzer durchstürmen das feindliche Gebiet, ohne auf Flankenschutz zu achten, ohne Rücksicht auf Geländebeschaffenheit und auf Nachschubmöglichkeiten. Sie rasseln durch die unwegsamen belgischen Ardennen, erreichen schon am Pfingstsonntagabend die nordfranzösische Stadt Sedan und bereiten den Übergang über die Maas vor.
Wenn die motorisierten Kolonnen auf Widerstand stoßen, den sie nicht niederkämpfen und niederwalzen können, bomben ihnen die Flugzeuge den Weg wieder frei. Am ersten Tag der Offensive im Westen bringt die Luftwaffe eine Armada von 1120 Kampfflugzeugen, 1016 Jägern, 342 Stukas, 248 Zerstörern und 42 Schlachtflugzeugen auf. Sie starten im rollenden Einsatz bis zu neunmal täglich. Zwar sind die englischen und französischen Piloten ihren deutschen Gegnern weder an Mut noch an Können unterlegen, aber ihre Maschinen erweisen sich als hoffnungslos veraltet und purzeln wie Fallobst von dem von deutschen Jagdflugzeugen beherrschten Himmel. Die Me 109 ist mit ihrem 1100 PS starken Daimler-Benz-Motor (Benzineinspritzung) 570 km/h schnell, hat eine Reichweite von 660 km und kann 10 500 Meter hoch steigen, 945 Meter pro Minute.
Unter den Augen einer entsetzten, genarrten und auch bewundernden Welt tobt ein Krieg zwischen Horror und Bravour. Als sich die Holländer und Belgier nach der völkerrechtswidrigen Überrumpelung Schlaf und Bestürzung aus den Augen wischen, sind deutsche Fallschirmjäger schon mitten unter ihnen; sie setzen sich innerhalb des Verteidigungssystems fest wie Läuse im Pelz. Es sind aufgelegte und oft auch auffliegende Himmelfahrtskommandos; die Zahl ihrer Überlebenden läßt sich meistens an den Fingern abzählen. Zwei Drittel der sie absetzenden Transportflugzeuge des Typs Ju 52 werden in Holland abgeschossen oder gehen zu Bruch. Das Geschwader KG z. b. V. 2 verliert beim Landeversuch auf einem Flughafen bei Den Haag fast 90 Prozent seiner Maschinen – aber Verluste hat die Propaganda nicht zu vermelden.
Der Blitzkrieg ist bar mit Blut zu bezahlen, aber ». . . Gegenüber diesem neuen Konzept der Kriegführung schmolzen die Armeen Belgiens, Frankreichs und der britischen Expeditionsstreitkräfte dahin wie Schnee in der Sonne«, schreibt in seinem Buch ›The Stuka at war‹ der britische Autor Peter C. Smith: »Mit den ersten Schlägen vernichteten die deutschen Kampfflugzeuge die Masse der alliierten Luftstreitkräfte, die auf den Flugplätzen bereitstanden . . .
48 Stunden nach den ersten Bombenangriffen gegen holländische, belgische und französische Flugplätze waren die alliierten Truppenbefehlshaber nicht mehr Herren der Lage. Der dann folgende fluchtartige Rückzug war katastrophal . . .«
Das kleine Holland verfügt über elf Divisionen, die sich erbittert und tapfer schlagen, aber von vornherein keine Chance gegen die deutsche Übermacht haben. Die Verteidiger sprengen die Deiche, um Überschwemmungen auszulösen; sie sollen die Angreifer so lange aufhalten, bis den Niederländern Engländer und Franzosen zur Hilfe kommen. Aber alle Notrufe bleiben ohne Antwort, und die Überflutung tritt erst nach vier Tagen ein.
Deutsche Panzer stehen am 13. Mai vor Rotterdam. Das holländische Öl- und Margarinezentrum mit dem Welthafen ist keine offene Stadt, es wird von den Truppen des Obersten Scharroo energisch verteidigt. Am Morgen des 14. Mai fordert Generalleutnant Ludwig Schmidt, Kommandierender General des XXXIX. Panzerkorps, Scharroo in einem Ultimatum zur Übergabe auf, da er sonst mit allen nötigen Mitteln den Widerstand brechen müsse: »Dies kann die völlige Vernichtung der Stadt nach sich ziehen«, schreibt der General. »Ich ersuche Sie als Mann von Verantwortungsgefühl, darauf hinzuwirken, daß diese schwere Schädigung der Stadt unterbleiben kann.«
Die Drohung ist kein Bluff, wie Oberst Scharroo zunächst annimmt. Rotterdam hält den deutschen Vormarsch auf. Fällt die Stadt, wird Holland kapitulieren. In diesem Fall hätten die Angreifer auch ihre Fallschirmjäger herausgepaukt, die nach einem Einsatz von fünf Tagen und vier Nächten am Ende sind.
Oberst Scharroo versucht Zeit zu gewinnen, wie jeder tüchtige Militär in seiner Lage. Er pokert, aber sein Einsatz ist zu hoch, denn 600000 Zivilisten sind in der umkämpften Stadt. Um 10 Uhr 40 werden zwei deutsche Offiziere ins holländische Hauptquartier entsandt. Die Niederländer führen sie mit verbundenen Augen durch Rotterdam. Aber erst um 12 Uhr 10 stehen sie Oberst Scharroo gegenüber. Er sichert zu, um 14 Uhr einen Parlamentär zu schicken.
General Schmidt sendet einen Funkspruch an die Luftflotte 2: »Angriff wegen Verhandlungen verschoben.«
Der Funker fummelt an seinem Gerät herum. Wellensalat, er kommt nicht durch.
13 Uhr 30. Das Kampfgeschwader 54 startet in Delmenhorst, Quakenbrück und Hoya-Weser zum Angriff. 100 He 111 heben sich in die Luft. Angriffszeit: 15 Uhr. Angriffsziel: Ein Dreieck nördlich der über die Maas führenden Willem-Brücke in Rotterdam. Ein Verbindungsoffizier hatte es am Vorabend an Ort und Stelle mit dem XXXIX. Panzerkorps abgesprochen.
14 Uhr 15. Endlich kommt die Meldung mit der Angriffsverschiebung durch. Aber der Befehl aus dem Äther, Rotterdam zu schonen und das abgesprochene Ausweichziel anzugreifen, erreicht die in zwei Formationen fliegenden Kampfflugzeuge nicht mehr. Sie haben – typische Angriffsvorbereitungen – ihre Schleppantennen bereits eingezogen.
Der Generalstabschef der Luftflotte 2, Oberstleutnant Rieckhoff, springt in eine Me 109 und jagt hinter dem Geschwader her. Er kann die Zeit nicht überrunden, das furchtbare Schicksal der Stadt nicht abwenden.
14 Uhr 45. Die Stimmung in den deutschen Gefechtsständen ist gespannt und gereizt. Noch immer keine Bestätigung, daß das Geschwader KG 54 umgeleitet worden ist. Der Himmel ist unbewölkt, aber über Rotterdam schwebt eine Dunstglocke, dunkler Qualm steigt auf.
Motoren dröhnen. Geschwaderkommodore Oberst Lackner erreicht mit 54 He 111 in Angriffsformation Rotterdam.
Die Generale Schmidt und Student springen aus ihrem Gefechtsstand auf die Stieltjes Straat, schießen persönlich mit ihren Leuchtpistolen rote Signale ab, die der Dunst verschluckt.
Aus den Schächten der Hes rauscht der Tod ins Ziel. Die Sprengbomben zünden Brände. Ölvorräte mästen das Feuer. Es frißt sich durch die Fachwerkbauten der Altstadt, durch ganz Rotterdam.
Die zweite Welle: 46 Hes, geführt von Oberstleutnant Höhne. Der Offizier gibt den Angriffsbefehl. Die Automatik des Abwurfs rollt ab.
In diesem Moment sieht er eine rote Leuchtkugel. Während aus der Führungsmaschine und den beiden Rotten-Hes die Bomben nach unten fallen, gibt Höhne den nachfolgenden Flugzeugen des Verbands den Befehl zum Abdrehen. »Ich habe«, so berichtet er danach, »später keinen den Begleitumständen nach so dramatischen Angriff mehr geflogen.«
43 Bomber fliegen ein Ausweichziel an. Aber die 97 Tonnen Sprengbomben, die auf Rotterdam fallen, haben in der dichtbesiedelten Stadt grauenhafte Folgen. Auf den Straßen, in den Kellern, in provisorischen Unterständen werden Frauen und Kinder erschlagen. Die Feuerwehr, mit veralteten Handpumpen ausgerüstet, muß zusehen, wie die Stadt niederbrennt, insgesamt 11 000 Gebäude mit 25 000 Wohnungen. 80 000 Menschen werden obdachlos.
General Schmidt entschuldigt sich persönlich beim Oberbürgermeister und bei Oberst Scharroo für einen Angriff, den er nicht gewollt hatte, aber auch nicht mehr verhindern konnte. Eine faire Geste, die freilich die mehr als 900 toten Zivilisten auch nicht wieder lebendig machen kann.
Rotterdam: Eine Kette unglücklicher Zufälle wird zu einem Alarmsignal der Unmenschlichkeit. Die alliierte Propaganda macht aus einem unaufhaltsamen – allenfalls fahrlässig ausgelösten – Verhängnis einen vorsätzlichen Terrorakt, erhöht die Zahl der Todesopfer auf 30 000, übertreibt ein Grauen maßlos, das keiner Steigerung bedurfte.
»Im Anschluß an den verheerenden deutschen Bombenangriff auf Rotterdam hob der neue britische Premierminister Winston Churchill am 15. Mai die Sperre gegen zivile Ziele in Deutschland auf«, schreibt in seinem Buch ›Battle over the Reich‹ der englische Autor Alfred Price: »Noch in der gleichen Nacht griff ein Verband von 99 Bombern Öl- und Eisenbahnziele im Ruhrgebiet an. Die strategische Bomberoffensive gegen Deutschland hatte damit ernsthaft begonnen.«
Die ersten Angriffe auf das Ruhrgebiet richten mehr Verwirrung als Schaden an. Die Navigation liegt noch im argen, nach eigener Beobachtung der Royal Air Force fallen bei Nachtangriffen die Bomben meistens bis zu drei Kilometer neben das Ziel, und das heißt, daß sie je nach Zufall ins leere Gelände knallen oder in dichtbesiedelte Wohnblocks. Zum ersten Mal erscheint in den deutschen Wehrmachtsberichten die stereotype Formel: ›Die Zivilbevölkerung hatte Verluste.‹ Noch ahnt niemand, daß sie bei Kriegsende über eine halbe Million Menschenleben betragen werden.
Schon wenige Tage nach Rotterdam läßt Churchill von seiner Kraftmeierei über dem Kohlenpott wieder ab: An der Frankreichfront brennt’s, und er braucht jetzt jede verfügbare Maschine, um sein Expeditionskorps zu retten.