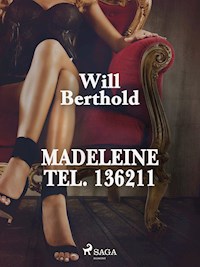Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Johann Reichhart war von 1924 bis 1946 Henker, der letzte eines Geschlechts, das dreihundert Jahre lang in Bayern den Scharfrichter gestellt hatte. 150 Goldmark erhielt er pro Hinrichtung. Er setzte unter anderem durch, dass die schwarze Augenbinde abgeschafft wurde, was die Vollstreckungszeit auf drei bis vier Sekunden verkürzte. Während Reichhart während seiner Dienstzeit dafür bekannt war, sich um einen möglichst "humanen" Hinrichtungsablauf zu bemühen, so galt er dennoch nach dem Zusammenbruch des Nazi-Regimes als "Hauptbeschuldigter", so stufte ihn zumindest die Spruchkammer ein. Er hatte die Urteile vollstreckt, die Richter hatten sie lediglich gesprochen. Und während sich Reichhart auf seine Verteidigung vorbereitete, holten ihn die Amerikaner nach Nürnberg und Landsberg zu weiteren Exekutionen – diesmal an Nationalsozialisten und Kriegsverbrechern.Will Berthold (1924–2000) war einer der kommerziell erfolgreichsten deutschen Schriftsteller und Sachbuchautoren der Nachkriegszeit. Seine über 50 Romane und Sachbücher wurden in 14 Sprachen übersetzt und erreichten eine Gesamtauflage von über 20 Millionen. Berthold wuchs in Bamberg auf und wurde mit 18 Jahren Soldat. 1945 kam er vorübergehend in Kriegsgefangenschaft. Von 1945 bis 1951 war er Volontär und Redakteur der "Süddeutschen Zeitung", u. a. berichtete er über die Nürnberger Prozesse. Nachdem er einige Fortsetzungsromane in Zeitschriften veröffentlicht hatte, wurde er freier Schriftsteller und schrieb sogenannte "Tatsachenromane" und populärwissenschaftliche Sachbücher. Bevorzugt behandelte er in seinen Werken die Zeit des Nationalsozialismus und den Zweiten Weltkrieg sowie Themen aus den Bereichen Kriminalität und Spionage.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 474
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Will Berthold
Vollstreckt
Johann Reichart, der letzte deutsche Henker
SAGA Egmont
Vollstreckt - Johann Reichart, der letzte deutsche Henker
Vollstreckt Johann Reichart, der letzte deutsche Henker
Copyright © 2017 by Will Berthold Nachlass
represented by AVA international GmbH, Germany (www.ava-international.de)
Originally published 1984 by Goldmann Verlag, Germany
Copyright © 1982, 2017 Will Berthold Lindhardt og Ringhof Forlag A/S
All rights reserved
ISBN: 9788711727324
1. Ebook-Auflage, 2017
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt og Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk – a part of Egmont www.egmont.com
Vorwort
Das erste Mal sah ich ihn im Vorfrühling des Jahres 1958, auf Wunsch eines Verlegers, der die Erinnerungen des Johann Reichhart für ein exemplarisches Zeitdokument hielt. Ich hatte mich lange dagegen gewehrt, mit einem Mann zusammenzutreffen, der über dreitausend Menschen mittels Fallbeil und Strick »legal« vom Leben zum Tode brachte, obwohl ich als früherer Polizeireporter der größten Zeitung Süddeutschlands gegen makabre Begegnungen abgehärtet war.
Das Grundgesetz hatte die blutige Höchststrafe abgeschafft. Diese humanitäre Tat stand einem Land besonders gut an, in dem zwölf Jahre lang der Justizmord als Staatsdoktrin betrieben worden war. Unsere betont liberale Verfassung konnte zwar das Fallbeil einmotten, nicht jedoch den Mord ausschließen. Es hatten sich in der Tat einige grausame Fälle, besonders an Taxifahrern, gehäuft, und Politiker, selbst Minister, witterten Morgenluft und gingen auf Stimmenfang durch Blutrunst.
Sachlicher war die Diskussion zwischen Strafrechtlern: Die einen bewiesen, daß die Todesstrafe keine abschreckende Wirkung habe, die anderen konnten unwiderlegt auf eine Reihe von Triebverbrechen hinweisen, die sich nicht ereignet haben würden, wenn man die Täter gleich nach ihrem ersten Verbrechen mit dem Fallbeil aus der Welt geschafft hätte.
In dieser Situation schien es mir angebracht, mit einem Mann zusammenzukommen, der das legale Töten als Beruf erlernt hatte. Wie würde er zu seinem schauerlichen Lebenswerk stehen? Plagten ihn Gewissensbisse? Oder war er so abgestumpft, daß er auch heute noch die Ungeheuerlichkeit nicht spürte, deren technischer Handlanger er im Staatsauftrag gewesen war?
Ich ging also, mit gemischten Gefühlen zwar, zu dem für mich arrangierten Rendezvous mit dem Henker. Ich ließ mich, da mir nicht wohl dabei war, von einem befreundeten Journalisten begleiten. Wir waren in einem Speiserestaurant in Münchens Lucille-Grahn-Straße verabredet, zu einem Vorgespräch und Mittagessen.
Reichhart kam auf die Minute pünktlich, ein mittelgroßer, hagerer Mann mit schütteren Haaren und hellen Augen. Ein Gesicht von der Stange, zerklüftet und runzelig, das Gesicht eines Mannes, der im Leben viel mitgemacht haben mußte. Er stellte sich halblaut vor, er hatte einen kräftigen Händedruck und ein verlegen-mißtrauisches Lächeln, das, sowie er Zutrauen gefaßt hatte, einer treuherzig-pfiffigen Miene wich.
Er sprach schnell, leicht polternd, im oberbayerischen Dialekt. Vom Typ her glich Reichhart einem ländlichen Handwerker, der in der benachbarten Stadt Arbeit und Auskommen findet. Mit fünfundsechzig hatte er soeben das Pensionsalter erreicht, dreizehn Jahre nachdem bei Nacht und Nebel seine, wie es im Amtsdeutsch hieß, »Fallschwertmaschine« in der Donau versenkt worden war. Zuvor hatte sich Reichhart mit seiner auf einem Lastwagen montierten, zerlegbaren Guillotine in einem späten Schneesturm des Frühjahrs 45 verfahren – was einigen Verurteilten im letzten Moment das Leben rettete.
Von allen Männern aus dem Strandgut des Dritten Reiches, die ich kennengelernt hatte – keineswegs wenigen –, war Johann Reichhart, wie sich schon bei unserer ersten Begegnung zeigte, nicht der Schuldigste, wohl aber der Ärmste; er schlug sich in dieser Zeit schlecht und recht durch, mit Haarwasser, Heiligenbildern und Hunden handelnd, die er in Deisenhofen, an Münchens östlichem Stadtrand, züchtete.
In seiner Umgebung war er bekannt und – meistens – gemieden. Wenn er sich in einem Wirtshaus an einen Tisch setzte, mußte er damit rechnen, daß die Gäste aufstanden und sich einen anderen Platz suchten. Ebenso kam es natürlich auch vor, daß sich Leute um ihn drängten, um sich Schauer des Gruselns zu holen. Sie saßen um Reichhart herum wie Zaungäste, die an eine Unfallstelle drängen.
Selbst während Johann Reichhart die Speisekarte las, redete er pausenlos. Unangegriffen verteidigte er sich fortgesetzt, unschwer waren aus seinen Wortsuaden die Selbstvorwürfe herauszuhören. Ich hatte vor der Begegnung gelesen, was in den Zeitungsarchiven über den »Scharfrichter des Dritten Reiches« und sein Fach geschrieben worden war. Daß die meisten Meldungen Eintagsfliegen der Sensation waren, wußte ich schon, bevor ich ein Wort mit dem Fünfundsechzigjährigen gewechselt hatte. Da hieß es, der Mann, der nicht durch freie Wahl, sondern aus Gründen der Tradition – die Reichharts waren seit dreihundert Jahren Henker in Bayern – seinen Beruf gewählt hatte, sei heute ein entschiedener Gegner der Todesstrafe. Ein anderes Boulevardblatt brachte die Nachricht, Reichhart sei einer rechtsradikalen Partei beigetreten, weil sie für die Wiedereinführung der Todesstrafe eintrete. Eine Zeitungsente widerlegte die andere.
Er trug einen dunklen Anzug, der viel zu feierlich war für den Tag und für die Stunde; offensichtlich sein gutes Stück, wie es die Bauern anziehen, wenn sie zu ihren feinen Verwandten in die Stadt fahren. Die Sonntagsmontur war gepflegt und doch abgetragen. Auf einmal hatte ich die Zwangsvorstellung, daß Reichhart sie auch bei seinen Amtshandlungen getragen haben könnte.
Ich fragte ihn danach.
»Eigentlich waren Gehrock und Zylinder als meine Amtstracht vorgeschrieben«, antwortete er. »Zumindest in den ersten zehn oder zwölf Jahren meiner Tätigkeit. Später aber genügte der dunkle Anzug.« Er deutete auf sich: »Ich hab’ nur diesen einen.«
Ich sah auf seine Hände. Sie waren derb und knochig, unsensibel, zupackende Hände, die Hände eines Mannes, der zeitlebens viel gearbeitet hatte. Ich mußte an Schillers Worte denken, die er in »Wallensteins Tod« Gordon in den Mund legt: »Zu Henkers Dienst drängt sich kein edler Mann.« Gut eineinhalb Jahrhunderte später kam der Psychologe Edmund Metzger zu der Aussage: »Das Töten als Beruf und gegen Entgelt widerspricht grundsätzlich unserer Vorstellung von der Würde des Menschen.«
Das Gespräch brach ab. Ich starrte wieder auf die Hände. Ich roch jetzt nicht mehr den leichten Geruch von Mottenpulver, der vom Anzug meines Tischnachbarn ausging, ich hatte auf einmal den widerlich-süßlichen Geschmack des Blutes im Mund, und ich fragte mich, bei wie vielen Gelegenheiten der Mann mit dem geröteten Gesicht seinen Sonntagsanzug getragen haben mochte. Tausendmal? Doppelt so oft? Oder noch öfter? Abgesehen von einigen hohen Festtagen wie Weihnachten, Ostern und Pfingsten hatte wohl jeweils mindestens ein Mensch sterben müssen, wenn Reichhart das sorgfältig verwahrte Kleidungsstück aus dem Schrank genommen hatte.
Es war zu viel für meine Magennerven.
Ich stand auf, hastete hinaus, kam gerade noch, bevor ich mich übergeben mußte, bis zur Toilette. Ich ging zurück, entschuldigte mich und gab der Kellnerin einen Wink, mein Essen abzutragen.
»Hat’s nicht geschmeckt?« fragte sie.
»Doch«, behauptete ich und orderte einen Magenbitter.
Als der Schnaps serviert wurde, demonstrierte Reichhart gerade mit dem Zeigefinger am Nacken meines Begleiters, naiv, mit dem Berufsstolz des Fachidioten, wie man einen Menschen aufhängen muß, damit er »fast nicht leidet«.
»Das können Sie mir glauben«, sagte der Nachrichter, »Sie spüren nichts. Außerdem geht es so schnell, daß Sie überhaupt nichts merken.«
»Nicht wahr, Sie würden uns beide also auch ziemlich schmerzfrei hängen?« fragte mein Begleiter.
Reichhart überhörte die Ironie. »Darauf können Sie sich verlassen«, versicherte er ernsthaft; es fehlte nur noch, daß er hinzugefügt hätte, daß wir bei ihm in guten Händen seien.
Was er über das »humane Hängen« sagte, war mir bekannt, er spielte wohl auf die »Wiener Schule« des Scharfrichters Josef Lang an, des einzigen Henkers, der – vom Volksmund »Hauptmann Pepi« genannt – zu einiger Beliebtheit gekommen und deshalb sogar zum Staatsbeamten aufgerückt war. Man rühmte »sein weiches Herz«. Lang hätte – wie sein Biograph Oskar Schalk feststellte – »keinem Tier etwas zuleide tun können, und mancher Kutscher hat sich böse Händel mit ihm eingewirtschaftet, wenn er seine Pferde mißhandelte … ein durch und durch human denkender und empfindender Mensch … ein gemütlicher Spezi … ein närrischer Kinderfreund und überhaupt ein grübiger Wiener vom Grund«.
Solcherlei Qualifizierung war eine absolute Ausnahme. Der Henker, eine Erscheinung aus atavistischer Zeit, war bei allen Völkern und in allen Epochen mehr geächtet als geachtet. Die »Bambergische Halsgerichtsordnung« aus dem Jahre 1507 unterstellt dem Scharfrichter »eine böse, unordentliche Begierde in Vergießung des Menschen Blut«. In unserer Gegenwart stellt der Strafrechtler Eberhart Schmidt, als Sachverständiger vom Bonner Bundestag gehört, fest: »Es hat noch keinen Henker gegeben, und es wird auch nie einen Henker geben, der die Todesstrafe um des reinen, rechtlichen Solls willen vollzieht. Der Henker tötet und verurteilt, wie man Vieh schlachtet.«
»Du sollst nicht töten«, heißt es in der Bibel, aber der Mensch hat zu allen Zeiten das göttliche Gebot mit den Füßen getreten. Die weltliche und geistliche Obrigkeit tötete nicht nur, sie tat es auch besonders grausam. Die Vollstreckungen fanden öffentlich statt. Es waren »Galgenfeste«, bei denen die Damen der höheren Stände in Ohnmacht fielen und ihre Galane sich häufig beschwerten, daß zu wenig und zu schnell hingerichtet worden sei. Typisch für die Roheit, die eine ohnedies unmenschliche Prozedur noch abstoßender machte, war zum Beispiel die Hinrichtung des fränkischen Ritters Wilhelm von Grumbach, der mit seinen Anhängern am 18. April 1567 von sechs Scharfrichtern in Gotha »justifiziert« wurde. Der schwerkranke Delinquent konnte nicht auf eigenen Beinen gehen; er wurde von acht Stockknechten zur Richtstätte getragen. Dort legte man ihn nieder, fesselte ihn und schnitt ihm das Herz aus dem Leib. Der Richter schlug es ihm mit den Worten: »Sieh, Grumbach, dein falsches Herz« um den Mund, dann wurde der Körper in Stükke gerissen. Die anderen Delinquenten, die der Prozedur zusehen mußten, wurden anschließend gevierteilt, enthauptet oder gehängt. Die Massenexekution vor vollbesetzten Rängen zog sich über zwei Stunden hin. Wie der Chronist berichtet, wohnten »ein’ grausam große Welt Volkes von Fürsten, Grafen, Edelleuten, Kriegsvolk, Bürgern und Bauern dem Schauspiel bei«.
»Fasching des Tötens« nennt der Strafrechtspsychologe Hans von Hentig diese Exzesse des Sadismus, bei denen durch Folter überführte Menschen aufs Rad gespannt, von Pferden in Stücke gerissen, zu Tode geschleift, mit der Garotte, dem spanischen Würgeeisen, erstickt oder auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurden.
Es waren nicht nur Auswüchse des Mittelalters; Verrohung und Geschmacklosigkeit zeigten sich bis weit in die Neuzeit hinein. »Der Schrecken des Galgens und des Verbrechens trat vor meinen Sinnen in den Hintergrund vor den Scheußlichkeiten, die ich sah, vor dieser Haltung, diesen Blicken, dieser Sprache der zusammengedrängten Zuschauer«, beschrieb der englische Dichter Charles Dickens als Augenzeuge eine öffentliche Hinrichtung in London vom 13. November 1849. »Als ich um Mitternacht ankam, ließ schon das schrille Geschrei und Geheul von Knaben und Mädchen, die die besten Plätze einnahmen, mein Blut stocken. Mit dem Fortgang der Nacht wuchsen Geheul, Kreischen und Gelächter. Man parodierte bekannte Negermelodien … Als der Tag graute, streiften mit aufreizender Frechheit bekannte Diebe, Dirnen übelster Art, Raufbolde, Säufer und Strolche jeden Kalibers umher. Prügeleien, Ohnmachten, Pfeifen, Imitationen aus dem ›Punch‹, rohe Späße, laszives Aufkreischen mit obszönen Gesten, wenn ohnmächtige Frauen von der Polizei fortgetragen wurden und ihre Kleider dabei in Unordnung gerieten, unterbrachen zum Jux die allgemeine Unterhaltung. Als die Sonne in aller Pracht aufstieg – und das tat sie –, vergoldete sie Tausende und Abertausende aufwärts gewandter Gesichter, die so unaussprechlich viehisch und blutdürstig nach oben starrten, daß der Mensch sich vor seiner eigenen Erscheinung schämen mußte …«
Noch 1868 fand in Wien ein Galgenfest statt, bei dem nach dem Bericht eines Zeitgenossen gezecht, gejubelt, gesungen und von Verkäufern »Arme-Sünder-Würstel« und »Galgenbier« angeboten wurden. Österreich hat von da an – wie die meisten europäischen Länder – öffentliche Hinrichtungen verboten, aber vor dem Gefängnis in Versailles fand noch im Jahre 1939 eine öffentliche Exekution mit der Guillotine statt.
Im Mittelalter wie in der Neuzeit war diesen widerlichen Schaustellungen die Ernüchterung gefolgt und mit ihr wenigstens eine Ahnung von Schuld, denn damals wie heute wußte man, wie erbärmlich es war, den Todeskampf mit Massenwollust zu feiern. Es widersprach allem, was der Gläubige in der Kirche von der Kanzel hörte; es widersprach jeder Moral, jeder Sittlichkeit, vom Geschmack nicht zu reden. Der Voyeurorgie folgte der Katzenjammer. Das schlechte Gewissen schrie nach Kompensation. Man brauchte einen Sündenbock und man hatte einen parat: den Henker.
»Er hatte ein hohes Amt, er galt als unentbehrlich, aber seine Mitmenschen haben ihm seine Dienste übel gelohnt«, schreibt in seinem erschütternden Buch »Todesstrafen« Kurt Rossa. »Sein Weg durch die Geschichte ist eine via dolorosa ohne Beispiel. Überall hat man den Henker ärger als den schändlichsten Verbrecher geschurigelt und schikaniert. Er mußte sich besonders auffällig kleiden oder ein Abzeichen tragen, der römische ›carnifex‹ hatte wie ein Aussätziger kleine Glöckchen bei sich zu führen. Das Haus des Henkers stand in Griechenland, in Rom, im alten Frankreich und im mittelalterlichen Deutschland außerhalb der Städte, es wurde zuzeiten sogar grell angestrichen, damit kein Fremder es versehentlich beträte. Immer hatte er sich fernzuhalten von den Ehrbaren, er hatte einen besonderen Platz in der Wirtsstube, sofern ihm das Betreten eines Wirtshauses überhaupt gestattet war.
Auch als Christenmensch war er nur ein Wesen zweiter Klasse. In der Kirche hatte er, getrennt von den übrigen, seinen eigenen Stuhl, ihm wurde mancherorts die kirchliche Trauung und selbst das Abendmahl verweigert. Der Scharfrichter zu Worms brauchte 1517 eine päpstliche Erlaubnis, um jährlich zweimal das Abendmahl feiern zu dürfen, allerdings nicht in Gemeinschaft mit der Gemeinde.
Seine Unehrlichkeit war ansteckend wie eine Krankheit. Sein Weib und seine Kinder waren verachtet wie er, seine Töchter und Söhne mußten wieder in Scharfrichterfamilien einheiraten. Wer das Richtschwert, den Henkerskarren, den Galgen oder des Henkers Eigentum berührte, wurde ›infam‹ und mußte sich Reinigungsriten unterwerfen. Nicht einmal sein Vieh durfte bei den Tieren der anderen weiden. Die Selbstmörderecke des Friedhofs war seine Ruhestätte.«
Die herkömmliche Verachtung hat sich erhalten, und gerade die Zeitgenossen, die am lautesten nach der Todesstrafe schrien, distanzierten sich am deutlichsten von ihrem Vollstrecker. Johann Reichhart ist zu seinen Lebzeiten niemals zur Ruhe gekommen. Schon 1945 im Interniertenlager bei Garmisch-Partenkirchen rückten die gleich ihm inhaftierten Richter der Urteile, die er vollzogen hatte, von ihm ab; die vorübergehend entkleideten Robenträger fanden es unzumutbar, mit ihrem Handlanger im gleichen Lager verwahrt zu werden, mit einem primitiven Erfüllungsgehilfen, der die Blutjustiz des Dritten Reiches geradezu symbolisierte.
Die Logik war schlicht und schlecht: Nicht sie, die Richter, trugen Schuld daran, daß politische Gegner des Regimes, daß harmlose Witzeerzähler, Bibelforscher, Schwarzhörer, Schwarzschlächter und Schwarzhändler, daß arme Wichte und auch kleine Strolche unter das Fallbeil kamen, sondern ihr weisungsgebundener Handlanger, der rechtskräftige Urteile der »ordentlichen« Strafjustiz vollzogen hatte und dabei auf eine horrende Delinquentenzahl gekommen war. Freilich erreichte sie in zwölf Jahren noch nicht einmal die Mordproduktion eines einzigen Auschwitz-Tags – doch bei den Todesmühlen handelte es sich in den Augen der Richter um »unordentliche« Gerichtsbarkeit, gegen die sie machtlos waren, damals wie heute.
Die Feme und Häme seiner Auftraggeber hetzte Johann Reichhart in einen Selbstmordversuch; er schnitt sich die Pulsadern auf, wurde kurz vor dem Verbluten gefunden und gerettet. Kaum genesen, holten ihn die Amerikaner aus seinem Stacheldrahtgetto, ohne ihm zunächst zu sagen, worum es ging. Er sollte – nunmehr für die Sieger – das erledigen, wofür er von der Spruchkammer in Garmisch als »Hauptschuldiger« eingestuft werden sollte: In Nürnberg arbeitete Reichhart den Armeehenker für die Hinrichtung der Hauptkriegsverbrecher ein; in Landshut war er an Exekutionen beteiligt. Freilich waren die Todeskandidaten diesmal keine Politischen und auch keine Kriminellen, sondern KZ-Aufseher, Kommandeure von Einsatzkommandos und auch Verurteilte, die abgeschossene US-Piloten gelyncht hatten. Sowie Reichhart die Exekutionen hinter sich gebracht hatte, wurde er wieder von GIs in das Interniertenlager zurückgeschafft, um sich für das zu verteidigen, was er eben erneut hatte besorgen müssen.
Die Freiheit, die Reichhart schließlich – eingestuft als einfacher Mitläufer der Nazipartei – erlangte, wurde für ihn zu einem permanenten Spießrutenlauf; in einem freilich blutigen Statisten manifestierte sich das Schuldbewußtsein vieler Zeitgenossen. Häufig wurde der Einsame von Deisenhofen mit Zurufen wie: »Rübe ab!« traktiert. Der Hundezüchterverein, dessen Mitglied Reichhart war, um für seine Schnauzer und Pinscher einen Stammbaumnachweis zu erhalten, wollte ihn ausschließen. Während in der Öffentlichkeit immer lauter und dringender die Wiedereinführung der durch das Grundgesetz abgeschafften Todesstrafe verlangt wurde – bei gleichzeitiger Forderung nach Einstellung aller schwebenden Prozesse gegen NS-Täter –, während sich ein Abgeordneter des Deutschen Bundestags bereit erklärte, das Todesurteil notfalls auch selbst zu vollziehen, und ein anderer Volksvertreter, Mitglied der Regierungspartei – er hatte die Wiederinbetriebnahme des Fallbeils so leidenschaftlich gefordert, daß es ihm den Spitznamen »Kopfab-Jäger« eintrug –, vorübergehend sogar zum Bundesjustizminister avancierte, bezeichneten es Briefeschreiber an Münchener Zeitungen immer wieder als Skandal, daß Johann Reichhart, ein »Mann mit so viel Blut an den Händen«, frei herumlaufe. Nicht der Richter war in ihren Augen schuld, sondern der Henker – von allen Errungenschaften des Dritten Reiches schien sich das »gesunde Volksempfinden« am längsten erhalten zu haben.
Johann Reichhart war nicht der einzige Henker des Dritten Reiches, aber neben dem vorwiegend in Plötzensee auftretenden Pferdemetzger Röttger der bekannteste. 3165mal wurde er in die Todeszelle gerufen. Wenn er eintrat, trug der Tod im Morgengrauen sein Gesicht. 3165 Menschen, die meisten Männer, hatte dieser Scharfrichter in mehr als fünfundzwanzig Berufsjahren in nicht mehr überbietbarer Geschwindigkeit vom Leben zum Tode befördert, unter ihnen abgefeimte Mörder und gänzlich Unschuldige, kleine Bauern, die ein »Schwein mit zwei Schwänzen« geschlachtet, Postbedienstete, die aus einem Feldpostpäckchen ein paar Zigaretten entwendet, Nachbarn, die aufgefischte Feindnachrichten verbreitet hatten, Bagatellsünder, auch Schwerverbrecher, meistens aber Politische wie zum Beispiel die Geschwister Scholl, Hans Leipelt, Christoph Probst, Alexander Schmorell und Professor Huber, alle Mitglieder der idealistischen, doch harmlosen Widerstabsgruppe »Weiße Rose«.
Er kam, bereitete die Exekution vor, verkürzte den Hinrichtungsvorgang von üblicherweise zwanzig auf vier Sekunden, er fragte nicht, er zweifelte nicht, er sträubte sich nicht – sein Gewissen war die Stoppuhr. Freilich hatte Reichhart einige Male um seine Ablösung gebeten, aber der Staat verweigerte sie ihm mit der womöglich gar nicht so abwegigen Begründung, daß seine Arbeit »kriegswichtig« sei.
Er erhielt dafür pro Exekution 50 Reichsmark Entgelt; davon mußte er den Lohn für seine beiden Knechte und auch ihre »Auslösung« bezahlen. Steuerlich gesehen war der Henker ein selbständiger Gewerbetreibender mit einem vom Staat vorgeschriebenen Umsatz.
Die zahlreichen Sondergerichte und der Volksgerichtshof hielten ihn nicht klein. In einem Jahrzwölft Nazizeit wurden über 16 500 Todesurteile gefällt, von Militärgerichten weitere 24 559 allein bis zum 31. Dezember 1944, wo die statistischen Aufzeichnungen abbrachen. Die meisten dieser Urteile sind vollstreckt worden. Keiner der furchtbaren Juristen, die sie verhängt hatten, wurde dafür jemals strafrechtlich durch gültiges Urteil zur Rechenschaft gezogen, nicht ein Richter der sogenannten ordentlichen Justiz. Ein vormaliger Marinerichter brachte es sogar zum Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg und verteidigte sich nach Bekanntwerden eines bei Kriegsende vollzogenen Todesurteils mit den unfaßbaren Worten: »Was damals rechtens war, kann heute nicht Unrecht sein.«
Rechtens war zum Beispiel das Urteil gegen den zweiundfünfzigjährigen Regierungsrat Dr. jur. Theodor Korselt aus Rostock, der in der Straßenbahn kurz nach dem Abfall Italiens bemerkt hatte: So weit müsse es in Deutschland auch kommen, und der Führer habe zurückzutreten, weil »wir nicht mehr siegen können und nicht alle bei lebendigem Leibe verbrennen wollen«.
»Als Mann in führender Stellung und mit besonderer Verantwortung hat er dadurch den Treueid gebrochen«, heißt es im Urteil vom 23. August 1943, »unsere nationalsozialistische Bereitschaft zu mannhafter Wehr beeinträchtigt und unserem Kriegsfeind geholfen. Er hat damit seine Ehre für immer eingebüßt und wird mit dem Tode bestraft.«
Die Witwe des damals »rechtens« Verurteilten hatte, wie in seinem Buch »Die Sippe der Krähen« der Autor Michael Anders mitteilt, 746,60 Reichsmark Gerichtskosten zu entrichten, davon 300 Reichsmark für die Todesstrafe und 158, 18 für die Vollstreckung des Urteils; in diesen Kosten war das Entgelt für den Henker inbegriffen.
Die Höhe seiner Entschädigung wurde in den Ländern verschieden gehandhabt; der Berliner Scharfrichter zum Beispiel erhielt zu einem Jahresfixum von 3000 Reichsmark nur 30 Reichsmark Kopfprämie und hatte ebenfalls seine Helfer davon zu bezahlen. Sein Assistent Kleine wurde 1946 in Halle – damals Sowjetzone – wegen Beihilfe zu den Exekutionen in den Jahren 1944/45 als »Nutznießer« verurteilt. Er hatte für 931 Vollstreckungen 26433 Reichsmark erhalten. Wie Kurt Rossa feststellt, war der »Stücklohn eines Scharfrichters die Sache der freien Übereinkunft«.
Das preußische Strafvollstreckungsgesetz vom 1. August 1933, noch weitgehend vom Weimarer Staat übernommen, stellt im § 4, Absatz II, fest, daß der Vollzug der Todesstrafe die »ernsteste staatliche Hoheitsbestätigung« sei; trotzdem delegiert sie die Exekution an Lohnbeauftragte.»Die Nazijustiz liebte das Todesurteil, doch sie verachtete den berufsmäßigen Henker«, urteilt Rossa, »nicht Justizbeamte bedienten ihre Guillotine, sondern Privatpersonen, die auf Grund von Dienstverträgen gegen Stücklohn ihres Amtes walteten.«
In München-Stadelheim, einem der Arbeitsplätze des Johann Reichhart, wurden 1200 Hinrichtungen vollstreckt, zusätzlich arbeitete der Henker ambulant mit dem Fallbeil im Gepäck. Vor dem braunen Machtantritt war eine Exekution ein singuläres Ereignis, das nach einem düsteren, pedantisch vorgeschriebenen Ritus vollzogen wurde; zu ihm gehörten die Henkersmahlzeit ebenso wie der Anstaltsgeistliche oder die geladenen Zeugen. Davon kam man schon deswegen ab, als, wie es der evangelische Gefängnispfarrer Karl Alt nannte, an »Großschlachttagen« von vier, acht, zwölf, achtundzwanzig bis zu hundertsechundachtzig Menschen vom gleichen Scharfrichterteam hingerichtet wurden.
Die vom Fließband gelieferten Todesurteile der »ordentlichen« Justiz ließen sich nur noch durch Massenhinrichtungen bewältigen. Die Henkersmahlzeit wurde abgeschafft. Jeweils zwei Leichen kamen in einen mit Sägemehl gefüllten Sarg, der um 20 cm verkürzt war – amtlich angeordnete Materialeinsparung, da ein Körper ohne Kopf weniger Platz benötigte. Mitunter wurden erkrankten Verurteilten von abgestumpften Wärtern die Medikamente mit den Worten verweigert: »Dir wird ja sowieso bald die Rübe abgehackt.«
In Plötzensee, der Richtstätte Berlins, gab es für Justizwachtmeister, die Todeskandidaten aus der Zelle zur Exekution führen mußten, bis zu acht Zigaretten Sonderzulage; dafür mußten sie gelegentlichen Widerstand brechen und Schreienden ein Handtuch in den Mund stopfen. In der gleichen Anstalt sollten an einem Septembertag des Jahres 1943 hintereinander dreihundert Verurteilte enthauptet werden. Nach der hundertsechsundachtzigsten Exekution waren die Henker am Ende ihrer Nervenkraft, so daß einhundertvierzehn Todeskandidaten einen Tag länger auf die »ernsteste staatliche Hoheitsbetätigung« warten mußten.
Die Delinquenten wurden mit einer solchen Eile aus den Zellen gerissen und in den Vollstreckungsraum geleitet, daß der Verwaltungsoberinspektor Sch. die Namen verwechselte und vier Gefangene versehentlich köpfen ließ. Menschenleben waren wenig wert. Ein Dienststrafverfahren blieb dem Überforderten erspart; es ging – für den Beamten – mit einer »ernsthaften Verwarnung« ab.
»Der abgeschlagene Kopf fiel in einen Weidenkorb, die Augen weit offen«, heißt es in einem Bericht, den Hans Halter – er hatte Augenzeugen zum Sprechen gebracht – im »Spiegel«-Heft 8/1979 veröffentlichte. »Weil die Verurteilten auf dem Schafott nicht festgeschnallt wurden, konnte sich der Körper im Tode ein letztes Mal frei bewegen. Der Torso bäumte sich auf, die Beine zuckten und schleuderten die Holzpantinen fort.
Aus dem Rumpf spritzte das Blut in hohem Bogen in den Gully … Wer hier im Namen des Volkes vom Leben zum Tode gebracht wurde, dem zeigte sich der Staat in aller Macht und Herrlichkeit. Der Henker im Cut, seine drei Knechte im schwarzen Anzug. Der Herr Kammergerichtsrat in roter Robe, der Staatsanwalt und der Pfarrer im schwarzen Talar, die Justizbeamten im jagdgrünen Tuch, der Anstaltsarzt im weißen Kittel, die Gäste in Uniform. Auf dem Tisch ein Kruzifix, an der Wand zwei hohe Kandelaber.
Nicht irgendein KZ-Wächter war am Werk, sadistisch veranlagt und womöglich betrunken. An diesem Todesort herrschten Recht und Ordnung, war jeder Schritt durch eine Vorschrift festgelegt. Für die Gäste gab es Eintrittskarten und den Hinweis: ›An der Richtstätte wird der deutsche Gruß vermieden‹. Vom Opfer erwarteten die Beamten, daß es sich dem Protokoll gemäß verhalte, ›ruhig und gefaßt‹. Nur selten fiel einer aus der Rolle.
›Ich erinnere mich an keinen, der geweint hat, geschrien oder sich gewehrt‹, sagt mir der evangelische Pfarrer Hermann Schrader, 80, der damals ein dutzendmal dabei sein mußte. ›Mancher war auch dadurch beruhigt, daß man ihm sagen konnte: Ich stehe hinter Ihnen, bis das Fallbeil fällt.‹ Das dauerte nicht lange. Vom Kommando ›Scharfrichter, walten Sie Ihres Amtes!‹ bis zur Meldung ›Herr Staatsanwalt, das Urteil ist vollstreckt‹ vergingen nur Sekunden – in Friedenszeiten zwanzig bis fünfundzwanzig, im Krieg nur noch sieben oder gar vier. Für jeden Toten hat ein Beamter die Zeiten in ein Formblatt DIN A 5 eingetragen, das immer noch aufbewahrt wird …
Von den rund dreitausend … die in diesem Geviert sterben mußten, gibt es oft nicht einmal ein Foto. Der älteste, ein Arbeiter, war dreiundachtzig Jahre, der jüngste gerade siebzehn. In Berlin-Plötzensee starben einundvierzig Ehepaare, die voneinander nicht Abschied nehmen durften. Mütter, die in der Haft ein Kind geboren hatten, wurden nicht geschont. Recht ging vor Gnade, zweihundertfünfzig Frauen wurden geköpft. Ihnen schnitt ein alter Schuster am letzten Abend die Haare kurz, um den Hals freizulegen. Ein Gefängnispfarrer erinnerte sich daran: ›Der Haarschnitt war ein Vorrecht des Schusters. Er tat es mit Gleichmut, ohne Gemütsbewegung und mit einer gewissen stumpfsinnigen Befriedigung.‹ Richtige Freude am Töten hatten nur wenige Beamte …«
Fraglos: ein Thema – ein ebenso abscheuliches wie notwendiges. Voraussetzung war natürlich, Johann Reichhart zum Reden zu bringen. Wiewohl er ständig sprach, war es nicht so leicht. Ich mußte erst in mehreren Begegnungen einen Schutzwall von Zorn, Trotz, Schuldgefühl und Selbstverteidigung durchbrechen, bevor er wirklich über das sprach, worauf es ankam.
»Sie wissen doch, daß unter den von Ihnen Hingerichteten viele Unschuldige waren?« fragte ich Johann Reichhart vorsichtig.
»Heute weiß ich das«, erwiderte er, »damals nicht. Es war sicher dumm, aber ich habe an den Staat geglaubt. Der Staat erläßt die Gesetze, und die müssen befolgt werden, nahm ich an, und wenn ich dazu beitrug, daß sie befolgt werden, war es doch kein Verbrechen.«
Ich schwieg.
»Sie wissen überhaupt nicht, was da alles passieren kann, wenn der Scharfrichter pfuscht«, fuhr er fort. »Fragen Sie nicht, was mit dem US-Henker, den ich eingearbeitet habe, diesem Sergeant … Sergeant –«
»Woods«, ergänzte ich.
»… alles passiert ist. Das geben Sie mir doch zu, daß es in jedem Fall falsch ist, wenn die Verurteilten länger leiden müssen als nötig«, attackierte er mich, und mit hartnäckiger Logik setzte er hinzu: »Ob sie nun schuldig sind oder unschuldig.«
»Also haben Sie auch Unschuldige hingerichtet«, entgegnete ich.
»Nur mit richterlichem Urteil, das mir vorher gezeigt und das vorgelesen wurde.«
»Waren Sie denn der Meinung, daß zum Beispiel auch Schwarzschlächter den Tod verdient haben?«
»Sie mußten damit rechnen«, antwortete Reichhart. »Das Gesetz war da.«
»Und das ist Ihnen richtig erschienen?«
»Es ist mir sehr hart vorgekommen und übertrieben. Die Leute haben mir leid getan«, erwiderte er. »Aber schlimm ist es erst geworden nach dem Zusammenbruch, da hab’ ich manchmal …«
»Als Sie im Interniertenlager eingesperrt wurden?«
»Nicht deswegen«, versetzte Reichhart. »Als ich in den Zeitungen gelesen habe, daß da Leute enthauptet wurden, die überhaupt nichts angestellt haben – bloß weil sie gegen die Nazis gewesen waren. Dann war es nicht mehr zum Aushalten. Zuerst habe ich mir noch gesagt: Du kannst nichts dafür. Du gar nichts, du hast nur getan, was von dir verlangt wurde, so schnell wie möglich und ohne Pfusch. Aber es wurde immer schlimmer, nachts, wenn ich schlafen wollte –« Er brach ab, starrte auf den Tisch, auf dem er seine Unterlagen ausgebreitet hatte, Berge von Unterlagen. »Es waren auch wirklich abscheuliche Burschen dabei, hundsgemeine Mörder – und ich bin heute noch der Meinung, daß sie den Tod verdient haben.«
»Und die würden Sie heute wieder hinrichten?«
»Nie mehr«, versicherte er. »Keinen einzigen. Nicht ich und auch keiner mehr aus meiner Familie. Ich garantiere Ihnen, daß ich der letzte Reichhart bin, der so etwas gemacht hat, ob nun die Todesstrafe wieder kommt oder nicht.«
»Heißt das, daß Sie gegen die Todesstrafe sind?«
Er schwieg, er wollte nicht bejahen, auch nicht verneinen. Er betrachtete das Problem nicht von übergeordneter Warte, sondern aus der Sicht seiner eigenen Misere, seiner Selbstvorwürfe und auch der Mißachtung, in der er leben mußte. »Sollen doch die Richter künftig ihre Dreckarbeit selbst erledigen«, entgegnete er. »Dann sind sie vielleicht auch etwas … etwas menschlicher.«
Johann Reichharts Antworten kamen nicht so glatt, wie ich sie hier verkürzt wiedergebe, aber dem Sinn nach so lautend. Seit der Mann, der wie ein Einsiedler in einem primitiven Holzhaus lebte, in sein Gewerbe eingetreten war, hatte er gewissermaßen Buch geführt, hatte sich weit mehr für die Verurteilten interessiert, als es die flüchtige, wenn auch für sie tödliche Begegnung, die er mit ihnen hatte, erwarten ließ. Anklageschriften, Abschriften von Urteilen, Zeitungsberichte, Photos, Fahndungsmeldungen waren von ihm gesammelt und sorgfältig geordnet worden. Zusätzlich hatte Reichhart in grobschlächtiger Schrift eine Art Tagebuch geführt.
Erst als es durch die Terrorjustiz des Dritten Reiches zu Massenexekutionen kam, machte er keine Einträge mehr. Es gab ja auch nur kurze Urteilsbegründungen und knappe Vollstreckungsbefehle, und die Namen von fünfunddreißig Menschen, die in Drei-Minuten-Abständen in den Tod gehen, kann sich niemand merken.
Was mir Johann Reichhart erzählte, habe ich in druckreife Form gebracht, ohne ihm dabei die Hand zu führen. Ich habe lediglich Umständlichkeiten und Wiederholungen weggelassen und mit seinem Einverständnis die Kriminalfälle anhand seiner Unterlagen rekonstruiert, ergänzt durch seine mündlichen Mitteilungen.
Sie waren eine Fundgrube.
Und eine Schlangengrube.
Stefan Amberg
Der Tod trug mein Gesicht
Es war so weit. Gewehrkolben hämmerten gegen die Holztür. Vor dem Haus stand ein Jeep. Drei, vier Soldaten in olivgrünen Uniformen waren dabei, in mein Deisenhofener Haus einzudringen. Es war im Mai 45; ein Lenz ohne Frühling.
Ich flüchtete in den Keller. Es war natürlich sinnlos, aber wenn der Mensch Angst hat, benimmt er sich wie ein gejagtes Tier. Einer meiner Nachbarn mußte mich denunziert haben.
Eine Minute später griffen sie mich und zerrten mich aus meinem Versteck. Sie hatten die Waffe im Anschlag und aufgedunsene, rote Gesichter.
»Bloody, dirty bastard!« schrie mir einer zu.
»Murderer!« brüllte ein zweiter.
Sie rissen mich derb am Arm, stießen mich vorwärts. Die Angst, die ich spürte, machte mich stumpf gegen den Schmerz. Ich roch den Fusel, den sie getrunken hatten. Einen Moment lang fürchtete ich, daß sie mich auf meinem eigenen Grundstück formlos umlegen würden. Einer machte eine Geste mit der flachen Hand an seinem Hals, und das sollte wohl bedeuten, daß sie mich hängen wollten.
Sie schleppten mich zu ihrem Jeep; einer setzte sich links, ein zweiter rechts. Aus der Entfernung sahen ein paar Zivilisten zu. Der Fahrer jagte los, mit Vollgas. Eine Zeitlang fuhren sie wie unschlüssig hin und her, rasten über Münchens zerstörte Straßen. Dann hielten sie vor dem Hachinger Friedhof.
»Go on, son of a bitch!« sagte der Sergeant neben dem Fahrer.
Sie trieben mich vorwärts, dabei ging ich freiwillig, mit einem pelzigen Gefühl in den Beinen. Als sie mich gegen einen Grabstein stellten, wußte ich, daß sie mich nicht hängen, sondern erschießen wollten.
Sie ließen sich Zeit. Sie waren ja Amateure. Sie fummelten mit der geladenen, entsicherten Waffe vor meinen Augen. Dann verbesserte der Sergeant meine Position wie ein Photograph, der das offizielle Hochzeitsbild macht. Sie schoben mich nach links, dann nach rechts. Einer fesselte meine Hände mit einem Kälberstrick. Sie lachten, redeten durcheinander. Einer spuckte, verfehlte aber mein Gesicht.
Ich lehnte mich gegen den Grabstein, starrte in die Gewehrmündungen. Gleich würde alles vorbei sein. Und das war gut so.
Aber es kam anders.
Plötzlich trat ein US-Offizier dazwischen und beendete die Szene. Er brüllte den Soldaten etwas zu. Sie nahmen auf einmal Haltung an. Er gab ihnen Befehle, die ich nicht verstand. Aber später sagte einer der GIs in seinem radebrechenden Deutsch: »Kaltgemacht wirst du doch, du Schwein.«
Sie lieferten mich in einer Arrestzelle der Polizei ab. Dann kam ich in ein Untersuchungsgefängnis. Jetzt begann die Irrfahrt quer durch die Barackenlager. Manchmal war ich mit fünfzehn anderen in einer Zelle, mitunter auch allein. Meistens war die Luft stickig und das Essen knapp. Aber wo ich auch war, stets war der Himmel für mich so groß wie das Fenster hinter den Gitterstäben.
Ab und zu erhielt ich eine Zeitung. Mitunter sagte mir einer der Mitgefangenen, was die Nazis alles verbrochen hatten. Allmählich begriff ich, wie sehr der Staat, dem ich blind ergeben gedient hatte, mich ausgenutzt hatte, ausgenutzt und mißbraucht.
Es brachte mich um den Schlaf. Der Morgen quälte mich, und die Nacht fürchtete ich. Niemand half mir. Meine Mitgefangenen waren Hoheitsträger der Partei, Richter, Staatsanwälte – die Größen von gestern. Einige wurden später hingerichtet; andere rückten schon sehr bald wieder in die höchsten Stellungen ein. Aber keiner, ob er zur Gruppe eins gehörte oder zu den Glücklicheren, wechselte ein Wort mit mir, wollte neben mir schlafen oder seine Zukunfssorgen mit mir teilen.
Ich war der Einsamste im Lager, und doch selten allein, denn nun fingen sie an, mich zu besuchen, in großer Schar, die Männer und Frauen, die ich hingerichtet hatte. Mitten in der Nacht starrten mich 3165 Gesichter an, so wie damals, als ich der letzte Mensch gewesen war, den sie in ihrem Leben sahen.
Ihr Tod trug mein Gesicht.
Ich hatte einen schrecklichen Beruf gehabt. Ich war Scharfrichter gewesen – ich möchte es nie wieder werden.
Damals begann es, aber der Spuk wurde nicht ferner, als sich die Zeit normalisierte, und oft verwünschte ich die betrunkenen GIs, die im Hachinger Friedhof so lange herumgemacht hatten.
Wenn die Nacht in den Tag übergeht, ist es soweit. Dann kommt der stumme Zug. Die Frauen. Die Männer. Die Schuldigen. Die Unschuldigen. Und ihre toten Augen starren mich aus Wachsgesichtern an, wie damals, als ich den Hebel zog. Einige lächeln. Andere kämpfen verzweifelt gegen das Ende. Die meisten beten. Doch mit dem Amen fällt das Beil. Und während ich die Lippen aufeinanderpresse, höre ich meine Stimme durch das Grauen geistern: »Das Urteil ist vollstreckt.«
Ich habe es öfter als dreitausendmal sagen müssen. Auf Befehl des Staates, der so großzügig mit dem Leben umging, führte ich 3165 Menschen in die Todeszelle. Ich arbeitete mit den Augen, mit den Händen, mechanisch. Empfindungen hätten den traurigen, letzten Akt verzögert und die Todesangst eines einsamen Menschen verlängert. Ich verkürzte das Sterben auf vier Sekunden In dreiundzwanzig Dienstjahren als Scharfrichter ist mir nie eine Panne passiert.
Nur in einem einzigen Fall versagte die Exekution:
Bei mir selbst.
Ich sollte schweigen. Ich habe es jahrelang getan. Viele Menschen gingen mir aus dem Weg. Aber die Sensation läuft mir nach. In den Hungerjahren nach dem Krieg wollte Amerika meine Geschichte kaufen. Gegen Care-Pakete.
Ich schwieg.
Dann kam eine englische Agentur und bot mir eine Riesensumme.
Ich schwieg.
Ich hatte die Absicht, immer zu schweigen. Aber zwischen diesem Entschluß und dem heutigen Tag liegen zweitausend Nächte, die mich folterten, marterten, zermürbten … und die mich zwangen, meine Geschichte zu berichten.
Ich weiß nicht, ob es eine Anklage oder Verteidigung sein wird. Ich muß es tun wie unter einem inneren Zwang. Ich will schildern, wie man Scharfrichter wird. Warum. Wie es ist, wenn man Menschen sterben läßt. Und dann das Gewissen aufsteht. Die Angst. Die Furcht. Das Grauen.
Ich habe diese Menschen gesehen. Ich kannte ihre Fälle. Ich hatte fast mit allen Mitleid. Aber ich war überzeugt, daß sie zu Recht sterben mußten.
Bis dann die Hitlerjustiz auf das Recht verzichtete.
Ich weiß, daß hier die Grenzen meines Berichts zu liegen haben. Diese Hunderte, Tausende von Menschen, die von einem Regime hingerichtet wurden, dessen Hebel ich bedienen mußte, sind eine ungeheure Anklage, die zu schreiben ich kein Recht habe. Ich werde mich auf die kriminellen Fälle beschränken. Meine Erlebnisse, Erinnerungen und Begegnungen mit politischen Opfern habe ich einem Journalisten übergeben, der sie als wohl einzig dastehendes Zeitdokument darstellen mag.
Bis zu den Hinrichtungen des Jahres 1933 stimmte es, wenn der Staatsanwalt sagte: »Im Namen des Volkes …«
Ich erhielt von der Weimarer Republik meinen ersten Anstellungsvertrag. Es war kein Zufall. Ich stamme aus einer Familie, die seit beinahe dreihundert Jahren in ununterbrochener Reihenfolge den Scharfrichter stellte. Bei uns zu Hause hatte ein Scharfrichter nichts Düsteres oder Anrüchiges an sich. Wir hielten es für einen harten, notwendigen und ehrenwerten Beruf. Wir kannten die Namen unserer Vorfahren, zum Beispiel Lorenz Schellerer, der auf dem Münchner Heumarkt im Jahre 1854 eine der letzten Hinrichtungen mit dem großen Handschwert vornahm und dabei die Delinquentin, eine Gattenmörderin, mehrmals verfehlte. Seitdem wurde in Deutschland die Guillotine eingeführt.
Ich hatte schon als Neunjähriger meinen Vater verloren. Ein wenig vertrat mein Onkel Franz Xaver die Vaterstelle. Er war ein großer, würdig aussehender alter Herr, der streng und fromm lebte.
Er war aber auch der Scharfrichter von Bayern, der einzige, der in diesem Land jemals in Beamtenrang aufrückte. Er hatte von 1894 bis 1924 achtundfünfzig Mörder hingerichtet. Für jeden von ihnen ließ er Totenmessen lesen. Und später stiftete er aus eigenen Mitteln eine Kapelle.
Damals war mein Onkel schon über siebzig Jahre alt. Als im Jahre 1924 die Schwurgerichte wieder eingesetzt wurden, mußte er in den Ruhestand treten. Er wurde vom Justizministerium gebeten, für einen geeigneten Nachfolger zu sorgen. Er wandte sich an meinen Bruder Michael, der aber den elterlichen Hof bewirtschaftete und nicht die Dienstwohnung im Münchner Amtsgericht in der Au beziehen konnte.
Damit war ich an der Reihe.
Ich sagte nein.
Ich hätte dabei bleiben sollen.
Mein Onkel und ein Staatsanwalt nahmen mich in die Zange. Ich hatte zu dieser Zeit eine gut gehende Gastwirtschaft. Vorher leitete ich eine Tanzschule. Damals war ich jung und lebenslustig. Die Wanderjahre hatten mich nach Hamburg verschlagen, wo ich auch zwei Tanzturniere gewann. Mit einem hanseatischen Regiment war ich in den Ersten Weltkrieg eingerückt, wurde verschüttet und verwundet, schließlich wieder entlassen. Dann arbeitete ich in einer großen Wurstfabrik. Der Neigung nach wollte ich Kaufmann werden und wurde es auch. Ich hatte in allen Berufen Glück – bis auf einen.
Auf ihn, auf die Stellung eines Nachrichters, wurde ich am 15. März 1924 vereidigt und trat am 1. April meinen Dienst an. Damit war ich der Nachfolger meines Onkels geworden, der jetzt zufrieden war, daß dieser Beruf in den Händen seiner Familie blieb.
Ich hätte das niemals tun sollen.
Es waren oft keine Menschen mehr, die ich zu dem schwarzen Vorhang führte. Aber viele starben ruhig und reuig. Einige stemmten sich in wilder, blinder Lebensgier gegen meine Gehilfen, bei denen jeder Handgriff saß. Ich mußte einmal an einem Tag Vater und Sohn und an einem anderen Bruder und Schwester enthaupten.
Unter meiner Hand endete das Leben von Söhnen, die ihre Väter ermordet hatten. Unter meinem Fallbeil starben Eltern, die ihre Kinder beseitigt hatten.
Ich hörte die schrillen Schreie der Frau, die zusammen mit ihrem Liebhaber den eigenen Mann im Backofen verbrannt hatte.
Ich steckte einem jugendlichen Raubmörder, als er schon auf dem Brett angeschnallt war, auf seinen Wunsch in die linke Hand das Sterbekreuz und in die rechte das Bild seiner Mutter.
Ich vollstreckte das Urteil an einem Mann, der … schon einmal gestorben und beerdigt worden war.
Ich sorgte dafür, daß die letzten Wünsche der Delinquenten erfüllt wurden, soweit es ging. Ein Bauernsohn, der die Magd ermordet hatte, durfte in seinem Hochzeitsanzug sterben; ein gelähmter Totschläger, dem das Anziehen Schmerzen machte, im Hemd.
Ich enthauptete einen siebenfachen Frauenmörder und einen Mann, der seine eigenen sechs Kinder erstickt hatte.
Die Sühne schickte mich kreuz und quer durch Deutschland. Niemand wußte, daß auf meinem Opel Blitz hinten zerlegt die Todesmaschine lag. Meine beiden Gehilfen reisten mit dem Zug, um kein Aufsehen zu erregen. Wir durften uns nicht in der Stadt der Exekution zeigen, keine Gastwirtschaft betreten, keinen Alkohol zu uns nehmen. Wir wurden wie Häftlinge in eine Zelle gesteckt.
Wenn wir kamen, wußte der Delinquent, daß er im Morgengrauen sterben würde.
Mein Dienstanzug waren Gehrock und Zylinder. Paragraph 15 der Hinrichtungsordnung lautet: »Der die Vollstreckung leitende Beamte hat darauf bedacht zu sein, daß die Hinrichtung in ernster und würdiger Form vor sich geht. Er selbst hat in Amtstracht, die übrigen Anwesenden haben im dunklen Anzug oder in Dienstkleidung zu erscheinen.«
Meine Befehle erhielt ich vom Staatsanwalt. Ich erlebte mitunter, wie der Vertreter der Anklage sich abwenden mußte, wenn ich das von ihm erwirkte Urteil vollstreckte. Manchmal beobachtete ich auf seinem Gesicht Grauen und Zweifel. Einmal hob einer die Hand, als ob er das Urteil rückgängig machen wollte. Andere drohten zusammenzubrechen. Aber sie mußten durchhalten, bis es vollzogen war.
Ich erlebte Staatsanwälte, die vor der Exekution Witze rissen oder danach mit Appetit belegte Brötchen aßen. Ich kannte andere, die vorher gequält zu mir sagten: »Nicht, Reichhart, Sie machen es doch so schnell, wie es geht?«
Ich kenne Staatsanwälte, die nicht nahe genug an das Fallbeil herangehen konnten, und solche, die während des Vollzugs die Augen schlossen und sich die Hände an die Ohren preßten.
Ich kann bezeugen, wie immer wieder bei politischen Urteilen die Opfer fast leicht und lächelnd starben, während der Vertreter der Anklage aussah, als ob er unter das Fallbeil müßte.
Und dann kamen die Sondergerichte. Der Volksgerichtshof. Die Urteile überschlugen sich. Die Guillotine kam nicht mehr nach. Und ich stand und stand und zog den Hebel. Zweiunddreißig Exekutionen einmal an einem Tag. Die Gesichter der Delinquenten hatten sich gewandelt. Die Mörder waren nur noch selten.
Keine Zeit zum Nachdenken. Drei Minuten Abstand zwischen den Hinrichtungen. Keine Kerzen mehr. Kruzifixe waren aus dem Todesschuppen entfernt worden.
»Schnell, schnell!« drängte ein Staatsanwalt.
Ich sah auf, ich konnte nicht mehr. Ich wollte zurücktreten. Ich habe es zweimal versucht, dreimal. Es wurde abgelehnt. Man hat mir gedroht. Man behauptete, daß meine Arbeit kriegswichtig sei.
Und ich tötete und tötete. Zweimal in der Woche, dreimal. Zehnmal am Tag, zwanzigmal. Ich ging den Menschen aus dem Weg. Wenn ich an einer Kirche vorbeikam, aus der ein Gebet wehte, wenn ich die Worte hörte: »Vater unser …«, dann blieb ich plötzlich stehen. Automatisch. Dann wartete ich noch drei, vier Sekunden. Jetzt mußte das Fallbeil sausen.
So war es doch immer. Nach dem »Amen« nickte der Staatsanwalt und sagte: »Walten Sie Ihres Amtes.«
Ein Griff. Das Brett dreht sich im Neunzig-Grad-Winkel. Ein schwarzer Vorhang. Ein Wachstuchkorb. Ein Schlag.
Aus.
So schnell ist der Tod.
Mich ließ er nicht mehr los. Ich glaube, in diesen Tagen, Wochen und Monaten der Haft erfaßte ich zum ersten Mal die Problematik meines Berufs. Der Staat, der mich überbeschäftigt hatte, ließ mich allein – oder besser gesagt, die Funktionäre des Staats, die jetzt, sich aus ihren eigenen Gesetzen und Anordnungen hinauswindend, ihre Verteidigung vor der Spruchkammer vorbereiteten.
Auch mir war mitgeteilt worden, daß ich mich zu verantworten hätte, und zwar gleich in der Gruppe der Hauptschuldigen.
Aber bevor ich Näheres erfuhr, trat eine Wendung ein: Plötzlich stand ein amerikanischer Captain vor mir, fragte nach meinem Namen, lächelte mir aufmunternd zu, bot mir eine Zigarette an. Als ich im Jeep nach Landsberg fuhr, wußte ich noch nicht, um was es ging. Im Gefängnishof begriff ich es schnell. Ich mußte auf Befehl der Dritten Armee zwei neue Galgen bauen und Mastersergeant Woods, den späteren Scharfrichter in Nürnberg, unterrichten. Ich holte die Stricke vom Zollamt ab, die später Woods geschmacklos zentimeterweise als Souvenirs verkaufte.
Mein Schicksal ließ mich nicht los. Auch in Landsberg standen Galgen.
Die Guillotine war bei Nacht und Nebel in die Donau versenkt worden. Aber an den Henker erinnerte man sich. Es schien, als ob von der Justiz des Dritten Reiches nur ich übriggeblieben sei, der ich Urteile vollstreckte, die ich nicht zu verantworten brauche. Staatsanwälte und Richter, denen ich beinahe tagtäglich in diesen schaurigen Morgenstunden im Todesraum der Strafanstalt begegnet war, haben längst ihre Stellungen wieder erhalten.
Ich sollte mich für sie verantworten.
Ich stand vor der Spruchkammer. Ich sagte: »Ich werde nie mehr einen Menschen hinrichten – mögen die Richter künftig ihre Todesurteile selbst vollstrecken!«
Neben mir saß Hans, der mir von meinen vier Kindern am nächsten stand. Er wollte helfen und konnte es nicht.
Er verzweifelte über mich.
Er verzweifelte für mich und ging freiwillig in den Tod.
Sie holten mich öfter, und wieder war der Tod in meinem Gefolge. Auf Befehl. Wie früher. Nur trugen diesmal meine Auftraggeber Uniformen statt Roben. Und die Männer, die ich hängte, waren in meinem Tagebuch keine Namen, die mir nichts sagten. Ihre Untaten hatten selbst in den dünnen Nachkriegszeitungen reichlich Platz eingenommen.
In der Nacht vor der Hinrichtung wurden sie in einen Keller gebracht. Eine Häftlingskapelle veranstaltete für sie ein Wunschkonzert, während die Frauen, die am nächsten Morgen Witwen sein würden, mit verstörten Gesichtern im »Hotel Goggl« herumsaßen.
Es gab wieder eine Henkersmahlzeit; jeder Verurteilte durfte rauchen, soviel er wollte, nur Alkohol blieb den Rotjacken versagt.
Dann wurden sie aufgerufen und gingen zum Galgen, von Priestern begleitet. Und ich waltete meines Amtes, wie immer so schnell, zielstrebig und schmerzfrei wie möglich. In die Augen brauchte ich dabei keinem zu sehen, denn es wurde ihnen eine schwarze Kapuze über das Gesicht gezogen, bevor ich den Mechanismus der Falltüre auslöste.
Zwischen den Hinrichtungen lebte ich jetzt in einer vorläufigen, brutalen Freiheit. Manchmal wurde ich nach Landsberg gerufen und dann wieder nach Hause geschickt; dann jeweils hatten die deutschen Anwälte der Rotjacken einen Hinrichtungsstop erwirkt. Meistens war es kein fragwürdiger Zeitgewinn, denn immer mehr Insassen von Landsberg wurden begnadigt, so daß ich am Ende nur noch sieben Delinquenten hinrichten mußte, unter ihnen Oswald Pohl, als Chef des SS-Wirtschaftshauptamtes zuständig für die KZ-Lager und die Leichenfledderei an den Ermordeten, Otto Ohlendorf, Chef eines Vernichtungskommandos, der nach eigenem Eingeständnis 90000 Menschen liquidiert hatte, und Standartenführer Paul Blobel, dem der Mord an 60000 Menschen vorgeworfen wurde.
Die Tage der Freiheit empfand ich von vornherein als eine Leihgabe. Bei den Anfeindungen, denen ich ausgesetzt war, mußte ich damit rechnen, daß man mich wieder holen würde. Im Mai 1947 erschien die Polizei und verhaftete mich. Als einer der Vollstrecker der Todesurteile des Dritten Reiches kam ich in das Internierungslager nach Moosburg.
Krankgeschrieben lieferte man mich in ein Interniertenlazarett in Garmisch ein. Ich hatte Kreislaufstörungen; mir ging es wirklich miserabel. Aber ich merkte bald, daß die anderen Patienten vorwiegend Prominente des Dritten Reiches waren, die bereits wieder eine Vorzugsbehandlung genossen. Ich bewegte mich unter feinen Leuten, und es war mir klar, daß die Größen von gestern meine Gesellschaft ebenfalls als merkwürdig empfanden.
Ich war zusammen mit Herrn von Papen, Emmy Göring, Feldmarschall Sperrle, Reichspostminister Ohnesorge, dem Hitler-Adjutanten Julius Schaub, SA-Obergruppenführer Brückner und vielen anderen gestürzten Hoheitsträgern, die ich nur aus der Zeitung und der Wochenschau kannte.
Nicht so sehr der Stacheldraht bedrückte mich als meine Mithäftlinge, die mir aus dem Weg gingen, als ob sie Angst vor mir hätten. Im Grunde verdankte ich es ja nur ihnen, daß ich im Internierungslager war. Aber sie wollten nichts mit mir zu tun haben.
Ich meldete mich gleich am ersten Tag beim Lagerleiter. »Ich gehöre nicht hierher«, erklärte ich ihm.
»Warum nicht?«
»Ich habe nur die Urteile des Reiches vollstreckt«, erwiderte ich. »Ich war ein kleiner, unbedeutender Mann.«
Ich erreichte nichts. Aber die Mithäftlinge erfuhren von meiner Intervention und benahmen sich entsprechend. Ich merkte es zuerst gar nicht, bis eines Tages der SA-Obergruppenführer Brückner zu mir kam, um mir die Verachtung des ganzen Lagers zu übermitteln.
»Reichhart«, sagte er. »Sie hätten die Hinrichtungen von Landsberg nie vollstrecken dürfen.«
»Was hätte ich denn tun sollen?« fragte ich.
Der Mann ballte die Fäuste. »Da hätten Sie sich eher selbst das Leben nehmen müssen!«
Ich drehte mich in meinem Bett zur Wand um.
Mein Zustand verschlechterte sich. Schüttelfrost. Man schaffte mich in den Operationsraum. Der behandelnde Arzt und seine Helfer waren ausnahmslos frühere SS-Leute. Sie verachteten mich wegen Landsberg.
Ich lebte in einem Getto innerhalb eines Gettos. Als Aussätziger. Ich haßte meine Mitgefangenen und wurde von ihnen gehaßt. Ich lebte in dumpfer Gleichgültigkeit. Die Baracken waren feucht und kaum geheizt. Ich war schwer krank und bekam kolikartige Schmerzen. Die schlechte Verpflegung war keine Schikane; zu dieser Zeit löffelte man in ganz Deutschland dünne Kohlsuppen. Auch die Menschen außerhalb des Internierungslagers mußten die Suppe schlucken, die ihnen die Menschen innerhalb des Internierungslagers angerührt hatten.
Ich lebte im Delirium und wartete auf das Ende. Es kam nicht. Nicht von selbst. Mein Bewußtsein dämmerte in einem Fieberwahn. Ich spielte mit dem Gedanken, Schluß zu machen. In meinen immer wiederkehrenden Anfällen sah ich mich in zwei Rollen: als Delinquent auf dem Schafott und gleichzeitig als Scharfrichter. Ich befahl mir selbst: »Mach schnell, Johann! Mach es wie immer!«
Vier Sekunden, überlegte ich verdämmernd, wie immer, länger darf es auch bei dir nicht dauern.
Es tat nicht einmal weh. Nebenan schnarchte einer. Das Urteil ist vollstreckt, dachte ich.
Dann schwamm mein Bewußtsein weg.
Als ich wieder zu mir kam, lag ich auf einem Bett. Vor mir stand ein Arzt und fluchte. »Schweinerei!« sagte er, während er an meinem Handgelenk hantierte.
Es schmerzte, und ich hatte die Empfindung, daß meine Armgelenke Stiefel waren, durch die man Schnürsenkel zog. Da begriff ich, daß man mein armseliges Leben wieder zusammennähte.
Ich weinte stumm, ohnmächtig und wehrlos, einem elenden Leben ausgeliefert. Ich verzweifelte, weil mir in meiner ganzen Laufbahn eine einzige Hinrichtung mißglückt war: das Todesurteil, das ich an mir selbst vollstrecken wollte.
Was es bedeutete, erfuhr ich schon wenige Tage später. Ich lag im Bett, an das der SS-Arzt Professor Dr. Packhaus herantrat. »Sieh da, der Henker«, sagte er höhnisch und drehte sich nach den anderen um.
Sie verstanden den Hinweis.
Ich war krank, hilflos. Ich konnte mich nicht wehren. Sie gingen mit Fäusten und Stiefeln auf mich los, rissen mich aus dem Bett, trampelten auf mir herum, bis ich das Bewußtsein verlor.
Ich lag Tage im Koma. Hinterher erklärte mir ein Arzt, er sei nicht sicher gewesen, ob ich je daraus wieder erwachen würde.
Ich wußte, was ich von meinen Lagergenossen zu halten hatte. Ich verstand mich auf sie.
Ich war ja ein Leben lang mit Mördern umgegangen.
Diese blutige Bekanntschaft hatte am 21. Juli 1924 begonnen.
Es war so weit. Im Gepäckwagen des Zuges, in einer riesigen Holzkiste verpackt, lag die Maschine. Die Arbeiter fluchten beim Einladen.
»Habt ihr Bleiklötze drin?« fragte der Zugschaffner.
Wir waren zu dritt im Abteil. Wenn wir zurückfuhren, würden drei Menschen nicht mehr leben. Drei abscheuliche Mörder. Ihr Fall stand in allen Zeitungen. Drei Gesichter. Eines wirkte brutal, das zweite gleichgültig, das dritte war ein Milchgesicht. Ich kannte die Fotos auswendig. Ich kannte die Unterschrift unter den Bildern. Drei Todesurteile im Landshuter Mordprozeß. Sie hießen Hutterer, Fischer und Steingruber.
Sie waren nach und nach auf die schiefe Bahn geraten. Zuerst hatten sie nur gestohlen und eingebrochen. Dann kamen die ersten Raubüberfälle. Eigentlich waren sie zu viert. Aber dem Vierten trauten sie nicht. Er hieß Langer.
Zu dritt führten sie es aus, während eines Skats zu viert. Der Tisch steht an einer Stelle, die genau markiert ist. Steingruber mischt die Karten. Dann steigt er auf den über dem Raum liegenden Boden und schießt nach unten. Da sich Langer gerade nach hinten beugt, gehen die Schüsse daneben. Steingruber geht nach unten und erwürgt unter Mitwirkung von Fischer und Hutterer den Komplizen.
Sie schleppen den Toten weg. Frau Fischer sieht es.
»Jetzt muß die auch noch beseitigt werden«, sagt Steingruber zu Fischer.
Sie würfeln, wer den Bandenbefehl auszuführen hat.
Der neunzehnjährige Hutterer verliert. Er verwürfelt das Leben der Frau Fischer, sein eigenes und das der Komplizen, die das Verbrechen mit ihm verabredet hatten.
Deshalb kamen wir nach Landshut. Die Gefängnisverwaltung schickte einen Lastwagen. Der Staatsanwalt wartete auf mich. »Bauen Sie die Maschine auf«, sagte er, »erst eine Probe.«
Dann wies er mir eine Zelle zu. Für eine kurze Besorgung durfte ich noch einmal in die Stadt. Auf der Straße traf ich einen alten Bekannten. Einen Gastwirt. Er faßte mich am Rockärmel. »Ich bin übermorgen auch dabei«, sagte er.
»Wobei?«
»Bei der Hinrichtung. Die machst doch du?«
Ich nickte und begriff, daß mein Bekannter einer der zwölf bürgerlichen Zeugen war, die bis zum Jahre 1934 jeder Hinrichtung beiwohnen mußten.
Die Probe klappte. Ein Regierungsrat vom Landesbauamt nahm sie ab. Seine Hände zitterten. Damit war für ihn der Fall schon erledigt.
Letzte Nacht vor der ersten Exekution. Ich konnte nicht schlafen. In meiner Nachbarzelle saß der Todeskandidat Fischer. Einmal sah ich ihn durch das Guckloch. Er stand in der Mitte, war groß und schlank, hatte den Kopf gehoben und bewegungslos zur Decke gestarrt. Er mußte gespürt haben, daß ich ihn beobachtet hatte.
Mein Gott, dachte ich. Ich fröstelte vor mir selbst. Ich wollte im Gang auf- und abgehen, aber man hatte versehentlich meine Zelle verriegelt.
Auf einmal hörte ich es. Schritte. Monotone, gleichmäßige Schritte. Erst zählte ich sie. Dann hämmerten sie in meinen Ohren, trampelten auf meinen Nerven, diktierten den Takt meines Blutes.
Ich hielt es nicht mehr aus, trommelte gegen die Türe. Die Wachen öffneten. Hinter ihnen stand der Gefängnisarzt. Im ersten Moment hielt er mich für den Delinquenten. Dann ging er in die richtige Zelle. Zu Fischer. Er gab ihm ein Beruhigungsmittel. Die Schritte waren nicht mehr zu hören.
Dafür klapperten um einhalb fünf Uhr die Kannen. Die Kalfaktoren brachten das Frühstück. Ich trank nur Kaffee. Dann aß ich doch. Du mußt, sagte ich mir, sonst wird dir schlecht. Wenn’s dir schlecht würde, müßten die Todeskandidaten länger leiden.
Eine halbe Stunde vor der Hinrichtung stand ich im Schuppen. Das Kruzifix glitzerte silbrig. Der Luftzug der Türe bewegte den schwarzen Vorhang vor der Guillotine. Ich mußte mich dazu zwingen, ihn wegzuschieben, um nachzusehen, ob alles in Ordnung war.
Das Fallbeil war aufgezogen und grinste mit schräger Schneide.
Dann kamen die Beamten. Die Zeugen. Unter ihnen mein Bekannter. Sie drückten sich gegen die Wand. Ich stand mit meinen Gehilfen mitten im Raum.
»Lassen Sie Ruppert Fischer vorführen«, sagte der Staatsanwalt mit belegter Stimme.
Meine Assistenten holten ihn ab. Ihnen folgten sicherheitshalber Gefängnisaufseher. Die Zeit bis zu ihrer Rückkehr dauerte ewig. Ich las meine eigene Unruhe von den Gesichtern der anderen.
Dann kamen sie. Schritte. Die Füße des Verurteilten schleiften. Er wurde halb getragen. Die Kerzen zuckten flackrig über die Niederschrift des Urteils. Fischer hing in den Schultern meiner Helfer.
»Sie heißen?« fragte der Staatsanwalt genau nach dem Reglement des Todes.
Fischer gurgelte nur.
Ein Priester. Ein paar Herzschläge Gebet.
»Scharfrichter, walten Sie Ihres Amtes!«
Er mußte es zweimal sagen, bis ich es begriff. Sechs Meter bis zu dem schwarzen Vorhang. Ich glaubte plötzlich, daß sich meine Füße nicht bewegen würden. Der Staatsanwalt starrte auf seine Schuhe, während Fischer der Kragenlatz abgebunden wurde. Fischers starres Gesicht begann allmählich zu leben. Vor Angst …
Da stürzte ich auf den Vorhang, riß ihn auseinander. Schnell, schnell, dachte ich … und das habe ich von da ab jedes Mal gedacht. Und immer sah ich das Gesicht des Mörders in den endlosen Sekunden vor mir, in denen sich meine Füße nicht vom Boden hoben. Ich sah nur noch Schatten.
Das schwere Brett klappte um. Der Schlitten mit dem armen Sünder schoß an mir vorbei, rastete ein. Wir mußten ihn noch festschnallen. Die Gurte haßte ich von der ersten Sekunde an. Sie kosteten Zeit. Meine Finger flogen. Einen Blick noch. Nur Schluß!
Ich hielt den Griff der Auslösung in der Hand. In dem Augenblick, in dem ich ihn herunterzog, hörte ich einen schweren Fall hinter meinem Rücken. Gleichzeitig polterte das Fallbeil dumpf in seinen Scharnieren. Ehe ich es begriff, hatte ich einen Menschen hingerichtet … wie das Gesetz es befahl.
Ich ließ den Griff los, als ob er aus glühendem Eisen wäre. Jetzt konnte ich mir auch den Fall vor der Auslösung des Beils erklären: Der Gastwirt, einer der zwölf bürgerlichen Zeugen, war zusammengebrochen und mußte weggeschafft werden.
»Urteil vollstreckt«, sagte ich.
Und zum erstenmal spürte ich, wie schwer diese Worte auszusprechen sind, wenn sie in die Stille des Todes hineingesagt werden müssen …
Und dann kam schon der nächste. Steingruber. Ich sah ihn nicht an. Es ist nur eine Probe, redete ich mir mit zusammengebissenen Zähnen ein. Ich brachte es fertig. Diesmal war auch der Staatsanwalt grün im Gesicht.
Ich schrie fast die Worte heraus: »Urteil vollstreckt!«
Der dritte, Hutterer, kam nicht. Er behauptete in letzter Stunde, sein Geburtsdatum falsch angegeben zu haben, jünger zu sein. Es mußte überprüft werden. Das kostete Zeit.
Draußen, vor dem Schuppen, bekamen die Gesichter der Zeugen wieder Farbe. Der Staatsanwalt wollte etwas zu mir sagen. Aber er mußte mein Gesicht gesehen haben, denn er schwieg. Der Pfarrer betete leise weiter.
Drei Tage später mußte ich doch noch den dritten hinrichten. Sein Einspruch war gescheitert. Aber er durfte zweiundsiebzig Stunden länger leben. Was das bedeutete, begriff ich schon bei meiner ersten Exekution.
Wir redeten auf der Rückfahrt kein Wort. Meine Frau sah mich fragend an. Ich zuckte die Schultern.
Wieder konnte ich nicht schlafen. Ich ging ruhelos in meiner Wohnung auf und ab. Irgendwo lag die Bibel. Ich fand sie, schlug sie auf, las die Stelle: »Wer Blut vergießt, des Blut soll wieder vergossen werden …«
Aber sie waren doch noch so jung, dachte ich. Zwei Morde. Jetzt sind fünf Menschen tot …
So begann meine düstere Karriere, zufällig in der gleichen Zeit, da mein größter Fall ins Rollen kam: Martha Marek, eine Frau ohne Beispiel. Bald werden alle Zeitungen voll von ihr sein.
Und ich wußte noch nicht, daß ich eines Tages mit ihr in der Todeszelle stehen würde, wie in Landshut mit Hutterer, mit Fischer, mit Steingruber.
Die Megäre aus Wien
Die Frage, die in diesen trüben Märztagen des Jahres 1927 um die Welt geht, hat nichts mit Politik, mit Sport oder mit Krieg zu tun. Man stellt sie in den Cafés von Paris, in den U-Bahnen Berlins, in den Büros der Londoner City, in den Bars von New York, in den Straßen von Wien. Diese Frage ist kurz und ungeheuerlich. Sie lautet:
Kann sich ein Mensch vorsätzlich, mit eigener Kraft, bei vollem Bewußtsein, das Bein abhacken?
Staatsanwalt Dr. Baumann sagt ja. Er ist groß und schlank, und er verliest seine Anklageschrift ohne Erregung.