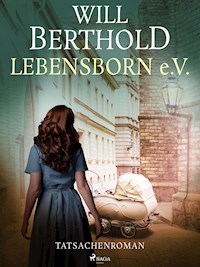Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Malmedy – dieser Name steht für eines der besonders dunklen Kapitel des Zweiten Weltkriegs: das Massaker an amerikanischen Gefangenen im Zuge der Ardennnen-Offensive Ende 1944 an der Straßenkreuzung nahe Malmedy. Wieder einmal ist Will Berthold ein eindringlicher Kriegsroman gelungen, der sich auf Tatsachenberichten stützt. In seiner Erzählung schildert Berthold aber nicht nur die schrecklichen Ereignisse am 17. Dezember 1944, sondern konzentriert sich in erster Linie auf die Vorgänge während des Dachauer Kriegsverbrecherprozesses. Hauptfigur dabei ist der US-amerikanische Chefverteidiger Evans, der als Jurist und Oberst damals seinen Dienst im besiegten Deutschland tat und sich dafür einsetzte, keine blindwütige Rache gegen die 43 Verurteilten walten zu lassen. "Schuldig" oder "unschuldig" entschied damals über Tod oder Überleben der vor Gericht stehenden früheren SS-Soldaten.Will Berthold (1924–2000) war einer der kommerziell erfolgreichsten deutschen Schriftsteller und Sachbuchautoren der Nachkriegszeit. Seine über 50 Romane und Sachbücher wurden in 14 Sprachen übersetzt und erreichten eine Gesamtauflage von über 20 Millionen. Berthold wuchs in Bamberg auf und wurde mit 18 Jahren Soldat. 1945 kam er vorübergehend in Kriegsgefangenschaft. Von 1945 bis 1951 war er Volontär und Redakteur der "Süddeutschen Zeitung", u. a. berichtete er über die Nürnberger Prozesse. Nachdem er einige Fortsetzungsromane in Zeitschriften veröffentlicht hatte, wurde er freier Schriftsteller und schrieb sogenannte "Tatsachenromane" und populärwissenschaftliche Sachbücher. Bevorzugt behandelte er in seinen Werken die Zeit des Nationalsozialismus und den Zweiten Weltkrieg sowie Themen aus den Bereichen Kriminalität und Spionage.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 850
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Will Berthold
Malmedy
Das Recht des Siegers
SAGA Egmont
Malmedy - Das Recht des Siegers
Malmedy Das Recht des Siegers (Mitgefangen Mitgehangen, Malmedy, Malmedy aufgeschoben aufgehoben)
Copyright © 2017 by Will Berthold Nachlass represented by AVA international GmbH, Germany (www.ava-international.de)
Originally published 1957 by Kindler Verlag, Germany
Copyright © 1957, 2017 Will Berthold Lindhardt og Ringhof Forlag A/S
All rights reserved
ISBN: 9788711727348
1. Ebook-Auflage, 2017
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt og Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk– a part of Egmont www.egmont.com
Erstes buch
Mitgefangen — Mitgehangen
Malmedy
1. kapitel
Das große, weiträumige Haus von München-Harlaching hat schon viel schlimmere Stürme erlebt als den heutigen Abend. Es ist kurz nach 22 Uhr, und nur wenige Gäste, eine bunte, vom Zufall zusammengewürfelte Gesellschaft von Amerikanern und Deutschen, können noch auf den Beinen stehen. Der dünne Whisky hat ihnen dicke Köpfe gemacht.
Der eigentliche Besitzer der Herrschaftsvilla sitzt in einem Internierungslager. Mit Recht übrigens. Sein derzeitiger Vertreter, ein rundlicher Besatzungsmajor, liegt bereits im Bett und gibt den überreichlich getrunkenen Schnaps wieder von sich. Der Gastgeber ist nicht der einzige, der schlappmacht. Der Stil der Partys des Jahres 1946 ist mitunter die Stillosigkeit …
Leutnant Henry F. Morris ist ganz und gar nicht in Laune. Seit zwei Stunden beobachtet er schweigend und verdrossen die willigen, billigen Mädchen und die girrenden, hektischen Damen, die nie genug bekommen. Seit dieser Zeit steht die Frau eines früheren NS-Parteibonzen im Mittelpunkt und führt das große Wort; dabei weiß jeder von ihr, deren Namen früher auf den Titelseiten der Zeitungen beinahe täglich zu finden war, daß sie in ihrer Villa am Tegernsee den amerikanischen Befreiern splitternackt entgegengekommen war.
Die Unterhaltung ist zweisprachig. Der junge, schlaksige Leutnant kann das miserable Englisch und das gebrochene Deutsch nicht mehr hören. Er greift sich nochmals einen „Scotch“ und wünscht sich 4000 Kilometer weg von hier. Der Krieg ist zwei Jahre aus, und er weiß nicht, was er in diesem verdammten Germany noch zu suchen hätte.
„Mixen Sie mir auch einen“, sagt ein junges Mädchen hinter ihm.
Er nickt, ohne sich umzudrehen.
„Noch mehr Soda?“ fragt er gewohnheitsmäßig.
„Nein, danke, es reicht.“
Jetzt erst sieht er sie … und er sieht sie gerne. Sie ist mittelgroß, dunkelblond, hat helle, wache Augen und eine hübsche Stirn. Ihr Englisch ist so sauber wie ihr Gesicht.
„My god … wo kommen Sie denn her?“ fragt Leutnant Henry F. Morris.
„Ich habe mich verspätet. Aber auf Partys dieser Art kommt man wohl nie zu spät.“
„Bestimmt nicht.“
Mit den Gläsern in der Hand verziehen sich die beiden in eine Ecke, finden zwei Polsterstühle, lassen sich nieder, schlagen die Beine übereinander, betrachten sich lächelnd.
„Ich wollte gerade gehen.“
Der Leutnant gibt sich keine Mühe, seine Sympathie besonders zu verstecken.
„Lassen Sie sich nicht aufhalten“, versetzt das Mädchen.
Er steht auf, versucht einen Augenblick lang gerade dazustehen, streckt ihr die Hand hin und sagt:
„Ich bin Henry F. Morris.“
„Ich heiße Vera Eckstadt.“
Sie lächelt, ohne dabei den Mund zu verziehen. Sie ist selbstsicher, natürlich kokett, ohne eine Spur von Pose dabei. Sie wirkt wie eine Zwanzigjährige, könnte aber auch schon älter sein.
„Schade, daß wir uns ausgerechnet hier kennenlernen müssen“, nimmt der Amerikaner das Gespräch wieder auf.
„Wo sollten wir es sonst?“
„Es ist seltsam. Entweder ich kann jemanden in der ersten Sekunde leiden oder ich kann ihn nicht ausstehen.“
„Sie können mich also leiden“, antwortet das Mädchen lächelnd.
„Ja“, sagt er. Einen Augenblick lang wirkt er verlegen. „Es ist schrecklich mit diesen Leuten hier“, erklärt er, „sie wollen alle was. Die einen Zigaretten oder Schnaps, die anderen ihre Entnazifizierung oder eine Lizenz oder sonst irgendeinen Unfug.“
„Ja. Manche füllen sogar den Zucker in mitgebrachte Tüten“, entgegnet Vera. Sie legt sorgfältig das linke Bein über das rechte, streicht mit einer knappen, keineswegs prüde wirkenden Bewegung den Rock glatt.
„Ihr Amerikaner habt eben zuviel, und wir Deutsche haben zuwenig.“
„Na ja“, erwidert Henry, „nicht ganz ohne Grund, nicht?“
Sie nickt.
„Ich kann mir schon vorstellen, wie das bei euch ist. Aber Sie können nicht wissen, wie einen das alles ankotzt, wenn jeder, dem Sie begegnen, etwas von Ihnen will … Auf einmal haben Sie das Gefühl, Sie sind in einem Netz und gleich kommt die Spinne …“
Sie nickt wieder. Sie wirkt jetzt ernst und müde.
„Ja“, sagt sie leise, „und dabei will ich auch etwas von Ihnen.“
Er hört es gar nicht.
„Ich bin nur hierhergekommen, um Sie zu treffen.“
Er schweigt noch immer.
Sie wird heftig:
„Hören Sie, Henry F. Morris, ich will etwas von Ihnen!“
„So“, sagt er langgedehnt und verständnislos.
Er greift hastig in die Tasche, holt eine Zigarette hervor, will sie anzünden. Das Feuerzeug versagt.
„Sie müssen mich morgen mit Colonel Evans zusammenbringen … Sie sind doch sein Assistent, nicht?“
„Zum Teufel, was wollen Sie eigentlich“, stößt er hervor.
„Wenn Sie mir nicht helfen“, sagt sie leise und bestimmt, „wird ein Unschuldiger gehängt.“
„Können Sie mir einen Deutschen zeigen, der nicht schuldig ist?“
„Ja“, erwidert sie.
Sie steht auf. Ihr Blick wird auf einmal merkwürdig starr, als ob sie in eine imaginäre Ferne sähe, als ob sie Raum und Zeit vergäße, als ob sie entsetzlich allein sei.
„Ja“, sagt sie noch einmal. Ganz leise.
„Meinen Bruder.“
In der ersten Sekunde begreift es der Leutnant nicht. Dann ist es soweit. Er würgt den Fluch hinunter, betrachtet Vera Eckstadt, lächelt dümmlich dabei, versucht die Zigarette noch einmal anzuzünden, schnappt sein Whiskyglas, trinkt es in einem Zug leer. Die Minute ist aus Gummi. Sie ist endlos, gemein und quälerisch …
An diesem Tag zweifelt Colonel Evans zum erstenmal in seinem Leben an Gott. An der Weltordnung. An der Würde des Menschen. An der Humanität seines Landes. Am Fortschritt. An diesem Tag fürchtet der Oberst alles zu verlieren, an das er bisher glaubte …
An diesem Tag verflucht der Oberst die Tatsache, daß er Jurist ist. Daß er Englisch spricht. Daß er als Amerikaner zur Welt kam. Daß er die Uniform eines Obersten der Vereinigten Staaten trägt. Daß er sein Land liebt.
An diesem Tag glaubt er, es zu hassen.
Colonel Evans ist mittelgroß und zierlich, hat ein intelligentes, kantiges Gesicht, lebhafte, scharf beobachtende Augen. Er stammt aus Atlanta, der Hauptstadt von Georgia, und der energische, fast asketisch wirkende Mann ist schon auf den ersten Blick der Typ des Gentleman aus den Südstaaten.
Der Krieg spült ihn nach Deutschland. Er hatte keinen Grund, es besonders zu lieben. Und er liebte es auch nicht besonders. Er tat seine Pflicht. Er diente in der Army. Er brachte es bis zum Obersten. Eigentlich sollte er längst zurück sein, um sich um seine Rechtsanwaltspraxis zu kümmern. Er war jetzt bald an der Reihe und stand kurz vor der Rückreise in die Vereinigten Staaten.
Da kam der Auftrag.
Er sagte zunächst nein. Er hatte sich Ideale bewahrt. Schwachen, verführten, gescheiterten Menschen zu helfen, dazu war er jederzeit zu haben. Aber Verbrechern? Mördern? Dutzendfachen Mördern? SS-Henkern, die wehrlose Kriegsgefangene niederschossen? Die ihre letzten Schreie, ihre letzte Verzweiflung, ihre letzten Gebete ignorierten? Die sie gemeiner, erbarmungsloser abschlachteten als die Viehmärkte ihren täglichen Schweineauftrieb? Vertierten Unmenschen, die aus nächster Nähe mit der Maschinenpistole ihren Opfern zwischen die starren, entsetzten Augen schossen, daß die Gehirne herausspritzten wie der Tomatensaft aus einer nachlässig geöffneten Konservenbüchse? Mörder vertreten, die ihr Handwerk von der Pike auf gelernt hatten?
Man hatte ihm die Chefverteidigung des sogenannten Malmedy-Prozesses angetragen. Er kannte den Fall Malmedy wie jeder andere Amerikaner aus den Zeitungsberichten. Er wußte, daß Generalfeldmarschall Rundstedt in einem letzten Aufbäumen vor der totalen Niederlage Weihnachten 1944 seine Truppen weit nach Belgien hineingetrieben hatte. Daß es ihm gelungen war, einen letzten, wenn auch zeitlich sehr begrenzten Sieg zu erringen.
Soweit war die Sache in Ordnung. Was aber Malmedy zu einem unauslöschlichen Brandmal des Krieges machte, waren die Begleiterscheinungen der Ardennenoffensive. Voraustruppen der SS, teilweise in amerikanischer Uniform, ausgesuchte Leute, meist fanatische Nationalsozialisten, die fließend Englisch sprachen, waren in das Hinterland vorgestoßen und hatten Gefangene gemacht.
Und sie hatten sie, wie sie es zu nennen pflegten, umgelegt. Dafür standen sie jetzt vor Gericht. Vor einem bemerkenswert fairen Gericht. Vor Richtern, die sich redlich bemühten, unvoreingenommen die Taten zu beurteilen. Die meisten hatten ihre Geständnisse unterschrieben, sie hatten zugegeben, Gefangene ermordet zu haben.
Juristisch lag der Fall damit klar. Was nun kommen mußte, war das Urteil. Auch hier konnte es keinen Zweifel geben. An den Galgen von Landsberg war noch Platz für viele.
Für viele, die zu verteidigen Mr. Evans keine Lust hatte. Gut, man hatte ihm die Akten geschickt, und er hatte schließlich mit der natürlichen Neugier des Juristen, der kein Dossier vorbeiziehen lassen kann, darin geblättert.
Und dann war er auf Widersprüche gestoßen …
Da sollten Menschen an einer Friedhofsmauer erschossen worden sein … wo der Friedhof nicht eingesäumt war. Da sollte eine Belgierin auf einem Stuhl in ihrer Wohnung exekutiert worden sein, die in Wirklichkeit von einer amerikanischen Bombe erschlagen wurde. Da hatten frühere SS-Leute in schriftlichen Geständnissen zugegeben, Menschen ermordet zu haben … die noch lebten!
Soviel Zufälligkeiten, so viele Irrtümer auf einmal konnte es nicht geben. Das übersah der Colonel mit einem Blick. Hinter diesen Unstimmigkeiten mußte sich etwas Gräßliches, etwas Entsetzliches, etwas Ungeheuerliches verbergen.
Waren die Geständnisse erpreßt worden? Hatten die US-Ermittler ähnliche Methoden angewandt, wie sie durch die Gestapo weltbekannt und berüchtigt geworden waren?
Hier, an dieser Stelle seiner Untersuchung, drohten den Obersten Phantasie, Logik und Anstand zu verlassen. Hier konnte er einfach nicht mehr folgen. Hier war er am Ende seiner Vorstellungswelt angelangt.
Ein anderer hätte die Akten ohne weiteres in den Papierkorb geworfen und sich eine Fahrkarte nach Amerika besorgt.
Nicht so Colonel Evans. Er wird sich nichts schenken. Nichts sich, nichts seinem Land, nichts seiner Uniform, nichts seinen Farben. Seine Intelligenz wird das Gericht kennenlernen. Seinem Anstand werden die Angeklagten fassungslos gegenüberstehen. Seinen Mut wird die Presse in aller Welt rühmen.
Seinen inneren Kampf aber wird er mit sich selbst abmachen müssen.
Den Colonel geht mit großen Schritten in seinem Büro hin und her. Er hatte alle Einzelheiten der Akten im Kopf. Immer noch hofft er, daß sich die Widersprüche als ein Irrtum herausstellen werden, für den es eine ganz natürliche Erklärung gibt. Er unterbricht seinen Fußmarsch, geht auf das Aktenbündel zu, liest, schüttelt den Kopf, rennt wieder hin und her, reißt das Fenster auf, schließt es im nächsten Augenblick, zündet sich eine Zigarette an, wirft sie weg, tritt sie aus.
Leutnant Henry F. Morris ist eingetreten. Er wartet, bis der Oberst aufsieht.
„Eine Dame möchte Sie sprechen, Sir“, sagt er dann.
„Welche Dame?“
„Fräulein Eckstadt.“
„Kenne ich nicht“, versetzt der Colonel abweisend.
„Die Schwester eines Angeklagten.“
„Wie oft soll ich Ihnen noch sagen, daß ich keine Familienbesuche mag.“
„Es ist eine Bekannte von mir. Sir … Nur fünf Minuten.“
„Von mir aus“, knurrt der Colonel.
Er mustert Vera Eckstadt flüchtig, stellt sich vor, ohne ihr die Hand zu geben, sagt, daß er leider wenig Zeit hätte.
„Ich fasse mich kurz“, beginnt das Mädchen. „Mein Bruder ist einer der Malmedy-Angeklagten. Er hat ein Geständnis abgelegt, daß er fünf amerikanische Kriegsgefangene erschossen hat … Das ist nicht wahr. Ich kenne meinen Bruder gut. Er würde keiner Fliege etwas tun.“
„Warum legt er dann Geständnisse ab?“
„Das kann ich Ihnen genau erklären, Herr Oberst. Zuerst haben sie ihm eine Kapuze aufgesetzt. Dann hat man ihn in einen stockfinsteren Raum geführt. Dann hat man ihm gesagt, daß er in zwei Minuten erschossen wird. Dann hat man ihm brennende Streichhölzer unter die Nägel geschoben. Als er vor Schmerz aufbrüllte, schob man ihm das Geständnis zum Unterschreiben hin. Er war noch nicht weich. Man stellte noch andere Dinge mit ihm an. Soll ich sie Ihnen aufzählen, Sir?“
„Danke.“ Die Stimme des Colonel klingt scharf und schneidend.
„Eines Tages hielt er es nicht mehr aus. Und er gestand Verbrechen, die er nie verübt hatte. Er wollte sich lieber hängen als weiterquälen lassen.“
Der Oberst läßt Vera Eckstadt ruhig aussprechen. Er hat sein Gesicht in der Gewalt. Rein äußerlich ist ihm keine Spur von Bewegung anzumerken. Auch seine Stimme klingt völlig unverändert.
„Und wer soll das getan haben?“
„Die Namen kenne ich nicht. Vertreter der Anklage jedenfalls.“
„Hören Sie, Fräulein“, sagt der Oberst, und jetzt ist ihm der ganze Zorn, der ganze Ärger und der ganze Ekel voll anzumerken, „wollen Sie behaupten, daß Amerikaner so etwas tun?“
„Yes, Sir.“
„Wissen Sie, wie viele Millionen Juden die Deutschen vergast haben?“
„Ich weiß es“, antwortete das Mädchen, „ich weiß aber auch, daß mein Bruder genauso unschuldig sterben würde wie die jüdischen Mitbürger … Ich habe nicht viel, um ihn zu retten. Ich kann Sie nur bitten, anflehen …“
Dem Mädchen fällt das Sprechen schwer. Es weint, ärgert sich über die Tränen, versucht sie wegzuwischen, spricht stockend weiter:
„Ich will keine Gnade, Sir, für ihn. Die braucht er nicht. Gerechtigkeit, das wäre alles.“
Der Besuch dauerte tatsächlich nur fünf Minuten. Und er endete, äußerlich gesehen, ergebnislos. Aber der Oberst, sonst weit davon entfernt, sich von Gefühlen beeindrucken zu lassen, muß immer wieder an das Mädchen denken. Alles in allem wirkte sie sicher, natürlich, unpathetisch.
Ihrem Bruder war es gelungen, einen Brief aus der Zelle, in der er seit Monaten in Einzelhaft saß, zu schmuggeln. Aber würde nicht auch ein Mörder seiner Schwester gegenüber beteuern, unschuldig zu sein? Und würde nicht auch die Schwester eines Mörders annehmen, daß ihren Bruder keine Schuld träfe?
Am gleichen Tag noch fordert der Colonel die Akten des Gefreiten Werner Eckstadt an. Am gleichen Tag noch entschließt er sich, diesen Fall mit äußerster Gründlichkeit zu untersuchen. Ganz egal, wie seine Recherche ausgeht. Der Oberst wird auf der Seite des Rechts stehen. Auf der Seite der Menschlichkeit. Des Anstands. Der Sitte. Und wenn er diesen verdammten Deutschen in die Hände arbeiten müßte. Und wenn er sie einzeln vom Galgen abschneiden würde. Und wenn das Unrecht seines Landes durch die ganze Weltpresse ginge. Und wenn er sich an den Präsidenten persönlich wenden müßte.
Der Fall wird symptomatisch für den ganzen Malmedy-Prozeß sein. In ihm werden sich die Verbrechen widerspiegeln, hüben wie drüben. Und der Fall Eckstadt wird beweisen, daß das Verbrechen an keine bestimmte Uniform und an keine Nationalität und an keine Sprache gebunden ist. Daß es hüben wie drüben Mörder gibt, geborene, feige, hinterlistige Mörder. Und doch ist da ein Unterschied: vom Staat systematisch zu Mördern erzogene Menschen gibt es nur in einer Diktatur.
Und Menschen gibt es hüben wie drüben …
Am 7. August 1944 begann der Leidensweg des Gefreiten Werner Eckstadt. Er stand wie jeden Morgen am Kasernenhof und hörte nur mit halbem Ohr hin. Immer der gleiche Seich, den der Spieß vor dem Genesungshaufen des Panzerregiments zu verzapfen hatte: Wer Latrine reinigt, wer Kartoffeln schält, wer Wache schiebt, wer in Urlaub fährt und wer zur Nachuntersuchung muß …
Die Genesungskompanie stand im Drillich und ohne Koppel auf dem Kasernenhof einer mitteldeutschen Kleinstadt. Das dazugehörige Panzerregiment verblutete in Rußland. Nur wer dem Tod von der Schippe sprang, hatte Aussicht, nach der Entlassung aus dem Lazarett eine Weile unter der Leitung von Hauptfeldwebel Hanke die Kaserne zu polieren. Aber nicht zu lange. Wenn sich die Knochen wieder halbwegs bewegen ließen, unterschrieb der Stabsarzt die Fahrkarte … in die Ewigkeit oder bis zum nächsten Mal.
Später erinnerte sich der Gefreite Eckstadt noch an alle belanglosen Einzelheiten des Tages, der die entscheidende Wendung in sein Leben brachte. Im dritten Glied stehend, hatte er mit dem Fuß Kringelzeichen in die Schlacken des Kasernenhofs gezeichnet. Sein Nebenmann bohrte in der Nase. Plötzlich stank es fürchterlich.
„Hier hat einer nen toten Vogel in der Tasche“, sagte ein Obergefreiter. Alle schienen sich über den Gestank zu freuen.
„Was gibt’s zu lachen, Herrschaften?“ fragte der Spieß. Aber er interessierte sich nicht weiter dafür. Er gab die Parole bekannt und schob sein Buch wieder unter das zweite Knopfloch der Uniformjacke.
Bevor er wegtreten ließ, sagte er noch:
„Eckstadt, Sie melden sich anschließend auf der Schreibstube.“
Sicherheitshalber ging der Gefreite erst noch einmal auf seine Stube zurück, um sich mit dem angebissenen Kunsthonigbrot zu beschäftigen. Er war lange genug beim Kommiß, um zu wissen, daß es in diesem Krieg nichts gab, was nicht noch eiliger werden konnte.
Der Spieß nickte mit dem Kopf, als Eckstadt die Hacken zusammenschlug und sich bei ihm meldete.
„Nee“, sagte er, „nicht zu mir. Zum Chef.“
Er zeigte mit dem Daumen über die Schulter. Er hatte nur noch einen Arm. Für den anderen hatte er das „Deutsche Kreuz in Gold“ bekommen, das die Landser „Spiegelei“ nannten.
Eigentlich war der Kompanie-Chef, Hauptmann Pfeiffer, ganz in Ordnung. Aber Eckstadt war ihm einmal dumm gekommen.
„Wollen Sie Offizier werden, lieber Eckstadt?“ hatte ihn der Kompanie-Chef gefragt.
Der Gefreite antwortete zu spontan:
„Nein, Herr Hauptmann, ich möchte lieber einen Beruf ergreifen.“
„Da sind Sie ja“, sagte der Hauptmann jetzt, „… Sie können sich setzen.“
„Bitte Herrn Hauptmann danken zu dürfen“, salbaderte Eckstadt herunter.
„Nach der letzten Untersuchung sind Sie k. v.“
„Jawohl, Herr Hauptmann.“
„Der Arm ist wieder in Ordnung?“ fragte Hauptmann Pfeiffer und lächelte flüchtig. Er erwartete keine Antwort.
Eckstadt sah auf die Narbe herab, deren unteres Ende brandrot und violett aus dem Jackenärmel herausleuchtete.
„Eckstadt, Sie sind abkommandiert.“ Der Hauptmann zog ein Stück Papier aus einem Aktendeckel.
„Jawohl, Herr Hauptmann“, erwiderte der Gefreite müde. Er hatte längst damit gerechnet.
„Ja … Aber nicht zur alten Einheit … Sie sind zur SS versetzt.“
„Nein“, sagte Eckstadt. Es fuhr ihm so heraus.
„Ich kann’s nicht ändern.“
Der Kompaniechef stand auf und ging ein paar Schritte hin und her.
„Es ist nur vorübergehend.“ Es klang beinahe entschuldigend. „Ihre Mutter ist Engländerin?“ fragte der Offizier wie zur nachträglichen Bestätigung.
„Ja“, entgegnete Eckstadt. Wie sollte er wissen, daß das der Grund seiner Versetzung war. Wie sollte er ahnen, daß ihn seine tadellosen, englischen Sprachkenntnisse direkt in die Hölle führen würden? Eines Tages würde er es begreifen, wenn er ohne Aussicht und ohne Hoffnung, ohne Gnade und Erbarmen, von Verzweiflung und von Todesangst geschüttelt, in ein unentwirrbares Netz von Mord, Lüge, Betrug und Verbrechen verstrickt sein würde … Hauptmann Pfeiffer stand auf. Der Gefreite folgte ihm automatisch. Einen Augenblick standen sie sich dicht gegenüber: der Hauptmann schlank und schmal, mit olivgetönter Haut, die schwarzen Haare wie eine lackierte Kappe am Kopf anliegend; der Gefreite etwas untersetzter, breitschultriger, mit gekräuseltem, sandfarbenem Haar und blitzenden, weißen Zähnen.
„Sie haben doch nichts gegen die SS?“ fragte Pfeiffer.
Eckstadt überlegte. Hatte er etwas gegen sie? Einmal mußte sein Regiment eine SS-Division heraushauen. Ein anderes Mal war er selbst von der SS herausgehauen worden.
Wenn Eckstadt länger darüber nachgedacht hätte, wäre ihm manches eingefallen, was ihm nicht an der SS paßte.
Der Hauptmann streckte ihm die Hand hin.
„Alles Gute, Eckstadt … Und machen Sie uns keine Schande.“
Er ist in Ordnung, dachte der Gefreite, auch wenn er mich an die SS verkauft hat.
Der Spieß machte die Papiere fertig und bot dem Gefreiten eine Zigarette an.
Das war der Abschied vom Heer.
So kam er zur SS.
Die Einheit, bei der er sich melden sollte, lag mitten in der Heide in einem Barackenlager. Die Straße dorthin war ungepflastert. Ein langer Saum von Birken stand traurig daneben. Eckstadt machte ein saures Gesicht. Er glaubte Füchse und Hasen zu sehen, die einander gute Nacht wünschten.
Die SS-Leute machten kein großes Aufheben von seinem Erscheinen. Auf den ersten Blick sah alles ähnlich aus wie beim Heer. Die feineren Unterschiede sollte er erst im Laufe der Zeit kennenlernen.
Er meldete sich auf der Schreibstube beim Hauptscharführer. Das war ein Bulle mit einem Baß und einem Kindergesicht.
„Na, wollen mal sehen, was uns die Wehrmacht geschickt hat“, sagte er und betrachtete Werner Eckstadt grinsend. „Dich wollten sie wohl loswerden?“
„Nein, Herr Hauptfeldwebel.“
„Keine Beleidigungen. Ich bin kein ,Herr‘ und kein ,Hauptfeldwebel‘. Das heißt: Nein, Hauptscharführer. Kapiert?“
„Jawohl, Herr … äh … Hauptscharführer.“
„Das wirst du noch lernen.“
Eckstadt nahm seinen Laufzettel in Empfang.
„Weißt du eigentlich, was hier los ist?“ fragte der Spieß gutgelaunt.
„Nein. Hauptscharführer.“
„Aber ich.“ Der Bulle mit dem Kindergesicht grinste. Hintergründig. Sonst sagte er nichts.
Zum ersten Mal spürte Werner Eckstadt den Druck in der Magengegend, als er auf der Bekleidungskammer die neuen Klamotten empfing. SS-Klamotten. Die Feldmütze paßte er sich vor einem Spiegel auf. Sie hatte vorne einen Totenkopf. Eckstadt und der Totenkopf musterten sich gegenseitig erschrocken.
In der Stube saßen schon sieben Mann. Sogar drei Unterscharführer unter ihnen.
„Heil Hitler!“ sagte Eckstadt. Er wollte nichts falsch machen. Aber es nützte nichts. Die Gespräche verstummten. Hitlers politische Soldaten fühlten instinktiv den Außenseiter: einen, der dem Führer keinen Blankoscheck ausgestellt hatte; einen, der in einer anderen Welt gelebt hatte als sie; einen, der nicht freiwillig, sondern gezwungen zu ihnen gestoßen war; einen, dem man mißtrauen mußte.
Sie ließen es ihn von der ersten Sekunde an fühlen. Sie würden es ihn so lange spüren lassen, bis sie ihre eigene, erbärmliche, beschissene Angst vom hohen Roß ihres Elitebewußtseins herunterfegte.
Nur ein netter Junge mit einem blonden Kopf und einem offenen Gesicht half Eckstadt beim Spindeinräumen.
„Ich heiße Willi Seifried“, sagte er. Etwas leiser fügte er hinzu: „Weißt du, was die hier mit uns vorhaben?“
„Du bist wohl auch nicht freiwillig?“
„Bei der SS schon“, erwiderte der Junge, „nur hier nicht … Meine Division hat mich abgestellt. Sie suchten Leute, die fließend Englisch sprechen.“
„Ach“, entgegnete Eckstadt. Wieder spürte er das unbewußte Grauen. Er dachte verzweifelt nach. Aber er kam nicht dahinter. Noch nicht.
Aber jeder Tag des Dienstes, der am anderen Morgen begann, brachte ihn näher an die fürchterliche Wahrheit. Jeder Tag bestätigte den entsetzlichen Verdacht, der ihm gekommen war.
Sie waren insgesamt 80 Mann. Diese 80 wurden von einem Obersturmbannführer geschliffen. Als erstes lernten sie alle Tricks, die man braucht, um sich in einem vom Feind besetzten Gebiet über Wasser zu halten. Nachmittags lernten sie Englisch. Genauer gesagt: sie lernten den amerikanischen Akzent. Sie büffelten amerikanische Rangabzeichen vor großen Tafeln. Plötzlich waren auch amerikanische Waffen da, an denen sie ausgebildet wurden. Nach zwei Wochen spulte der Dienstplan ganz auf englisch um. Es wurde ihnen verboten, deutsch zu sprechen. Und der Obersturmbannführer schiß sie auf englisch an, wenn ihnen manchmal noch ein deutsches Wort herausrutschte.
Es hieß nicht mehr „Scheiße“, sondern „shit“.
Nach drei Wochen trat das Ereignis ein, das für Werner Eckstadt den letzten Zweifel und auch die letzte Hoffnung beseitigte, noch einmal aus dieser Mausefalle herauszukommen. Ein Lastauto schleppte olivgrüne, amerikanische Uniformen heran.
Sie standen vor der Kammer und nahmen sie in Empfang. Von jetzt ab hatte Werner Eckstadt Angst. Eiskalte Angst. Er sollte sie nicht mehr loswerden. Auf Jahre hinaus nicht mehr.
Die anderen faßten die Verkleidung zunächst als einen gelungenen Spaß auf. Natürlich waren genügend Latrinenparolen im Umlauf, aber die Gerüchte kamen an die einfache, brutale Wahrheit nicht heran. In ihrem stupiden Glauben, daß es „der Führer schon richtig machen wird“, war die Erkenntnis nicht miteingeschlossen, daß sie Hitler zu einem Verbrechen mißbrauchen wird. Zu einem Verbrechen ohne Beispiel.
„Wenn wir hiermit am Wochenende ausgehen“, sagte Uscha Roettger, auf die Ami-Uniform deutend, „wird die Heeresstreife dumm aus der Wäsche gucken.“
Die verzweifelte Wut schoß in Werner Eckstadt so schnell hoch, daß er seinen Mund nicht länger halten konnte. Er sah in die feixenden Gesichter seiner Stubenkameraden, und er betonte jede Silbe laut und überdeutlich:
„Die Heeresstreife wird Augen machen? … Ihr Armleuchter. Was meint ihr, was die Amis machen, wenn sie euch schnappen? Stielaugen werdet ihr kriegen, wenn sie euch den Strick um den Hals legen und am nächstbesten Ast hochziehen.“
Das Feixen in den Gesichtern erstarb plötzlich.
Eckstadt sprach weiter:
„Das dürfen sie nämlich. Da brauchen sie euch gar nicht um Erlaubnis zu bitten. Stellt euch doch nicht so dämlich an. Ihr wißt doch selbst, wie man mit Spionen und Saboteuren umgeht. Und die tragen bloß Zivil. Bei uns ist die Sache noch um einen Zacken schweinischer. Wir haben ihre Uniform an. Der Beschiß ist größer. Die Gemeinheit auch.“
„Halten Sie Ihre Schnauze“, brüllte ihn Unterscharführer Roettger an.
„Mensch, wie kannst du so etwas sagen?“ fragte Seifried … „Der Kerl will Meldung machen.“
„Weil’s die Wahrheit ist“, antwortete Werner.
Aus der Meldung wurde nichts. Am anderen Morgen bestätigte ein hoher SS-Führer jedes Wort von Eckstadts Behauptung. Der Standartenführer war mit dem Auftrag aus Berlin gekommen, den 80 Mann reinen Wein einzuschenken. Er entledigte sich dieser Aufgabe in dem von der nationalsozialistischen Propaganda geübten und gepflegten Stil. In einer Mischung aus Dramatik und Schnulze, aus Heldenbeschwörung und Gangster-Rotwelsch. Er sprach mit verantwortungsbewußten Worten von einer verantwortungslosen Sache.
Wenigstens machte er es kurz. Nach einer knappen Viertelstunde wußten die achtzig Mann, daß sie als verlorener Haufe bei der nächsten deutschen Offensive im Westen aus der Luft hinter den feindlichen Linien abgesetzt werden. In der Uniform des Feindes sollten sie Verwirrung stiften und den Nachschub sabotieren.
„Der Führer verlangt viel von euch“, sagte der Standartenführer zum Schluß, „aber denkt stets an ihn. Denn er gibt euch alles.“
„Scheiße“, murmelte Eckstadt. Sämtliche Stubennazis hörten es, verloren aber kein Wort darüber, vielleicht, weil sie dasselbe dachten.
Bei einer Unstimmigkeit über eine belanglose Frage kam es zur ersten Revolte. Scharführer Hepke drehte durch, sprang auf und brüllte:
„Macht doch gleich euren Laden zu! Verheizt uns doch! Wozu noch Umstände? Sagt doch gleich, daß ihr uns zum Verrecken ausgesucht habt!“
Der Obersturmbannführer statuierte das Exempel auf der Stelle. Er degradierte Hepke zum SS-Mann. Von jetzt ab meuterten die anderen nur dann noch, wenn keine Vorgesetzten in der Nähe waren.
Ausgang und Urlaub wurden gesperrt. Die Post war offen abzuliefern. Auf dem Dienstplan stand ein neuer Programmpunkt: Fallschirmspringen. An einem Holzgerüst wurde geübt. Einer brach sich ein Bein. Jeder wünschte sich das. Aber nur einer schaffte es.
Und Werner Eckstadt war jetzt mit der Angst nicht mehr allein. Er merkte es an den einfachsten Dingen. Auf einmal wurden seine Stubengenossen Kameraden. Die Angst trieb sie zu Haufen. Sie wurde zu einer ansteckenden Krankheit. Zwei Offizieren war es gelungen, sich krankheitshalber ablösen zu lassen.
Rottenführer Kerber hatte weniger Glück. Er meldete sich mit Fieber im Revier.
„Simulant“, brüllte ihn ein Arzt an.
Eine Woche lang blieb Kerber ganz still. Dann hatte er einen gräßlichen Unfall. Er war mit einer Kanne kochend heißen Wassers zum Rasieren in den Waschraum gegangen. Wie es passierte, sah niemand. Jedenfalls war Kerbers linker Arm hinterher von oben bis unten verbrüht. Es sah schrecklich aus. Und der Rottenführer hatte vor Schmerz einen fast irren Gesichtsausdruck. Aber seine Augen leuchteten glücklich.
Ende November brachte ein Kurier die Karten. Große, schöne Generalstabskarten. Das Einsatzgebiet der Sabotage-Trupps war bereits eingezeichnet.
„Die Ardennen“, sagte einer, und alle fuhren zusammen.
„Ja, die Ardennen“, erwiderte der Obersturmbannführer mit der Miene eines Magiers, der das Karnickel aus dem Zylinder zaubert.
Die Männer schwiegen. Sie starrten lautlos auf die Karte. Nicht jeder hat Gelegenheit, sich sein Grab vorher auszusuchen.
„Warst du mal da?“ fragte Willi Seifried den Uscha Haubold.
Der Unteroffizier nickte.
„Ja“, erwiderte er dann, „die höchsten Bäume in der ganzen Gegend. Schön zum Ansehen. Schlecht zum Dranhängen.“
Ab jetzt bekamen sie Schnaps in regelmäßigen Zuteilungen. Sie dachten nicht lange über die Gründe nach. Sie besoffen sich, wie es beabsichtigt war. Der Krieg hat bewährte Rezepte: gegen Verstopfung Rizinus, gegen Höllenangst Schnaps.
Werner Eckstadt rührte seine Ration nicht an. Er schenkte sie Uscha Roettger, dem Stubenältesten.
„Du bist ein feiner Kerl, Werner“, rülpste der Unteroffizier. „Ich hielt dich erst für ein Riesenarschloch … Aber du bist ’ne Nummer. Wir können dich in unseren Verein aufnehmen …“
Der Uscha war im Suff über seine eigenen Worte so gerührt, daß er Wasser in den Augen hatte.
„Danke“, erwiderte Eckstadt ganz ruhig. Er nahm das Glas aus Roettgers Hand und goß es dem Unterscharführer mitten in das Gesicht.
Sie sprangen alle auf. Eckstadt sah von einem zum anderen.
„Ihr könnt mich nicht riechen“, sagte er ruhig, „und ich die meisten von euch auch nicht. Ihr habt mich für eine feige Sau gehalten. Das bin ich auch. Ich bin nicht freiwillig zur SS gegangen. Aber ihr! Und jetzt scheißt ihr in die Hosen. Das stinkt! Das stinkt so sehr, daß ich davon das Kotzen bekomme …“
Er knallte die Stubentüre hinter sich zu. Er war müde. Und er war voller Ekel. Wie er das alles durchschaute. Da saßen sie nun und wollten eigentlich mit ihm Händchen halten, wollten ihm sagen: Sieh Kamerad, wir sind genauso feige Schweine wie du. Aber weil es der Führer befiehlt, spielen wir manchmal Helden, solange der Vorrat reicht. Jetzt reicht er nicht mehr …
Ganz plötzlich wurde es ernst. Auf einmal ging es los, noch bevor sie ihre Schnapsration ausgetrunken hatten. Der Alarm war hundertmal geübt. Er klappte. Undramatisch, mechanisch. Sie saßen zuerst in planverdeckten Lastautos der Waffen-SS und dann in Transportmaschinen der Luftwaffe.
Der Flug dauerte eine Stunde. Eine Stunde Zeit zum Beten oder zum Fluchen. Eine Stunde Zeit für nichts. Für sinnlose Gedanken. Für das Würgen im Hals. Für die schweißtreibende Angst. Für die mausgrauen, starren Gesichter der Nebenmänner.
„Es ist soweit“, sagte der Oberfeldwebel der Luftwaffe.
Er öffnete das Ausstiegsluk.
Dann sprang einer nach dem anderen.
Unmittelbar vor Werner Eckstadt war der Unterscharführer Roettger dran. Er zögerte eine Sekunde. Der Oberfeldwebel gab ihm einen Tritt in den Hintern. Er trat mit Genuß.
Eckstadt sah die Nacht unter sich.
Da bekam auch er seinen Tritt vom Schicksal …
2. kapitel
Sie fielen lautlos vom Himmel, Partisanen eines wahnwitzigen Befehls. Während sie vom Wind auseinandergetrieben wurden und plötzlich allein im feindlichen Hinterland standen, in der falschen Uniform, den Strick des Henkers fast schon fühlbar um den Hals, während sie sich mit ihrer Angst beschäftigten und ihre Instruktionen vergaßen, rumpelten die Motoren der Panzervorausabteilung der SS-Division Leibstandarte Adolf Hitler zum Angriff. Laub, Reisig, Tarnnetze, alles flog zur Seite. Seit drei Tagen hatten die 40 Tigerpanzer der „Gruppe Florian“ auf den Einsatzbefehl gewartet. Tag und Nacht standen sie im Feuer feindlicher Flugzeuge, stets waren sie vom Tod gesucht, bedroht, verfolgt.
Immer wieder war der Angriffsbefehl verschoben worden.
Wegen des Wetters. Der Generalfeldmarschall von Rundstedt brauchte niedrighängende Wolken, schlechte Fliegersicht, damit seine Panzer operieren konnten. Die Besatzungen hätten ihm dankbar sein sollen. Aber sie verwünschten ihn und seine Offensive, den Scheißkrieg und den stählernen Sarg, in dem sie bereits aufgebahrt waren … sie verwünschten den besten Kameraden und die eigenen Eltern, denen sie ein Leben verdankten, das schon keines mehr war, ehe es überhaupt begonnen hatte.
Obersturmführer Klausen, der Führer einer Panzerkompanie in der „Gruppe Florian“, fuhr seinen Panzer offen. Er lehnte im Turm und beobachtete, wie seine Leute hinter ihm einschwenkten. Er hatte das Manöver oft gesehen, aber jedesmal mit besseren Gefühlen als heute.
Die Landser hatten der Ardennenoffensive bereits einen Namen gegeben, noch bevor sie gestartet worden war. Unternehmen „Von der Hand in den Mund“ hieß sie. Die Panzer hatten nicht genug Sprit.
„Den müßt ihr euch von den Amis holen!“ hatte der Befehl allen Ernstes gelautet. „Ihr müßt so schnell sein, daß euch die Spritlager der Amis in die Hände fallen …“
„Karbid“, schrie der Obersturmführer seinem Fahrer zu. Das heißt in der Panzersprache: „Gib Gas!“
Und die Stahlkolosse rauschten los …
Soweit ist Colonel Evans mit dem Aktenstudium gekommen. Wieder läuft er im Zimmer hin und her. Er wird sich diesen Eckstadt vornehmen. Gut, warum soll nicht auch ein Anständiger unter den Malmedy-Angeklagten sein! Es wird keiner gehängt, solange der Oberst von seiner Unschuld überzeugt ist. Dafür wird er seinen ganzen Einfluß, seinen ganzen Mut, sein ganzes Gewicht einsetzen.
Er ruft den Staatsanwalt an.
„Wie Sie wissen, habe ich die Verteidigung übernommen“, sagt der Oberst.
„Ich hätte mir das an Ihrer Stelle noch einmal überlegt“, versetzt der Staatsanwalt knapp.
„Ich brauche Ihre Ratschläge nicht“, fährt ihn der Colonel an. „Ich möchte eine Sprechkarte haben.“
„Die kann ich Ihnen nicht geben.“
„Passen Sie auf“, erwidert der Colonel langgedehnt, „entweder ich habe in einer Viertelstunde in meinem Büro eine Sprechkarte für das Kriegsverbrechergefängnis in Schwäbisch-Hall oder Sie können etwas erleben, was Ihnen noch nie passiert ist!“
Der Oberst wirft den Hörer auf die Gabel zurück. Sein Gesicht ist gerötet. Wieder saust er hin und her. Er wird den Weg der vorstoßenden Panzer, der abgesprungenen Saboteure weiterverfolgen, bis er restlose Klarheit hat.
Hier stimmt etwas nicht.
Er fühlt, er ahnt, er weiß es.
Die Stadt ist grau wie der Himmel, grau wie die Gesichter ihrer Passanten, die der Alltag gehetzt, verbissen, schweigend auf die schmutzigen Straßen spuckt. Nur die bunten Gruppen schwatzender Schwarzhändler vor dem Deutschen Museum, am Isartorplatz und in der Möhlstraße beleben das Stadtbild. Hilflose Polizisten beobachten Zigarettenverkäufe … Warum sollten sie eingreifen? Vielleicht sind ihre eigenen Frauen gerade unterwegs, verscheuern eine Kommode gegen Butter oder Butter gegen eine Kommode …
Mit kräftigen, bulligen Soldaten besetzte Jeeps fahren langsam an den Gehsteigen entlang. Die GIs rufen in ihrem quakenden Landserenglisch den Mädchen Scherzworte zu, halten plötzlich den Wagen an und kontrollieren einen Passanten, dessen Nase ihnen mißfiel. Erst wenn der Abend kommt, endet für sie die Langeweile, in irgendeiner Beize, bei teurem Schnaps und billigen Mädchen.
Vera geht durch die Maximilianstraße, ignoriert die Blicke der Männer, die Angebote der Schwarzhändler und die Rufe der Militärpolizei. Der Wind rafft ihren dünnen Mantel. Ihr Gesicht ist gerötet. Sie geht lässig und selbstbewußt, langsam, die Augen im Niemandsland der Gleichgültigkeit. Sie trägt Nylonstrümpfe, die den letzten Monatsgehalt kosteten, und sie geht so zierlich und sicher auf ihren hohen Absätzen, als sei sie mit ihnen bereits zur Welt gekommen.
Am Max-Joseph-Platz fährt eine schwarze Limousine dicht an den Randstein heran. Ein Zivilist steigt aus und geht auf Vera zu.
„Sie sind Fräulein Eckstadt?“
Vera nickte gleichgültig.
„Kommen Sie mit!“
„Was wollen Sie?“
„Fragen Sie nicht … CIC, amerikanischer Geheimdienst.“
Das Mädchen zögert noch eine Sekunde. Mechanisch betrachtet sie das Auto, sieht die amerikanische Nummer. Man hat sich als Deutscher daran gewöhnt, Befehle auszuführen, auch wenn sie zunächst noch völlig unverständlich sind.
Zwei Männer sitzen noch im Wagen. Der Fahrer biegt in die Prinzregentenstraße ein, gibt Gas, rast die Windungen am Friedensengel hoch, überquert das Rondell, hält vor einem von Säulen umgebenen Haus.
„Kommen Sie“, sagt der Zivilist zum zweiten Male in anglisiertem Deutsch. Er hat ein zu kurzes Kinn und ein zu langes Sakko, spricht brüsk, ist ein Teil jener Unwichtigkeit, die im Jahre 1946 so wichtig war.
Er führt Vera in ein Büro, läßt sich auf einen Stuhl fallen, zündet sich eine Zigarette an und sagt gedehnt:
„Setzen Sie sich, Fräulein Eckstadt.“
„Was wollen Sie eigentlich von mir?“ fragt Vera nochmals. Ihre hellen, wachen Augen sind zu einem schmalen Spalt zusammengezogen. Ihr Blondhaar fällt sorgfältig geordnet in den Nacken und endet in einer hübschen Rolle. Sie hat die Beine übereinandergeschlagen, entnimmt ihrer Handtasche eine Zigarette, gibt sich selbst Feuer, sieht dabei zum Fenster hinaus.
„Do you speak English?“ fragt der Mann.
„Ja“, versetzt Vera, „genausogut wie Sie Deutsch.“
Ein uniformierter Leutnant steht lässig im Hintergrund, betrachtet Vera. Das Gespräch interessiert ihn nicht.
„Sie waren beim BDM?“
„Natürlich.“
„Und Ihr Bruder war bei der SS?“
„Ja“, erwidert sie, „und mein Vater bei der NSV … Wollen Sie mir nicht endlich sagen, wer Sie sind?“
„Ich heiße Bauer“, antwortet der Mann.
„Sie haben sich an Colonel Evans herangemacht“, fährt er fort, „und ihm Greuelmärchen erzählt. Ich will hier nicht wiederholen, was Sie alles behauptet haben. Sie wissen es ja selbst am besten.“
Bauer steht auf, geht am gleichgültigen Leutnant vorbei, läuft ein paar Schritte hin und her.
„Das ist Nazipropaganda“, sagt er dann heftig. „Ich warne Sie. Wir sind hier, um die Demokratie zu schützen. Wir dulden keine verlogenen Angriffe!“
„Ich habe nur die Wahrheit gesagt“, entgegnet Vera heftig, „und ich dachte, in der Demokratie kann man die Wahrheit sagen.“ Sie steht auf. Ihre Augen blitzen. Sie spricht schnell und kalt: „Oder wollen Sie mich einsperren? Wie meinen Bruder?“
„Seien Sie ruhig!“ entgegnet Bauer.
Der Leutnant zerquetscht unbeteiligt seinen Kaugummi, immer noch Vera anstarrend.
„Sie wissen jetzt, was Ihnen droht“, fährt Bauer fort, „überlegen Sie es sich genau, sonst verlassen Sie heute zum letzten Mal dieses Haus.“
Ein Gedanke schießt Vera plötzlich durch den Kopf. Sie betrachtet den Uniformierten lächelnd und sagt in englischer Sprache:
„Und was meinen Sie, Leutnant? Wollen Sie auch die Demokratie mit Gefängnissen verteidigen?“
Der Leutnant malmt bedächtig auf seinem Kaugummi herum, grinst, richtet sich auf.
„Ich finde, daß Sie ein sehr hübsches Girl sind“, sagt er dann.
„Wenigstens etwas“, entgegnet Vera.
Bauer setzt sich ärgerlich.
„Ich habe keine Vorurteile“, setzt der Leutnant hinzu, „wenn Sie Lust haben, gehen wir heute abend miteinander aus.“
Vera überlegt blitzschnell. Heute abend ist sie mit Leutnant Henry F. Morris, dem Assisten von Colonel Evans, verabredet. In Sachen ihres Bruders natürlich. Was sollte sie sich sonst aus dem Leutnant machen? Aber vielleicht kann dieser CIC-Leutnant weiterhelfen? Vielleicht kann sie ihn zum Sprechen bringen? Vielleicht kann sie diese schlaksige Gleichgültigkeit aus ihm heraustreiben … vielleicht kann sie Werner helfen?
„Lust habe ich keine“, erwidert sie lächelnd, „aber ich gehe trotzdem mit Ihnen aus.“
„Ich heiße Tebster“, sagt der Leutnant, geht auf sie zu und schüttelt ihr die Hand. Er läßt Bauer wie eine heiße Kartoffel fallen, nickt Vera zu. „Ich bringe Sie zurück“, setzt er hinzu.
Unter der Türe dreht er sich nach Bauer um.
„Mein Freund hier ist manchmal sehr eilfertig. Machen Sie sich nichts daraus.“
Vera nickt. Ganz kann sie ihren Triumph nicht hinunterschlucken.
„Auf Wiedersehen, Herr Bauer“, sagt sie ironisch.
Der Mann blickt sie nicht an, er schaut zum Fenster des CIC-Gebäudes hinaus.
An diesem Tag ist Colonel Evans in das Hauptquartier der amerikanischen Armee nach Heidelberg gefahren. Trotz massiver Drohungen erhielt er keine Sprechkarte für die Insassen des Gefängnisses in Schwäbisch-Hall. Der Ankläger, ein Oberleutnant, würde es nicht wagen, sie ihm so hartnäckig zu verweigern, wenn er nicht von der Armee gedeckt würde. Darum kümmert sich der Colonel nicht. Er ist entschlossen, den Stier bei den Hörnern anzugehen – wie bei einem Rodeo in seiner Heimatstadt Atlanta.
Heute morgen hat ihn die Versetzung nach Amerika erreicht. Er warf sie in den Papierkorb. Drei Gesuche zuvor waren abgelehnt worden. Und jetzt, ausgerechnet jetzt, da er in diesen Dreckhaufen von Akten griff, schenkte man ihm die Rückfahrkarte! Eine große, erfolgreiche Rechtsanwaltspraxis wartet auf ihn, eine Frau und zwei Kinder, die er liebt, ersehnen seine Ankunft …
Der Colonel geht durch die Versuchung hindurch, unbedacht, ungehemmt, unbeirrt. Sein Anstand und seine Courage haben ihm eine Falle gestellt, in die er blindlings hineinläuft … ein Mann, ein Mensch, ein Charakter. Er bedenkt nicht, daß er Deutschen hilft, die er eigentlich nicht leiden kann.
Einen ganzen Tag braucht er, um an den Zwei-Sterne-General Simson heranzukommen. Eine Mauer schweigender Höflichkeit schien langsam vor ihm zurückzuweichen. Er wurde vertröstet, zum Essen eingeladen, belobigt, abgelenkt. Aber so kann man mit Colonel Evans nicht umgehen. Er will zum General. Und er wird ihn treffen und wenn er eine Woche warten muß.
Am Abend schafft er es. Er wird in die schneeweiße Villa eingeladen. Eine Party natürlich. Der General begrüßt ihn höflich und wendet sich sofort seinen anderen Gästen zu. Der Colonel läßt den Whisky stehen. Er wartet.
Um 22 Uhr ist es so weit. Er faßt den General, geht mit ihm in einen Nebenraum.
„Sir“, beginnt er, „ich will hier keine Feste feiern, ich will arbeiten. Ich habe den Malmedy-Case übernommen, und was ich anfasse, führe ich zu Ende.“
Der General nickt.
„Ich brauche eine Sprechkarte. Ich muß sehen, was hier gespielt wird. Sie bringen mich nicht los, Sir … nicht einmal nach drüben, solange ich diese Leute nicht gesprochen habe.“
Der General betrachtet Evans aufmerksam. Simson ist groß und schlank, hat ein sympathisches Jungengesicht und trägt an seiner linken Brustseite drei Reihen Orden.
„Mir gefällt das alles nicht“, beginnt der General, „Evans, denken Sie nicht, daß ich Schweinereien decke. Ich wünsche keine Schweinereien. Weder so noch so.“
Er bietet dem Oberst eine Zigarre an, schneidet sie ihm ab, reicht ihm Feuer.
„Ich habe eine Frage“, fährt er dann fort, „Colonel, eine lächerliche Frage: Sind Sie ein guter Amerikaner?“
Der Oberst fährt hoch. Jede Verbindlichkeit ist aus seinem Gesicht gewichen. Es ist weiß, schmal, kalt.
„Haben Sie Zweifel, Sir?“ fährt er den General an.
„Ist schon gut“, antwortet Simson. „… Entschuldigen Sie.“ Jetzt wirkt der General müde und abgespannt. „Sie können Ihre Sprechkarte haben … Ich wünsche Ihnen alles Gute.“
Der Colonel verläßt die Party, ohne sich zu verabschieden. Morgen wird er in das Gefängnis fahren. Morgen wird er weitersehen. Ein Gefühl der Übelkeit kriecht ihm langsam von unten nach oben … Er sieht seine Frau, seine Kinder vor sich, er sieht das Flugzeug, das ihn nach Amerika zurückbrächte, er sieht Berge von Schlagzeilen, die über ihn herfallen, er sieht Vorwürfe, Drohungen …
Und wieder geht er durch das alles hindurch, blaß, kalt, unbeirrt. Ein Mann, ein Mensch, ein Charakter, bereit, für die Humanität zu kämpfen, jede Art von Faschismus zu schlagen, wo immer er ihm begegnet …
So geht der Fall des Gefreiten Werner Eckstadt weiter mit einem eintägigen Umweg über das Hauptquartier der amerikanischen Armee in Heidelberg …
Der Wind versprengte sie bereits in der Luft. Sie waren allein im Hinterland eines Feindes, dessen Uniformen sie trugen. Gespenstisch hoben sich ihre schneeweißen Fallschirme vom Dunkel der Nacht ab, glitten lautlos zu Boden. Am 17. Dezember 1944. Der Zeitplan rollte. In Hunderten von Stellungen, Löchern und Gräben, in Panzern und an Lafetten sahen die Männer auf die Uhr. Sie hörten es tikken. Die Höllenmaschine war in Gang gesetzt. Das Zifferblatt wurde zum Orakel. Bleich, phosphoreszierend meldeten die Zeiger, wieviel Zeit noch zum Leben übrigblieb. Hitler, der „größte Feldherr aller Zeiten“, verkürzte seinen Krieg dadurch, daß er die letzten Reserven in die Weihnachtsoffensive warf. Die Ardennenschlacht hatte begonnen …
Werner Eckstadt, vormals Gefreiter, jetzt wider Willen zum SS-Rottenführer befördert, war als einer der Letzten abgesprungen. Er dachte nicht an seinen Auftrag, an die Unsinnigkeit, an die Folgen … In seinem Magen und in seinen Gedärmen würgte die Angst. Als er unter seinem Schirm langsam hin und her pendelnd, unter sich die Nacht, über sich die Nacht, rings um sich die Nacht, sechs Meter pro Sekunde sank, glaubte er, direkt zur Hölle zu fahren.
Die Gruppe Eckstadt war aus tausend Meter Höhe abgesprungen. Die letzten Minuten davor waren unerträglich gewesen. Einer hatte gebetet, fünf hatten getrunken, der Rest fluchte oder schwieg, einer kotzte und einer sprang buchstäblich mit vollen Hosen. Sie dachten an die Hochspannungsleitungen, an den Starkstrom, der sie in einer Sekunde zu einem schwärzlichen Klumpen zusammenschmoren würde. Sie sahen Bäume vor sich, deren Äste sie aufspießen mußten. Und wenn das alles nicht eingetreten wäre, wenn sich der Fallschirm geöffnet hätte, dann mußte man mit Gewißheit inmitten der amerikanischen Stellungen landen. Und das Knistern der Fallschirmseide würde sich in Schüsse des Hinrichtungs-Pelotons verwandeln …
Es tat einen häßlichen, glucksenden Platsch. Als das eisige, faulige Wasser über Werner Eckstadts Kopf zusammenschlug, stellte er mechanisch fest: ich bin unten.
Das Wasser füllte den kleinen Speicherweiher eines Dorfes. Aus ihm wurde eine Elektroturbine betrieben. Das aber stellte Werner erst später fest. Er kämpfte verzweifelt, um aus dem eisigen Bad herauszukommen, heraus aus dem Schlick, der die Augen verklebte, heraus aus der brökkelnden, dünnen Eisschicht, die den Weiher überzog wie die Haut gekochter Milch.
Er paddelte, watete, stürzte blindlings irgendwohin. Er sah so gut wie nichts. Ich Rindvieh, dachte er, mache einen Lärm, daß die Amis zusammenlaufen müssen. Wie sollte er ihnen dann erklären, was ein amerikanischer Militärpolizist nachts in einem Dorfteich zu suchen hat? Er keuchte. Nichts war zu hören, nichst zu sehen. Kein Laut. Nur in den Ohren das Dröhnen des eigenen Herzens.
Die Kameraden hatte Werner Eckstadt vergessen, Haubach und Roettger, den kleinen Seyfried und auch den Obersturmführer. Keine Zeit zum Fluchen. Und diese irren Gedanken. Und diese Angst. Da hatten sie alles genau ausgetüftelt. Am grünen Tisch, bei der letzten Befehlsausgabe vor dem Absprung, hatte Rädchen auf Rädchen ineinandergepaßt. Monatelang wurde der wahnwitzige Auftrag geprobt … aber von einem simplen Dorfweiher wußten sie nichts, die Arschlöcher.
Werner hatte das Wasser und den Schlamm hinter sich, schlich durch das Dorf. Er müßte frieren, aber es wahr ihm siedendheiß. Am Ortsausgang stand an überhöhter Stelle eine einzelne Scheune. Er ging vorsichtig hinein, ließ sich auf das Stroh plumpsen. Als erstes rieb er sein Feuerzeug trocken. Die Zigarette brannte nicht. Er sah eine halbleere Tenne und zwei Karren mit aufgerichteten Deichseln.
Zuerst heraus aus den Klamotten, dachte Werner Eckstadt. Sollen sie ihren Dreckskrieg alleine weiterführen. Für ihn war er zu Ende, dachte, meinte, hoffte er wenigstens. Er grinste vor sich hin, während er sich das olivgrüne Zeugs vom Leib riß. Selbst die Unterhose hatte noch diese Farbe. Ob sie das auch als Uniform gelten ließen, die Amis? Jetzt erst merkte er, wie er fror. Seine Zähne klapperten. Trotzdem verspürte er ein solches Gefühl der Erleichterung, daß er am liebsten Rad geschlagen oder die Scheune angezündet hätte … Er war aus dem Todeskommando ausgetreten, bevor es richtig begonnen hatte, dachte er … Man mußte nur abwarten. Die Artillerie schoß jetzt aus allen Rohren. Der Himmel brannte, der Widerschein des Feuers drang durch die Ritzen in die Scheune.
Überrollen lassen, dachte Werner, und sich dann stellen, in Unterhosen. Die Eigenen würden schon Boden gewinnen. Diese Überzeugung hatte nichts mit Politik zu tun. Das ist ja das Dumme, dachte Werner, daß unsere Burschen als Soldaten immer Klasse sind, ob sie nun für eine beschissene Sache kämpfen oder für eine ordentliche.
Das Stroh machte warm. Er deckte sich nur oberflächlich zu und rechnete aus, wie lange die deutschen Panzer brauchen würden. In ein paar Stunden mußten sie da sein.
Er versank in eine Art Halbschlaf. Die Zeit verlor ihre Hülle. Die Wärme machte wohlig. Er räkelte sich. Ob die anderen auch eine Scheune gefunden hatten? Ob sie die Helden markierten … Oder ob sie ebenfalls die Flucht in den Verstand angetreten hatten?
Plötzlich kreischten die Angeln der Scheunentüre. Er konnte gerade noch seinen Kopf unter das Stroh zerren. Er spürte das blendende Licht. Er spürte den Schweiß auf seiner Haut. Wenn sie die achtlos herumliegenden Uniformstücke sahen! Wenn sie auf ihn treten würden! Wenn er husten müßte!
Es waren zwei Amerikaner. Sie unterhielten sich.
„Das hat uns genau gefehlt, mein Junge“, sagte der eine, „werden uns schon die Zeit vertreiben.“
Werner hörte, wie die Amis näher kamen, spürte den leichten Schritt ihrer gummibesohlten Schuhe. Die beiden GIs hatten offenbar Wache oder Streife und es war ihnen draußen zu kalt und zu windig. Der Strohhaufen raschelte. Werner spürte einen enormen Druck auf seinem rechten Bein. Die Amis hatten sich gesetzt.
„Mixer, einen Pernod“, brüllte einer von ihnen lustig.
Der andere lachte.
„Jack, was ist ein Pernod?“ fragte der andere.
„Greenhorn“, entgegnete Jack. „Ein Pernod ist ein Drink. Sieht gelb aus, wenn du ihn bestellst. Wird grün, wenn du Wasser ’reingießt.“
„Wieso?“
„Greenhorn“, fuhr Jack fort. „Warum wird ein Mädchen rot, wenn du sie ansprichst, und blaß, wenn du sie im Bett hast.“
Werners Bein wurde pelzig. Wie lange konnte er das noch aushalten? Eine winzige Bewegung und sie hatten ihn. Der Rest war dann sterben …
Ein wenig ließ der Druck jetzt nach. Der eine der beiden Amis mußte sich langgelegt haben.
„In Europa haben sie lauter verrücktes Zeug“, sagte der offenbar jüngere GI dann.
Jack grunzte.
„Das Beste sind die Weiber, Billy … Und wenn du deine fünf Sachen noch beinander hast, dann fährst du nicht nach Baltimore in Urlaub, sondern nach Paris.“
„Sie werden uns nicht fragen“, versetzte Billy melancholisch. „Auf unserer Fahrkarte steht Deutschland.“
„Da gibt’s auch Weiber …“
„Das sind Nazis“, knurrte Billy, „die werden dir was abschneiden. Hitler hat ihnen befohlen, daß der Krieg auch noch im Bett weitergeht.“
„Nonsens“, sagte Jack. „Weiber sind Weiber.“
Das Stroh knisterte wieder, weil sich der GI aufrichtete.
„Weißt du, warum die hier in Europa so toll sind? Weil ihre Männer schon seit fünf Jahren nichts mehr zu fressen bekommen haben. Na, ich kann dir sagen … ich hab’s erlebt. Das war unter dem Arc de Triomphe in Paris, da kam so eine Schnucke mit ein paar Veilchen oder sonst einem Schnittlauch … und sagte zu mir: ,Vielen Dank für die Befreiung.‘ Na, da hab’ ich sie gleich unterm Arm gefaßt und scharf angesehen. ,Miß‘, habe ich erwidert, ,die Befreiung kommt erst jetzt …‘ Mensch, die hat’s gleich kapiert.“
Ein Streichholz knirschte auf der Reibfläche.
„Das mit der Befreiung kannst du aber bei den deutschen Girls nicht sagen“, quengelte Billy.
„Denen werde ich was ganz anderes erzählen. Da gibt’s keine Flausen, verstehst du?“
Nicht nur Werners Beine waren wie betäubt. Die Worte der beiden GIs prasselten wie Hammerschläge auf ihn nieder. Die deutschen Mädchen, die er kannte, zogen plötzlich an ihm vorbei. Erika und die muntere Gisela und die spröde Ruth und die hochnäsige Karin. Und dann dachte er an Vera, seine Schwester, die in ein paar Wochen, in ein paar Monaten vielleicht diesen grobschlächtigen Yankees gegenüberstehen würde … Die kleine Vera, mit den hellen, lustigen Augen, mit der sorglosen Art, mit dem schnellen Witz, die immer wußte, was zu tun war.
„Idiot“, brüllte Jack, „du zündest ja die ganze Scheune an!“
Werner spürte, wie sie aufsprangen … Es ging blitzschnell. Ein Strohhaufen brannte. Das Feuer fraß sich rasch weiter. Die Soldaten trampelten wie verrückt im Stroh herum.
Da passierte es!
Werner bekam einen Tritt an das Schienbein, einen in den Unterleib. Und noch einen.
Sie sahen ihn. Sie starrten ihn aus großen Augen an.
„He“, sagte Jack, „das ist aber eine Überraschung.“
Werner stand langsam auf, verstört, benommen, gerädert.
Ihre Maschinenpistolen pendelten an den Riemen von der Schulter.
„Was ist mit dir los? Bist du tot? Bist du besoffen?“
Werner Eckstadt sah, daß Jack ein Sergeant war. Er schlang die Angst und die Übelkeit hinunter. Er versuchte zu lachen. Es klang falsch und blechern.
„Ich … ich bin von meiner Einheit abgekommen. Ich wollte den Tag abwarten und hab’ mich hier eben hingehauen.“
Er wunderte sich, wie selbstverständlich ihm die englischen Worte über die Zunge glitten.
„Welche Einheit?“ fragte der Sergeant.
Werner nannte ein amerikanisches Phantasie-Kommando, dessen Bezeichnung und Nummer ihm vor dem Fallschirmabsprung eingeschärft worden war. Gleichzeitig aber hatte man ihm gesagt:
„Das gilt aber nur für den Bluff. Wenn die Amis das nachprüfen, seid ihr geliefert. Überlegt nicht lange, legt sie lieber gleich um.“
„Never heard!“ sagte der Sergeant … „nie gehört.“
Werner Eckstadt schwieg. Und dabei mußte er doch reden. Die GIs sahen ihn tückisch an. Sie wirkten nicht wie Burschen, die lange mit sich fackeln ließen.
„Ha“, sagte der Sergeant, „weißt du, was du bist? Getürmt bist du! Los!“ Jack wandte sich mit einer Kopfbewegung an den baumlangen Billy, der Hände hatte, zu denen man eigentlich einen Waffenschein brauchte.
Billy griff langsam nach Eckstadt, schüttelte den vermeintlichen Deserteur ein paarmal hin und her, ließ ihn aus und schlug ihm mit der Faust in das Gesicht. Der Deutsche fiel um wie ein Sack. Wie durch Watte hörte er die Worte des Sergeanten.
„Das ist nur ein kleiner Vorgeschmack, Boy. Das ist nur unter uns, du Schwein! Das sind nur die Abschiedsgrüße von der Front!“
Billy zog Werner hoch. Grinsend, überlegt und ruhig scheuerte er ihm die nächste.
Und Werner Eckstadt lag wieder im Stroh. Über seine Oberlippe rann Blut. Die beiden stießen ihn mit den Füßen an.
„Wisch das ab!“ befahl der Sergeant.
Werner reagierte folgsam.
„Wenn dich einer fragt, sagst du, du hast dich gestoßen … Was sollst du sagen?“
„Ich habe mich gestoßen“, wiederholte Werner mechanisch.
„So“, versetzte der Sergeant, „und jetzt liefern wir dich ab.“
Werner zögerte eine Sekunde. Aber unmittelbar danach bezog er einen Tritt, daß er quer durch die Scheune flog. Er stand auf, sackte aber gleich wieder zusammen.
Sie rieben ihn mit Schnee ab, stellten ihn wieder auf die Beine. Sie gingen zu dritt zum Dorf zurück. Der Sergeant wies mit der Hand die Richtung.
Aber plötzlich fiel sein Arm leblos herab. Dann warf er sich zu Boden. Ein paar Sekunden später krachte es. Ein orangefarbener Blitz zuckte über das freie Schneefeld. Der Knall war hell, scharf und gemein.
„Come on!“ schrie der Sergeant. Er hetzte im wildenZick-Zack-Sprung über den Schnee, Billy dicht hinter ihm.
Werner Eckstadt blieb wie angewurzelt stehen. Erst die surrenden Granatsplitter ordneten seine Gedanken. Die Scheune hinter ihm flog in die Luft, brannte lichterloh, und von der Straße her bewegten sich langsam, mit abscheulich brummendem Geräusch, schwarze Kästen auf ihn zu, Panzer, deutsche Panzer …
Er zählte sie. Am Dorfeingang standen drei, hinter dem Weiher zwei. Noch nie in seinem Leben hatte Werner Eckstadt die Silhouetten deutscher Tigerpanzer so schön, so schneidig, so imponierend empfunden.
Maschinengewehre rauschten auf. Sie schossen auf Billy und Jack. Billy überschlug sich und blieb liegen. Werner Eckstadt lachte, er lachte schallend. Über das Blut aus seinen Lippen rannen Tränen.
Dann hatten sie ihn im Visier. Er warf sich in einen Graben, wartete, bis sie näherkamen, stand dann wie versteinert auf, bevor sie ihn zermalmen konnten, hob die Hände und schrie wie wahnsinnig:
„Ich bin ein Deutscher. Aufhören! Aufhören! Ich bin ein Deutscher!“
Das Lachen war ihm vergangen. Wenn der Richtschütze jetzt durchdrückte? Nicht lange überlegen, hatte man ihnen vor dem Einsatz gesagt. Nicht erst fackeln, blitzschnell handeln! „Schießt sie zusammen! Denkt an den Sprit, nur das ist wichtig … Wenn ihr keinen Sprit kriegt, holt euch selbst der Teufel. Scheißt auf die Humanität. Ist ja alles Quatsch, die werfen ja auch ihre Dreckbomben auf Frauen und Kinder und sind nur dann fein, wenn sie Angst haben. Macht kein Federlesens!“
All das schoß Werner in dieser endlosen Minute, da die Panzer näherkamen, durch den Kopf. Fünfmal starb er und zum sechstenmal setzte er auf das Leben. Vielleicht wollten sie ihn ganz aus der Nähe erledigen … oder erzählten sie sich gerade einen Witz und warteten auf die Pointe, bevor sie abdrückten. Sie hatten ja Zeit. Sie saßen ja warm und sicher in ihren stählernen Vernichtungskästen …
Obersturmführer Klausen war an diesem frühen Morgen des 17. Dezember 1944 recht zufrieden. Die Ardennen-Offensive ließ sich günstiger an, als er befürchtet hatte. In diesen ersten Stunden wenigstens. Als sich die Nacht allmählich in eine trübe, milchige Dämmerung verwandelt hatte, waren Klausens Panzer scheppernd gegen den Feind gerückt. Acht Tiger und zwei Panzerspähwagen, so dicht aufgerückt, daß sie ihre Heckumrisse sehen konnten.
Auf der Vormarschstraße lag der Schnee glatt wie von einer Walze festgepreßt. Rechts und links der Straße stiegen die Hänge des Ardenner Waldes an. Die nackten, schwarzen Äste der kahlen Bäume verloren sich im Nebel.
Klausen hatte das Turmluk offen. Er rauchte. Er wartete darauf, daß die ersten Granaten aus dem Dunst heranjaulten, sich in die Straße wühlten und Dreck und Steine aufspritzen ließen. Er wartete mit dem leichten Sodbrennen auf dem Magengrund, das bei den Frontsoldaten das Herzklopfen ersetzt und in dem Augenblick schwindet, da es wirklich mulmig wird.
Aber es wurde nicht mulmig. Zunächst nicht. Der Ardennenwald schien die GIs aufgesogen zu haben.
Sie nahmen Kilometer um Kilometer, ohne auf echten Widerstand zu stoßen. Erst die deutsche Artillerie weckte die Amerikaner, sonst hätten sie die Offensive vollends verschlafen. Die GIs hatten diese verdammten Deutschen von der Atlantikküste bis nach Belgien gejagt und setzten gerade zum Sturm auf Deutschland an. Woher sollten sie wissen, daß diese elenden „Krauts“ noch einmal alles auf eine Karte setzen würden, und das genau vor Weihnachten, wo man einen Brief schreibt, einen Truthahn ißt und zur Abwechslung auch einmal einen Feldgottesdienst besucht.
Die Besatzung des Obersturmführers Klausen hockte auf ihren Plätzen und hielt den Mund. Eine halbe Stunde lang brachte sie das fertig. Nach den ersten zwanzig Kilometern wurde es dem Fahrer Saalbeck zu dumm. Er schrie in sein Sprechgerät:
„Fahren wir nach Paris, Obersturmführer?“
Klausen nahm die Augen nicht von der Straße.
„Wenn’s geht“, antwortete er.
Saalbeck lachte in das Mikrophon. Es klang wie das heisere Meckern eines verdrossenen Ziegenbocks. Dabei streiften seine schmutzig-grünen Augen die zitternde Nadel auf der Benzinuhr.
Sie hatten vielleicht noch 500 Liter in ihren Tanks. Sie waren nicht einmal ganz „betankt“ worden, wie es so schön hieß.
„Sprit holt ihr euch beim Feind!“
Hinter einer Biegung krachte es plötzlich. Das „Heeres-Anklopfgerät“, die Zwei-Zentimeter-Spritze des vorderen Panzerspähwagens, bellte. Bis die Tiger um die Ecke kamen, war alles schon vorbei. Acht amerikanische Soldaten standen mit schwarzgesengten Gesichtern herum und hielten die Hände hoch. Ein neunter und ein zehnter Ami lagen quer auf der Straße, als wollten sie in den gegenüberliegenden Graben robben. Dem vorderen von ihnen fehlte der Kopf …
Klausen kletterte aus seinem Panzer, betrachtete die beiden brennenden Jeeps.
„Sie Esel“, sagte er dann zu dem Fähnrich des Panzerspähwagens.
„Jawohl, Obersturmführer“, erwiderte der Mann stramm.
„Können Sie nicht vorsichtiger schießen? Da verbrennen mindestens achtzig Liter Benzin.“
Der Fähnrich machte ein dumm-stolzes Gesicht. Klausen kletterte ächzend in seinen Panzer zurück. Das olivgrüne Häuflein der angebratenen Amis übersah er. Dann fielen sie ihm wieder ein. Er stieg aus seinem Turmluk und wies mit dem Daumen über die Schulter nach hinten.
Die GIs hielten die Hände auf dem Kopf und trotteten zurück. Dort kam die eigentliche Vorhut, das Gros. Sollten die sehen, was sie mit den Amis machten. Erst, wenn er den feindlichen Widerstand nicht mehr brechen konnte, durfte er stehenbleiben … oder mußte es, weil er kein Benzin mehr hatte.
Der Richtschütze Wieblich sah die charakteristischen Bewegungen seines Kompaniechefs.
„Könn wa nich machen, Obersturmführer.“ Seine Ohrläppchen waren rot vor Ärger und Enttäuschung.
„Schnauze, Wieblich“, erwiderte Klausen trocken.
„Ick will Ihnen ja nur Ärjer ersparen, Obersturmführer“, antwortete Wieblich.
„Schnauze, Wieblich!“
Der Richtschütze stammte noch aus den besseren Tagen der SS. Er hatte mitgeholfen, seiner Einheit den Namen „Lötlampen-Division“ zu verschaffen. Des Führers Garde hatte sich in Rußland die Zeit damit vertrieben, mit Lötlampen Dörfer in Brand zu setzen und die Zivilbevölkerung auszuräuchern.
„Det war praktisch.“ Wieblich schwärmte noch oft davon. Die Wieblichs waren in der Minderheit. Aber die Minderheit war groß genug, um den Ruf eines ganzen Volkes zu vernichten.
Die Panzereinheit erreichte ein Dorf, passierte einen Weiher. Die Sicherungsposten fielen im Maschinengewehrfeuer, bevor sich noch begriffen, daß der Feind anrückte.
„Genau ins offne Maul“, stellte Wieblich zufrieden fest.
Sie waren bester Laune. Es klappte alles so nach Maß, daß sie eine der hinteren Panzerbesatzungen auf der verlassenen Dorfstraße zum Hühnerfang kommandierten.
Am Ortsende vor der Scheune tauchten wieder drei Amis auf.
Feuerstoß! Daneben.
Zwei der drei liefen querfeldein. Feuerstoß!
„Den hat’s erwischt!“ sagte der Richtschütze.
Der zweite entkam. Der dritte stand noch wie angewurzelt, verschwand in einem Graben. Wieblich merkte sich genau die Stelle. Saalbeck fuhr auf sie zu.
In diesem Moment erhob sich Werner Eckstadt, in Unterhosen, und hielt die Arme in die Höhe.
Wieblich schwenkte den Turm, zielte. Er ließ sich Zeit beim Maßnehmen;
„Laß ihn“, sagte der Panzerkommandant per Sprechfunk zu seinem Richtschützen. „Der hat durchgedreht. Der kommt ja auf Socken.“
Wieblich knurrte unwillig.
Aber dieses Knurren rettete Werner Eckstadt zunächst das Leben …
So oft hat Werner Eckstadt seiner Schwester Vera in einem kurzen Drei-Tage-Urlaub von den Ereignissen in der Nähe von Stavelot, südlich Malmedy, erzählt, daß sie jede Einzelheit kennt, daß sie schon nicht mehr nach Worten zu suchen braucht, wenn sie sie wiedergibt. Sie trägt ein rotes Kleid mit freien Schultern. Eine schwere, goldene Kette, ein Geschenk ihrer verstorbenen Mutter, glitzert an ihrem Hals. Der CIC-Leutnant Tebster hat sie in einen Soldaten-Club mitgenommen. Eine Flasche Vat 69 steht am Tisch. Der schlaksige Leutnant gießt beständig ein.
Die Musik spielt vorzüglich. Eine deutsche Tanzkapelle, die sich rasch auf Hot umgestellt hat. Das Licht ist angenehm gedämpft. Nicht so gedämpft sind die Stimmen einiger Damen, die auf ihre amerikanischen Begleiter einsprechen … Damen wenigstens, wenn man sehr höflich ist.
„Gut, daß Sie nicht so sind wie die da“, sagt Tebster.
„Schlimme Erfahrungen?“
„Es geht.“
„Was machen Sie bei der CIC?“
„Ich entnazifiziere.“
„Macht Ihnen das Spaß?“
„Ein Scheißgeschäft“, erwidert der Leutnant. „Ich bin nur da, weil meine Mutter Deutsche war, und ich deutsch spreche.“
Vera nickt. Das Licht spiegelt sich auf ihren blanken, weißen Schultern. Sie sieht bezaubernd aus, so, daß die Männer sie wohlgefällig und die Frauen sie mißgünstig betrachten.
„Wollen wir tanzen?“ fragt Tebster.
„Einen Moment, Leutnant. Eine Frage noch: Ihre Mutter war Deutsche?“
„Ja.“
„Meine war Engländerin“, erwidert sie.
„Deswegen können wir doch tanzen.“
„Noch einen Augenblick, Leutnant. Sie kennen die Geschichte mit meinem Bruder?“
„Ja, aber was soll das?“
„Ich will Sie erpressen“, entgegnet Vera. „Wenn Sie ihm helfen, tanzen wir. Wenn Sie ihm nicht helfen, gehe ich sofort nach Hause.“
„Sie sind ein Biest.“