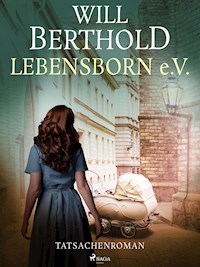Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Es geht um Millionen von Dollar, und der Coup ist perfekt vorbereitet: Gangster haben einen Jumbo-Jet entführt, in dem sich fast 400 Personen befinden. Großindustrielle, Politiker, Millionäre, aber auch Frauen und Kinder. Gehören die Verbrecher zur Mafia? Jedenfalls sind sie erbarmungslos in der Durchsetzung ihrer Forderungen, und schnell ist allen klar: Dies ist der Alptraum, der Wirklichkeit geworden ist, dies ist ein Flug um Leben und Tod, und ihrer aller Schicksal liegt in den Händen der Luftpiraten. Der Pilot der Maschine, Martin Nobis, bangt nicht nur um sein eigenes Leben, sondern auch um das der Menschen, die sich ihm anvertraut haben, ganz besonders um das der Journalistin Brenda, die er über alles liebt. Während er den Kurs auf Befehl der Kidnapper immer wieder ändern muss, verbreiten sich Angst und Schrecken unter den wehrlosen Passagieren wie ein Lauffeuer ...-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 339
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Will Berthold
Hölle am Himmel
Roman
SAGA Egmont
Hölle am Himmel
Genehmigte eBook Ausgabe für Lindhardt og Ringhof Forlag A/S
Copyright © 2017 by Will Berthold Nachlass,
represented by AVA international GmbH, Germany (www.ava-international.de).
Originally published 1974 by Lübbe Verlag, Germany.
All rights reserved
ISBN: 9788711727027
1. Ebook-Auflage, 2017
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt og Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmontwww.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk– a part of Egmont www.egmont.com
1
Der Frühling ließ sich nicht lumpen. Schon der Morgen zeigte sich von seiner besten Seite, und eine rötliche Sonne stand am Horizont. Sie spiegelte sich silbern auf den Jet-Riesen, die auf Frankfurts Rhein-Main-Flughafen zum Frühstart bereitstanden. Mit ihren mächtigen Schwingen und ihren gedrungenen Rümpfen sahen sie aus, als duckten sie sich ungeduldig vor dem Sprung über den großen Teich.
Aus allen Richtungen gingen Schönwettermeldungen ein. Der Tag war wie geschaffen für den Luftverkehr, und Martin Nobis, der deutsche Flugkapitän und Chefpilot der Jet-Air-Intercontinental sah mit einem Blick auf die Wetterkarte, daß ihn die Sonne bis New York begleiten würde. Sein Jet-Riese sollte als erster um 6 Uhr 59 nach Übersee starten. Er war bereits 71 Minuten früher auf dem Flughafen eingetroffen. Überpünktlichkeit war für ihn ein Gesetz, auch wenn es bedeutete, daß seine Mutter vor Tag und Tau aufstehen mußte, um ihn nach Frankfurt zu fahren.
Es war natürlich schierer Unfug, aber das konnte er allen klarmachen, nur nicht der alten Dame selbst. Sie war noch hartnäkkiger als er. Außerdem wußte er, wie sehr er nach der Trennung ihren liebenswerten Eigensinn vermißte.
Er war ein Mann von dreiundvierzig, der kein Gramm Ballast an seinem Körper duldete. In sein Gesicht hatten sich die Abenteuer des Lebens wie Keilschrift eingeritzt. Schon auf den ersten Blick wirkte er wie ein Mann mit Mumm.
Der Flugkapitän hatte die Startvorbereitungen überprüft. Nun blieben ihm noch ein paar Minuten für einen Vorgang, der nicht auf der Check-Liste stand.
»Komm, Mutschka«, sagte er zu seiner Begleiterin, »ich bring’ dich zum Wagen.« Er legte den Arm um ihre Schultern, zog die kleine Frau leicht an sich. Aus der Entfernung sahen sie nicht aus wie Mutter und Sohn, sie glichen eher einem Liebespaar, das vor dem Abflug noch ein wenig Zärtlichkeit herausschinden wollte.
»Ist es schon soweit?« fragte die zierliche Frau. Sie war über sechzig, hatte die Figur einer Dreißigjährigen; ihr schmales Gesicht, beherrscht von lebhaften Augen, wirkte beinahe alterlos. Sie trug Schuhe mit hohen Absätzen, wie immer. Für den Morgen war sie ein wenig zu elegant gekleidet, aber ein Hauch Extravaganz gehörte zu ihrer Persönlichkeit.
Sie gingen nebeneinander zum Parkplatz, ganz langsam, als könnten sie die Zeit betrügen. Mutter und Sohn sahen sich häufig, aber immer nur kurz. Und sie hatten nie gelernt, rasch voneinander Abschied zu nehmen.
»Paß auf dich auf, mein Kleiner«, sagte Maria Nobis zu Martin, der sie um gut drei Kopflängen überragte.
Sie umarmte ihn, glitt behende in den Wagen, winkte ihm zu und startete stürmisch wie ein Mädchen. Martin stellte wieder einmal fest, wie jung seine Mutter geblieben war.
Es war 6 Uhr 41. Die Passagiere gingen gerade an Bord der Boeing 747, die den Namen ›Happy Day‹ führte. Die gutgelaunte Gesellschaft erwartete auch einen glücklichen Tag, Bob S. Greenhill vielleicht ausgenommen, dem vor dem Start immer das Flugverbot seines Hausarztes einfiel. Aber wann hätte der New Yorker Geschäftsmann schon einmal auf die Empfehlungen seiner Umwelt gehört?
6 Uhr 50. Die Bodentreppen wurden weggefahren, die Einstiegs-Luken geschlossen.
In diesem Moment platzte die angenehme Vorstellung von einem reibungslosen Luftverkehr.
Entführungsverdacht. Bombenalarm.
Nichts Neues in Frankfurt. Oder auf einem anderen Weltflughafen.
Der Prokurist einer Bank, der einen Geschäftsfreund aus Chicago abholen wollte, hatte auf der Toilette zufällig ein Gespräch mitgehört.
»Zwei Männer, vermutlich Ausländer«, meldete er aufgeregt dem amtierenden Flugleiter. »Bombe in der Maschine nach New York.«
»Aber in welcher?« fragte Müller zwo gequält. »Allein in der nächsten halben Stunde starten fünf.«
Es würde keine starten. Der Rhein-Main-Flughafen mußte zwangsläufig die Abflüge stoppen, bis alle Maschinen überprüft waren. Immer wieder gelang es Verrückten oder Verbrechern durch Bluff oder Bomben den Luftverkehr lahmzulegen.
Die Polizei rückte aus. Kriminalbeamte mischten sich unter die Passagiere. Die Feuerwehr hielt sich in Reserve. Zwei Notärzte standen bereit. Sprengstoff-Spezialisten wurden alarmiert.
Der Aufwand wirkte lächerlich, aber ein Versäumnis wäre tödlich.
Im letzten Moment gelang es, die New York-Passagiere der Lufthansa, der Panam, der BEA und der TWA am Flugsteig zurückzuhalten, aber die beinahe vollbesetzte Boeing 747 der Jet-Air-Intercontinental stand bereits mit laufenden Triebwerken auf der Rollbahn.
Im Cockpit duftete es nach Lack, Farbe und Leder. Der Jumbo, gestern in New York erstmals in Dienst gestellt, trat heute den Rückflug seiner Jungfernreise an. Eine solche Premiere nutzte der Chefpilot, um sich – zum Leidwesen seines Präsidenten Lovestone – vom Schreibtisch weg an den Steuerknüppel zu stehlen, zumal seine Mutter nur eine gute Autostunde von Frankfurt entfernt lebte.
Flugkapitän Nobis sah auf die Uhr. Die Starterlaubnis ließ auf sich warten. Ein Flughafen, der im Jahr viele Millionen Passagiere ›umsetzt‹, konnte sich auch nicht die kleinste Unpünktlichlichkeit leisten; dann drohte ein Chaos. Der Tower blieb stumm.
Flugkapitän Nobis griff zum Mikrofon.
»Jet-Air-Flug 99«, meldete er sich. »Was ist eigentlich los? Habt ihr uns vergessen oder macht ihr Frühstückspause?«
»Mitnichten«, antwortete der Mann ruhig. »Tut mir leid, aber Ihr Flug wird sich weiter verzögern.«
»Das hab’ ich gerne«, versetzte der Jumbo-Kommandant. Der deutsche Flugkapitän war nicht nur der Chefpilot seiner Linie, er saß seit einem Jahr auch als Vertreter des fliegenden Personals in ihrem Vorstand und war Sprecher von 751 Flugkapitänen, 913 Co-Piloten und 2 499 Stewardessen.
»Vielleicht wollen uns ein paar Herren der Wüste wieder einmal mit dem Nahost-Problem vertraut machen«, unkte der Co-Pilot.
»Oder ein Ehemuffel versucht seine hochversicherte Frau loszuwerden«, spöttelte der Bord-Ingenieur.
»Nein«, warf Peggy, die blonde Chefstewardeß ein, die alle Passagiere für eine Amerikanerin hielten, obwohl sie aus München stammte. »Ein frommer Räuber will zum Papst nach Rom.«
»Schluß damit!« sagte Nobis barsch; ihm lag diese Unterhaltung nicht. Alles war schon einmal dagewesen und konnte sich jederzeit wiederholen.
»Jet-Air-Flug 99«, meldete sich endlich der Mann im Turm wieder. »Wir schicken einen Bus für die Passagiere. Wir müssen Ihren Jumbo durchsuchen … Bombendrohung.«
Flugkapitän Nobis erhob sich.
Als Halbgott in Blau hätte er die Räumung der Maschine auf seinen Ersten Offizier abwälzen können. Aber der Mann, von dem eine berühmte US-Journalistin gesagt hatte, er könne länger fliegen als laufen – sein verstorbener Vater war ein Lufthansa-Pionier der ersten Stunde gewesen – erledigte wie immer die Dreckarbeit selbst.
»Wir haben eine kleine Verspätung, weil Manöver der NATO den Luftraum blockieren«, log er mit dem Charme des geborenen Verführers. »Ich darf Sie zu einem kleinen Frühstück in unsere Cafeteria einladen …«
Er schaffte den Auszug der Passagiere mühelos.
Ein VW-Transporter karrte Sprengstoff-Spezialisten heran. Sie begannen, den üppigen Jumbo mit elektronischen Suchgeräten abzutasten. Die Männer arbeiteten stumm und schnell, hatten angespannte Gesichter und wissende Hände, die vor den zurückgelassenen Taschen und Aktenmappen nicht haltmachten.
Martin Nobis nahm an, daß die Fluggäste in Kürze wieder an ihre Plätze zurückkehren dürften.
»Können Sie noch eine verspätete Passagierin an Bord nehmen?« fragte jemand von der Flugabfertigung.
»Von mir aus eine ganze Hammelherde«, knurrte Nobis. »Wenn sie stubenrein ist.«
2
Aus geschäftlichen wie persönlichen Gründen hätte sich der Flugkapitän gewählter ausgedrückt, wäre ihm der Name der Nachzüglerin bekannt gewesen, die schon beim Betreten der Abfertigungshalle die verlogene Ruhe an den Schaltern gewittert hatte: eine Verschwörung des Schweigens, um keine Panik aufkommen zu lassen.
»Oh, Miß Fairday«, überschlug sich der Jet-Air-Vertreter bei der Begrüßung. Obwohl seine Linie mit dem Slogan warb: »Bei uns ist jeder prominent«, führte sie eine Geheimliste besonders bedeutender Persönlichkeiten. VIPs – very important persons, und auf dieser stand die verspätete Passagierin ganz oben.
»Vielleicht kann ich Sie noch in unseren Jumbo einschleusen«, raunte er der attraktiven Journalistin zu, die gerade den deutschen Bundeskanzler für das amerikanische Fernsehen interviewt hatte.
Er griff nach ihrem Gepäck; wild die Koffer um sich schleudernd bahnte er sich einen Weg durch das Gewühl, als kämpfte er sich mit einer Machete durch den Urwald, aber Brenda Fairday kam rascher voran. Willig wichen die Passagiere beiseite, und selbst Herren gesetzten Alters drehten sich nach ihr um. Sie ging sicher, mit ausgesprochen melancholischen Schritten. Achtlos, wenn auch ohne Arroganz, ließ sie die bewundernden Blicke hinter sich liegen wie wurmstichige Äpfel, die vom Baum fielen.
An den Schaltern der Polizei- und Zollkontrolle stauten sich die Menschen. Pedantisch kontrollierten die Beamten heute die Pässe zweimal und das Gepäck dreimal. Man brauchte Brenda nicht erst zu erklären, daß etwas faul war, wenn sie um 7 Uhr 30 noch die Maschine nach New York erreichte, die um 6 Uhr 59 starten sollte.
Der Mann von der Jet-Air-Intercontinental versuchte, die VIP-Passagierin ohne Kontrolle durchzuschleusen, er verschwendete seine Beredsamkeit an taube Ohren. Die Beamten wollten höflich bleiben, sich aber dabei auch auf keinerlei Risiko einlassen. Seit die Unterwelt den Himmel entdeckt hatte, war die modernste Art zu reisen zu einer der gefährlichsten geworden.
»Rasch, rasch«, sagte der Mann von der Fluglinie.
Der Wagen mit Brenda Fairday fuhr Slalom um abgestellte Riesenvögel. Auf einem Welt-Flughafen, auf dem in einem Abstand von 20 bis 30 Sekunden Flugzeuge starten und landen, genügte eine Unterbrechung von einer halben Stunde, um die Abstellplätze zu verstopfen. Bei der Starterlaubnis würden dann die Passagier-Flugzeuge bevorzugt, und der dicke Eierfrachter konnte so lange in der Sonne stehen, bis Küken ausschlüpften.
Brenda passierte eine DC-10, aus deren Leib kreischende Geräusche kamen.
»Sie verlangen ihr Frühstück«, sagte der Lotse.
»Wer?« fragte Brenda zerstreut.
»Eine ganze Fuhre Affen«, versetzte der Mann lachend.
Im letzten Moment kam die Amerikanerin an Bord, als Passagierin Nr. 366. Peggy, eine alte Bekannte von einem halben Dutzend Atlantik-Flügen, begrüßte sie mit Handschlag und geleitete sie an ihren Platz.
Die Stewardessen trugen bereits flache Schuhe. Die schlanken, hochgewachsenen Mädchen stellten sich Fragen, die sie nicht beantworten konnten. Sie schritten den schmalen Gang entlang, als präsentierten sie sich auf einem Laufsteg zur Wahl der Schönheitskönigin. Schon ihr Anblick förderte das Wohlbehagen der Passagiere.
»Ich habe eine Überraschung für Sie«, sagte die blonde Bordfee.
Brenda schaute verblüfft auf die neueste Ausgabe des TIME-Magazins. Sie blickte auf die Titelseite wie in einen Spiegel: ein schmales Gesicht, umrahmt von sanftroten Haaren, beherrscht von moosgrünen Augen. Das Foto war kaum retuschiert und hervorragend gedruckt. Sie durfte mit Original und Kopie zufrieden sein.
»Ladys and Gentlemen«, sagte Peggy in das Bordmikrofon, »wir bedauern die Verspätung. Bei dem hervorragenden Wetter werden wir sie wieder einholen … Inzwischen darf ich Sie mit der Schwimmweste vertraut machen.«
Man kennt sie in fünf Kontinenten, las Brenda Fairday ihren Steckbrief. Man liest sie in mindestens 16 Sprachen. Sie versteht es, den Zeitungsleser an die Mattscheibe zu locken oder dem Fernsehzuschauer wieder eine Zeitschrift in die Hand zu drücken, je nachdem, in welchem Fach sie sich versucht, las sie und lächelte. In jedem hat sie Erfolg.
Brenda sah einen Augenblick zu Peggy, die in ihrer Unterweisung fortfuhr:
»Unsere Boeing 747 ist das wohl sicherste Flugzeug der Welt. Sie fliegt mit einer Reisegeschwindigkeit von 940 Kilometern in der Stunde, und sie kostet über 80 Millionen Mark …«
Während die anderen Passagiere diese imponierenden Zahlen anhörten, um sie gleich wieder zu vergessen, las Brenda weiter:
Ihr Gesicht ist eher schön als hübsch. Interessant geschnitten. Ihre natürliche Sinnlichkeit wird durch den Verstand gefiltert. Sie kann tragen, was sie will. Sie wirkt in Jeans genauso attraktiv wie im Cocktailkleid. Sie huldigt nicht der modischen Unsitte, ihre weiblichen Reize in das Schaufenster zu legen, doch sie unterschlägt sie auch nicht.
Sie arbeitet hart mit dem Einsatz ihres Kopfes, nicht mit den Vorzügen ihres Geschlechts. Sie läßt die Blicke ihrer Bewunderer an sich heran, nicht deren Hände. Sie hat das Glück der Tüchtigen. Nicht sie jagt die Ereignisse, die Sensationen scheinen hinterihr her zu sein. Die Niederung eines nicht selten verkrampften Gespräches über die Gleichberechtigung der Frau läßt sie unter sich wie ein Falke das Mauseloch. Die Männer träumen von einer solchen Frau – und die Frauen von einem solchen Erfolg …«
»Wir werden in einer Höhe von über 12000 Metern fliegen«, fuhr die Chefstewardeß Peggy fort. »Und den Nordatlantik in …«
Aber dieser Erfolg ist teuer bezahlt, überflog Brenda den Text: Miß Fairday gibt ihr Lieblingsalter mit 29 an. Heute ist sie 30 und klug genug, zu wissen, daß sie alle zwölf Monate ein Jahr älter wird. Es muß ihr klar sein, daß sie alles ihrer Karriere opferte. Sie hatte keine Zeit für Dinge, die andere Frauen erfüllen mögen. Entweder sie versteht es, Affären und Romanzen gegenüber der Öffentlichkeit perfekt zu tarnen, oder – was wahrscheinlicher ist – es gibt sie nicht …
Brenda lehnte sich zurück. Das Heft in ihrer Hand wurde schwer, ihr Lächeln starr. Sie war getroffen und konnte sich nicht dagegen wehren. Dinge, die sie kaum zu denken wagte, wurden hier in einer Zeitschrift mit Millionen-Auflage breitgetreten.
Mit Männern hatte sie es schwer, weil sie es mit ihnen zu leicht hatte. Aus der großen Zahl ihrer Bekannten tauchten in der Erinnerung Figuren auf; Szenen – kürzere und längere – rollten noch einmal ab.
Erleichtert stellte Brenda fest, daß ein Gesicht stehen blieb: Martin.
Zuerst nur ein Kontrast von nachtblauen Augen und schwarzen Haaren; Martin – einer, der mehr dachte als sprach. Nie über Geld, nie über Frauen, nie über Gesundheit, nie über Krieg.
Sie hatte ihn interviewt, und daraus wäre beinahe ein Zwiegespräch für immer geworden; damals, in New York, vor zwei Jahren. Sie erlebte eine Romanze in Asphalt und war versucht, ihren Erfolg an den Nagel zu hängen und die Frau eines Mannes zu werden, der schon eine Geliebte hatte: die Fliegerei.
»Und so wünsche ich Ihnen einen angenehmen Flug im Namen unseres Flugkapitäns Nobis und seiner Crew«, schloß Peggy.
Brenda war hart im Nehmen. Nichts regte sich in ihrem Gesicht, als sie hörte, daß Martin den Jumbo flog. Die Begegnung mit ihm hatte sie immer erwartet, befürchtet und gewünscht.
Die TIME glitt zu Boden. Time heißt Zeit, und es war Zeit, daran zu denken, was sich aus dem Geschenk des Zufalls machen ließe.
Brenda merkte nicht, daß der Riesenvogel über die Piste raste, schwerfällig abhob und dann seine Schnauze zielstrebig in den Himmel bohrte. Sie blieb noch angeschnallt, als sich die anderen längst aus den Gurten befreit hatten. Der Jet-Air-Flug 99 ging auf Kurs, während Brenda den ihren noch suchte.
Der Düsenriese flog mit voller Pulle, als könne er die Sonne überrunden. Das größte Flugzeug der zivilen Luftfahrt erreichte beinahe Schallgeschwindigkeit. Trotzdem störte der berüchtigte Turbinenlärm an Bord nicht; es hörte sich an, als brumme ›Jumbo‹ vor Zufriedenheit, daß er stündlich 15000 Liter Treibstoff durch seine Düsentriebwerke gurgeln durfte.
Es war 8 Uhr 41. Genau in dieser Minute explodierte die Bombe.
Nicht an Bord der ›Happy Day‹.
In New York.
3
Die Explosion zerriß die Stille der Nacht. Der Schall brach sich an den verlebten Fassaden der Häuser in Brooklyn. Aber die aus dem Schlaf gerissenen Bewohner drehten sich nur auf die andere Seite. In einer Stadt, in der zum Beispiel der Durchschnittsbürger Morris S. Kanbar innerhalb von 14 Monaten elfmal von Banditen auf offener Straße überfallen oder von Einbrechern heimgesucht worden war, machte eine Detonation nur wenig Furore.
Erst nahmen Augenzeugen an, daß der Anschlag dem Kennedy-Airport in Idlewild gegolten hätte. Dann wies jedoch eine hohe Feuersäule wie ein blutiger Riesenfinger dem Katastrophen-Kommando den Weg zu der dahinterliegenden Basis der Jet-Air.
In Rekordzeit tauchte der Präsident der Fluglinie am Unglücksort auf. Mr. Norman S. Lovestone glich nicht einem Mann, der aus dem Schlaf gerissen worden war, sondern eher dem Titelbild eines Herren-Magazins: ein junges Gesicht umrahmt von schlohweißen Haaren, der Typ des ordentlichen US-Geschäftsmannes, der an Gott, Golf, Gesundheit und Gerechtigkeit glaubt. Und in seinem Fall noch an Groß-Flugzeuge.
Die Rettungstrupps schufteten wie besessen. Hangar B war so wenig zu retten wie die Boeing 707, die hier vor ihrem Verkauf an eine Charter-Fluggesellschaft überholt werden sollte. Der Schaden belief sich auf etwa zehn Millionen Dollar und ließ sich weitgehend auf die Versicherung abwälzen.
Die Rufschädigung mußte die Fluggesellschaft jedoch selbst verkraften.
»Du stehst im Weg, du Trottel«, brüllte einer der Feuerwehrleute. Er erkannte seinen Chef erst, als er ihn brutal beiseite gedrängt hatte. »Oh, Verzeihung«, stotterte er und stürzte sich wild in die Löscharbeit.
»Schon gut, mein Junge«, rief ihm Mr. Lovestone nach.
Seine Leute waren tüchtige Burschen. Keine Panik. Jeder Handgriff saß. Sie riegelten beinahe mühelos den Brandherd ab.
Erst als der Spitzenmann der Jet-Air daran dachte, daß einer von ihnen die Bombe gelegt haben mußte, bekam er trotz der Hitze kalte Füße.
Er stampfte in sein Büro zurück.
Dieser Anschlag hatte nichts mit Kuba zu tun, nichts mit Palästina, nichts mit Israel, der PLO oder Ägypten. Verschwommen spürte der erste Mann der Jet-Air, daß etwas Ungeheuerliches auf ihn zukam.
Er betrat sein Hauptquartier. Während ihn der Lift in das oberste Stockwerk katapultierte, überlegte er, daß er wegen der Presse wohl besser in den Keller gefahren wäre; aber er wollte vom Nimbus der Jet-Air retten, was noch zu retten war.
Keine Entführung bisher. Kein Unglücksfall. Täglich über hundert Langstrecken-Flugzeuge im Einsatz, insgesamt mindestens 40000 Passagiere an Bord. Sie waren bei der Landung genauso zufrieden wie eine halbe Million Kleinaktionäre, vorwiegend in Amerika und in Deutschland, bei der Abrechnung. Die Bilanz der Firma schwebte über den Wolken, wo ewig schönes Wetter herrscht.
Auch der Konkurrenz ging es gut, selbst wenn ihr die Jet-Air gelegentlich eine ›Jumbo‹-Nasenlänge voraus war. Jeder Gedanke, sie könnte hinter dem Attentat im Hangar B stecken, war absurd. Der Luftverkehr nahm so rasch zu, daß ihn sämtliche Fluglinien zusammen kaum schaffen konnten.
Der Spitzenmanager betrat sein Vorzimmer.
»Wo stecken Sie denn bloß?« fuhr er seine Sekretärin an und begriff umgehend, daß ihr Dienst nicht um drei Uhr Ortszeit begann: »Entschuldigen Sie, Myrna«, sagte er, »ich bin ein bißchen …« Er sah, wie sie Kaffeewasser aufsetzte. »Gut«, sagte er, »aber rufen Sie zuerst die Bundespolizei in Washington an. Versuchen Sie, irgendwie Larry Merx an die Strippe zu bekommen.«
Der Hausherr der Jet-Air wollte in sein Büro zurückgehen.
»Überflüssig, Norman«, sagte eine bekannte Stimme hinter ihm.
Mr. Lovestone fuhr herum, begrüßte den FBI-Sonderbeauftragten zur Bekämpfung von Flugzeug-Entführungen und stellte erleichtert fest: »Eigentlich hätte ich mir denken können, daß Sie schneller sind als ich.«
»Vertrauen ehrt«, versetzte der große, schlaksige Mann trokken. Er sah aus, als sei er unentwegt damit beschäftigt, seine zu lang geratenen Arme und Beine unterzubringen. Sein Gesicht wirkte hungrig. Wenn er lächelte, glich es einer gesprungenen Glasscheibe.
Der Spezial-Agent schnupperte und lächelte Myrna an. Sonst wirkte er aufreizend langsam, fast träge, als interessiere ihn eine Tasse Kaffee und sonst nichts auf der Welt. Dabei hatte der Mann in den letzten 27 Minuten – seit der Übernahme des Falls – ein gewaltiges Pensum erledigt.
»Gibt es eine Erklärung für diese Gemeinheit?« fragte Norman S. Lovestone.
»Ja«, antwortete der Mann aus Washington. »Aber sie ist beschissen.«
Der Hausherr ließ die rüde Ausdrucksweise durchgehen. »Sie denken wohl an ein Verbrecher-Syndikat?« fragte er.
»An was sonst«, entgegnete Larry Merx. »Papas Gangster mit modernsten Mitteln.« Er wußte, wovon er sprach. Die zunächst in den USA ausgebrochene Entführungswelle hatte ihn rasch ins Fach geschwemmt. Er konnte glänzende Erfolge gegen Erpresser, Psychopathen, Polit-Spinner und Versicherungs-Betrüger vorweisen, doch nicht grundlos hetzte ihn seit einigen Monaten die Sorge, daß eine nach Cosa-Nostra-Muster organisierte Bande Flugzeug-Entführungen als eine Marktlücke des Verbrechens entdeckt haben könnte. Wenn sie den Untergrund in die Stratosphäre verlegte, würde am Himmel die Hölle ausbrechen.
Das Telefon schrillte. Die beiden Männer verfolgten gespannt, wie Myrna gelassen den Hörer abnahm.
»Für Sie«, sagte sie und nickte dem FBI-Mann zu.
Larry Merx hörte sich einen Bericht an. »Gut, kommen Sie gleich hoch, Mike«, befahl er. Er drehte sich nach dem Luft-Reeder um. »Nicht viel Neues«, erklärte er. »Keine Verletzten. Die Explosion erfolgte gezielt in der Pause während des Schichtwechsels. Womöglich die unblutige Einleitung einer Erpressung ganz großen Stils.«
»Um Geld?« fragte Mr. Lovestone.
»Darauf können Sie sich verlassen, Norman.«
»Dann sollten wir es den Leuten vielleicht geben«, sagte er zögernd.
»Vielleicht«, erwiderte der FBI-Mann verächtlich. Er war entschlossen, mit eigener Münze zu bezahlen. »Trinken Sie Ihren Kaffee aus«, bat er. »Wir vertreten uns ein bißchen die Beine.«
In der Tür begegneten sie einem Mann mit einem fast auffälligen Durchschnittsgesicht. »Das ist Mike Blower«, stellte ihn Larry vor. »Sie haben nichts dagegen, daß er sich ein bißchen in Ihrem Arbeitszimmer umsieht?« fragte er.
»Natürlich nicht«, antwortete der Hausherr.
Sie gingen über den Flur zum Lift.
»Ich gebe Ihnen jede Vollmacht, Larry. Sie dürfen meinen ganzen Laden umkrempeln. Es darf nur nichts an die Öffentlichkeit …«
»Wir werden den Reportern einen erstklassigen Unglücksfall servieren.«
»Wir stehen alle zu Ihrer Verfügung. Ich sowieso. Aber auch mein Vertreter, unser Finanzmann, die Personalchefin, der ganze Vorstand und …«
»Die Herren sind alle in New York?« fragte der FBI-Mann.
»Ja«, entgegnete Mr. Lovestone. »Das heißt«, verbesserte er sich gleich, »unser Chefingenieur ist gerade bei den Boeing-Werken und Martin Nobis …«
»… fliegt wieder einmal in der Weltgeschichte umher«, ergänzte Larry.
»Verbieten Sie einem Fisch das Schwimmen!«
»Beneidenswerter Junge«, erwiderte Larry, und sein ausgemergeltes Gesicht zeigte einen Augenblick so etwas wie Sehnsucht. Einst war er in Kalifornien als Leiter der Testflug-Abteilung Martins Chef gewesen. Der deutsche Pilot hatte sich dabei als sein bester Mann erwiesen und war später zu seinem einzigen Freund aufgerückt.
Sie begegneten Löschfahrzeugen, die vom Explosionsherd zurückkamen. Das Feuer war gebändigt, nur dicke, schwärzliche Schwaden standen über Hangar B wie über Kains, des Brudermörders, Opferaltar.
»Sie wissen, daß Sie eine Laus im Pelz haben?« fragte der FBI-Mann.
»Ich weiß gar nichts«, antwortete Lovestone beleidigt.
»Dann will ich es Ihnen erklären: Wir verfolgen einen heißen Tip, daß aus dem engsten Kreis Ihres Hauses geheime Informationen nach draußen gelangen.« Er blieb stehen. »Machen Sie kein so unglückliches Gesicht, Norman«, tröstete er. »Wir sind ja bei Ihnen.«
Der Transistor in seiner Brusttasche gab ein Signal.
»Wo stecken Sie, Chef?« fragte der FBI-Agent Mike Blower an.
»Sie treffen uns in zwei Minuten vor dem Hauptportal.«
Er war vor ihnen da. Sein Gesicht wirkte wiederum ausdruckslos, aber Larry sah ihm an, daß er fündig geworden war.
»Schießen Sie los«, sagte er.
»Erstens war Ihr Telefon angezapft, Sir«, wandte er sich an den Präsidenten. »Dann habe ich, getarnt in einer Lampe, in einem Aschenbecher und in einem Buchrücken auf Anhieb drei Wanzen gefunden.«
»Wanzen?« fragte der Hausherr. Er sah noch immer aus wie ein Gentleman, doch wie einer, der gerade ein anrüchiges Haus verläßt.
»Elektronisches Ungeziefer«, erläuterte Larry Merx. »Mini-Sender, die jedes Gespräch in Ihrem Büro mitgehört und weitergeleitet haben. In Ihrem wunderschönen Arbeitszimmer finden ja auch die Vorstands-Konferenzen statt. Da hätten wir eine Erklärung für die Indiskretion.« Ohne Nachdruck setzte er hinzu: »Eine.«
»Zuerst einmal brauche ich einen Whisky«, erwiderte Mr. Jet-Air grimmig. »Und dann sagen Sie mir, was ich tun kann!«
»Eine ganze Menge«, versetzte Larry. »Wir drehen den Spieß um. Wir werden die Wanzen nutzen, um unsere Gegenspieler in eine Falle zu locken.«
Norman S. Lovestone nickte düster.
»In den nächsten Stunden werden sich die Gangster mit Ihnen in Verbindung setzen und Geld verlangen. Wie ich annehme, telefonisch.«
»Und?« fragte Mr. Lovestone matt.
»Sie werden empört sein, Norman. Sie werden toben. Und dann Umfallen. Aber ganz langsam. Verstehen Sie? Ich brauche Zeit. Wir peilen den Anrufer an. Für uns ist jede Sekunde wertvoll.« Der FBI-Mann überzeugte sich, daß ihm der Luft-Reeder folgen konnte.
»Wie steht’s eigentlich um Ihr schauspielerisches Talent?«
»Ich hab’ mal den König Lear gespielt«, erwiderte der Hausherr kläglich. »Als Elfjähriger in einer Schüleraufführung.«
»Ich will Sie nicht verrückt machen«, sagte Larry. »Doch von Ihrem Geschick wird es abhängen, ob die vielleicht größte Schweinerei in der Geschichte der Luftfahrt verhindert wird oder nicht.«
Sie probten das zu erwartende Gespräch so lange durch, bis der FBI-Spezialist zufrieden war.
Sie gingen im Arbeitszimmer des Hausherrn auf Posten. Sie mußten warten. Eine Stunde, zwei. Endlos. Mitunter versuchte Mr. Lovestone etwas zu sagen, aber der FBI-Spezialist erinnerte stumm an die Wanzen. Sie sahen immer wieder auf das Zifferblatt. Die Zeit schien zu stehen wie eine verstopfte Sanduhr.
4
Bisher war der Jet-Air-Flug 99 ohne Zwischenfall verlaufen. Die Schönwetterbrücke reichte von Frankfurt bis New York. Über dem Jumbo wölbte sich der Himmel wie eine seidige Kuppel, und sein endloses Blau färbte noch tief unten auf die See ab.
»So ein Flug vergeht wie im Flug«, sagte ein Passagier, der Brenda Fairday schon seit einer halben Stunde mit seinen Kalauern verfolgte.
Sie winkte Peggy heran.
»Läßt sich ein kurzer Besuch im Cockpit arrangieren?«
»Ich will’s versuchen, wenn ich der Crew das zweite Frühstück serviere«, zögerte die Chefstewardeß. »Ich muß den Captain fragen. Sie wissen ja …«
Während sie sprach, ließ Peggy Mr. Greenhill nicht aus den Augen. Zehn Jahre Langstreckenflug hatten ihren Blick für schwierige Passagiere geschärft: Sie wußte, daß sich der Mann nicht wohlfühlte. Verdorbener Magen? überlegte sie. Flugangst? Ein Herzfehler?
»Geht es Ihnen nicht gut, Sir?« fragte sie den bekannten Geschäftsmann.
»Unsinn«, wehrte er ab.
Vorsorglich gab Peggy ihrer Kollegin einen Wink, sicherheitshalber nach einem Arzt Ausschau zu halten. Der Passagier – merkwürdigerweise wirkte er im Sitzen größer als im Stehen – mußte es bemerkt haben.
»Lassen Sie das«, protestierte er. »Ich brauche keinen Doktor.« Er atmete schwer. »Was ich brauche, ist ein großer Bourbon. Ohne Wasser! Ohne Eis!«
Es war sicher nicht das Richtige für ihn, aber solange Betrunkene nicht randalierten und nach ihren Beinen haschten, war eine Stewardeß darauf gedrillt, den Passagieren auch unsinnige Wünsche zu erfüllen, selbst wenn sie als Entführer, bewaffnet mit Handgranaten oder Pistolen, das Öffnen der Cockpit-Tür verlangen sollten.
Flugkapitän Nobis gab seine Position an die Bodenstation durch. Die Navigation erfolgte automatisch, sicherer als jede menschliche Berechnung, mit einer Zielabweichung von höchstens 30 Kilometern auf eine Entfernung von 8000 Kilometern. Das fliegende Ungeheuer war so genial konstruiert, daß man mitunter meinte, der Jumbo steuere seinen Flugkapitän, statt umgekehrt.
Vielleicht gingen deshalb Martins Gedanken streunen, landeten immer wieder bei dem schmucken, verträumten Häuschen inmitten eines Weinbergs. Dahin, nach Klingenberg, hatten sich seine Eltern vor Jahren zurückgezogen. Die Verbindungen Vaters nach drüben hatten Krieg, Zusammenbruch, Haß und Greuel überlebt und dem jungen Martin den Start in den USA ermöglicht. Er fiel sofort durch sein fliegerisches Gefühl auf; es war fast kurios, daß zu dieser Zeit ein Deutscher zum jüngsten Testpiloten Amerikas aufrückte.
Martin war schon bei der Verkehrsfliegerei gelandet, als sein Vater starb. Der Tod war nicht nur grausam, sondern auch lächerlich: Der Flug-Veteran aus einer Zeit, in der man sich im Tiefflug noch an Kirchtürmen orientierte, der Pilot, der mit einer klapprigen JU aus Stalingrad und Breslau bis zuletzt noch Verwundete herausgeflogen hatte, wurde von einem Auto angefahren und erlag den Verletzungen.
Vielleicht kam es daher, daß sich Martin in der Luft sicherer fühlte als auf der Erde.
Dieses Unglück band ihn noch fester an die Mutter. Die alte Dame lebte zwischen Rebstöcken und Fotos, zusammen mit dem Katzenpärchen Romeo und Julia, die sich wie die eigentlichen Hausherren aufführten, den Stunden entgegen, in denen ihr großer Sohn bei ihr war. Dann kochte sie ihm sämtliche Leibspeisen auf einmal, als könne er sechzehn oder achtzehn Stunden lang ununterbrochen essen, und sie war voller Stolz auf sein berufliches Können, und voller durchtriebener Neugier, was seinen Junggesellenstand anbelangte.
»Wie lange willst du dich denn noch als Vagabund allein in der Welt herumtreiben?« fragte sie ihn immer.
»Hast du denn eine Braut für mich, Mutschka?«
»Nein«, erwiderte sie. Es machte einen Teil ihres Charmes aus, daß sie so eine schlechte Lügnerin war. Nach den Gesetzen weiblicher Logik setzte sie auf eine Schwiegertochter – voller Eifersucht, daß es in Martins Leben neben ihr noch eine andere Frau geben könnte. Aber wie sollte sie sonst zu Enkelkindern kommen, von denen sich Romeo und Julia am Schwanz ziehen ließen?
Jedenfalls durchschaute Martin sie in diesem Punkt völlig, und sie kämpften beide mit List und Liebe.
Peggy erschien, um den Imbiß zu servieren. Zweimal Kaffee mit reichlich Beilagen für Flugkapitän und Bord-Ingenieur. Der Co-Pilot, der stets mit Übergewicht kämpfte, bekam nur ein Glas Tee. Beim Rückflug war er immer auf Diät gesetzt, denn mit Sicherheit würde ihn die Jet-Air auf die Waage stellen.
»Darf ich Ihnen etwas Salat bringen, Jim?« schloß Peggy ihren Dauerwitz ab.
»Laß dir das nicht gefallen, armer Junge«, grinste Martin Nobis und griff nach dem dicksten Schinkenbrot; er sah, wie sein junger Mann an jedem Bissen mitschlang. »Komm«, sagte er und erhob sich. »Zur Entschädigung übergeb’ ich dir den Vogel.«
Er stellte belustigt fest, daß sein Co-Pilot beim Platzwechsel wesentlich schneller war als er. Jim würde sehr bald schon einen erstklassigen Captain abgeben. Martin Nobis hatte Hunderte von Piloten ausgebildet oder überprüft. Eine einzige Fehlanzeige, und selbst diese nicht in fliegerischer, sondern in menschlicher Hinsicht.
Die Stewardeß hielt sich noch immer im Cockpit auf.
»Gibt’s noch was, Peggy?« fragte Nobis.
»Ja«, begann sie vorsichtig. »Eine Passagierin möchte Sie besuchen.«
»Die Zeiten sind vorbei.«
»Es handelt sich um –«
»Keine Ausnahme.«
»Und das gilt auch für mich, Martin?« fragte Brenda, die die fünf Meter Niemandsland zwischen Bar und verbotener Zone überschritten hatte.
Daß er ihre Stimme sofort erkannt hatte, stellte sie fest, als Martin sich ganz langsam – wie in Zeitlupe – umdrehte, in der Art eines Realisten, der seinen Leuten verhehlen möchte, daß er Tagträume hat.
»Brenda«, sagte er, und seine Augen waren beredter. Einen Moment stand er da, als wisse er nicht, ob er seine Hände in die Taschen stecken oder zärtlich um ihren Kopf legen sollte.
»Das«, setzte er albern und gedehnt hinzu, »ist aber eine Überraschung.«
»Du hast dich nicht verändert«, erwiderte Brenda.
»Aber du bist schöner geworden«, sagte Martin.
»Oder du kurzsichtig!«
»Ein Pilot hat scharfe Augen«, entgegnete Martin.
Er stand auf und geleitete Brenda an die Bar zurück. Sie ließen sich nebeneinander nieder, und in diesem Moment glaubten sie beide, Worte zu hören, die nicht gesagt wurden, obwohl sie stimmen mochten.
»Warum hast du dich zwei Jahre lang nicht gemeldet?« fragte Brenda.
»Weil du dich so lange nicht gerührt hast. Außerdem wollte ich deiner Karriere nicht im Wege stehen.«
»Und ich nicht deiner Flug-Passion«, sagte sie. »Weil wir uns beruflich nichts nehmen wollten, haben wir uns privat den Weg verbaut.«
Sie sahen sich voll an. Zwei Jahre Einsamkeit, überspielt durch Geschäftigkeit, waren vergessen.
»Kennst du noch meine New Yorker Wohnung?« fragte Martin.
»Du wirst lachen«, erwiderte sie, »ich hab’ sogar noch den Schlüssel.«
»Das Schloß ist seitdem nicht geändert worden«, versetzte er in seiner typischen Art. »Du entschuldigst«, sagte er und ging in das Cockpit zurück, wo man bereits in New Yorker Ortszeit rechnete.
5
Der morgendliche Ansturm hatte New York in einen brodelnden Eintopf von Lärm, Hast und Mief verwandelt, aber nach neun Uhr begann die überforderte Millionenstadt auf kleinerer Flamme zu kochen. Die Wolkenkratzer verschluckten Hunderttausende von Menschen, um sie am Abend wieder auszuspucken.
Der Tag hatte Tritt gefaßt, sechs Stunden hinter Mitteleuropa. Nur in der Zentrale der Jet-Air-Intercontinental in der Nähe des Flugplatzes Idlewild war er vorzeitig gestolpert.
9 Uhr 33.
»Spreche ich mit Mr. Lovestone?« fragte eine verzerrte Stimme. »Hören Sie gut zu. Ich erzähle nichts zweimal. Entweder Sie gehen auf meine Bedingung ein«, fuhr der Unbekannte fort, »oder es fliegt wieder eine Maschine in die Luft. Diesmal eine vollbesetzte.« Die Stimme in der Leitung drohte: »Zum Beispiel Ihr neuer Jumbo ›Happy Day‹ mit 366 Passagieren und 16 Mann Besatzung.«
Mr. Lovestone quollen die Augen aus dem Kopf, und sein rechteckiges Zimmer wurde einen Moment lang rund und drehte sich wie ein Karussell. »Hier ist der Zentralsitz einer Fluglinie«, fuhr Norman dann den Erpresser an. »Und keine Irrenanstalt.«
Larry Merx lenkte ihn wie der Leitstrahl eine Maschine bei einer Blindfluglandung.
»Wer sind Sie überhaupt?« schrie der Präsident in die Muschel und steigerte seine Stimme zu dem Organ eines Mannes, der 35111 Mitarbeiter sicher durch die Fährnisse des Geschäftslebens steuert.
»Ich bin der Bursche, der heute nacht ein kleines Feuerwerk in Ihrem Hangar B veranstaltet hat«, erwiderte eine verzerrte Stimme, die sich jetzt anstrengte, ein wenig langsamer zu sprechen. »Ich will eine Million. Bis heute mittag. Punkt zwölf Uhr. In Hundert-Dollar-Scheinen.«
Als der Spitzenmanager diese Forderung hörte, nahm er ein Wechselbad von Hitze und Frost. Er hatte die Vermutung des Experten von der Bundespolizei in Washington für übertrieben gehalten. Doch diese Hoffnung war jetzt geplatzt wie ein Reifen. »Sie sind ja wahnsinnig«, stöhnte er auf.
»Oder Sie«, konterte die blecherne Stimme. »Falls Sie nicht auf mich hören. Oder die Polizei bemühen.« Er lachte heiser. »Denken Sie an Ihre wunderschönen Jets in der Luft«, drohte er. »Denken Sie an die vielen unschuldigen Passagiere an Bord.«
Larry Merx starrte auf das Zifferblatt: 42 Sekunden. Dann sah er gespannt durch die offene Tür ins Vorzimmer, wo sein Assistent Mike Blower mit den Fahndungs-Trupps der Telefongesellschaft und der New Yorker Kripo in Sprechverbindung stand.
Der Mann gab das Signal, hob den Arm, und das hieß, daß der Standort des Erpressers mit Erfolg angepeilt worden war. Das hieß, daß in dieser Sekunde Dutzende von Streifenwagen mit Sirenengeheul durch die Weltstadt hetzten. Das hieß, daß Larry eine Chance hatte, einen Mann zu fassen, der ihm den Weg zu der Bande weisen müßte.
»Und wenn ich bezahle?« fragte der Präsident zögernd.
»Dann lassen wir Sie in Ruhe.«
»Und wer garantiert mir das?« fragte Mr. Lovestone.
»Niemand«, versetzte der Erpresser kalt. »Sie haben keine andere Wahl, als uns Vertrauen und Geld zu geben.«
Obwohl mit jeder weiteren Sekunde dieses Telefonats die Chance stieg, den Unbekannten zu fassen, rechnete Larry doch nicht mit einem Erfolg. Wenn der Anrufer zu einer Gang gehörte – woran nicht zu zweifeln war –, mußte er ein Fachmann sein und wissen, daß er gefahrlos nicht länger als 40 Sekunden sprechen konnte. Ein Profi würde das Gespräch jetzt abbrechen und von woanders aus fortsetzen.
Der FBI-Spezialist sah, daß Mr. Jet-Air am Ende war, er schob ihm hastig einen Zettel mit einem Stichwort zu.
»Und wie sollen wir Ihnen das Geld überhaupt zukommen lassen?« griff es Mr. Lovestone hastig auf.
»Sie halten die Million bereit. In einem Paket. Punkt zwölf Uhr. Am Hauptportal Ihrer Firma. Wir schicken Ihnen einen Boten und überzeugen uns, daß ihn niemand verfolgt. Andernfalls –«, drohte der Erpresser und legte auf; nach einer Minute und zehn Sekunden.
Von nun an rollte die Fortsetzung des Gesprächs mit anderen Worten. Regie: FBI. Medium: eingeschmuggelte Mikrofone. Zuhörer: eine nach Cosa-Nostra-Muster organisierte Unterwelt-Bande.
»Myrna, ich verbitte mir, daß Sie mich mit jedem Wahnsinnigen verbinden«, rügte der Präsident.
»Soll ich die Polizei verständigen?« fragte die Sekretärin.
»Um Gottes willen«, entgegnete Mr. Lovestone. »Auf keinen Fall. Vorläufig wenigstens. Verbinden Sie mich bitte mit der Chase Manhattan. Fragen Sie den Hauptkassierer, ob er bis heute mittag eine Million in Hundert-Dollar-Noten für uns beschaffen kann.« Er verbesserte sich sofort: »Oder nein, lassen Sie das noch, bis ich die Herren des Vorstandes gesprochen habe.«
Als Larry Merx sah, daß sein Zauberlehrling auf eigenen Beinen gehen konnte, stürmte er das verwaiste Arbeitszimmer des Chefpiloten Martin Nobis, das er nach gründlicher Untersuchung auf Abhörgeräte requiriert hatte.
Mike Blowers Gesicht trug schwer an einer Neuigkeit.
»Wir haben die Nummer, Chef«, begann er.
»Nun lassen Sie das weiße Kaninchen schon aus dem Zylinder hopsen, Sie Magier«, antwortete Larry gereizt.
Sein Assistent reihte die Ziffern zu einer Zahl aneinander; sie besagte Larry nichts.
»Es handelt sich hierbei um einen Nebenanschluß der Jet-Air«, erläuterte Mike Blower. »Genutzt wird er von Mr. Lionel Taylor.«
»Dem Chefingenieur?« erwiderte Larry nach kurzem Nachdenken. »Und der Mann ist zur Zeit in Kalifornien.«
»Ja«, bestätigte der Helfer, »und zwar ist es ein Autoanschluß. Dieser Dreckskerl von Anrufer ist einfach in Manhattan spazierengefahren.«
»Sehen Sie, es gibt für alles eine natürliche Erklärung«, stellte Larry fest. »Nur meistens zu spät.«
»Aber das Auto von Mr. Taylor?«
»Vermutlich gestohlen und bis jetzt noch nicht entdeckt.«
Wie zur Bestätigung seiner Kombinationsgabe ging Sekunden später die Meldung ein, daß der Cadillac von der Verkehrspolizei sichergestellt worden war. Ohne Insassen. Falsch geparkt; am Rand der breiten Auffahrt zum Riesengebäude der UN, die Taxis, Omnibussen und Staatskarossen Vorbehalten ist.
Larry Merx hatte den Anruf auf Tonband mitgeschnitten und hörte es ab. Er spulte zurück und begann von neuem:
»Merken Sie etwas, Mike?« fragte er.
»Der Mann hat seine Stimme unkenntlich gemacht. Vermutlich durch eine Cellophan-Folie über der Membrane.«
»Mehr fällte Ihnen nicht auf?«
»Dem Akzent nach ein Italo-Amerikaner.«
»Schon besser«, entgegnete Larry. »Und nun hören Sie noch einmal genau zu.« Er wollte sichergehen, daß er sich nichts einbildete. »Achten Sie auf die Worte ›Hauptportal‹, ›Passagiere‹ und ›Ruhe‹, drängte der Chef.
»Hört sich an, als ob der Mann mit einem harten Rachen-R sprechen würde«, erwiderte sein Assistent zögernd.
»Gut, Mike. Schnappen Sie sich unsere Maschine. Fliegen Sie sofort nach Washington und jagen Sie diese Feststellung durch den Computer.«
Das FBI-Archiv hatte 6000 genaue Lebensläufe Verdächtiger gespeichert und die Fingerabdrücke von 90 Millionen Amerikanern. Vielleicht enthielt die Kartei auch Hinweise auf Stimmen mit einem Rachen-R – sofern es nicht erst durch eine künstliche Verzerrung entstanden war.
Mr. Jet-Air kam herüber.
»Ausgerechnet bei uns«, sagte er. »Können Sie sich das erklären, Larry?«
»Ja«, versetzte der FBI-Mann gelassen. »Die Jet-Air hat viel Geld. Außerdem sitzt vermutlich ein Komplize der Bande im Haus.«
Er betrachtete den Mann mit dem jungen Gesicht und den schlohweißen Haaren. »Und zwar sehr hoch oben.«
»Finden Sie ihn«, fuhr Mr. Lovestone ihn an.
»Nur mit Ihrer Hilfe«, entgegnete Larry. »Zunächst einmal brauche ich die Personalveränderungen des letzten halben Jahres.«
»Das liegt in zehn Minuten auf Ihrem Schreibtisch.«
»Dann werden Sie«, fuhr der Spezialist aus Washington fort, »eine Firma mit der Rationalisierung Ihrer Fluglinie beauftragen. Sie wird Ihnen vier Mann schicken – vier FBI-Leute, die sich hier in allen Abteilungen umsehen werden.«
Er stellte fest, daß Mr. Jet-Air von dem Vorschlag wenig begeistert war.
»Hören Sie zu, Norman: Die Täter, die bis jetzt Attentate auf Flugzeuge verübt haben, waren Amateure. Aber auf ihr Konto kommen immerhin in den letzten 19 Jahren bereits 802 Menschenleben. 691 Passagiere und 111 Besatzungsmitglieder. Offizielle Feststellung des ›Büros für Entwicklung der Luftfahrt‹ in Rom. Nur geklärte Fälle. Wir wissen nicht, wie viele weitere Unfälle in Wirklichkeit Verbrechen waren.«
Er sprach ohne Betonung, aber der Hunger in seinem Gesicht wirkte dabei satt vor Angst. »Und nun haben wir es, wenn nicht alles trügt, erstmals mit echten Gangstern zu tun. Mit hartgesottenen Profis, die ohne weiteres einen Jumbo mit 400 Menschen in die Luft sprengen.«
»Ich will Ihnen etwas sagen«, erklärte Lovestone müde. »Ich zahle die Million.«
»Kommt nicht in Frage«, erwiderte Larry.
»Übernehmen Sie die Verantwortung?« fuhr ihn der Generaldirektor an.
»Das muß ich wohl«, entgegnete der große, drahtige Mann. »Bis zwölf Uhr mittags wird gar nichts passieren.«
»Vielen Dank für Ihren Trost«, erwiderte Norman S. Lovestone. Er wagte nicht, daran zu denken, was nach diesem Ultimatum geschehen könnte.
6
Jet-Air-Flug 99 meldete als voraussichtliche Ankunftszeit in New York 10 Uhr 32. Der Jumbo hatte die in Frankfurt durch den falschen Bombenalarm entstandene Verspätung weitgehend wieder aufgeholt. Gleich mußte das Flugzeug als winziger Punkt auf dem Radarschirm der Bodenstation auftauchen. Kaiserwetter an diesem Bilderbuchtag. Nicht die sanfteste Brise behelligte die Boeing 747.
Die meisten Passagiere sahen sich schon den zweiten Film an. Django, der Rächer, geisterte über die Leinwand. Wie in den meisten Wild-West-Schinken siegte am Ende das Gute und das Böse blieb auf der Strecke. Im übrigen uniformierte die Passagiere die gute Laune. Einmal mehr bestätigte sich die Mundpropaganda, daß Jet-Air-Intercontinental die erfahrensten Piloten, die strengsten Sicherheitsvorschriften, die beste Küche und die hübschesten Stewardessen hätte.
Im Cockpit, dem Gehirn des Riesenvogels, wurde geschwiegen. Jim, der Erste Offizier, flog die Boeing 747, und das hieß, daß er lediglich den Auto-Piloten überwachte. Der Bord-Ingenieur wurde nur aktiv, wenn etwas nicht stimmte, und Martin Nobis kämpfte um eine Orientierung privater Art, seitdem er Brenda begegnet war. Sein Bewußtsein schrieb an dem Kapitel Liebe, mit ungelenker Handschrift. Auch wenn er es sich nicht eingestand, war er ein Mann nach Maß der Frauen, die bei ihm leicht maßlos werden konnten. Seine Erinnerung häufte die Abenteuer mit dem schönen Geschlecht wie Kleingeld aufeinander. Auch wenn er seine Vergangenheit drehte und wendete, blieb nicht viel mehr als ein wenig flüchtige Zärtlichkeit, irgendwo, mit irgendwem, genossen, vergessen.
Und an der Bar des kleinen Salons, gleich hinter dem Cockpit, nur ein paar Meter von der Jumbo-Kanzel entfernt, saß jetzt die junge Frau mit den Katzenaugen und den sanftroten Haaren und drohte, eines Luftmillionärs lässiges Verhältnis zu den Gefühlen zum Absturz zu bringen.
Martin erhob sich von seinem Sitz vorn rechts. »Habt ihr eigentlich etwas gegen Damenbesuch?« fragte er in einem Ton, der keine Antwort erwartete.
Jim, der Co-Pilot, grinste durch die vierfach verstärkte Cockpit-Scheibe, als sich der Flugkapitän gespielt langsam aus seinem Bereich entfernte. Einen Moment lang glich er eher einem Einsteigdieb als einem Chefpiloten.