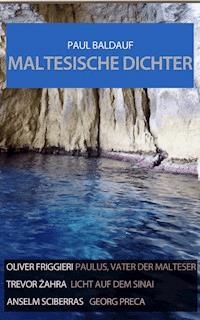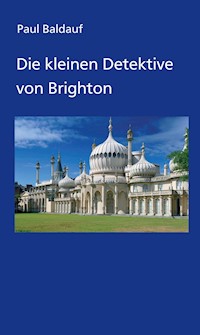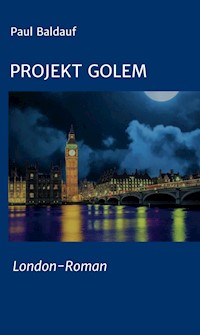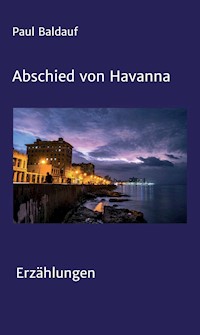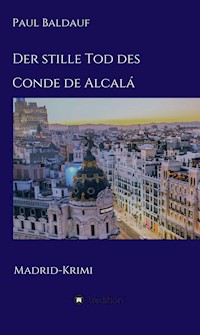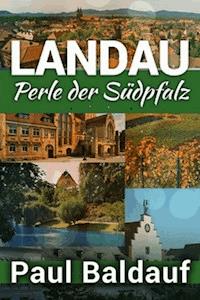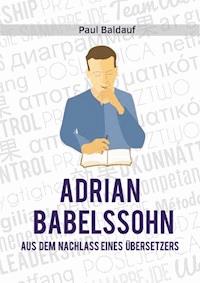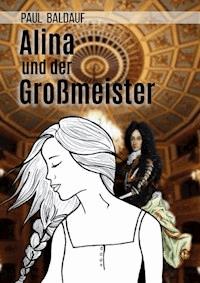Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Wagner und Rehles
- Sprache: Deutsch
Der Sohn des Verderbens: Ein Speyer-Krimi Wagner und Rehles (3. Fall) Vorspann: Morgur streift in der Dunkelheit durch Gassen und bis an den Rhein. In Nähe eines Bootes scheint ihm, als höre er eine Stimme: 'Nein, bitte nicht, lassen Sie mich los!' Szenenwechsel: Alina ist ein argloses, gutmütiges Mädchen und Einzelkind. Eines Abends bekommt sie überraschend eine Chat-Nachricht von 'Daniel, 14 Jahre'. Er sieht gut aus auf dem Foto. Ach, sie findet ihn nett, sogar schüchtern. Morgur, ein Sonderling, wird in der Firma gemobbt, von seiner Frau öffentlich erniedrigt, vom Chef in Heimarbeit gedrängt. Er zieht sich immer mehr in ein Zimmer, seine "Höhle" zurück. Eines Tages macht sich Alina heimlich auf, um Daniel auf einem verlassenen Spazierweg zu treffen. Ihren Eltern erzählte sie, sie wären vor dem IMAX-Kino verabredet. Als eine Spaziergängerin später von einem Altenheim auf dem Nachhauseweg ist, fällt ihr etwas Weißes auf. Sie kommt langsam näher und entdeckt einen leblosen Körper. Oberkommissar Wagner und seine "rechte Hand", Kommissar Rehles, beginnen zu ermitteln. Szenenwechsel: Eines Abends schleicht Frau Morgur bei Gewitter nach oben stellt ihrem Mann das Essen vor die Tür auf den Boden. Dabei hört sie einen Monolog, der ihr die Sprache verschlägt. Später macht sie in seinem Zimmer eine Entdeckung. Ihr Mann arbeitet nur stundenweise in der alten Firma. Bald taucht er dort nicht mehr auf, verhält sich zunehmend seltsam. Firmenchef Windbeutler wittert, dass irgendetwas nicht stimmt und sucht sein Zuhause auf. Unterdessen lassen die Speyerer Kommissare in ihrem Bemühen nicht locker. Wird es ihnen gelingen, Licht in das Dunkel zu bringen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 268
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Paul Baldauf
Der Sohn des Verderbens
Speyer-Krimi
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
DER SOHN DES VERDERBENS
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
Über den Autor
Impressum neobooks
DER SOHN DES VERDERBENS
PAUL BALDAUF
1. Kapitel
Er hüllte sich in seinen Mantel, verließ, nahezu fluchtartig, das Haus. Die Straßen rund um den Hasenpfuhl lagen zu dieser Zeit des Jahres verlassen da. Während unweit der Speyerbach ruhig und dunkel dahinfloss, erhob sich in Sichtweite die mächtige Kathedrale. Er knöpfte seinen Mantel zu und überquerte das Kopfsteinpflaster. In Nähe des Speyerbachs stieg er Treppenstufen empor und sah in träge vorüberziehendes Wasser. Dann wandte er sich wieder ab und schlug einen Weg ein, der ihn zum Holzmarkt führte. Eine kleine Gruppe von Menschen kam aus dem Kutscherhaus und verschwand bald im Gewirr der Gassen der Altstadt. Wohin jetzt? Ob sie gemerkt hat, dass ich gegangen bin? Er blieb stehen, seine Augen bewegten sich unruhig hin und her, während sich seine Hände in den Manteltaschen zu Fäusten ballten. Vielleicht hatte sie es ja gar nicht so gemeint…Während er dies dachte, wusste er schon, dass dieser Beschwichtigungsversuch sinnlos war. Natürlich war es genau so gemeint …Das hätte sie nicht sagen dürfen …Nun, da er eine Weile stand, merkte er erst, wie kalt es geworden war. Er überquerte den Platz, wandte sich nach links und ging in Richtung Johannesstraße. Dort blickte er nach oben und sah, wie langsam Schnee niederging. Während er planlos seinen Weg fortsetzte, Schneeflocken von seinem Mantel strich, kehrte die Erinnerung wieder, so wie ein Besucher, den man zuerst erfolgreich hingehalten hat und der sich dann doch ungestüm Eintritt verschafft: Wie sie sich vor mir auftürmte…, vor mir aufpflanzte, es sah aus, als wachse sie mit jedem Satz in die Höhe. Die Verachtung in ihrem Blick, diese schneidenden, höhnischen Worte…Es ist höchste Zeit, dass ich mich zur Wehr setze…Autos fuhren vorbei, ein Fahrer hupte. Galt es ihm? Er drehte sich um und bemerkte, dass seine Schuhe nass und mit Schlamm bedeckt waren. Seine Gedanken kehrten zu seiner Frau zurück: Warum nur drängt sie nicht darauf, sich von mir zu trennen, warum versucht sie nicht, mich vor die Tür zu setzen, wo ihr doch das Haus gehört? Denkt sie, es würde mir ohne sie besser gehen und will sie dies vermeiden…? Geht es ihr besser, wenn es mir schlechter geht? Braucht sie mich dafür?
Mittlerweile lag das Bistumshaus St. Ludwig hinter ihm und er näherte sich langsam dem Dom. Nach einer Weile tauchte zu linker Hand das Don Quijotte auf. Er sah hinüber, zur Maximilianstraße. Trotz der Kälte waren Leute zu Fuß unterwegs. Wie entspannt sie wirken, dachte er mit Argwohn und zunehmend grimmig. Wie gelassen und zufrieden! Wie können sie auf solch provozierende Art zur Schau stellen, dass es ihnen gut geht? Er überquerte die Straße und bewegte sich auf eine kleine, hinabführende Gasse zu. Plötzlich erinnerte er sich, dass er einmal genau hier, an dieser Stelle stand, als das Altstadtfest voll im Gange war. Leute drängten sich überall, auf Straßen und Gassen. Damals war er losgezogen, plan- und ziellos und allein. Dabei saß ihm die Ungewissheit im Nacken, wie und mit welchen Worten sie ihn später wieder empfangen würde, wenn er verstohlen die Wohnung betrat. Damals blickte er hin auf die Menge, die sich bei Musik und romantischem Lichtschein, sorglos und lebenslustig in Gruppen zusammenballte. Er sah hin und erlebte sich wieder einmal wie ein Fremdkörper, der keinen Zugang fand. Nach einiger Zeit fiel er damals auf, bis jemand mit dem Finger nach ihm zeigte. Er erinnerte sich an ihre Blicke und wie er in der Dunkelheit verschwand, wie ein scheues Wild, das sich schnell im Gehölz verbirgt.
Nun war er auf Höhe des Domhofs. Selbst bei diesem Wetter stand ein Fenster gekippt. Lichtschein fiel auf die Straße, Stimmen und Gelächter waren zu hören. Leute betraten gut gelaunt den Innenraum des Lokals oder verließen ihn zufrieden. Er passierte sie, ohne sie anzusehen. Am liebsten hätte er sich noch etwas tiefer in den Mantel verkrochen. Er wartete ab, bis Autos vorbeigefahren waren. Dann näherte er sich, an den Pollern des Domplatzes vorbei, dem Domnapf. Er fühlte, wie er die Erinnerung nicht länger niederhalten konnte. Das hätte sie nicht tun dürfen! Er sah sich selbst wieder das Firmengelände betreten: Skeptische Blicke der Kollegen und dann ihre Entdeckung, dass er nichts mitbrachte. Warum hatte sie ihm keinen Kuchen gebacken, aber so getan, als ob? Alle Kollegen gaben am Geburtstag einen aus und er wusste doch, dass sie nur wegen des Kuchens und der Getränke mit ihm zusammensitzen wollten. Das war Absicht! Sie ließ mich auflaufen. Und dann war es zu spät: Noch einen Kuchen kaufen, schnell in die Bäckerei laufen? Nein, nein, das akzeptierten die Kollegen nicht. Die schmeckten den Unterschied heraus und warfen es einem vor. Sie hatte ihm doch immer einen Kuchen gebacken. Nicht meinetwegen, sondern weil alle in der Firma wussten, dass er von ihr stammte und sich ihr Ruf als exzellente Kuchenbäckerin herumsprach. So war die Feier ausgefallen. Nicht, dass ihm da etwas fehlte. Die Feier war immer eine Qual, da er spürte, dass er nicht dazu gehörte, da er ihre befremdeten Blicke wahrnahm, ihre Anspielungen mitbekam. Aber Kuchen verschlangen sie gern und so war ihre Laune ihm gegenüber an diesem Tag immer besser. Aber heute stand ich mit leeren Händen da und die meisten haben mir noch nicht einmal gratuliert. Er sah wieder die Blicke von Kollegen, den bald stummen, bald ausgesprochenen Vorwurf, ihre Enttäuschung, ihr Kopfschütteln. Der Chef des Hauses ließ ihm über seine Sekretärin kühl gratulieren und dann war er den ganzen Tag wieder allein in seinem Kabuff. Das war die schlimmste Strafe, dass sie mich in diesen Kabuff verbannt haben. Dabei habe ich doch damals diese Prüfung abgelegt und gut bestanden, noch eine Fortbildung und Seminare besucht. Buchhaltung, Rechnungsprüfung: Da macht mir so schnell niemand etwas vor! Dies war eine Welt, in der er sich auskannte, die klar, geregelt und überschaubar war, in der die Zahlen nicht eigenmächtig wurden und das Programm seinen Eingaben und Vorgaben zu gehorchen hatte! Oh, ja, er war ein effizienter Buchhalter, ein hervorragender Rechnungsprüfer. Kein Wunder eigentlich, wenn man es von einem anderen Blickwinkel aus bedachte, dass man ihn in diesen kleinen, engen, schlecht beleuchteten Kabuff wegsperrte. Sie konnten bestimmt meine Überlegenheit nicht mehr ertragen, die drei Buchhalterinnen und haben heimlich gegen mich intrigiert. Mittlerweile war er sogar froh, war er doch die meiste Zeit über von ihrem Anblick befreit.
Während er weiterlief, den Domkiosk passierte, sah er sie wieder vor sich. Am meisten nahmen sie ihm bestimmt übel, dass er sich an ihrem Getratsche nicht beteiligte. Was hätte ich auch sagen sollen? Zumal ihn nach einiger Zeit der Verdacht erfüllte, dass sie – hinter meinem Rücken, diese verschlagene Brut! – über ihn tratschten! Wie sie ihre Köpfe zusammensteckten, tuschelten, verstohlen zu ihm hinsahen und dann, wenn er eintrat, plötzlich wieder auseinander gingen... Sicher duldeten sie ihn in der Firma nur, weil er in seinem Fach wirklich gut war. Ja, die Zahlen trügen nicht, ich habe sie im Griff. Wenn er diese endlos langen Listen von Zahlen vor sich sah, die sich aus Forderungen oder Zahlungsverpflichtungen ergaben, so schienen sie ihm wie ein kleines Heer, das seinem Befehl unterstand. Und immer ging die Rechnung auf. Im Grund waren ihm diese Zahlen viel lieber als die Leute, die in der Firma arbeiteten. Die Zahlen fragten nicht aus, gingen nicht auf Distanz, tuschelten nicht und waren nicht falsch.
Mittlerweile war er, am Springbrunnen vorbei und die Treppe hinab, in den Tiefen des Domgartens angekommen. Und was für ein Tag ist heute? Er blickte – gleichsam mit Argwohn – auf sein Gedächtnis. Heute war sein Geburtstag. Und wie feierte er, wer feierte mit ihm? Der Park lag verlassen in der Dunkelheit. Er blickte zu den Bäumen. Wie gut, dass sie immer still waren. Wie oft wünschte er, dass die Leute in der Firma auch so still wären. Aber nein, sie redeten und er hegte zusehends den Verdacht, dass er selbst zum Hauptgegenstand ihrer Gespräche wurde. Tauchte er irgendwo auf, wurden sie plötzlich still, sahen sich vielsagend an. Währenddessen ging er an der Minigolf-Anlage vorbei. Wie lächerlich kam es ihm einmal vor, als er hier an einem Wochenende vorbeilief, wo Familienmitglieder eng zusammenstanden, sich bemühten einzulochen und dann ihre Mienen, wenn es einem von ihnen gelungen war. Als wäre damit irgendetwas gewonnen. Dann taten sie ganz fröhlich und gingen zuversichtlich zur nächsten Station, Leute, die zusammengehörten, die die Gesellschaft genossen und er, er schaute aus der Entfernung zu, hoffte, dass ihre Schläge misslängen. Was für ein Lächeln lag auf ihren Zügen, wenn sie erfolgreich spielten. Sie sahen aus, als wären sie das blühende Leben. Dabei waren sie doch alle Todeskandidaten, wenn man es genau bedachte: Ein paar Jahre oder Jahrzehnte und dann würde ihnen ihr Einlochen nichts mehr nutzen: Dann würde man sie betten, in einen kleinen, engen Raum, in den niemand wollte… und der noch enger war, als der Kabuff, in den man ihn verbannte.
Er blickte zu den vor ihm liegenden Rasenflächen, die die Dunkelheit wie mit einem Laken bedeckte. Weiter hinten erstreckte sich der Rhein, jener, seltsam zeitlos wirkende Strom. Manchmal stand er einfach nur nahe am Rheinufer und schaute hinaus, betrachtete langsam dahin fließende Wassermassen. Schiffe störten da eher. Als er einige Schritte später in Höhe des Alter Hammer angekommen war, schaute er scheu nach rechts. Einige Leute saßen doch tatsächlich bei dieser Kälte im Freien. Für einen Moment fühlte er sich versucht, auf sie zuzugehen und ihnen laut zuzurufen: ’Ich habe heute Geburtstag! Was sagt ihr nun?!’ Aber er verwarf den Gedanken, schlug seinen Kragen hoch, beschleunigte den Schritt. Sicher sah jetzt jemand nach ihm, oh ja, er konnte schon ihre Blicke spüren. Sicher dachte der ein oder andere: Wer ist das denn? Was will der hier, wo geht er hin? Aber er war ihnen keine Auskunft schuldig, und ihr auch nicht, später, wenn er wieder in ihr Haus schlich, bei Nacht.
Ob sie sich jetzt Gedanken macht, wo ich bin? Sie wird froh sein, dass ich fort bin. Zugleich wird sie wütend sein, dass ich Ihre Erlaubnis nicht eingeholt habe. Auf einmal tauchte vor seinem geistigen Auge wieder jene Szene auf, die seinem Gedächtnis unauslöschlich eingebrannt war. Lag es Tage, Wochen oder Monate zurück? Es war, als weigere sich sein Gedächtnis, mit dieser bildhaft-akustisch gespeicherten Erniedrigung auch noch ein festes Datum zu verbinden: Ihr verächtlich geringschätziger Blick…: ‘Sieh dich einmal an! Wenn du dich sehen könntest, wie ICH dich sehe…Was für ein jämmerliches Bild von einem Mann! Du wirst langsam zur Mumie. Was hast du erreicht? B u c h h a l t e r..Da kauerst du vor dich hin in deinem Kabuff und vermoderst irgendwann oder bekommst Schimmelpilze. Dich kann ich doch nirgends mitnehmen!‘
Er lief schneller, blieb auf einmal stehen, presste seine Handflächen gegen seine Ohren. Ich will diese Stimme nicht mehr hören, weg mit dir, n i e m e h r! Er war nunmehr, in unmittelbarer Nähe des Rheins, vor einem kleinen Boot angelangt, das unweit eines Spazierweges auf eine kleine freie Fläche postiert worden war. Er blieb stehen und schaute dumpf auf den Strom. Wie still es hier ist... Er trat näher und sah zu dem Boot, lauschte: Kein Laut…Oder doch? Was ist das für eine Stimme…, woher kommt sie: N e i n, b i t t e n i c h t! W a s t u n S i e? W e r s i n d S i e? L a s s e n S i e m i c h l o s! Und dann ein langer, heller, bald gedämpfter und zum Ersticken gebrachter Schrei…Hörte er da nicht ein Geräusch, wie von einem Gewicht, das auf den Boden aufschlug? Er trat entsetzt zurück. Was war das eben? Er sah sich um, lauschte: Kein Mensch weit und breit. Er atmete schwer.
2. Kapitel
Eine Woche danach
Kommissar-außer-Dienst Rehles blickte zufrieden in die Weite und begleitete dies mit einer entsprechenden Geste.
„Immer wieder schön, der Weihnachtsmarkt.“
Oksana hing an seinem Arm und seinen Lippen. Er deutete auf die herrliche Beleuchtung am Stadthaus, an der Alten Münze, dann hin zu Verkaufsständen und leuchtenden Girlanden, die der Stadt um diese Jahreszeit ein ganz besonderes Flair verliehen. Wer ihn sah, wie er seiner Frau mit stolzem Blick die Schönheit des vorweihnachtlichen Speyer zeigte, hätte fast auf den Gedanken kommen können, Rehles habe das Ganze mit aufgebaut. Sicher, Lemberg, die Heimatstadt meiner Frau, ist eine faszinierende Stadt. Aber Speyer kann sehr gut mithalten. Der Schnee knirschte unter seinen Stiefeln. Oksana hielt sich an ihm fest. Ihr elegantes Schuhwerk war nicht auf der Höhe der kalten Jahreszeit.
„Magst du einen Glühwein?“
In Gedanken zückte er schon lässig sein gut gefülltes Portemonnaie.„Trinken wir beide eine Glühwein und nachher musst du mir nach Hause tragen.“
Er schüttelte kennerhaft den Kopf.„Nein, nein. So stark ist der nicht. Nicht wie euer Vodka.“
Er biss sich auf die Lippen. Das hätte ich besser nicht gesagt…Die Erinnerung stieg in ihm auf: Jener erste Abend bei Oksanas Eltern in Lemberg, oder Lviv, wie sie dort sagten…Erst die Schwierigkeiten bei der Verständigung und dann seine Hingabe an ein Ritual, das dort bei bestimmten Anlässen einfach dazu gehörte: Vodka…Dabei nahm er doch sonst immer nur in vertretbaren Mengen sein Bitburger zu sich. Dieser Vodka war Neuland für ihn und stärker als erwartet. Er räusperte sich, während er versuchte, peinliche Vorkommnisse von damals aus seinem Gedächtnis zu tilgen. Oksana neckte ihn:„Kann ich mir noch gut erinnern, wie du unsere Vodka probiert hast. Weißt du noch, wie heißt bei uns? Horilka! Schon stärker als deine Bier. Damals noch ein Glas mehr und kannst du auf Ukrainisch singen.“Er lachte etwas gequält, zog sie weiter, bahnte sich einen Weg – „Danke, geht schon“ – wich hier aus, drängelte dort, bis sie endlich vor einem Glühweinhäuschen standen. Im Handumdrehen hielten sie ein Glas Glühwein in der Hand, stießen an.
„Autsch, gut warm.“Oksana lachte vergnügt.„Musst du langsam machen, so wie Katze.“Sie machte es ihm vor. Er blickte verdrießlich. So wie Katze? Nein, nichts für mich, da warte ich lieber. Er blies über den heißen Wein, während Oksana wohlige Laute von sich gab. Fehlt nur noch, dass sie anfängt zu schnurren…Seine Stimmung wurde wieder besser.
„Ha!“ rief er auf einmal aus.„Was hast du?“„Da vorne…, die Schneebel!“„Wer?“„Sandra Schneebel, bisher unsere Auszubildende. Wird übernommen.“„Ach so.“Sie sah in die Richtung, in die sein Finger zielsicher deutete. Unweit von ihnen stand eine junge Frau mit schwarzem, lockigem Haar, die ihnen halb den Rücken zudrehte. Sie unterhielt sich lebhaft mit einer anderen jungen Frau.„Willst du hingehen und ihr begrüßen?“„Sie begrüßen.“„Am Ende gefällt dir noch und machst ihr schöne Augen!“ Rehles wusste nicht genau, ob sie es nun ernst meinte. Er nahm vorsichtig einen Schluck Glühwein, schüttelte den Kopf:„Keine Sorge, ich glaube, da gibt es andere, die ihr hinterher sehen...“„Ach, ja?“
„Wa…“, er hielt gerade noch rechtzeitig inne.
„Wie?“„Wa…s ich gerade sagen wollte: Der Puhrmann hat, glaube ich, ein Auge auf sie.“Von Wagner sage ich besser nichts. Wo er doch so oft bei ihr im Eiscafé vorbeischaut. Ist schließlich mein Chef. Nur nichts anbrennen lassen. „Ah, du meinst eure, wie sagt man, oberste…?“„Hauptkommissar.“Sie kniff ein Auge zu.
„Hat ein Auge auf sie? Na, wenn nur ein Auge ist…“In diesem Moment drehte Sandra Schneebel sich um. Sie erkannte Rehles, stieß ihre Freundin an und beide kamen näher. Der Kommissar fuhr eine Hand aus.„Oksana, das ist Sandra Schneebel. Oksana, meine Frau.“Nun kreuzten sich Arme und Hände. Oksana nahm Sandra heimlich ins Visier: Ist sie sehr hübsch…Kein Wunder, dass diese Puhrmann oder wie heißt, um sie herum schleicht wie um Brei. Wagner arbeitet auch mit diese Sandra. Bestimmt gefällt sie ihm auch. Kommt er vielleicht deswegen nicht mehr so oft in Eiscafé? Hm.Ihr Mann trat von einem Fuß auf den anderen. Was nun? Den Damen einen Glühwein spendieren? Geht ganz schön ins Geld. „Einen Glühwein, die Damen?“Bevor sie noch protestieren konnten, bestellte er. Sandra war vergnügt:„Noch änner? Oh, wei!“Dann dankten beide. Er trank zügig aus und erhob erneut die Hand.„Für uns dann auch noch einen, bitte.“Oksanas Protest kam zu spät. „Musst du mir nachher nach Hause tragen, quer durch Stadt. Kann ich sowie schlecht laufen, mit diese Schuhe.“Sandra Schneebel probierte den Glühwein.„Huu, der iss noch heiß!“Nun war wieder einmal die Erfahrung eines Mannes gefragt, der mit beiden Beinen fest im Leben stand.„Am besten, man trinkt ganz vorsichtig, so wie eine Katze.“Sandra und ihre Freundin lachten fröhlich. Oksana dachte, sie höre nicht richtig. Sie sah ihren Mann aus den Augenwinkeln an und setzte für einen Moment einen Schmollmund auf.
3. Kapitel
Am nächsten Morgen verließ Oberkommissar Wagner Schramm’s Kaffeerösterei in der Gilgenstraße. Er spürte, wie die Tasse Columbian Medellin ihre Wirkung zu entfalten begann. Ah…, das tut gut! Die Luft war angenehm frisch und kühl, Straßen glänzten von frisch gefallenem Schnee, es atmete sich leicht. Er hüllte sich tiefer in seinen Mantel und rieb sich die Hände. Während er vor seinem geistigen Auge einen Kalender überflog und die Anzahl der noch freien Tage ausrechnete, steuerte er auf den Durchgang am Altpörtel zu. Ein Mädchen huschte aus einer Tür von Blumen Nothhelfer und ließ, eine Passantin begrüßend, ihren Charme spielen. Speyer, wahrlich kein schlechtes Pflaster… Ob ich für immer hier bleibe? Er blickte auf Schnee, der ringsum gut verteilt war. Was nun? Sehen, ob irgendein Bistrot aufhat, in dem ich ein vernünftiges Frühstück bekomme? Auf einmal wurde ihm bewusst, dass er seit etlichen Tagen einen Termin vor sich herschob: Es hilft ja alles nichts, muss mal wieder zum Friseur. In der Wormser Straße angekommen, passierte er die alteingesessene Buchhandlung Oelbermann, überquerte die Straße und lenkte dann seine Schritte zum Haarparadies Hammer. Er schaute hinein: Noch war kein anderer Kunde da. Er trat ein, hängte seinen Mantel auf. Ein junger Mann begrüßte ihn freundlich.„Nehmen Sie Platz. Ich komme gleich.“Es dauerte nicht lange – „So, jetzt!“ – und der Friseur stand hinter ihm. Er holte einen Umhang und brachte ihn so an, wie es sich gehörte. Eine flinke Handbewegung und schon entdeckte Wagner einen Spiegel hinter sich.„Wie sollen wir’s schneiden?“Wagner sah sich um. Wir? Ist noch jemand da?„Kürzer.“Der Friseur lachte, gut gelaunt, hell auf.„Und ich dacht’ schon, ich soll’s Ihne länger mache.“Er trat näher und fügte leiser hinzu: „Ä Spässel.“Der Friseur stellte das Radio etwas leiser −…auf der A6…, bitte fahren Sie vorsichtig − und ergriff ein kleines Sprühgerät. „So, jetzt wird’s graad e bissje nass.“Wagner verdrehte die Augen. Der Friseur, der behutsam vorging, sprühte nichtsdestoweniger so lange, bis die Haare feucht genug waren. Da komme ich mir ja vor, als wäre mein Kopf eine Topfpflanze… „So kann ich einfach besser schneide, als wenn’s ganz trocke iss.“Wagner nickte. Am besten nicht widersprechen, lag ja außerhalb seines Kompetenzbereichs.
„Unn um die Ohre rum…? Halb bedeckt oder alles freimache?“„Wäre gut, wenn Sie die Ohren dran lassen: Spässel!“Der Friseur lachte vergnügt auf.„Alla guut.“Er kämmte und schnitt, schob Haare hin und her, veränderte den Blickwinkel, schnitt weiter. Doch der Gast blieb stumm. Nun sah er, dass er sogar die Augen geschlossen hielt. Der wird mir doch am Ende nicht hier einschlafen…Da hörte Wagner vorderpfälzischen Singsang:„Ä Tässel Kaffee?“„Nein, danke. Ich war vorhin in Schramm’s Kaffeerösterei.“„Ich dacht’ nur, weil Sie so still sinn.“„Ach, wissen Sie…, wenn man beruflich immer so viel reden muss…“„Wem sagen Sie das? Des iss ganz klar, dess versteh ich. Da iss mer als froh, wenn man mal sei Ruh hat. Nur manche Kunde, die erwarten einfach, dass man sich nach Ihne erkundigt und sich unnerhält.“„Da können Sie bei mir beruhigt sein.“
Langsam wurde er doch ein wenig neugierig. Würd’ mich schon mal interessieren, was der beruflich so macht…„Da haben Sie einen Beruf, in dem man viel rede muss? Ich versteh…“Was könnt’n der sei: Anwalt?„Manchmal bin ich auch lange Zeit still und grübele nur.“„Und dafür wer’n Sie bezahlt? Dess deed mer aah gefalle! Ich grübel als auch viel, aber mir zahlt niemand was dafür. Das iss der Unnerschied.“„Die Lebensschicksale sind sehr unterschiedlich.“„So isses!“
Der Friseur setzte mit einer letzten Schnittoffensive gleichsam das Fanal zum Endspurt. „Ein paar graue hab ich schon entdeckt. Iss abber net schlimm.“Wagner zog die Mundwinkel nach unten.„Wenn’s Ihne mit der Zeit mit dem Grau zuviel wird, kummen Se halt zu mir und dann mache mer die Packung druff.“Der Friseur raunte unter dem Siegel der Verschwiegenheit:„Sie wer’n lache, dess machen immer mehr Männer. Oft die, wo mer’s gaar net denkt.“„Ich fürchte, ich werde nicht lachen.“Der Friseur holte flugs einen großen Spiegel und zeigte seinem Neukunden das Resultat seiner Haarpflegekunst.„Zufriede?“„Sehr gut!“
In diesem Moment ging die Tür auf, ein Mann trat ein. Wagner blickte in den Spiegel und war bestürzt.„Was machen S I E hier?!?“Hinter ihm stand Kommissar Rehles, der Mann, den ihm sein berufliches Schicksal vor einigen Jahren über den Weg führte. „Äh, ich wollte gerade zum Friseur.“Rehles starrte vor sich hin, als habe er sich in der Zimmertür eines Büros geirrt. Dann deutete er auf die vielen Haare am Boden:„Das hat sich aber gelohnt.“Wagner verzog das Gesicht. Dann nahm er den Haarschopf seines Mitarbeiters in den Blick. Diese verwegene Locke gehört auch mal ab.„Ich dachte, Oksana schneidet Ihnen die Haare?“„Das war einmal. Seit sie im Eiscafé Roma arbeitet…“Wagner bewegte sich zur Kasse.„Stimmt so.“„Danke!“An der Tür drehte Wagner sich noch einmal zu Rehles um.„Bin jetzt schon gespannt, wie Sie am Montag aussehen...“
4. Kapitel
5. Kapitel
Auf demselben Flur, gleich neben dem Aufgang zur Treppe, fand sich zu rechter Hand der Eingang zum Personalbüro. Herr Unterberger strich sich durch sein graumeliertes gewelltes Haar und versuchte sich zu konzentrieren:
„Moment e mohl. Sahn mer mohl…“
Er zückte seinen Filzstift und überprüfte die Urlaubsliste, die der Auszubildende ihm vorlegte. Dann hob er das Blatt in die Höhe, so als müsse er es erst im Licht der Sonne betrachten. Die mit Schreibmaschine und Lineal gezogene Umrandung war doch auf dieser Seite…, mal sehen. Nein, obwohl…, vielleicht 1 Millimeter?
Er holte sein Lineal aus der Schublade, legte an und maß ab. Er fühlte eine gewisse Gereiztheit in sich aufsteigen. Darüber befragt, hätte er wohl kaum zu sagen vermocht, woher sie stamme und auf wen oder was sie sich richte. Er beugte sich nach links und linste in den Nebenraum:
„Herr W a d l e?“Der Auszubildende, der inzwischen an seinen Arbeitsplatz zurückgekehrt war, schrak auf und blickte nach links. Herr Unterberger winkte ihn herbei, bewegte sich dabei unruhig hin und her, wie er immer zu tun pflegte, wenn jene schwer zu steuernde Gereiztheit von ihm Besitz ergriff. Er zeigte auf das Blatt, gerade so als ob dieses ein Corpus Delicti sei. Dann wedelte er mit ihm hin und her:„So kann ich das nicht brauchen!“Der Auszubildende lugte hervor, so wie eine Schildkröte ihren Kopf aus dem Panzer hervor schiebt. Kleinlaut fragte er:„Wieso?“Herr Unterberger zeigte, zur Stütze seiner Anklage, auf das zuvor mitgelieferte Muster. Dann maß er erneut nach:„Die Linie hier…, hätte ich gern etwas tiefer. Und hier, etwas höher. Gerade so, wie hier auf dem Blatt!“Der Auszubildende, der das Fadenscheinige des Vorwurfs klar erkannte, fühlte zugleich, dass eine Diskussion kaum weit führen würde. Er blickte in das Gesicht des Angestellten, der den Geist der Personalabteilung verkörperte. Einmal in der Woche war er meist einer der Ersten, die unten im Eingangsbereich eingetroffene Brezeln abgriffen und nach oben beförderten. Dann spendierte er auch schon mal die eine oder andere Brezel und trat als Vaterfigur auf. Sein Gesichtsausdruck glitt dann zuweilen ins Joviale, Leutselig-Betuliche ab. Nun aber zeigte er ein ganz anderes Gesicht, das eines Mannes, der langsam aber sicher fuchtig wurde. Der Auszubildende wich zurück, zeigte den ersten abgelieferten Entwurf, verglich ihn mit den Angaben Unterbergers und preschte nochmals vor:„Der erste Entwurf, den ich Ihnen gegeben habe, war genauso, wie Sie es jetzt haben wollen.“Unterbergers Blick blitzte geradezu auf. Es fehlte nur noch, dass Funken sprühten. Er nahm das als Beweis guter Erstausführung vorgelegte Blatt unwirsch entgegen – „Moment e mohl“ – und wurde durch festes Klopfen an seiner Tür abgelenkt.„Wir sprechen dann später…“
Der Auszubildende zog sich zurück und bekam mit, wie der Leiter der Abteilung Einkauf, Herr Riesbacher, das Arbeitszimmer von Unterberger betrat. Riesbacher steckte, wie immer, in einem etwas eng bemessenen, penibel sauber gehaltenen und etwas antiquiert wirkenden Anzug. Etwas Unruhiges, Quirliges ging von ihm aus, so als sei er immer und überall, jederzeit gerade auf dem Sprung oder werde von einem Sprung abgehalten. Der Auszubildende hätte sich nicht gewundert, wenn in Riesbachers Körper tatsächlich eine Sprungfeder steckte. „Herr Unterberger…, Folchendes: Stör’ ich?“Die Frage schien nicht wirklich nach einer Antwort zu verlangen und klang beinahe eher so, als hoffe hier jemand auf Zustimmung zur Frage. Seine Füße bewegten sich unruhig hin und her. Herr Unterberger blickte auf und verneinte.„Wenn Sie jetzt ’ja’ gesagt hätten, wäre ich trotzdem nicht gegangen!“
Herr Riesbacher hatte seine Stimme bewusst erhoben, wusste er doch um die Anwesenheit von zwei Mitarbeiterinnen im Nebenraum. Den Auszubildenden betrachtete er – rein kaufmännisch-rechnerisch – als zu vernachlässigende Größe. Seinen Satz schloss er mit Gelächter ab, das sich nur zur Hälfte freie Bahn brach und deshalb etwas krampfig wirkte. Herr Unterberger fühlte, wie die impertinente Bemerkung von Riesbacher – was glaubt der eigentlich?!? – seine schon leicht siedende Gereiztheit weiter aufheizte.„Um was geht’s?“„Jetzt lachen-se doch auch mal, Herrn Unterberger! Net immer so ernst. Folchendes…“Während er seine Stimme anhob, lauschte er mit einem Ohr in den Nebenraum. Wie erwartet, hörte er nun zu seiner Genugtuung ein gedämpftes Lachen der Damen, die Unterberger zuarbeiteten. Diesen lag daran, dass ihr Lachen seitens Unterbergers keinesfalls so gedeutet werden könne, als machten sie sich etwa über ihn lustig. Ihr Gelächter klang daher auch eher so, als wolle jemand zum Ausdruck bringen, wie gut hier das Arbeitsklima sei, wenn sogar während der Arbeit gelacht werde. Riesbacher hatte aber für solche Feinheiten kein Ohr. Seine Sache war die klar zu berechnende, streng zu kalkulierende Welt der Ver- und Einkaufspreise, der Preise pro Stück oder Ries, der kaufmännischen Bilanzen, der buchhalterischen Grundsätze, der doppelten Buchführung. Nicht ohne Stolz führte er gelegentlich an, dass er ja bei der IHK in Ludwigshafen seinerzeit eine Fortbildung absolviert und mit sehr gut bestandener Prüfung abgeschlossen habe, die in gehobenen kaufmännischen Fachkreisen Ansehen genieße. Nun wandte er sich Unterberger auch in der Körpersprache zu, sprach gedämpfter. Das Fußvolk von nebenan sollte gar nicht erst auf die falsche Idee kommen, als lasse hier jemand die Zügel schleifen und stelle eine Atmosphäre plumper Vertraulichkeit her. „Folchendes, Herr Unterberger. Eine Fraache…Wie viele Urlaubstage hab ich eigentlich noch?“Unterberger hatte diese simple Frage nicht erwartet. Erleichtert sah er sich um und begleitete dies mit zunächst seltsamen Lauten, derer er sich offensichtlich nicht bewusst war und deren Bedeutung sich nicht auf Anhieb erschloss : „Perúmpumpum…Ich kann’s net saache, so aus em Stegreif. Einen Moment...“Er schaute sich auf dem Schreibtisch um, öffnete eine Schranktür und blickte dann in den Nebenraum…Nun erklang eine gereizte, argwöhnisch klingende Stimme:„H e r r W a d l e?!“Er hatte die Buchstaben bewusst in die Länge gezogen, rechnete er doch damit, dass der Auszubildende vermutlich in Gedanken oder in eine seine Aufmerksamkeit ganz auf sich ziehende Arbeit vertieft war.„Ja?“„Kommen Sie mal bitte.“Der Auszubildende erhob sich und trat in den Bereich unmittelbar vor dem Nebenzimmer. Herr Riesbacher musterte ihn mit einem Blick, den er so ähnlich auch aufsetzte, wenn eine neue Großlieferung Papier eintraf, die peinlich genau auf Übereinstimmung mit der Bestellung zu prüfen war. Dabei zog er die Stirne etwas in die Höhe, wie jemand, der zu lange gelesen hat und blinzelte. „Sie hatten doch vorher die Urlaubsliste?“„Ja, hab ich Ihnen zurückgegeben.“Herr Unterberger blickte ihn ungläubig an und zog ein Gesicht, als sei nun ein Meineidiger gleich einer Unwahrheit zu überführen. Bevor er etwas entgegnen konnte, preschte Riesbacher nach vorn:„Richtich, richtich, da isse ja.“Er hatte die Liste hinter einem Ordner entdeckt. Unterberger spürte, wie sich seine Gereiztheit einem neuen Höhepunkt näherte.„Ja, so kann ich das nicht brauchen!“Der Gesichtsausdruck des Auszubildenden glich in bemerkenswerter Weise einem Fragezeichen. Unterberger legte nach:„Wenn Sie mir die Liste zurückgeben, dürfen Sie sich nicht einfach hinter den Ordner legen.“„Hab ich auch nicht. Den Ordner haben Sie nachher erst hervorgeholt. Der stand vorher gar nicht da.“
Unterberger kochte und schnaubte. Riesbacher, der aus irgendeinem unbekannten Grund guter Dinge war, schaltete sich quirlig ein:„Herr Unterberger, das ist ja schon bedenklich. Sie werden doch nicht langsam vergesslich werden, so wie unser…, Sie wissen, wen ich meine.“