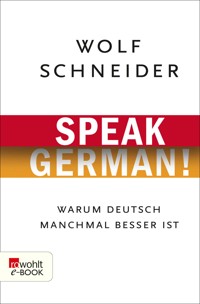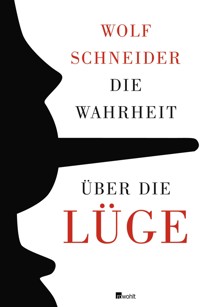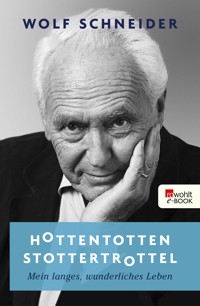9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Warum «ein Nachruf»? - Weil die Ära des Soldaten, wie wir ihn kennen, zuende geht. Heute taugt der Soldat nicht mehr zum Siegen: Selbstmordattentäter, sogar Partisanen sind ihm überlegen, erst recht die Drohnen, die Atomraketen, die Computer und auch menschliche Kampfmaschinen wie die Navy Seals. Der «klassische», der «symmetrische» Krieg ist so gut wie gestorben. Wolf Schneider geht dieser Entwicklung nach und nimmt dies zum Anlass einer umfassenden Erzählung: einer Geschichte des Soldaten, seines Handwerks, seiner Waffen, Strategien, atavistischen und kulturellen Motive, seiner gesellschaftlichen Stellung. Was waren das für Menschen, die da töteten oder auch nicht - wie taten sie es und warum? Wie ist es ihnen ergangen – auf dem Kasernenhof und in den Schlachten, die Länder verwüstet, Kulturen zerstört und Völker ausgerottet haben? Was trieb sie zu den Waffen – und wenn ihnen die Waffe in die Hand gezwungen wurde: Was zwang sie, von ihr Gebrauch zu machen? Wolf Schneider breitet in diesem Buch eine umfassende Weltschichte der Menschen aus, die andere Menschen töten sollten – der Begeisterten (die gab es) und der in Uniform Gepressten, der Schinder und der Geschundenen, der schreienden Opfer und derer, die man allenfalls «Helden» nennen könnte. Eine 3000 Jahre umfassende, facettenreiche Geschichte des Kriegers über Zeiten, Kontinente und Kulturen hinweg, die ihresgleichen sucht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 718
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Wolf Schneider
Der Soldat - Ein Nachruf
Eine Weltgeschichte von Helden, Opfern und Bestien
Rowohlt E-Book
Inhaltsübersicht
Inhalt
1 Wieso ein «Nachruf»? 9
I.Der Krieg braucht keine Soldaten mehr 13
2 Denn die Drohnen haben übernommen 15
3 Und die Atomraketen warten 20
4 Die Selbstmordattentäter warten nicht 25
5 Die Partisanen siegen 36
Wie nennen wir wen? 47
6 Und die Computer übernehmen 50 Die Krieger von morgen: Nerds und Geeks 56
II. Wie alles anfing 59
7 Die Menschenjagd 61
8 Der Zweikampf 73
9 Seit wann gibt es «Kriege»? 80 Kriegstote in der Neuzeit 91Wie nennen wir was? 94
10 Seit wann gibt es «Soldaten»? 97 Heeresstärken (bis 1700) 107
11 Carnots Soldatenfabrik 113 Heeresstärken (seit 1740) 125
III. Womit sie kämpften 127
12 Mit Pfeil und Schwert 129
13 Zu Pferde 138
14 Zu Fuß und im Karree 149 Die Wahrheit über Winkelried 160
15 Mit Feuer 162
16 Mit Stahl und Gas 177
IV. Wofür sie starben 189
17 Gründe – Vorwände – Irrtümer – Lügen 191
18 Für Raum und Beute 208
19 Fürs Vaterland 217
20 Für den Triumphator 222
21 Für Ruhm und Rache 229
22 Für ihre Religion 241
23 Für Plunder und Trophäen 249
24 Für Faulheit und Vergnügen 261
25 Fürs Abenteuer 271
26 Im Blutrausch 281
27 Mit Gewalt 292 Was ist ein Kriegsverbrechen? 301
28 Und wo bleibt der Mut? 303
V. Womit man sie zwang oder überlistete 313
29 Mit Stacheln 315
30 Mit Drill 324
31 Mit Medaillen 335
32 Mit buntem Tuch 344
33 Mit Kameraden 357
34 Mit Posaunen 364
35 Mit Angst 377 «Feigheit vor dem Feind» 382
VI. Wie sie verreckten 385
36 Sie litten erbärmlich 387 Trauma – Stress – Neurose 398
37 Sie starben entsetzlich 400
38 Für Napoleon und für Hitler 412
39 Und «Helden» gab es auch? 424
VII. Wie man vielleicht überleben kann 435
40 Soldaten: durch Verweigerung? 437 Stufen der Unfreiwilligkeit 446
41 Wir alle: mit Blauhelmen? 448
42 Durch Pazifismus? 454
43 Durch Einsicht? 465
Nachwort 481
Literaturverzeichnis 483
Quellennachweis 497
Bildnachweis 520
Namen- und Sachregister 521
Bücher von Wolf Schneider 544
1 Wieso ein «Nachruf»?
Weil die Ära des Soldaten, wie wir ihn kennen, zu Ende geht. Drei Jahrtausende lang war der Soldat der große Beweger der Weltgeschichte, das Objekt von Angst, Bewunderung und Entsetzen. Länder hat er verwüstet, Kulturen zerstört und Völker ausgerottet. Einen Ozean hat er mit Blut gefüllt. Mehr Leid hat er zugefügt, oft auch mehr gelitten als alle anderen Menschen. Nur dass nichts besser werden wird ohne ihn.
Schon für Hiroshima wurden Soldaten im überlieferten Wortsinn nicht mehr gebraucht. Nun werden die Bomben durch die Drohnen ersetzt und die Kämpfer demnächst durch Kampfroboter; zum Siegen taugen Soldaten nicht mehr, wir erleben es in Afghanistan; fürs Töten zuständig sind Söldner, Partisanen, Selbstmordattentäter oder eine Handvoll menschlicher Kampfmaschinen wie die Navy Seals. Sogar ohne Blutvergießen könnte der nächste, vielleicht der letzte große Krieg entschieden werden, der Endkampf um die Weltherrschaft: der Cyberwar.
Was war denn das für einer, der Soldat – ein Held? Heldentod, Heldenfriedhof, Heldendenkmal: Die Wörter sind ja noch geläufig, doch lebendig längst nicht mehr, sympathisch noch weniger, und realistisch waren sie nie – als hätte die Mehrheit einer Armee je aus «Helden» bestanden, aus vorbildhaften Männern also von unerhörter Tapferkeit! Die waren meist die Ausnahme. Falls wir das Wort «Held» überhaupt bewahren wollen, dann allenfalls für jene Soldaten, die für eine unstreitig gute Sache kämpften und standhielten bis in den Tod.
Ein Opfer? Ja, das war er. Millionenfach. In den beiden Weltkriegen zumal, den Tiefpunkten der Menschheitsgeschichte – als die Allgemeine Wehrpflicht die jungen Männer in ein Schlachten trieb, dem die wenigsten gewachsen waren, einem Feind entgegen, der meist nicht der ihre war: So stolperten sie zu Millionen ins Sterben. Bert Brecht war ihr beredtester Anwalt, mit den klassischen Zeilen aus den «Fragen eines lesenden Arbeiters»:
Wenn es zum Marschieren kommt, wissen viele nicht,
Dass der Feind an ihrer Spitze marschiert.
Die Stimme, die sie kommandiert,
Ist die Stimme ihres Feindes.
Der kleine Mann als Unschuldslamm, das von den Herrschenden zur Schlachtbank getrieben wird: Diese Ansicht hat als Gegenpol zu einem jahrtausendelangen Feldherrn- und Heroenkult ihren Zweck gehabt; mit der Wahrheit steht sie in keinem Zusammenhang. Die blutige Geschichte der Völker lehrt, dass ruhmreiche Generale und unbekannte Soldaten einander an Angriffslust nicht nachstanden, ja oft wurden widerstrebende Feldherren von kampf- und beutelüsternen Kriegern in eine Schlacht getrieben, die sie nicht wünschten. Es gibt eben Menschen, die das Kämpfen lieben. Der amerikanische Reporter Sebastian Junger berichtete 2010 über seine schießenden Landsleute in Afghanistan: «Krieg heißt Leben – multipliziert mit einem Faktor, von dem keiner eine Ahnung hat. Zwanzig Minuten Kampf: Das ist mehr Leben, als man sein Leben lang mit irgendwas anderem zusammenkratzen kann.»
Haudegen wie diese, Kraftprotze, Kämpfernaturen: Bei Kriegervölkern wie Hunnen, Normannen, Mongolen waren sie die Mehrheit; in den Söldnerheeren der frühen Neuzeit fühlten sie sich aufgehoben; in den Wehrpflichtarmeen bildeten sie immer noch den Kern, ohne den die Truppe nichts hätte leisten können. Sie waren es, die man am ehesten «Helden» nennen konnte in Schullesebüchern und vaterländischen Gedichten.
Nur dass gerade die Kämpfer oft zu Bestien wurden – durch den Militärapparat von aller Menschlichkeit befreit und von ihrem blutigen Umfeld beflügelt: zu Killern, Schlächtern, Folterknechten, die die Besiegten niedermetzelten, Frauen schändeten, Kinder erschlugen – wie die Reiter Dschingis Khans; wie die mordende, plündernde Soldateska des Grafen Tilly 1631 in Magdeburg; wie japanische Soldaten in China, deutsche in der Sowjetunion, sowjetische in Deutschland, amerikanische in Vietnam.
Unter den Schrecken des Krieges ist das einer der schlimmsten: Wer arglose Männer darauf drillt, Bajonette in Menschenleiber zu bohren, der belebt die Steinzeit in uns wieder, der serviert dem Schweinehund in uns ein Fressen. Die Kunst des Militärs bestand von jeher darin, Starke und Schwache, Raufbolde und Schwächlinge allesamt zu Soldaten umzuformen – zu Männern, die sich ihren Feind vorschreiben ließen und bereit waren, vor ihm nicht davonzulaufen, sondern ihn, selbst todesbereit, zu töten. Aus tausend Versuchungen zur Flucht einen Angriffskeil zu schmieden, war in Athen so schwierig wie in Preußen; eine Wunde schmerzte bei Cannae nicht anders als bei Verdun; die Angst würgte die Mazedonier in Indien nicht anders als die Deutschen im Kessel von Stalingrad.
Der Krieg, als «Vortod», mache alle Menschen gleich, schrieb Goethe 1792 als Reisender auf dem französischen Kriegsschauplatz. So lässt sich schlechthin vom Soldaten sprechen, von der geschundenen und blutbeschmierten Kreatur, die uns in ihren Qualen und Triumphen, in ihrer Raffgier und ihrer Frömmigkeit, ihrer Niedertracht und ihrer Größe so viele Rätsel stellt.
Wer das Phänomen des Soldaten ohne Vorurteile untersuchen will, dem schlägt freilich das Misstrauen beider extremen Richtungen entgegen: stolzer Ordensträger wie leidenschaftlicher Pazifisten. «Die größeren Beschwerden und Gefahren des Soldatenstandes sichern ihm in den meisten Staaten eine ehrenvolle Stellung», schrieb der Große Brockhaus von 1847. Lang ist’s her! 2012 (in einer Umfrage des Deutschen Beamtenbunds über das Ansehen der Berufsgruppen) rangierte der Soldat auf Rang 15, hinter dem Dachdecker und dem Briefträger.
Der Autor, der es 1945 in der deutschen Wehrmacht zum Unteroffizier gebracht und sich im Krieg in keiner Weise hervorgetan hat, ist entschlossen, sich neugierig und gelassen zwischen den Fronten zu bewegen. Es bleibt ohnehin nur der traurige Schluss: Schön, dass Millionen Männer nicht mehr Soldaten werden müssen – aber weniger schrecklich macht ihr Verschwinden künftige Kriege nicht.
I. Der Krieg braucht keine Soldaten mehr
2 Denn die Drohnen haben übernommen
Als Präsident Obama im Dezember 2009 in Oslo den Friedensnobelpreis entgegennahm, hatte er schon mehr Drohnenangriffe befohlen als Präsident George W. Bush (der Anstifter der Drohneneinsätze) in seiner gesamten Amtszeit. Und er ließ sie weiter fliegen – und weiter töten.
Drohnen! Sie heißen so, weil drone im Englischen «brummen» bedeutet, das deutsche «Dröhnen» ist verwandt, und der ursprüngliche Wortsinn schwingt mit: Die Drohne, the drone ist die männliche Biene, die von Arbeiterinnen gefüttert wird und allein den Lebenszweck hat, die Königin zu schwängern; daraus der übertragene Wortsinn «Müßiggänger, Faulpelz, Schmarotzer». Ja, müßig kreisen die Drohnen in 9 bis 15 Kilometern Höhe über der Zielregion, bis zu 40 Stunden lang, von unten unsichtbar, unhörbar – ausgerüstet mit bis zu 14 Raketen, einer hochauflösenden Videokamera, Infrarotsensoren für die Nacht und Radar sowieso.
Die Entscheidung, welcher mutmaßliche Taliban in Afghanistan umgebracht werden soll, fällt zum Beispiel in Clovis im US-Staat New Mexiko, 12000 Kilometer entfernt. Dort glaubt ein «Pilot» auf einem seiner Bildschirme einen Feind zu erkennen, gibt einem unbemannten Lenkflugkörper mit dem Joystick via Satellit das Signal «Schieß!» und ist Zeuge, wie, fünfzehn Sekunden später, das «Zielobjekt» zerstört wird – ein Auto, ein Haus, eine Menschengruppe, ein Partisan, manchmal ein, zwei Kinder. Der berühmte Satz «Stell dir vor, es ist Krieg, und keiner geht hin» hat seinen bösen Witz verloren: Es muss gar keiner «hingehen», und Krieg ist doch.
Die Ziele der «Piloten» sind von zweierlei Art: führende Terroristen, die Washington namentlich zu kennen glaubt und die Präsident Obama persönlich zur Hinrichtung freigegeben hat, und Häuser, Fahrzeuge, Gruppen, Einzelpersonen, die der Tele-Pilot auf Grund ihres Umfelds, ihrer Bewaffnung, ihrer Bewegungen für hinlänglich verdächtig hält – in Pakistan noch häufiger als in Afghanistan, weil viele Taliban sich in der Grenzregion versteckt halten. Umgebracht wurden auf diese Weise (nach dem Stand von 2013):
mindestens 470, vielleicht 880 Menschen, darunter 176 Kinder (Studie der Universitäten Stanford und New York);
2000 bis 3000 Menschen allein in Pakistan (Studie der «New American Foundation»);
mehr als 3000 Menschen (Ermittlung des «Britischen Büros für investigativen Journalismus»).
Natürlich, verglichen mit den 600000 Toten des britischen Bombenkriegs gegen Deutschland und den mehr als 100000 Toten von Hiroshima und Nagasaki ist der Drohnenkrieg von einer Präzision, die ein Menschenfreund insoweit loben könnte; und die US-Soldaten in Afghanistan sind für ihn dankbar in ihrer Hilflosigkeit. Doch die Tötung durch Drohnen verletzt das Kriegsrecht und das Völkerrecht, und für das Ansehen der USA in den betroffenen Ländern (nach Afghanistan auch Jemen und Somalia) ist der Drohnenkrieg verheerend – mit der mutmaßlichen Folge, dass er den Taliban und den Al-Quaida-Kämpfern mehr Anhänger zutreibt als Terroristen tötet.
Und Millionen Menschen in solchen Regionen leben unter einer Wolke der Angst, die unrettbar über ihnen hängt. Viele trauen sich nicht aus dem Haus oder verbieten ihren Kindern, in die Schule zu gehen. Die Deutschen wurden vor den britischen Flächenbombardements doch immerhin gewarnt, und wenn der Fliegeralarm vorüber war, konnte jeder sich auf die Straße wagen.
Das Völkerrecht? Pakistan ist nicht einmal ein kriegführender Staat. Doch die einheimischen Militärs haben insgeheim nichts dagegen, dass sie unbequeme Stammesführer auf diese Weise loswerden können. Das Kriegsrecht? Es verbietet die Tötung von Menschen, die nicht als «Kombattanten» identifizierbar sind (Seite 47). John Brennan, Präsident Obamas Anti-Terror-Organisator, wandte 2012 dagegen ein: Gerade die gezielte Tötung Einzelner optimiere die Verhältnismäßigkeit der Kampfmittel, wie das Kriegsrecht sie fordere: Kosten gering, eigene Verluste keine, feindliche Verluste dramatisch viel kleiner als durch Bomben und Granaten. Auch der Vorwurf der Heimtücke, weil das Opfer nichts ahnt und der Tötende sich nicht dem geringsten Risiko aussetzt, sei, so heißt es in Washington, kurios – wäre es denn moralisch hochwertiger, wenn beide stürben?
Auch ist es ja nicht so, dass die «Piloten», die jenseits des Ozeans die Raketen zünden, nicht zu leiden hätten. In ihrem Container fällen sie, gestützt auf eine Dienstanweisung von 275 Seiten, eine Entscheidung, die sie auch unterlassen könnten, und Sekunden später sehen sie, was sie angerichtet haben: Der LKW fliegt in die Luft, das Haus stürzt ein, der Taliban (wenn’s denn einer war) ist weg und manchmal nicht nur er. Und dann fahren sie nach Hause zum Abendessen mit Frau und Kind. Das ertragen viele nicht: Sie lassen sich versetzen, und manche leiden an der Soldatenkrankheit des 21. Jahrhunderts: der posttraumatischen Belastungsstörung. Auch deshalb bildet die US Air Force inzwischen mehr «Piloten» als Piloten aus. Und der Verteidigungsminister hat ihnen 2013 eine Ehrenmedaille für «Verdienste im Krieg» (distinguished warfare) gestiftet – zum Missfallen vieler Soldaten alten Stils, die noch ihre Haut zu Markte tragen mussten.
Die deutsche Regierung erwog 2013, in den USA Kampfdrohnen zu kaufen – «eine ethisch neutrale Waffe», versicherte Verteidigungsminister de Maizière, unbedingt erforderlich als Schutz bei plötzlichen Änderungen der militärischen Lage. Hinrichtungen jedoch, wie Präsident Obama sie angeordnet hat, kämen für die Bundeswehr nicht in Frage. SPD, Grüne, Linke und beide christlichen Konfessionen meldeten Bedenken an: Drohnen senkten die Hemmschwelle gegen den Einsatz militärischer Gewalt. Von den deutschen Soldaten in Afghanistan hieß es, sie verstünden solche Ängste nicht. Dass aber der Einsatz von tödlichen Drohnen in Afrika aus dem amerikanischen Luftwaffenstützpunkt in Ramstein bei Kaiserslautern gesteuert wird, hat 2013 in der deutschen Öffentlichkeit zu Protesten geführt. Drohnen aus Europa – vielleicht demnächst Drohnen über Europa? Eine schreckliche Vorstellung. Wer steuert sie? Telepiloten in China? Vielleicht die Mafia eines Tages? Und dazu die Prognose: Dass immerhin noch ein denkender Mensch sie lenkt, könnte bald von gestern sein.
Schon jetzt trifft der «Pilot» seine Entscheidung «algorithmisch vorgefiltert», und da das Gehirn mit seiner vergleichsweise geringen Rechenkapazität einfach zu langsam ist, wird über kurz oder lang die Software an Bord allein entscheiden. Genau dies streben amerikanische Militärs und Rüstungsfabrikanten an: die Drohne, die die Landschaft unter sich inspiziert, Bewegungen, Menschen, Objekte als verdächtig einstuft, Radarsignale als «unfriendly» erkennt, sogar den möglichen Kollateralschaden kalkuliert und ihn als vertretbar bewertet – und schließlich ihren Auftraggebern jenseits des Ozeans mitteilt, was sie zerstört, wen sie getötet hat.
«Willkommen in der Zukunft des Krieges!», schrieb dazu die «New York Times».[1] Damit entfällt jede Tötungshemmung, wie der Mensch sie doch oft entwickelt hat!, sagen die Gegner in humanitären Organisationen. Ja, sagen die Befürworter in Washington: Aber Drohnen töten nicht in Panik, nicht aus Rache, sie plündern nicht, sie foltern nicht.
Auch an Kampfrobotern zu Lande arbeitet die Rüstungsindustrie der USA und Israels inzwischen: lethal autonomous robots, kleinen Kettenfahrzeugen mit Hightech-Sensoren, die den Feind aufspüren und schießen, bis sich nichts mehr bewegt. Das wäre dann der Schlusspunkt unter eine Entwicklung, die mit der Artillerie begann und in der Atombombe kulminierte: Den Feind, den Menschen sieht man nicht, und sich zu wehren hat er keine Chance.
3 Und die Atomraketen warten
So viel ist doch klar: Wenn es zu einem dritten Weltkrieg käme, würden die etwa überlebenden Soldaten allenfalls noch als Aufräumkommandos, Sanitäter, Polizisten agieren; entschieden wäre der Krieg längst ohne sie. Die Weichen zu dieser Entwicklung wurden am 6. August 1945 gestellt: Da klinkten drei Soldaten über Hiroshima jene Bombe aus, die mindestens 66000 Nichtsoldaten umbrachte, ja an die 200000 Menschen, wenn man die hinzurechnet, die später an den Folgen starben – «der wichtigste Wendepunkt, seit sich die Menschen zum ersten Mal organisierten vor Zehntausenden von Jahren und mit Stöcken und Steinen in den Krieg zogen».[2]
Warum Präsident Truman die Entscheidung fällte, die furchtbare neue Waffe einzusetzen (und drei Tage später über Nagasaki noch einmal): Dafür werden bis heute zwei Gründe diskutiert. Japan war ja militärisch längst besiegt; aber natürlich, so ließ der Krieg sich noch rascher beenden, und ohne die Bombe wären bis zur Kapitulation noch viele amerikanische Soldaten gefallen – eine klare Rechnung. Dies zumal vor dem Hintergrund, den der amerikanische Soziologe Max Lerner so beschreibt: «Den Kern der amerikanischen Wehrpolitik bildet die intensive Abneigung gegen den Einsatz und Verlust amerikanischer Menschenleben. Deshalb setzte die amerikanische Führung die Atombombe in Japan ein … Amerika ist seit dem Bürgerkrieg nicht mehr Kampffeld gewesen. Die Amerikaner stellen sich deshalb unter dem Krieg eine sehr technische Operation vor, die tunlichst an fernen Gestaden unter möglichst geringem Einsatz amerikanischer Truppen und mit massiertem Aufwand von Material und Geld stattfinden soll.»[3]
Der andere Antrieb Trumans war offenbar: Die Rote Armee stand siegreich in Berlin, Stalin schien unersättlich – und da war es an der Zeit, ihm zu demonstrieren, wo die wahre Macht auf Erden lag. So setzte sich Truman über die Bedenken mehrerer Berater hinweg. Admiral William Leahy zum Beispiel, Chef des Stabes von Heer und Marine, hatte eingewandt, er habe es nicht gelernt, Krieg zu führen, indem man Frauen und Kinder tötet; dies sei ein Rückfall in die Barbarei.[4]
Rückfall oder nicht – es bleiben ein erstaunliches Faktum und eine plausible Vermutung. Das Faktum: Auf zwei Weltkriege, zwischen denen nur 21 Jahre lagen, ist eine Ära von bis heute 69 Jahren gefolgt, in der Großmächte keinen Krieg mehr gegeneinander führten, ja in der die beiden Weltmächte zwar Atomsprengköpfe mit der hundertfachen Wirkung von Hiroshima produzierten, also aufrüsteten bis zu dem unsinnigen Grad, dass sie die gesamte Menschheit vernichten könnten, mehrfach angeblich, ein overkill – und in der doch der Kalte Krieg ohne einen Schuss zu Ende ging.
Die Vermutung dahinter: Einmal musste die schreckliche Macht des Atoms demonstriert werden, damit die Menschheit genügend Angst vor ihr bekam. Und so hätte denn Truman ahnungslos (wie die meisten Akteure der Weltgeschichte) mit seiner brutalen Tat eine Art Segen gestiftet (wie nicht sehr viele). Die Probe aufs Exempel fand 1962 statt. Da ließ Chruschtschow auf Kuba zwar Abschussrampen für Atomraketen installieren, aber Kennedys souveränes Spiel mit dem Gleichgewicht des Schreckens zwang ihn, sie wieder abzubauen.
Der israelische Historiker Martin van Creveld geht so weit, die Atomwaffen schlechthin zu loben. «Soweit es sich aus heutiger Sicht beurteilen lässt», schrieb er 2007 (in seinem Klassiker «The Changing Face of War»), «haben die Atomwaffen die Welt zu einem viel sichereren Ort gemacht.»[5] So gesehen, hätte Präsident Obama entweder eine fromme Lüge verbreitet oder sich grausam geirrt, wenn er hartnäckig für eine Welt ohne Atomwaffen plädierte.
Für die Berufssoldaten freilich, schreibt Creveld, für die Offiziere, «die seit Jahrhunderten die Kriegskunst immer weiter perfektioniert und von 1939 bis 1945 Millionen Männer in einem gigantischen Kampf befehligt hatten, kam der Wechsel vom Kampf zur bloßen Abschreckung fast der Todesstrafe gleich»[6]. Nicht, andrerseits, für jene Millionen, die nun nicht mehr kämpfen und sterben, ja oft nicht einmal mehr eine Uniform anziehen müssen: Denn vor solchem Hintergrund haben immer mehr Staaten diese massenhafte Freiheitsberaubung, die Allgemeine Wehrpflicht, abgeschafft (über die: Kapitel 11).
Nein, Soldaten in Mengen werden nicht mehr gebraucht. Wenn noch Menschen überhaupt, dann «Piloten» für die Drohnen; Techniker für die Abschussrampen; hochgezüchtete menschliche Kampfmaschinen zum Kampf gegen Terroristen (Kapitel 6) und gegen Söldner dort, wo früher Soldaten agierten. Die Blauhelme der UNO könnten noch Nutzen stiften, aber sie tun es selten (in Kapitel 41 mehr darüber).
Hatte die Massentötung von Zivilisten in Hiroshima und Nagasaki möglicherweise eine positive Folge, nämlich ein heilsames Erschrecken auch der späteren Atommächte – die Flächenbombardements auf Japan, Deutschland, Vietnam brachten Menschen in Massen um und sonst nichts; und da das Niederbrennen ganzer Großstädte eben nicht zum Sieg der Alliierten beitrug, ließ der Verstoß gegen das Völkerrecht sich nicht einmal militärisch rechtfertigen.
In Tokio waren ja im März 1945 durch amerikanische Brandbomben 100000 Menschen umgekommen, das größte Luftkriegsmassaker der Geschichte fand ohne Atombomben statt – in der Form also, dass wenige, seit 1944 fast unbedrohte Soldaten die Massentötung von Nichtsoldaten vollzogen: in Deutschland 600000 Bombentote, darunter etwa 250000 Frauen und 100000 Kinder.[7] «Mit dem Rücken an der Wand hatte das britische Volk beschlossen, nicht zur Kenntnis zu nehmen, dass es sich auf das Niveau des Feindes begab», resümierte der englische Historiker John Keegan. «Nie geriet die Moral der deutschen Zivilbevölkerung dadurch ins Wanken»[8] – entgegen der Behauptung, mit der der Krieg gegen Frauen und Kinder in London gerechtfertigt worden war.
Und keineswegs, fügt Sir Basil Liddell Hart hinzu, sei der Krieg dadurch verkürzt worden: Dafür hätten sich die Bomber beizeiten auf das Verkehrsnetz und die Benzinversorgung konzentrieren müssen.[9] Spätestens 1944 (nun wieder Keegan) sei das in London auch allen Beteiligten klar gewesen – «außer den Dogmatikern im Bomber Command».[10]
Anders als in Deutschland und Japan, wo das Flächenbombardement den späteren Siegern bloß nichts nützte, hat es in Vietnam nicht einmal verhindert, dass die Bombardierten die Sieger wurden. Der Bombenkrieg war ein rundum sinnloses und ruchloses Kapitel der Kriegsgeschichte – Menschenjagd, Massenmord von oben. Zugleich verstieß er gegen einen uralten Grundsatz, eine Art Ehrenkodex des Soldatentums, selten wörtlich genommen, oft mutwillig durchkreuzt, oft aber durchaus praktiziert: dass bewaffnete Männer nur gegen bewaffnete Männer kämpfen sollten.
Überdies beraubte die Tötung vom Himmel herab den Soldaten der Chance, zu zögern, ehe er ein Leben zerstörte, dem er ins Auge sah. «Es wäre schwer», schrieb George Bernard Shaw 1944 während des Bombenkriegs gegen deutsche Städte, «einen Mann von normaler Gutmütigkeit dazu zu bringen, dass er eine Frau mit einem Baby im Arm mit einer Handgranate in Stücke reißt, wenn er sie sieht. Aber derselbe junge Mann wird, tausend Meter hoch im Flugzeug, eine Bombe auslösen, die eine ganze Straße mit Einfamilienhäusern in Trümmer legt.»[11]
Die Schreie der Opfer nicht hören zu müssen, nicht zu sehen, wie sie sterben, erweitert den Spielraum menschlicher Grausamkeit. Noch in dem mörderischen Krieg, den der Irak und der Iran von 1980 bis 1988 gegeneinander führten, kam es vor, dass der irakische Maschinengewehrschütze vor Entsetzen innehielt, wenn ihm die dritte, die vierte Angriffswelle iranischer Kindersoldaten entgegentaumelte.[12]
Jeder Anflug von Mitgefühl, solange Soldaten noch sahen, was sie taten: Im Atomzeitalter ist er dahin. Zwischen dem Techniker, der auf den Startknopf für die Atomrakete drücken würde, und den Millionen Menschen, die sie vernichten soll, läge ein Ozean. So furchtbar gewütet haben Soldaten nie. Und dass der Knopfdruck irgendwann stattfindet – wer wollte das ausschließen? Es waren zwei Atommächte, die 1962 auf den Einsatz ihrer Raketen zähneknirschend verzichteten. Inzwischen gibt es acht oder neun.
Kann eine Gesellschaft überleben, wenn ein Einzelner die Macht hat, Abermillionen seiner Artgenossen umzubringen?, fragte Peter Atkins, renommierter Chemiker in Oxford, 2003 in seinem Buch «Galileos Finger». «Die Fähigkeit, sich selbst zu vernichten, ist offenbar ein unvermeidlicher Bestandteil des Fortschritts, und leider geht sie der Einsicht voraus.»[13]
4 Die Selbstmordattentäter warten nicht
Ein Selbstmordattentat hätte Deutschland brauchen können an jenem 20. Juli 1944, an dem ein Soldat, Oberst Graf Schenk von Stauffenberg, zweierlei auf einmal wollte: Hitler umbringen und dann den Staatsstreich durchziehen. Und so misslang ihm beides.
Das wirksamste aller Kampfmittel ist das Attentat, das der Täter nicht zu überleben sucht. Noch nie haben sich so wenige Menschen so umstürzend in die Weltgeschichte eingeschrieben wie die zehn, die am 11. September 2001 die beiden Türme des World Trade Center in New York rammten und vernichteten.
Töten mit der klaren Einsicht, ja der Absicht, dabei getötet zu werden: Diese vorsätzliche Durchkreuzung des Selbsterhaltungstriebs ist zuerst aus dem 12. Jahrhundert von den Assassinen überliefert, «Haschisch-Rauchern». So wurden die meist jugendlichen Anhänger eines fanatischen schiitischen Geheimbunds genannt, den der Wanderprediger Hasan Ibn Sabbah seit dem Jahr 1090 in einer persischen Bergfestung um sich versammelt hatte. Sie betrachteten sich als Vorkämpfer des wahren Islams, und im Auftrag ihres Meisters ermordeten sie nicht nur christliche Kreuzfahrer (seit 1096), sondern auch hochgestellte Muslime: Gouverneure, Generale, zwei Kalifen sogar.
Dies stets in der Form, dass sie sich anschlichen mit dem Dolch im Gewande – und dann, das war das Unheimlichste für die Zeitgenossen, nicht zu fliehen versuchten, sondern gleichsam darauf warteten, von den Leibwächtern erstochen zu werden. Was für die Selbstmordattentäter von heute bloß unvermeidlich ist (die Opfer und sich selbst durch dieselbe Tat zu vernichten): Das führten sie mutwillig herbei. Im Englischen und in den romanischen Sprachen haben sie ihre Spuren bis heute hinterlassen: assassinate, assassiner, assassinare heißt «einen Meuchelmord begehen».
Als Marco Polo 1292 auf der Heimreise Persien querte, hatten die Mongolen die Bergfestung der Sekte längst erobert und sie zerstört – aber der Venezianer ließ sich noch etwas erzählen, was wahr sein könnte: Hasan Ibn Sabbah habe seinen Jüngern ein paar Tage lang jenes Paradies vorgegaukelt, das nach ihrer Tat auf sie warte. Sie seien in einen Haschisch-Rausch versetzt worden und in einem schattigen Garten erwacht, der in der Burg verborgen war; in Seide gekleidet, mit Honig, Milch und Wein verwöhnt und von schwarzäugigen Jungfrauen erwartet, wie im Koran verheißen. Nach neuerlichem Haschisch-Rausch hätten sich die Jünger in ihren alten Kleidern wiedergefunden, und der Meister habe ihnen erklärt: Das sei nur ein kurzer Vorgeschmack auf jenes Paradies gewesen, in das sie nach ihrer Tat einziehen würden für immer.
Eine Variante auf die Assassinen (Fliehe nicht!) demonstrierten zwei britische Staatsbürger nigerianischer Herkunft, 28 und 22 Jahre alt, im Mai 2013 in London. Auf offener Straße zerhackten sie einen britischen Soldaten – und blieben, die blutigen Fleischerwerkzeuge in der Hand, zehn Minuten am Tatort stehen, bis die Polizei sie überwältigte; von einer unerschrockenen Londoner Hausfrau ins Gespräch verwickelt, erklärten sie, dies sei die Rache für die vielen Muslime, die von britischen Soldaten getötet worden seien.
Zwischen den Meuchelmördern des 12. Jahrhunderts und den Terroristen unserer Zeit, denen das Leben von Christen und Juden nichts gilt, steht historisch das Unternehmen Kamikaze, «göttlicher Wind». So nannten die Japaner den Taifun, der im Jahr 1281 eine mongolische Invasionsflotte vernichtet und damit Japan gerettet hatte – und dann den verzweifelten Versuch von 1944/45, die Niederlage doch noch abzuwenden oder wenigstens ein Zeichen des Stolzes zu setzen. Dies aber, anders als früher die Assassinen und später die Al-Quaida-Terroristen, auf soldatische Weise: bewaffnete Männer gegen bewaffnete Männer.
Das Korps der Selbstmordflieger wurde im Oktober 1944 von Admiral Takijiro Ohnishi gegründet, dem Befehlshaber der japanischen Marineluftwaffe auf den Philippinen. Damals drohten die Philippinen verlorenzugehen, Japans letzte überseeische Bastion. Das wirksamste Kampfmittel der Amerikaner waren die Flugzeugträger; die Reste der japanischen Luftwaffe befanden sich ihnen gegenüber in hoffnungsloser Position.
Ohnishi machte die Rechnung auf: Wenn eines meiner Flugzeuge einen Träger angreift, so hat es geringe Chancen, zurückzukehren, geringe Chancen, einen Treffer zu erzielen, und fast keine Chancen, mit der 250-Kilo-Bombe, die die allein verfügbaren Zero-Jäger tragen können, das Riesenschiff ernstlich zu beschädigen. Verzichtete man dagegen bewusst auf die geringe Chance der Rückkehr, so wurden die beiden anderen Chancen erheblich erhöht: Ein Pilot, der sich mitsamt seinem Flugzeug auf das Schiff stürzte, konnte sein Ziel schwerlich verfehlen, und die Bombenwirkung wurde durch Aufprall und Explosion des Flugzeugs wesentlich verstärkt. Die verletzlichen Stellen eines Flugzeugträgers waren seine Aufzugschächte, durch die die Flugzeuge an Deck befördert wurden; gelang es, sie durch Kamikaze-Piloten zu zerstören, so war er wochenlang lahmgelegt.
Nach dem Verlust der Philippinen starteten weitere Selbstmordpiloten von Okinawa, schließlich vom Mutterland aus. Sie stürzten sich auch auf Transporter und Kriegsschiffe aller Art, und ihre relative Rolle in der zusammenbrechenden japanischen Verteidigung wuchs noch dadurch, dass der Sturz ins Ziel eine viel kürzere Ausbildungszeit erforderte als der herkömmliche Bombenabwurf.
Was wurde mit dem Unternehmen Kamikaze ausgerichtet? 1428 Flugzeuge kehrten nicht zurück. Da sich darunter auch abgeschossene Begleitmaschinen sowie solche Selbstmordflieger befanden, die abgeschossen wurden, ehe sie ins Ziel stürzen konnten, dürften etwa 1100 Piloten ihr Ziel erreicht und den Kamikaze-Tod gefunden haben, unter ihnen zwei Admirale.
Diesen Piloten gelang es, 34 amerikanische Kriegsschiffe zu versenken, darunter drei Flugzeugträger und 14 Zerstörer, sowie 288 feindliche Schiffe zu beschädigen, davon 36 Flugzeugträger und 15 Schlachtschiffe. Es kann als sicher gelten, dass dieselben überwiegend schlecht ausgebildeten Piloten in ihren veralteten Maschinen mit der spärlichen Bombenlast einen ungleich geringeren Erfolg erzielt hätten, hätten sie in herkömmlicher Weise angegriffen, und dass wahrscheinlich die Hälfte von ihnen dennoch gefallen wäre.
«Das Kamikaze-Korps hat uns ungeheuren Schaden zugefügt», bestätigte der amerikanische Vizeadmiral C. R. Brown in seinem Vorwort zur amerikanischen Ausgabe der offiziösen japanischen Geschichte von den Selbstmordfliegern. «Es hat Tausende unserer Männer getötet und verwundet, ja unseren Schiffsbesatzungen vor Okinawa größere Verluste zugefügt als das japanische Heer unseren gelandeten Truppen in den fast dreieinhalb Monate dauernden Kämpfen an Land.»[14]
Dass die Japaner aus ihrer noch vorhandenen Luftwaffe das Beste zu machen verstanden, steht also nicht in Zweifel. Was Admiral Brown und mit ihm den meisten Abendländern und auch vielen Japanern dennoch missfiel, ist, dass die Kamikaze-Angriffe trotz ihrer Erfolge nichts mehr an Japans Niederlage zu ändern vermochten, dass die japanischen Militärs dies auch gewusst hätten, dass die Unternehmung also sinnlos gewesen sei. «Selbst wenn wir militärisch keinen Sieg erringen konnten», halten die Verfasser der Kamikaze-Geschichte dem entgegen, «war es unsere Pflicht, zu den Waffen zu greifen, um dem japanischen Geist treu zu bleiben.» Und Admiral Ohnishi verkündete im Januar 1945: «Selbst wenn wir geschlagen werden, wird der Opfergeist dieses Kamikaze-Korps unsere Heimat vor dem völligen Zerfall bewahren.»[15] Bei Kriegsende beging Ohnishi Harakiri.
Harakiri – ja, lieber glorreich sterben als in Schande untergehen! Zur rituellen Selbsttötung hatte Japans Adel ein ungewöhnliches Verhältnis; sie galt als Ausdruck von Mut, Demut, Reue, Selbstbeherrschung. Harakiri hieß, sich mit einem Dolch den Bauch aufschlitzen von links nach rechts, und wenn die Eingeweide herausgequollen waren, schlug der Freund, der hinter dem Selbstmörder stand, ihm mit einem Schwert den Kopf ab. Diesen unsäglichen Tod wählte der Samurai entweder, um einer Strafe zu entgehen oder sich von einer Sünde zu befreien, die seine Familie oder den Kaiser entehrt hätte; oder weil der Kaiser ihm einen juwelenbesetzten Dolch zuschickte, mit der höflichen Bitte, von ihm Gebrauch zu machen. Damit war alle Schande getilgt.
Vor dem Hintergrund dieses Todeskults ist es glaubhaft, dass Admiral Ohnishi 1944 zunächst nur Freiwillige annahm, dass viele ihn bestürmten – die Flugzeuge reichten nicht für die opferwilligen Piloten. «Liebe Eltern, ihr könnt mir gratulieren!», schrieb der Feldwebel Isao Matsuo nach Hause. «Ich habe eine glänzende Gelegenheit zum Sterben bekommen … Möge unser Ende schnell sein und glatt wie zerbrechendes Glas!»[16]
Sie waren fröhlich zwischen der Entscheidung und dem Einsatz, die Piloten, sie feierten Feste, sie machten, bei allem Respekt vor dem Leben nach dem Tode, an das die Mehrheit von ihnen fest geglaubt haben dürfte, zugleich ihre Witze darüber, indem sie sich etwa darum stritten, wer von ihnen Kantinenchef werden solle im Yasukuni-Schrein beim Kaiserpalast in Tokio, in dem sich die Geister der Gefallenen versammeln.
Im Frühjahr 1945 genügte die Zahl der Freiwilligen dem Admiral Ohnishi nicht mehr; Druck wurde ausgeübt, sich «freiwillig» zu melden, und schließlich wurden Piloten auch ohne Umstände zum Kamikaze-Korps abkommandiert. Es heißt, dass sie anfänglich einen verstörten Eindruck gemacht, sich aber bald ins Unvermeidliche gefügt hätten – manche getröstet von dem Hochgefühl, dass sie die Auserwählten waren und dass auch der Besiegte noch Macht ausüben kann; vielleicht auch mit jenem Rest von Hoffnung, den Ohnishi zu wecken versuchte: Diese Demonstration der Entschlossenheit zum Äußersten werde die Kampfmoral des Feindes schwächen. Ja, entsetzt waren die betroffenen Schiffsbesatzungen durchaus.
Die letzten Selbstmordpiloten stürzten sich noch auf ihre Opfer, als die erste der beiden Atombomben auf Japan schon gefallen war – der Anfang vom Ende der Ära des Soldaten. Sein Zeitalter beendeten sie nicht ohne Würde: Sie raubten nicht, sie plünderten nicht, sie gaben den Tod nicht, ohne ihn zu erleiden; um eine kleine Sekunde gingen sie den Opfern voraus.
An Hymnen auf den Tod herrscht in Lied und Sinnspruch Überfluss: «Der schwarze Schatten des Todes» sei so kostbar wie das Sonnenlicht, verkündete Tyrtäus, Spartas Kriegspropagandist im 7. Jahrhundert v. Chr. «Morituri te salutant!», riefen die Gladiatoren dem römischen Kaiser zu. «Glücklich und frei die Toten!», sang Theodor Körner, der Dichter der Befreiungskriege, bevor er 1813 fiel. «Unsere Braut ist der Tod», hieß die Hymne der spanischen Fremdenlegion. «Sterben fürs Vaterland, das ist Leben!», sangen Fidel Castros Kubaner. Merkwürdig nur: Die Ersten, die solche vaterländischen Gesänge bis zur letzten Konsequenz ernst genommen haben, waren die japanischen Todesflieger.
Nichts außer dem Selbstmord bei der Tat verbindet sie mit den Fanatikern, die seit 1982 ausdrücklich auch Zivilisten, Frauen, Kinder töten wollen, um Macht zu demonstrieren und Entsetzen zu verbreiten: zumal die Hisbollah im Libanon, die Tamil Tigers auf Sri Lanka und schließlich Al-Quaida überall und nirgends.
1991 war das Sowjetimperium zusammengebrochen, die USA hatten sich als einzige Weltmacht etabliert, und 1992 prophezeite der amerikanische Politikwissenschaftler Francis Fukuyama «das Ende der Geschichte»: Nichts stehe nun einer liberalen Gesellschaftsordnung in aller Welt unter Führung der USA noch im Wege. Den ewigen Frieden versprach Fukuyama nicht, und insofern behielt er sogar recht. Schon 1993 aber sah sein Kollege Samuel Huntington den Clash of Civilizations kommen, den Krieg der Kulturen, nicht mehr der Staaten: Die abendländische werde auf die chinesische, japanische, hinduistische, slawische und lateinamerikanische Kultur prallen – und auf die islamische, natürlich.
Mit ihr fing es an am 11. November 1982. Da raste ein mit Sprengstoff beladenes Auto, von einem 17-Jährigen gesteuert, ins Hauptquartier der israelischen Armee im südlichen Libanon und brachte mindestens 60 Israelis um. Die USA traf es zuerst im April 1983 (Selbstmordanschlag auf die amerikanische Botschaft in Beirut) und mit vernichtender Wucht im Oktober: 241 tote Marines in deren Hauptquartier – und kaum eine Minute später 58 tote französische Fallschirmjäger. Im Februar 1984 zogen die USA ihre sämtlichen Truppen aus dem Libanon ab; die Hisbollah, die «Partei Gottes», die militante schiitische Organisation, die die Attentate organisiert hatte, konnte in der Geschichte der arabischen Selbstmordkrieger den ersten militärischen Erfolg verbuchen.
1987 riefen die Palästinenser zur Intifada auf, der Erhebung, dem «Abschütteln von Staub». Im Gazastreifen, im Westjordanland und in Israel selbst kam es zu Aufruhr, Streik und Boykott. Mörderisch wurde erst die zweite Intifada: Sie brach los, als der ehemalige israelische Verteidigungsminister Ariel Scharon im September 2000 die in islamischen Augen ungeheuerliche Provokation begangen hatte, in Jerusalem demonstrativ mit mehr als tausend Polizisten auf den Tempelberg zu ziehen. Nun begann die große Serie der Selbstmordattentate, meist durch Einzeltäter, die den Sprengstoff am Leib trugen; nach israelischer Statistik waren es insgesamt 143, überwiegend Jugendliche, vermehrt auch Frauen; 513 Israelis brachten sie um. Noch schlimmer wirkte in Israel der Schrecken, im eigenen Land, auf keinem Platz, in keinem Omnibus mehr sicher zu sein.
Was trieb sie an, die Selbstmordwilligen? Überwiegend junge Männer aus dem Volk, das Paradiesversprechen nahmen sie wörtlich, sie wurden gefeiert, viele mit einer Videoaufzeichnung vor der Tat, den Koran in der einen Hand und die Bombe in der anderen; sie sprachen von Allah, von der Freiheit Palästinas, von ihrem Stolz, ein Märtyrer zu sein. Ihre Eltern wurden von den Nachbarn geachtet, sie waren stolz auf ihr Kind; ein Vater sagte: «Ich danke Gott, dass er die Güte hatte, mich zum Mitglied einer Familie von Märtyrern zu machen.»[17]
Zwar ist der Selbstmord im Koran verboten – «doch die für Allahs Religion kämpfen und sterben» (die Märtyrer also), «deren Taten werden nicht verloren sein». So in Sure 47, und in der heißt es auch: «Wenn ihr im Krieg mit den Ungläubigen zusammentrefft, dann schlagt ihnen die Köpfe ab!» Und an weiteren 24 Stellen ruft der Koran dazu auf, die Ungläubigen zu töten.
Die libanesischen und die palästinensischen Selbstmordaktionen waren eines der beiden Vorbilder für Osama Bin Laden, das andere die Tamil Tigers auf Sri Lanka: die Kämpfer der Tamilen, der hinduistischen Minderheit im Nordosten der Insel, gegen die Mehrheit der buddhistischen Singhalesen. Nicht die Religion jedoch entzweite sie, sondern der Umstand, dass die Singhalesen sich als das Herrenvolk verstanden und die Minderheit diskriminierten.
Die Morde der Tamilen begannen 1983 mit der Tötung des singhalesischen Verteidigungsministers, 1993 brachten sie den Staatspräsidenten um, im Juli 2001 legten sie mit Bomben den Flughafen von Colombo lahm (ein furchtbarer Schlag gegen die Tourismus-Industrie) – fast durchweg mit demselben Erfolg wie ihre Brüder im Nahen Osten: Ein Einzelner raubte vielen das Leben und verbreitete Horror.
Osama Bin Laden, geboren 1957, Erbe eines Multimillionärs in Saudi-Arabien, begab sich 1979 nach Afghanistan, um sich am Kampf gegen die sowjetische Invasion zu beteiligen – in einer merkwürdigen Koalition mit amerikanischen Flugabwehrraketen, arabischem Geld und dem pakistanischen Geheimdienst. In Pakistan richtete Bin Laden eine Sammelstelle für freiwillige Kämpfer aus arabischen Staaten ein. Als die Sowjets 1989 abgezogen waren, kehrte er nach Saudi-Arabien zurück, ließ sich 1991 sein Erbe von angeblich 300 Millionen Dollar auszahlen und begab sich dann in den Sudan, wo er im Bürgerkrieg des islamischen Nordens gegen den christlichen Süden mitmischte.
1996 ging er wieder nach Afghanistan, fand dort eine Terrorgruppe namens Al-Quaida vor, setzte sich an ihre Spitze und erklärte allen Christen und Juden den Krieg. 1998 schlug er zu: Am selben Tag brachten Selbstmordattentäter in den US-Botschaften in Kenia und in Tansania mehr als 200 Menschen um, und in Videobotschaften rief Bin Laden zum Kampf gegen den «Großen Satan», die USA, und den «Kleinen» auf, den Staat Israel.
Damit hatte Al-Quaida zugleich demonstriert: Wir wollen gar nicht ein Territorium befreien wie Palästinenser und Tamilen – wir haben in vielen Ländern unsere Zellen und agieren global. Fasst uns, wenn ihr könnt! Da half es nicht viel, dass Präsident Clinton vermutete Ausbildungsstätten der Al-Quaida in Afghanistan mit Raketen beschießen ließ – so wenig, wie drei Jahre später Präsident Bush die Wurzel des Übels packen konnte, als er die Invasion von Afghanistan befahl.
Es geschah 1999, dass Mohammed Atta, Student an der Technischen Universität Hamburg-Harburg, mit drei gleichgesinnten Kommilitonen nach Afghanistan reiste, um dort mit Osama Bin Laden einen Plan zu besprechen, den sie in Hamburg ausgeheckt hatten: im Kampf gegen «die jüdische Weltverschwörung» den Märtyrertod zu sterben und sich dafür ein großes Ziel zu setzen, zum Beispiel das World Trade Center in New York. Osama akzeptierte, bestärkte die vier und leitete sie in einem Trainingslager an. Im Januar 2000 hinterlegten sie bei ihm ihr Testament, kehrten nach Hamburg zurück und beantragten Visa für die USA. Im Mai durften sie einreisen, lernten fliegen und erwarben erstaunlicherweise schon im Dezember die Lizenz zum Führen von Düsenflugzeugen. Von Osama ferngesteuert, koordinierten sie sich für den 11. September 2001 mit 15 weiteren Selbstmordkandidaten, die meisten aus Saudi-Arabien.
Am Morgen dieses Tages bestiegen die 19, mit Teppichmessern bewaffnet, in Boston vier Passagierflugzeuge, schnitten den Piloten die Kehle durch und steuerten das World Trade Center sowie in Washington das Kapitol und das Verteidigungsministerium an; das Kapitol wurde durch den selbstmörderischen Einsatz beherzter Passagiere gerettet.
Um 8.46 Uhr rammte das Flugzeug, das Mohammed Atta steuerte, den Nordturm des World Trade Center, um 9.03 Uhr das nächste den Südturm – und machte nun erst schrecklich klar, dass es sich wirklich um ein Attentat handelte. Um 9.59 Uhr stürzte der Südturm, um 10.28 Uhr der Nordturm ein – für Milliarden Augenzeugen auf Erden das Äußerste an Grauen.
Was trieb sie an, diese 19 überwiegend gebildeten jungen Männer aus gutem Hause, ganz andere also als ihre naiven Vorläufer im Libanon und in Palästina? Wahrscheinlich nicht, dass sie das Paradiesversprechen des Korans wörtlich genommen hätten – aber offenbar doch die Hoffnung, in ein erhabenes Reich jenseits aller Vorstellung einzutreten. «Öffne dein Herz, heiße den Tod im Namen Allahs willkommen!», hieß es in seiner «Fibel für Selbstmordattentäter», die am Flughafen Boston in Attas zu spät aufgegebener Reisetasche gefunden wurde. «Nur einen Augenblick bist du entfernt vom ewigen Leben in der Gesellschaft der Märtyrer … Dies ist die Stunde, in der du Allah treffen wirst. Engel rufen deinen Namen.»
Dazu muss echter, tiefer Hass auf die Ungläubigen gekommen sein, speziell auf die USA mit ihrem Größenwahn, die Vorstellung also, der gerechten, einer erhabenen Sache zu dienen – und ein Rausch der Macht in den letzten Sekunden, während der Turm auf sie zuraste und die Schreie der Passagiere ihnen in den Ohren gellten: Ich bin stärker als der Tod, ich bin der Mittelpunkt der Welt, ich schreibe Geschichte.
Erst drei Jahre später bekannte Osama Bin Laden in einer Videobotschaft, was er bis dahin bestritten hatte: der Urheber der Anschläge zu sein, und zu neuen Terrorakten rief er seine Anhänger in aller Welt auf, falls die USA ihre Politik nicht radikal veränderten.
Wir aber müssen wohl den Gedanken ertragen, dass dieser Osama Bin Laden nicht nur ein Scheusal war, sondern zugleich ein brillanter Kopf. Er hat mehr Macht ausgeübt und die Welt stärker verändert als je ein Einzelner zuvor. Er entdeckte das Passagierflugzeug als Waffe und ließ die beiden fliegenden Bomben für das World Trade Center vom Feind mit 58000 Litern Flugbenzin auftanken. Er fand 19 Sterbewillige und für zehn von ihnen jenes Ziel, dessen Zerstörung die verstörendste Symbolwirkung entfalten, das irdische Optimum an Verblüffung und Entsetzen produzieren würde: das Wahrzeichen der Welthauptstadt New York, den Inbegriff amerikanischer Macht und Herrlichkeit. Damit schuf er zugleich die dramatischsten Bilder des Fernsehzeitalters; im Abendland ließen sie die Adern frieren.
Aus Osamas Attacke folgte eine Erschütterung des amerikanischen Lebensgefühls (Soldaten hatten das Territorium der USA zuletzt 1815 bedroht), der Kollaps amerikanischer Liberalität, die milliardenverschlingende Invasion in Afghanistan mit ihrem unrühmlichen Ende, schließlich die Belästigung von Milliarden Flugpassagieren seit nunmehr dreizehn Jahren. Um den Preis von 3000 toten Zivilisten hatte er einen Sieg errungen, der mit den Millionen Bombentoten von Deutschland, Japan und Vietnam nicht zu erzielen gewesen war.
Am 2. Mai 2011 wurde Osama umgebracht von Navy Seals. Reguläre Soldaten haben gegen solche Strategen des Selbstmords keine Chance mehr.
5 Die Partisanen siegen
Mit Messern und mit Sensen waren sie 1808 in Spanien gegen die französischen Besatzer aufgestanden, Napoleon schäumte: «Meine Garde von Bauern aufgehalten? Von bewaffneten Räuberbanden?»[18] Im Zweiten Weltkrieg konnte die Wehrmacht die Partisanen in Jugoslawien nicht besiegen. 1973 kapitulierten die USA schmählich vor den Vietcong; 2003 wurden sie im Irak der Rebellen nicht Herr. Was zurzeit in Afghanistan geschieht, hat noch keinen endgültigen Namen.
Offensichtlich hatte die gewaltigste Streitmacht auf Erden zu wenig gelernt aus der Forderung, die Präsident Kennedy 1962, im Jahr nach dem Debakel an Kubas «Schweinebucht», erhoben hatte: Die US Army müsse sich für den Krieg gegen Partisanen wappnen – «diese älteste Form der Kriegführung wird gerade im Zeitalter der modernsten Waffen eine entscheidende Bedeutung gewinnen».[19]
Was Kennedy jedoch selbst 1961 eingefädelt hatte, war die Entsendung von «Kriegsberatern» nach Südvietnam, um das westlich orientierte Land vor den Drohungen des kommunistischen Nordens und der Infiltration von Partisanen zu schützen. Dem Präsidenten Johnson erteilte der amerikanische Kongress 1964 die Vollmacht, in den großen Krieg gegen Nordvietnam einzutreten (der freilich nie so heißen durfte). Auf unglaubliche 540000 Soldaten stockte Johnson die amerikanische Präsenz in Südvietnam auf – doppelt so viele, wie nordvietnamesische Soldaten und Vietcong im Einsatz waren, die unsichtbaren und allgegenwärtigen, mit dem Dschungel verwachsenen Partisanen.
«Dieses blutige, unheimliche, wahnsinnigmachende Land!», schrieb der amerikanische Kriegsreporter Michael Herr 1968 aus Vietnam. «Wir waren einfach an einem Ort, an den wir nicht gehörten, und die Vietcong brachten uns um, einfach weil wir da waren.»[20] Die Invasionsarmee versuchte es mit Stoßtrupps nach der Devise Search and destroy, aufspüren und vernichten: mit überfallartigen Aktionen also, bei denen ein Stück Land durchsucht und wieder preisgegeben wurde. Per body count (der Zählung von Feindleichen) teilte das Hauptquartier in Saigon die angeblichen militärischen Erfolge mit. 4000 Vietcong in der Schlucht von Dak to getötet!, hieß eine dieser Siegesmeldungen. Hunderte, schreibt Michael Herr, seien es ja wahrscheinlich gewesen; gefunden worden seien vier.[21]
Mit Agent Orange zerstörten die Amerikaner auf riesigen Flächen das Laubdach des Dschungels, das die Vietcong vor den Hubschraubern verbarg. In Feuerstürme von Napalm wurden sie eingehüllt. Auf Nordvietnam ging ein wüsterer Bombenhagel nieder als im Zweiten Weltkrieg auf Deutschland. «Zieht eure Hörner ein, ihr Nordvietnamesen!», ließ sich 1965 General Curtis Lemay vernehmen, der ehemalige Stabschef der Air Force – «oder wir bomben euch in die Steinzeit zurück».[22]
Die Unsinnigkeit des Bombenkriegs zeigte sich im Juni 1965 bis zur Groteske: Da starteten auf der Insel Guam dreißig der überschweren Bomber vom Typ B-52 zu einem fast 4000 Kilometer langen Flug, mit dem Auftrag, fünfzig Kilometer nördlich von Saigon vier Quadratkilometer Dschungel, halb so viel wie der Tegernsee, mit 400 Tonnen Bomben umzupflügen; der südvietnamesische Geheimdienst hatte dort eine bedrohliche Ansammlung von Vietcong ausgemacht. Kaum hatten die B-52 abgedreht, stießen Jagdbomber mit Napalm nach. Dann setzten achtzehn amerikanische Hubschrauber 150 südvietnamesische Soldaten ab, die das Areal durchkämmten.
Sie fanden nicht einen Vietcong, keinen lebenden und keinen toten, wohl aber einen Kessel mit heißem Tee – und wurden damit, schrieb die «New York Times», zum Gespött der halben Welt.[23] Das amerikanische Oberkommando machte geltend, der Tee sei immerhin ein Zeichen, dass dort kurz zuvor noch Menschen gewesen seien. Acht Soldaten übrigens kamen bei dem Einsatz nachweislich um – amerikanische: Beim Auftanken auf den Philippinen waren zwei Bomber zusammengestoßen.
Bomben sind eben eine lächerliche Waffe gegen Partisanen, und an Geduld sind diese ohnehin allen regulären Armeen voraus. «Der Schlüssel zum Sieg ist, den Krieg in die Länge zu ziehen», schrieb Dang Xuan Khu, Berater von Ho Chi Minh. «Wir müssen die feindlichen Kräfte zermürben, demoralisieren, entmutigen.»[24] Und das gelang. Wer überhaupt war ein Vietcong – woran sollte man ihn erkennen? Unter amerikanischen Soldaten galt die Faustregel: Er war einer, «wenn er tot ist und Vietnamese». Oft folterten sie, oft töteten sie auf Verdacht; in dem Dorf My Lai brachten sie 1968 mehr als 300 Vietnamesen um.
Ein unauffindbarer, undefinierbarer, zum Äußersten entschlossener Feind, Jahr um Jahr durch keine Übermacht zu besiegen, und die zunehmende Kritik aus der Heimat, wo Studenten den Namen «Ho-Tschi-minh» in einen rhythmischen Triumphgesang verwandelten, bald auch in Paris und Westberlin – das hielt kein Soldat lange aus. Präsident Nixon sah keine andere Wahl, als Vietnam seinem Schicksal zu überlassen. 1973 zogen die Amerikaner ab, zu Hause nirgends mit Konfetti, oft mit Schmähungen empfangen. Dazu das schimpfliche Ende vom 30. April, von Fernsehkameras festgehalten, die Welt sah zu: Wie die letzten Amis zum letzten Helikopter rannten, der vom Dach der US-Botschaft in Saigon startete, und Vietnamesen, die in amerikanischen Diensten gestanden hatten, klammerten sich verzweifelt an die Kufen.
Erbarmungswürdiger hat sich eine große Armee niemals verabschiedet. Seit 1982 sind die Namen der 58256 gefallenen amerikanischen Soldaten in eine fünfzig Meter lange Mauer von schwarzem Granit gemeißelt, das Vietnam Memorial in Washington – «eine klaffende Wunde der Schande» nennen viele es bis heute; ein Kriegerdenkmal jedenfalls ohne die Heldenpose, die jahrtausendelang zu ihm gehörte; ein Epitaph auf das Soldatentum.
Der sechswöchige Golfkrieg um Kuwait (1991) war vermutlich der letzte simple Krieg einer Übermacht alten Stils. Die Wüste von Irak ermöglichte den Einsatz von Bomberflotten und Panzerarmeen, und die richteten unter den längst geschlagenen irakischen Soldaten ein Massaker an: mehr als 100000 Tote. Gefallene oder tödlich verunglückte amerikanische Soldaten: 138.
Als die USA2003 zum zweiten Mal gegen den Irak in den Krieg zogen (unter einem dreisten Vorwand, siehe Kapitel 17), da glaubten sie offensichtlich, das Siegen würde ihnen ähnlich leicht wie zwölf Jahre zuvor – und Präsident Bush leistete sich eines der törichtsten Vorurteile, die in einem Krieg je öffentlich gefällt worden sind: «Mission accomplished!», bellte er am 1. Mai 2003, dem 42. Tag der Invasion, in die Fernsehkameras, als er in maßgeschneidertem Kampfanzug auf dem Flugzeugträger «Abraham Lincoln» gelandet war.
Nun erst begann ja das Desaster: der Kleinkrieg von Fanatikern, Partisanen, Terroristen, Selbstmordattentätern gegen die US Army, ihre Söldner, ihre Verbündeten, dazu die Bomben von Sunniten auf Schiiten und umgekehrt, da kein Diktator mehr den Frieden zwischen ihnen erzwang. Mindestens 4500 amerikanische Soldaten und 200000 irakische Zivilisten starben dabei. Allein im April 2006 brachten laut BBC1091 Iraker einander um, mehr als dreißig jeden Tag; 2013 waren es bis Oktober 7000. Im Juli flogen in Bagdad zwölf Autos gleichzeitig in die Luft und töteten 71 Menschen, und islamistische Gotteskrieger pendelten zum Bürgerkrieg nach Syrien hinüber.
Für die Amerikaner wenigstens konnte Präsident Obama 2012 am Memorial Day verkünden: Zum ersten Mal seit neun Jahren kämpfen und fallen im Irak keine unserer Soldaten mehr[25] – wohl aber Hunderte von Irakern im anhaltenden Bürgerkrieg der Konfessionen. Was Obama dabei nicht in Erinnerung rief: Die «New York Times» hatte 2010 rundheraus festgestellt, die USA seien im Irak geschlagen worden.[26] Der Versuch, mit 150000 Soldaten 30000 Rebellen zu besiegen, war gescheitert.
«Andere werden unserm Leben hier einen Sinn zuschreiben, einen edlen oder auch nicht», hielt ein amerikanischer Second Lieutenant 2004 in seinem Tagebuch fest. «Für uns aber gibt es nichts als die allgegenwärtige Gemeinheit des Kampfes. Wir kämpfen mit einer rivalisierenden Bande um dasselbe Revier, während die Einheimischen sich ducken – und abwarten, auf welche Seite sie sich schlagen sollen.»[27]
Die amerikanische Niederlage ging freilich nicht nur darauf zurück, dass Soldaten keine Kriege mehr gewinnen können. Erschwerend kam die amerikanische Strategie «des jähen Wechsels vom Morden zur Freundlichkeit» hinzu, wie die «Washington Post» sie beschrieb[28]: das redliche Bemühen um eine irakische Demokratie bei anhaltendem rüden Kampf gegen erlittene oder bloß befürchtete Gewalt. Und dazu das Image-Debakel, die Folterungen und Demütigungen gefangener irakischer durch amerikanische Soldaten, 2004 gingen die Fotos um die Welt: Zwei Amis grinsend hinter einem Haufen nackter Leiber, die Militärpolizistin Lynndie England einen nackten Iraker an einer Hundeleine über den Boden schleifend; dieselbe vor fünf nackt dastehenden Männern, auf deren Geschlecht sie wie mit einer Pistole fröhlich zielt, eine Zigarette im Mundwinkel. (Dass auch Frauen in Kriegen zuweilen die schieren Bestien sind, wird Kapitel 27 demonstrieren.)
Für die Zunft der Soldaten aber war die amerikanische Niederlage im Irak noch nicht so schmählich wie das Fiasko, das Amerika in Afghanistan erlitt – dem wüsten Land der wilden Krieger, an denen drei Weltmächte scheiterten: das britische Weltreich (1842 wurde dort eine britisch-indische Armee vernichtet), die Sowjetunion (nach neunjähriger Invasion zog sie 1988 ab, mit amtlich 13000, vermutlich viel mehr gefallenen Soldaten und mindestens einer Million getöteten Afghanen) und schließlich die USA.
Woran zerbrachen die scheinbar weit überlegenen Mächte? Zunächst am Land selbst: einer Hochregion der Steppen, Wüsten, wilden Schluchten, von Siebentausendern überragt – «ein so achsenbrechendes, hubschrauberzertrümmerndes, kampfmoraltötendes Gelände», schrieb Sebastian Junger 2010, «dass militärische Pläne nicht einmal eine Stunde überleben»[29]. Dazu das extreme Kontinentalklima: bis zu 40 Grad im Sommer, im Winter bis zu minus 25 Grad.
Vielleicht zerbrachen die Eindringlinge auch an den Menschen – den untereinander vielfach verfeindeten Stämmen, die doch einiges gemeinsam haben: im kargen Land an Entbehrungen gewöhnt, an permanenten Kleinkrieg auch, zum Teil von religiösem Fanatismus befeuert. Es war wohl nicht falsch, was der Große Brockhaus 1843 geschrieben hatte, dem Jahr nach der britischen Katastrophe: «Die Taktik des Afghanen ist die Geburt des einfachen Mutes oder der unversöhnlichen Rache; angreifen, überfallen und nicht angegriffen werden ist sein Motto; sein Schwert die Furcht des Feindes.»
Kaum waren die Sowjettruppen abgezogen, griffen die einheimischen Glaubenskämpfer, die Mudjaheddin, nach der Macht; 1992 riefen sie die «Islamische Republik» aus. Schon 1994 aber wurden sie von den noch radikaleren Taliban bekämpft, den «Erkenntnissuchenden», überwiegend Koranschülern aus Pakistan. Von dort und von Saudi-Arabien unterstützt, hatten die Taliban schon 1998 den größten Teil Afghanistans unter Kontrolle und errichteten ihre islamische Diktatur: Tod allen Andersgläubigen (die islamischen Schiiten eingeschlossen), Ausschluss aller Frauen von Schule und Beruf.
Nach der Katastrophe vom 11. September 2001 hatten die USA sogleich Osama Bin Laden in Verdacht, wie schon 1998 nach den Selbstmordattentaten auf die amerikanischen Botschaften in Kenia und Tansania (Kapitel 4). Am 7. Oktober 2001 rief Präsident Bush die Operation Enduring Freedom aus, Freiheit für immer! Bomben und Raketen also auf die vermuteten Zentren und Ausbildungslager der Taliban in Afghanistan. Am selben Tag zeigte der arabische Fernsehsender Al-Djazira Osama teetrinkend vor einer Höhle sitzend, von Kalaschnikows flankiert – für die islamische Welt das Signal: Hatte vor einer Höhle nicht auch Mohammed auf der Flucht aus Mekka gerastet in höchster Gefahr, beim Aufbruch zum grandiosen Sieg?
Tags darauf wurden die ersten amerikanischen und britischen Bodentruppen abgesetzt; schon am 13. November 2001 zogen sie, mit den richtigen Stammesfürsten verbündet, in Kabul ein, im Dezember schienen die Taliban besiegt, und der Weltsicherheitsrat beschloss, «zur Wahrung des Friedens» eine internationale Sicherheitstruppe nach Afghanistan zu entsenden, die ISAF.
Sogar die deutsche Bundeswehr war dabei: 1955 gegründet, seit 1960 bei Naturkatastrophen helfend auch im Ausland unterwegs, 1995 in Bosnien zum ersten Mal in militärischem Einsatz, wurden im November 2001 vom Bundestag «zunächst für ein Jahr» deutsche Soldaten nach Afghanistan geschickt, maximal 3900 Mann – zum Aufbau, nicht zum Kampf.
Die Taliban reorganisierten sich unterdessen in Pakistans Grenzregionen, und 2003 begannen sie mit dem Partisanenkrieg, der die Bundeswehr zum Kämpfen zwang und die Amerikaner allmählich zur Verzweiflung trieb. Sie töteten mit Sprengfallen, Granaten und Raketen, als Heckenschützen und als Selbstmordattentäter. Kein Landstrich wurde je befriedet, kein ISAF-Soldat erlebte je die Genugtuung, einen Sieg errungen zu haben.
Und immer weniger war den meisten klar, wofür sie eigentlich kämpften und starben in diesem wüsten, dreckigen Land. «Es gab Soldaten, die einsahen, dass die Army sich einer Selbsttäuschung hingab», schrieb Sebastian Junger. «‹Wir werden diesen Krieg nicht gewinnen, bis wir zugeben, dass wir dabei sind, ihn zu verlieren›, sagte einer zu mir im Frühjahr 2008.»[30] Im Dezember 2009 waren 68000 amerikanische Soldaten in Afghanistan stationiert, und die Entsendung von weiteren 33000 kündigte Präsident Obama an.
Das deutsche Kontingent, auf 4900 Soldaten gewachsen, sah sich nun auch in Kämpfe verwickelt, und bis 2013 waren 19 von ihnen gefallen oder tödlich verunglückt – jeder einzelne geehrt, in die Heimat überführt, beerdigt (merkwürdig anzusehen für einen, der an Tausende von Toten pro Tag gegen Ende des Zweiten Weltkriegs gewöhnt war). Die Lager? «Unwirtliche Orte aus Zelten, Sandsäcken, Stacheldraht und bemerkenswert rudimentären Sanitäranlagen», schrieb ein Besucher von der «Süddeutschen Zeitung» 2012, «mit Staub, Skorpionen, bissigen Spinnen größer als eine Hand; die Berge glutheiß, feindlich, ohne Baum und Strauch.»[31] Und mit Ausnahmen (Kapitel 24 stellt sie vor). In Feldpostbriefen deutscher Soldaten las sich das so: «Afghanistan, hier stinkt’s. Überall Wracks, Ruinen, Einschusslöcher. Hier gibt es schon lange keinen Gott mehr.» Oder: «Alles Verbrecher hier – ich traue niemandem!» Und: «Eigentlich ist Schießen ja das Tollste, was die Bundeswehr zu bieten hat.»[32]
Im Juni 2010 ernannte Präsident Obama den General David Petraeus zum Oberbefehlshaber in Afghanistan, mit dem klaren Auftrag, sich auf die Niederringung der Taliban zu konzentrieren – also sich von ebenjener Doktrin zu verabschieden, die er als Oberbefehlshaber im Irak vom Januar 2007 bis Oktober 2008 gepredigt und praktiziert hatte: «Soldaten müssen zugleich kämpfen und Nationen aufbauen», und dort mit leidlichem Erfolg. Nun verkündete Petraeus: «Wir haben dem Feind die Zähne in den Hals gerammt, und loslassen werden wir nicht»[33] – und ließ die Drohnen kommen. Schon nach gut einem Jahr, im September 2011, wurde er abgelöst und zum CIA-Direktor ernannt.
Die Taliban töteten weiter – die Drohnen auch. Durch Selbstmordattentate kamen nach Zählung der UNO in den Jahren 2010 und 2011 in Afghanistan 659 Menschen um. Osama Bin Laden starb im Mai 2011 unter den Kugeln der Navy Seals – und nichts änderte sich. In die afghanischen Polizei- und Sicherheitstruppen hatten sich mehr und mehr Taliban oder deren Gesinnungsgenossen eingeschlichen; solche sogenannten «Innentäter» töteten 2012 dreizehn «Kameraden» und 61 ISAF-Soldaten.
In amerikanischen Uniformen, mit Sturmgewehren und Panzerfäusten bewaffnet, überfielen sechzehn Taliban im September 2012 das größte britische Militärlager in Afghanistan, zerstörten sechs Jagdbomber und schossen um sich, bis nur noch einer am Leben war. Im Januar 2013 griffen Selbstmordattentäter mitten in Kabul die Hauptquartiere der Polizei und des Geheimdienstes an. Sicherheit, schrieb die «New York Times», gebe es nirgends in Afghanistan.[34]
In seiner Rede zur zweiten Amtseinführung, im Januar 2013, sagte Präsident Obama, «ein Jahrzehnt des Krieges» gehe nun zu Ende: Aus dem Irak wurden 2011 die amerikanischen Soldaten abgezogen, in Afghanistan werde es 2015 nur noch amerikanische Ausbilder und Berater geben (die Drohnen nicht gerechnet). Wie viele? General John Allen, der Oberbefehlshaber, bezeichnete 20000 Mann als erforderlich – der Sicherheits- und Versorgungstruppen wegen. Dabei sei der Widerstand der Taliban ungebrochen, stellte das Pentagon im Januar 2013 fest.[35] Ryan Crocker, US-Botschafter in Kabul vom Juli 2011 bis Juli 2012, hatte zu seinem Abschied verkündet: «Dass die Taliban besiegt sind, glaube ich erst, wenn ich meine Stiefel auf die Gurgel des letzten von ihnen setzen kann.»[36] Und unbestritten war es töricht, diesen zähen Feind wissen zu lassen, dass er nur zu warten brauchte, um dann doch zu siegen. Die Stammesfürsten, die «Warlords», wetzten ihre Messer, die meisten Afghanen warteten ab, auf wessen Seite sie sich schlagen sollten, die afghanischen Angestellten der ISAF-Truppen bangten um ihr Leben.
Über die 350000 Afghanen in Uniform, die dann die Sicherheit allein garantieren sollten, sagte 2012 der deutsche Verteidigungsminister, er sehe Probleme mit ihrer Mentalität: Fahrzeuge und Geräte benutzten sie, bis sie kaputt sind, «und dann wissen sie nicht mehr recht weiter»[37], und ein deutscher General: «Es fehlt ihnen an allem, was übers Gewehrhalten hinausgeht.»[38] Monate in gemeinsamen Lagern mit der Bundeswehr schafften wenig Vertrauen, Kameradschaft fast nie; und immer wieder kam es vor, dass Mitglieder der afghanischen Sicherheitskräfte entweder Taliban waren oder zu den Taliban überliefen.
Wie also weiter? «Zehnjährige Kriege haben es an sich, dass man manchmal nicht mehr genau weiß, warum sie stattfinden.» In Afghanistan, schrieb der Journalist Joachim Käppner weiter, «haben wechselnde Regierungen versucht, ein bisschen Krieg zu führen – aber bloß so viel, wie man der Gesellschaft zumuten zu können glaubte.» Nun stehe der Westen vor der Alternative, «die zurückgebliebenen Soldaten hastig aus einem Staat herauszuholen, der wieder in die Bürgerkriege der Vergangenheit zurückfällt – oder er wird erneut intervenieren müssen. Ein Albtraumszenario».[39]
«Ein bisschen Krieg», das war einer der drei Gründe für das Scheitern des Westens; die Taliban führten diesen Krieg total. Den zweiten Grund hat einer von denen selbst auf die Formel gebracht: «Ihr mögt die Uhren haben. Wir haben die Zeit.»[40] Für Partisanen arbeitet die immer – vom Urtrieb der Selbstverteidigung befeuert, im eigenen Land gut versorgt, vom Hass der meisten auf die Besatzer getragen und nicht auf ein rasches Ende angewiesen – anders als die Soldaten, die endlich nach Hause wollen, bezahlt von Regierungen, die an ungeduldige Wähler denken müssen.
Ein Drittes kam in Afghanistan dazu: Diesem Krieg fehlte eigentlich der Kriegsschauplatz. Die großen Kriegstreiber waren einst über Land gezogen, um es sich einzuverleiben, Alexander der Große nach Osten, Dschingis Khan nach Westen; die Alliierten des Zweiten Weltkriegs mussten ein Reich niederwerfen, um die Nazis zu besiegen. Präsident Bush aber hatte 2001 nicht Afghanistan den Krieg erklärt, nicht einer Region – sondern «dem Terrorismus». Das war, sagte 2004 Zbigniew Brzezinski, vormals Präsident Carters Sicherheitsberater, «als würde man sagen: Der Zweite Weltkrieg wurde nicht gegen die Nazis geführt, sondern gegen den ‹Blitzkrieg›».[41] Der Philosoph Peter Sloterdijk sagte es 2013 so: «Die USA haben den Globus zum Fahndungsgebiet und zum Schlachtfeld ohne Grenzen erklärt.»[42] Den Terror als solchen verfolgen sie, und siehe: Sie finden ihn nicht.
Im Mai 2013 legte Präsident Obama nach: Dem amerikanischen Kongress versprach er «eine maßvollere Antwort auf den Terrorismus. Dieser Krieg muss irgendwann enden, wie alle Kriege. Wenn wir unser Denken und Handeln nicht disziplinieren, können wir in immer mehr Kriege hineingezogen werden, die wir nicht führen müssten.» Spät genug, schrieb Robert Cohen, Kolumnist der «New York Times», habe Obama damit die Verantwortung übernommen für die Zukunft «dieser unersättlichen Bestie, die wir den globalen Krieg gegen den Terror nennen.»[43]