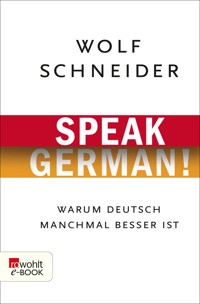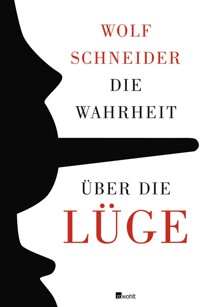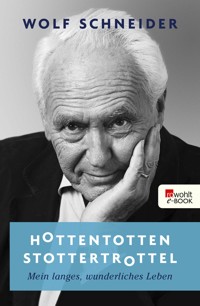9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wie schreibt man Texte, die den Leser nicht loslassen bis zur letzten Zeile? Wie verfasst man Briefe, mit denen man Kunden gewinnt und Personalchefs beeindruckt? Wie entwirft man Reden, die den Zuhörer nicht zum Gähnen treiben? Das perfekte Tag-für-Tag-Handbuch und die ultimative Stillehre für Lehrer, Schüler, Studenten, Journalisten, Lektoren, Öffentlichkeitsarbeiter und Werbetexter, für Pressesprecher, Kommunikationsberater, Redner und Redenschreiber, für Sachbuch-Autoren, Übersetzer, Briefeschreiber, Verfasser von Handbüchern und Gebrauchsanweisungen - und alle, die sich wünschen, dass ihre Wörter wirken. «Schneider bringt zielsicher gute Zitate, Textbeispiele und Analysen. Und witzig ist er bekanntlich auch. In vierundvierzig ‹Rezepten› zeigt er, was zur Herstellung von Text-Attraktivität erstens zu meiden und zweitens positiv zu beherzigen ist.» FAZ
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 351
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Wolf Schneider
Deutsch!
Das Handbuch für attraktive Texte
Inhaltsverzeichnis
KRITISCHE DIAGNOSE
I Einladung zum Leserfinden
Ermutigungen
II Wer will schon informieren!
Können sie nicht oder wollen sie nicht?
III Wer liest noch auf Papier?
Die Texteingabe am Computer
Die E-Mail
Short Message Service (SMS)
Das Chatten
IV Ist die Sprache nicht sowieso unlogisch?
Wenn der Erste zugleich der Letzte ist
V Die Sprache verändert sich – was sollen die alten Normen?
44 REZEPTE FÜR DIE THERAPIE
1 Den Leser abholen
DIE SÄTZE
2 Rührei vermeiden
3 An die 3 Sekunden denken
4 Beim Verb die Grammatik überlisten
Und was tut man dagegen?
5 Das Subjekt nicht allein lassen
Das aberwitzige Juristen-Deutsch
6 Attribute tilgen
7 Hauptsätze ausreizen
Was Goethes «Seejungfrau» uns noch immer lehren kann
8 Nebensätze anhängen
9 . . . aber mit Vorsicht!
Der Nebensatz als Ausdruck der Untätigkeit
Der Nebensatz als Medium der Verlegenheit
10 Unechte Nebensätze pflegen
11 Nebensätze manchmal voranstellen
Generalregeln für verständlichen Satzbau
12 Nebensätze niemals hineinzwängen
Preiswürdige Zwischensätze gibt es auch
13 Den Satzbau variieren
14 An des Lesers Nöte denken
Missverständnis auf halbem Weg
Der Präpositions-Salat
«nach» und «neben»
Die Parenthese
Die Ellipse (der Stummelsatz)
Der Inbegriff einer journalistischen Zumutung
15 Mit Satzzeichen Musik machen
Das sterbende Semikolon
Eliteunis oder Der Bindestrich
DIE WÖRTER
16 Mit Silben geizen
10-Cent-Wörter gesucht
17 Das Warnsignal «ung» beachten
18 Verben hofieren
19 . . . aber bitte nur solche!
Verb-Orgien
20 Adjektive minimieren
Die Ungeheuer
21 . . . denn gute sind rar
22 Den Sprachtabus misstrauen
23 Den Ausdruck wechseln – manchmal
Wie viele Wörter hat das Deutsche?
DER JARGON
24 Wissenschaftlern auf die Pelle rücken
Orgasmen der Wortkunst
25 Aktenstaub wegblasen
Aus dem bürokratischen Horrorkabinett
26 Nur die Hälfte schreiben
Unser aller Quasselbude
27 Eierkuchen wegwerfen
28 . . . vor allem die angegammelten
Eine noch schwärzere Liste
29 Anglizismen sortieren
33 Beispiele deutscher Kürze
30 . . . manchmal sogar übersetzen
33 erfolgreiche Eindeutschungen
31 Marotten umbringen
DIE REIZE
32 Grübeln und gliedern
33 Mit einem Erdbeben anfangen
Zeitungen und Zeitschriften
Bewerbungsbriefe, unverlangte Manuskripte
E-Mail und Internet
Werbetexte
Klassische Roman- und Novellen-Anfänge
34 Die Spannung durchhalten
35 Alles beim Namen nennen
Herrlich konkret
36 Den Teil fürs Ganze sprechen lassen
Schöne partes pro toto
37 Bilder finden
38 Den Wortwitz pflegen
Ein Understatement in drei Stufen
39 Absichern und abpolstern
PROBLEME
40 Soll man schreiben, wie man spricht?
Die Wörter
Die Sätze
Die Erzählstruktur
Die Sprachökonomie
41 Wie lang darf eine Rede sein?
42 Wie oft darf man Nein! sagen?
43 Wie darf ein Text nicht aussehen?
Für alle Texte
Orientierende Texte
Texte zum Lesen
Wie lang darf ein Text sein?
Und Briefe?
Analyse einer optischen Katastrophe
44 Mit Heine im Bunde
Bücher von Wolf Schneider
Namen- und Sachregister
KRITISCHE DIAGNOSE
I Einladung zum Leserfinden
Stillehre – klingt das nicht nach vorgestern? Heißt das nicht so viel wie: Da behauptet einer, gutes Deutsch sei immer noch ungeheuer wichtig – gutes Deutsch lasse sich auch definieren, sogar lehren–, und ausgerechnet dieser Autor wisse, wie?
Ja, wichtig ist sie wie eh und je, die klare, herzhafte Sprache – für jeden, der etwas zu sagen hat; der damit auch gelesen werden möchte; der mit Worten etwas bewirken will. Werbetexter wissen das, viele Politiker auch. Wer es nicht weiß oder nicht danach handelt, der verschleudert die Vorteile, die er davon haben könnte.
Und auch dies: Gutes Deutsch lässt sich definieren. Es ist das anschauliche, saftige, elegante Deutsch – und für alle, die nicht auf einen Nobelpreis für Lyrik spekulieren, hat es vor allem eines zu sein: verständlich ohne Rückstand, lesbar ohne Mühe. Die Verständlichkeit ist längst in Gesetze gefasst, eine seriöse Wissenschaft hat sie aufgestellt; über die Eleganz sind sich alle Stillehrer ziemlich einig seit dem römischen Rhetor Quintilian, und die Großen der Literatur bieten ihre Muster an.
Und dies alles ließe sich lehren? Wieder ja! Man müsste nur einen finden, der sich in die Verständlichkeitsforschung vertieft und alle Stillehren ausgewertet hat, die auf Deutsch und Englisch je erschienen sind. Der seit Jahrzehnten Höhepunkte deutscher Sprache sammelt, beginnend mit Martin Luther und mit Martin Walser nicht endend. Der seit einem Vierteljahrhundert angehende Journalisten in klarem Deutsch unterrichtet (so dass er all ihre Schwächen und Probleme kennt) und der sein Programm überdies an der Öffentlichkeitsarbeit von mehr als dreihundert Wirtschaftsunternehmen getestet hat. Er wäre also überhaupt nicht originell und würde es nicht einmal sein wollen. Er wäre lediglich auf der Höhe von Praxis, Literatur und Wissenschaft und hätte überdies gelernt, die manchmal verwirrende Fülle der Aspekte auf eine überschaubare Zahl alltagstauglicher Rezepte einzudampfen.
Der Lehrbarkeit kommt zugute, dass zwei Drittel aller Sprachprobleme dieselben geblieben sind seit Erfindung der Schrift; ihre Lösung unterliegt keiner Mode. Ein praller Satz ist ein praller Satz, zu allen Zeiten, in allen Sprachen, auf jedem Niveau – ob bei Tacitus oder in der Bibel, in der Tagesschau oder im Geschäftsbericht. Nur haben überraschend viele Deutschlehrer und Berufsschreiber das bis heute nicht begriffen.
Die Wörter, ja, die wandeln sich: Die «Saumseligkeit» ist selten geworden, Goethes «Fraubaserei» versteht kaum noch einer, und Goethe wiederum konnte nicht nur nichts von «software» wissen – ebenso hätte er Mühe gehabt, hinter dem heutigen Modewort «Beziehung» eine Art Liebe zu vermuten.
Doch auch den Wörtern ist etwas gemeinsam geblieben, zweierlei sogar. Das eine: Wenn sie einen Nerv treffen, bewegen sie die Gemüter wie eh und je. Mit Wörtern kämpfen Parteien, Ideologien, Produzenten um ihren Platz in unseren Hirnen. Mit «sozialer Gerechtigkeit». (oder dem Vorwurf, an ihr mangle es) wird große Politik gemacht, mit der «Achse des Bösen» ebenso, und selbst Gerhard Schröders «Agenda 2010» hat oder hatte ihren Zauber – obwohl uns doch keiner sagt, ob sie in eine ziemlich ferne Zukunft zielt oder ob wir die Zahl 20-10 so ähnlich lesen sollen wie 08-15 oder 47-11.
Gemeinsam seit Jahrtausenden ist den Wörtern ferner: Mit «Schwulst und Gepränge» erzielt man keine Wirkung – das sagt schon Quintilian. Schlanke, muskulöse Sätze zu formen aus Wörtern mit Saft: Das war von jeher eine Kunst, sie ist es geblieben, und sie zu beherrschen zahlt sich noch immer aus.
Inwieweit wir uns dabei der vielen Importe aus dem Englischen bedienen sollten, lohnt ein kurzes Nachdenken. Hier wird nicht zur Treibjagd auf Anglizismen geblasen: Viele davon haben unsere Sprache bereichert, niemand will an so praktischen Wörtern wie Job, Team, Flirt oder Training herummäkeln, und es wäre töricht, die überragende Rolle zu ignorieren, die das Englische in der internationalen Verständigung spielt.
Doch wer wollte leugnen, dass manche Leute– Marketing-Strategen, Werbetexter, Computer-Freaks zumal – sich an englischen Silben geradezu berauschen, weit über jeden Nutzen und Gewinn hinaus? Zu stutzen hie und da, ob nicht das deutsche Wort manchmal das stärkere ist – das würde keinen schänden. Wie meistens ist die Dosierung das Problem: Ganz ohne Kochsalz könnten wir nicht leben, aber wer zwei Esslöffel davon herunterschluckt, dem zerfrisst es die Magenwände.
Mehr als die englische Invasion hat eine andere Entwicklung die Sprache der Gegenwart geprägt: Das Ansehen gedruckter Texte, welcher Art auch immer, ist drastisch gesunken. Die Hälfte der Jungen in Deutschland und ein Viertel der Mädchen lesen überhaupt nichts mehr (Stern 2004). Ein Drittel jener Deutschen, die noch lesen, liest grundsätzlich keine Texte mit langen Sätzen (Geo 2003). Die meisten Studenten sind es nicht mehr gewöhnt, «sich selbständig in ein Thema einzuarbeiten; sie benötigen Animation» (Spiegel 2003). Und nun gar heilige Schriften studieren, sich Sprachkunstwerken genießend hingeben, nach dem treffenden Wort fahnden, Sätze meißeln – das tut kaum noch einer. Allem Gedruckten und Geschriebenen bläst der Wind ins Gesicht. Lesen, mehr als ein paar flotte Zeilen lesen ist altmodisch geworden im Tanz der Pixel und der Bits.
Wer also im 21.Jahrhundert noch gelesen werden, mit Wörtern Informationen transportieren, ja etwas bewirken will, der muss mehr investieren als seine Großeltern. Um Leser muss er werben, überlisten muss er sie. Möglichst interessante Stoffe (von denen kann dieses Buch nicht handeln) muss er appetitlich servieren – das ist hier das Thema, und dazu gehört vor allem zweierlei: der Wille, sich mit den einschlägigen Gesetzen, Regeln und Erfahrungen für attraktives Deutsch auseinander zu setzen, und die Bereitschaft, an seinen Wörtern und Sätzen zu feilen, ja notfalls sich mit ihnen abzuquälen. Wer seinen Text sogleich gut findet, bloß weil schließlich er selbst ihn geschrieben hat, der ist mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit ein Genie und mit sehr hoher ein weltfremder Zeitgenosse – falls er auf Leser hofft.
Steht der Text einmal da, so ist die Arbeit eben nicht beendet, nun fängt sie an, wann immer die Zeit reicht und wo immer der Ehrgeiz regiert: Ich will gelesen werden – ganz, gern und mit der angepeilten Wirkung. «Es trägt Verstand und rechter Sinn mit wenig Kunst sich selber vor», sagt Faust, und er irrt sich gewaltig. Die populäre Vorstellung, Klarheit sei in die Wörter gleichsam eingewebt, ist ein Aberglaube.
Vielleicht enthält die erste Niederschrift ja taube Nüsse, Schwabbelfett, Elemente der Geschwätzigkeit. Vielleicht verstoßen einige Passagen gegen die Gesetze der Verständlichkeit, wie hier in den Rezepten 1 bis 23 beschrieben. Vielleicht holpern manche Sätze so, dass das Trommelfell erschräke, wenn es sie hören müsste (und das laute Lesen sollte man zur Kontrolle immer praktizieren, wenn die Umstände es zulassen). Vielleicht brüstet sich der Text mit einem Wissenschafts-Chinesisch, das eher imponieren als informieren soll («Die Konversationsimplikaturen als konstituierende Elemente der Perlokution»); vielleicht bläst er schlichte Wörter zu jenen bombastischen Gebilden auf, wie sie durch Marketing- und Kommunikations-Abteilungen geistern: «DienstleistungsbasierteAktivitäten» zum Beispiel, wo etwas anderes als «Dienstleistungen» schwerlich gemeint sein kann.
Und all dieser gute bis allzu gute Rat sollte noch einen Nutzen haben im Zeitalter der E-Mail und des Internets? Ja, und nicht nur das: Die fröhliche Schludrigkeit, die dort regiert, bietet dem gewogenen Wort, dem geschliffenen Satz die Chance, das elektronische Umfeld stärker zu überstrahlen als jemals den herkömmlichen Text.
Also, Schreiber: Wollt ihr gelesen werden? Dann erkennt das Problem! Studiert, was man dafür beherzigen muss! Plagt euch! Geht mit der Sprache so um, dass eure Wunschleser euch mühelos verstehen, euch bis zum Ende folgen und euch mögen! Nur wenn die Sätze rote Backen haben, werden die, auf die sie zielen, sie mit roten Ohren lesen.
Was plakatierte 2003 das Schweizer Institut Inlingua? «Die strenge Sprachschule. Hauptsache, es macht nicht nur Spaß.»
Aber auch.
Ermutigungen
Große deutsche Philosophen werden vornehm die Achseln zucken über den dürftigen Zuschnitt alles dessen, was ich hier hervorbringe. Aber sie mögen gefälligst bedenken, dass das wenige, was ich sage, ganz klar und deutlich ausgedrückt ist, während ihre eigenen Werke zwar sehr gründlich, unermessbar gründlich, stupend tiefsinnig, aber ebenso unverständlich sind. Was helfen dem Volk die verschlossenen Kornkammern, wozu es keinen Schlüssel hat? Das Volk hungert nach Wissen und dankt mir für das Stückchen Geistesbrot, das ich ehrlich mit ihm teile.
Heine, Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland
Man hat den Deutschen vorgeworfen, dass sie bloß für die Gelehrten schrieben; ob nun dieses gleich ein höchst gesuchter Vorwurf ist, so habe ich mich doch danach gerichtet und überall für den geringen Mann mitgesorgt.
Georg Christoph Lichtenberg
Wenn jemand sich überlegt, fünfzehn oder zwanzig Stunden zu investieren, um ein Buch von mir zu lesen – fünfzehn oder zwanzig Stunden, die in Kinos oder im Internet oder mit Sport verbracht werden könnten–, dann wäre das Letzte, was ich wollte, ihn auch noch mit übertriebener Schwierigkeit zu bestrafen.
Jonathan Franzen
Für mich ist auch die Literatur eine Form der Freude. Wenn wir etwas mit Mühe lesen, so ist der Autor gescheitert.
Jorge Luis Borges
Was man nicht verstehen kann und vielleicht auch nicht verstehen soll, das schafft kein Vertrauen.
Johannes Rau (in seiner letzten Rede als Bundespräsident)
II Wer will schon informieren!
Unsere Träume fassen wir in Worte, auch unsere Hoffnungen, unsere Utopien; der Sprache bedienen sich ebenso Befehle, Drohungen, Flüche, Beleidigungen und Lügen. Information ist nicht ihr primärer Zweck, und fürs Informieren ist sie nur bedingt geeignet. Das mündliche Wortaufkommen der Menschheit besteht überwiegend aus dem Gebet und dem Geschwätz.
Gebet: In den Straßen arabischer Städte stehen Bettler, die rufen die hundert Namen Allahs zehntausendmal am Tag. Tibetische Mönche lassen ihr «Om mani padme hum» hunderttausendfach in einer Mühle kreisen. Einen Rosenkranz herunterbeten heißt fünfzehnmal das Vaterunser murmeln und hundertfünfzigmal das «Gegrüßest seist du, Maria».
Geschwätz: Kneipen, Betriebskantinen, Treppenhäuser hallen von einem unendlichen Geplapper wider. So zum Beispiel: Der Sprechende erzählt alles, was er wichtig oder witzig findet, dreimal hintereinander; eine schmähliche Fußballniederlage, über die sich alle einig sind, wird wieder und wieder durchgekaut; oder der Erzähler legt Wert darauf, alles weiterzugeben, was er schon mal gesagt hat («Sag ich doch zu ihm: Mensch, sag ich, das ist ja vielleicht kalt heute» – wobei die Umstände dafür sprechen, dass die Kälte wirklich herrschte und dies dem Angesprochenen so wenig verborgen geblieben war wie den Zuhörern).
Überdies hat das Fernsehen das Geschwätz sendefähig gemacht, ja einer winzigen Minorität das Privileg verschafft, die Mehrheit mit den Produkten ihrer Schwatzlust zu berieseln. Zu dieser bevorrechtigten Minderheit gehören vor allem die professionellen Fernseh-Dampfplauderer, zumal auf den privaten Kanälen, und die verschwitzten Sportler, denen nach Sieg oder Niederlage der Reporter das Mikrophon entgegenstreckt. Den stört es offensichtlich nicht, dass die Sporthelden außerordentlich selten etwas Überraschendes zu sagen haben – kein Wunder, sie keuchen ja, und noch dazu hat der liebe Gott seine Gaben nicht so ungerecht über die Menschheit ausgeschüttet, dass er jeden Meister in einer Körperkunst auch noch mit rhetorischen Talenten versehen hätte. Doch natürlich bleibt es nicht ohne Einfluss auf die Entwicklung der Sprache, dass solches Gestammel nicht mehr drei Umstehende erreicht wie früher, sondern drei Millionen vor den Fernsehschirmen.
Geschwätz wie Gebet sind hier nicht das Thema. Aber in die geschriebene Sprache, die sich Leser sucht, wirken sie hinein. Das Gebet sollte das geradezu: Denn in ihm regiert erstens Respekt vor dem Wort – etwas also, was jedem Text nützt, was den Siebzehnjährigen von heute aber weithin abhanden gekommen ist; und zweitens sind viele Gebete Sprachkunstwerke, an deren schlichter Kraft sich jeder, der sich Leser wünscht, durchaus orientieren kann – dieses zum Beispiel (4.Mose 6,24):
Der Herr segne dich und behüte dich; der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.
Von der Geschwätzigkeit dagegen sollte die geschriebene Sprache sich freihalten. Allzu oft aber schwappt sie in die Schrift hinüber: Redundanz heißt sie dann (Rezept 26 hilft dagegen) oder Tautologie, das Doppeltgemoppelte – wie das Standard-Versprechen des Marketingjargons, die angepriesene Ware sei «qualitativ hochwertig». (Rezept 20). Qualitativ! Darauf wäre man nie gekommen.
Geschriebene Texte, ebenso vorgelesene Reden und vorbedachte mündliche Feststellungen: Das sind die Sprachprodukte, deren Tauglichkeit dieses Buch zu heben versucht. Was ist ihr überwiegender Zweck? Sie wollen von Lesern oder Zuhörern verstanden werden und Interesse wecken – fürs Erzählen, fürs Informieren, fürs Werben.
Werben heißt nur im Grenzfall: für ein Produkt oder eine Politik Reklame machen. Im weiteren Sinn ist es unser ständiger Versuch, andere Menschen für uns, für unsere Sache, unsere Meinungen, unsere Pläne einzunehmen. Erzählen kann heißen: eigene Erlebnisse schildern oder, als Schriftsteller, fabulieren; in den anzustrebenden sprachlichen Mitteln macht das keinen Unterschied.
Informieren bedeutet, seinem lateinischen Ursprung nach, eigentlich: in Form bringen, gestalten; später erst: in Kenntnis setzen, Auskunft geben, unterrichten – vor allem über Sachverhalte, Abläufe, Ereignisse, Absichten und Meinungen. Dieser seit dem 16.Jahrhundert dominierende Wortsinn sollte jedoch nicht zu der Annahme verführen, Information finde statt, bloß weil sie nach den Umständen zu erwarten wäre.
Allzu oft ist eben dies nicht der Fall. Schon deshalb, weil viele, die etwas mitzuteilen haben, sich einer Sprache bedienen, die der Adressat missversteht oder nicht versteht, oder zwar verstünde – aber nur, wenn er sich eine Mühe gäbe, die er nicht zu investieren wünscht. Zur Information im vollen Wortsinn fehlt dann die zweite Hälfte: Sie ist nicht angekommen, sie ist nicht vollzogen worden, der Informationswillige ist gescheitert.
Zu der verbreiteten Unkenntnis, wie man sich verständlich machen könnte, tritt verschlimmernd der Umstand hinzu, dass der Wille zum Informieren nur schwach ausgeprägt, ja häufig nur schwer von dem bedingten Vorsatz zu unterscheiden ist: Ich will durchaus meine Adressaten unterrichten; wenn aber nur wenige mich verstehen, ist das auch nicht schlimm. Diese Gesinnung herrscht auf weiten Strecken in der Wissenschaft – und ausgerechnet in der Presse. Sie tritt in mehreren Spielarten auf: Zunftjargon, Desinteresse, Hochmut.
DER ZUNFTJARGON. Wer sich seiner bedient, zielt meist auf wenige. Sein Text ist in einer Sprache abgefasst, der ihn bloß einer fachlich vorgebildeten Minderheit zugänglich macht; vermutlich aus einem der folgenden Gründe:
Der Autor weiß, dass nur die anderen Experten ihn verstehen, und strebt dies auch an; er fühlt sich in der elitären Absonderung wohl.
Der Autor denkt nicht nach und unterstellt, der Text sei ohnehin perfekt, weil er von ihm ist.
Der Autor– Fachmann oder Journalist – bemüht sich zwar um eine gemeinverständliche Information, bleibt jedoch dabei dem Fachjargon verhaftet, weil sein Ehrgeiz nicht weit genug reicht oder weil er das Vorwissen seiner Leser überschätzt.
Eine offene Gesellschaft verträgt es aber schlecht, dass die Mehrzahl der in ihr verfügbaren Informationen ohne Not nur in Klüngeln zirkuliert.
DAS DESINTERESSE. Journalisten, Lexikon-Redakteure, Verfasser von Handbüchern und Gebrauchsanweisungen kennen zwar ihren Informationsauftrag und akzeptieren ihn zumeist; viele von ihnen aber sind zu weltfremd oder zu bequem, um sich in ihre Leser hineinzuversetzen und deren mutmaßlichen Erwartungen entgegenzukommen. In den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten traf man Redakteure von dieser Art zuhauf, bis das Privatfernsehen sich ihnen in den Nacken setzte; «Redaktionsbeamte». (so das interne Spottwort) faulenzen sich aber immer noch durch etliche Redaktionen.
DER HOCHMUT. Nicht nur viele Professoren – auch eine alte Garde von Redakteuren gerade in unseren renommierten Tages- und Wochenzeitungen, zumal in der Wirtschaft und im Feuilleton, halten es für unter ihrer Würde, an einen großen Leserkreis zu denken und auf dessen Horizont «hinabzusteigen». Sie schreiben vor allem, um von Vorstandsmitgliedern, Regisseuren, Dirigenten, Koryphäen gewürdigt zu werden und den Kollegen von den anderen Redaktionen oder Fakultäten zu imponieren. Ihre beliebtesten Mittel dafür sind elitäre Wörter und der Schachtelsatz (dagegen Rezept 24).
Während in den bisher beschriebenen Fällen immer noch ein Quantum Information angestrebt oder mindestens billigend in Kauf genommen wird, stoßen wir, zumal in Politik und Wirtschaft, weithin auf den klaren Willen, nicht zu informieren, sondern sich bloß den Anschein des Informierenwollens zu geben. Die redliche Auskunft ist dann gerade nicht das Ziel, sondern das Einnebeln, Einschläfern, Einschüchtern oder Irreführen.
Zuweilen geschieht dies fast ungetarnt. So verkündete der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Post AG auf der Hauptversammlung 2003: «Wir haben die betriebliche Altersvorsorge modifiziert und das System der fixen und variablen Vergütung für unsere Führungskräfte weiterentwickelt» – und kein Wort mehr. Haben die Führungskräfte sich also noch höhere Einnahmen zugeschanzt? Das ließ der Redner offen, und keiner fragte nach. Doch es gibt subtilere Methoden, Sachverhalte zu kaschieren und Leser oder Zuhörer einzulullen – mindestens diese:
DIE KALKULIERTE IRREFÜHRUNG. Der Politiker versichert zum Beispiel, seine Regierung werde das Problem der Arbeitslosigkeit «langfristig in den Griff bekommen». Dabei spekuliert er darauf, dass die meisten das Wort langfristig als «später einmal, und dann nachhaltig» missverstehen. Der klar definierte Gebrauch an Bank und Börse ist aber «auf lange Frist ab heute». Doch welcher Journalist weiß das schon und treibt den Politiker mit seinem Wissen in die Enge? (Gegen den Politiker-Jargon: Rezept 25)
DIE SCHÖNFÄRBEREI. Die Verlautbarung, die Rede beschränkt sich auf Teilwahrheiten, und die werden magisch angeleuchtet. Das ist sprachlicher Alltag in den Reden von Politikern («Nullwachstum») ebenso wie in den Prospekten der Reisebüros («strandnah»). Inwieweit diese Technik in die Öffentlichkeitsarbeit von Wirtschaftsunternehmen einfließt und einfließen sollte, ist umstritten.
DAS FREUNDLICHE NICHTS. Einige Public-Relations-Experten räumen ein, ihre Aufgabe sei nicht so sehr, Informationen zu verbreiten (nicht einmal geschönte), sondern zugunsten ihrer Firma «ein freundliches Grundrauschen» zu erzeugen – vergleichbar den einstigen Bulletins über das vorzügliche Befinden Seiner Majestät.
Wer wirklich informieren will, dem sagt dieses Buch, welcher Mittel er sich bedienen sollte, damit alle Adressaten ihn verstehen können und ihn lesen oder hören mögen. Wer nicht informieren will, der sieht immerhin schärfer als zuvor, was er versäumt.
Können sie nicht oder wollen sie nicht?
KONVERSATIONSLEXIKA erheben den Anspruch, ein Publikum zu informieren, das zwar interessiert, aber nicht fachlich vorgebildet ist. Die Brockhaus-Enzyklopädie schreibt über die Entstehung der Alpen:
Das geröllreiche kontinentale Verrucano… ist an der Wende Perm/Trias zur Ablagerung gekommen und leitet die mesozoische Geosynklinalphase ein.
Und über den Umlaut im Deutschen:
Alle Umlauterscheinungen sind partielle antizipative vokalische Fernassimilationen.
ZEITUNGEN verstehen sich im Großen und Ganzen als Überbringer von Informationen, die ihre Leser interessieren (oder nach Meinung der Redaktion interessieren sollten). Im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen hieß es 2004 über den amerikanischen Präsidenten George W.Bush (in einem Satz):
Der größte Freund des möglichst gesamtplanetarischen Freihandels, Wiederbeleber steiler Weltraum-Raketenabwehrsystempläne aus der technophilen reaganschen Urzeit und tragische Befreier von Bagdad sieht einfach nicht ein, daß Erkenntnis und Machbarkeit sozial zu irgend etwas verpflichten sollen – und so läßt er ankündigen, die Antarktis-Abkommen der Weltgemeinschaft im Rohstoffbedarfsfall nach der Fetzen-Papier-Doktrin behandeln zu wollen, erlaubt seinen Finanzverwaltern, dezent Druck auszuüben, damit Verhütungsinformationen wegen andernfalls bedrohter Familienwerte von staatlich geförderten Jugend-Beratungs-Websites gelöscht werden, stellt sich taub, wenn von neumodischem Kram Marke Klimaschutz geredet wird, schert sich erstaunlich wenig um Studien des National Research Council, der National Academy of Sciences, der National Oceanic and Atmospheric Administration und der Nasa betreffend die großräumige und langfristige Weltgroßwetterlage… (und so weiter, noch 52Wörter mehr im selben Satz).
DAS FERNSEHEN brachte 2005 (im Umfeld des Korruptionsskandals im deutschen Fußball) die Nachricht:
Ein Schiedsrichter wurde im Vorfeld des Spiels kurzfristig abgelöst. (ZDF)
Ein dreifach ärgerlicher Satz. Im Vorfeld, erstens, ist geblähter Jargon für vor, davor, zuvor, vorher.
Zweitens: Kurzfristig heißt eindeutig «für eine kurze Frist». Abgelöst also vielleicht für zwei Stunden oder zwei Spiele? Vermutlich nicht. Es lag wohl ein modischer Missbrauch des Wortes kurzfristig vor:
Entgegen dem klaren Wortsinn wird es oft an Stelle von rasch, umgehend, unverzüglich, erst kurz zuvor verwendet. Gemeint war demnach wahrscheinlich die schlichte Aussage: «Ein Schiedsrichter wurde kurz vor dem Spiel abgelöst.»
Das wäre sprachlich korrekt – doch es bliebe immer noch unbefriedigend. Wie kurz denn und für wie lange? Wenn es eine Stunde vor dem Anpfiff gewesen sein sollte – warum erfuhren das die Zuschauer nicht? Und war die Ablösung unbefristet – oder galt sie nur für dieses Spiel? Und wenn der DFB das verschwieg, hätte es dann nicht heißen müssen: «Für wie lange, ließ der DFB offen»? Schlampiger kann man mit seinem Wissen nicht umgehen.
HEIRATSANZEIGEN enthalten überraschend oft auf 1Teil Information (über die suchende oder gesuchte Person) 10Teile Schwärmerei über die Schönheit des erhofften Zusammenlebens. Zum Beispiel so:
Es ist ganz einfach, ein Treffen zu organisieren, plaudern, spüren, ob wir uns sympathisch sind, ob mehr daraus werden kann. Es ist ein schönes Ziel, an deiner Seite glücklich zu sein, Freundschaft und Vertrauen zu empfinden. Es wäre ein Erlebnis, mit dir zusammen den Frühling, den Schritt in den Sommer und später in den Herbst und Winter zu gehen, es wäre mein Traum mit dir alle «Alltags- und Alterssorgen» gemeinsam zu bewältigen und das Leben trotzdem oder gerade deshalb immer von der positiven Seite zu betrachten. Stell dir vor, es ist Sonntagmorgen, wir bringen einander das Frühstück ans Bett, das Fenster ist weit offen und der Duft des Gartens durchfließt unser Zimmer. Wir erzählen uns unsere Gedanken und die Gemeinsamkeit beflügelt uns, stärkt uns immer mehr. Wir beide – (ich: 50J./176)… Über den Gesuchten sagt die Inserentin nur: «50 bis 60Jahre, ab 180.» (Weltwoche, Zürich 2004)
Andere Heiratsanzeigen spitzen die Informationen über die gewünschten Eigenschaften mit solcher Detailfreude zu, dass es möglicherweise niemanden auf Erden gibt, der sie alle in sich vereint:
«Liebst du auch philosophierende Aphorismen und Liebesgedichte (Heine, Hesse, Rilke etc), einsame Märchenstrände (Indien, Sri Lanka, griech. Inseln), Segeln bei Windstärke 5, ausgiebige Rad- u. Wandertouren, die bereichernde Freude an der Kunst in Ausstellungen, Museen etc, die lockere Pinselführung beim schwungvollen, entspannenden Malen (Acryl) und vieles mehr? Schöne, schlanke Natur- und Kunstliebhaberin…» Folgt eine weitere Zeile über die Suchende, dann zwei Zeilen, dass der Gesuchte «ein feinfühliger, phantasievoller Optimist» sein soll. (Die Zeit, 2004)
Den in diesem Kapitel geschilderten Methoden, die Information zu verweigern, wäre insoweit die WELTFREMDHEIT hinzuzuzählen.
III Wer liest noch auf Papier?
Es wäre ein Wunder, wenn die Sprache sich nicht verändert hätte durch den fünffachen Anprall der Elektronik: die Texteingabe am Computer, das Internet, die E-Mail, das Chatten und den Short Message Service, SMS genannt. Eine Veränderung zum Besseren – zu mehr Substanz, zu mehr Verständlichkeit – ist es nicht. Wer im elektronischen Zeitalter noch gelesen werden möchte, hat mit zusätzlichen Problemen zu kämpfen; ein paar neue Chancen aber hat er auch.
Die Texteingabe am Computer
Natürlich enthält seine Tastatur dasselbe QWERTZUIOPÜ wie die Schreibmaschine, und dieselben Menschen wie früher bedienen sich ihrer in derselben Absicht wie früher – was die Frage nahe legt: Unterscheidet sich die Qualität überhaupt von der eines Typoskripts? Nein, sagen viele Benutzer: Ein guter Schreiber bleibt ein guter Schreiber, ob mit Tinte, Farbband oder Bildschirm.
Doch diese Auskunft ist von einer Treuherzigkeit, die von der Beschaffenheit der Texte, die aus dem Computer quellen, ebenso in Frage gestellt wird wie von der Geschichte der Medien. Von jeher wirkt die Technik der Kommunikation auf die Form und den Inhalt des Mitgeteilten zurück – dies der Sinn des Schlagworts the medium is the message, das der kanadische Medienphilosoph Marshall McLuhan 1964 mit seinem Buch «Understanding Media» in Umlauf setzte; und so viel modischer Missbrauch damit auch getrieben wurde: Im Kern ist der Satz wahr.
Der TELEGRAMMSTIL mit seinen extremen und oft künstlichen Verkürzungen («Eintreffe Dienstag…») war natürlich unbekannt, ehe der Telegraph erfunden wurde, und hat doch der Schriftsprache Kessheiten ermöglicht, wie man sie noch heute im Spiegel finden kann, wenn er beispielsweise Präside statt Präsidiumsmitglied schreibt. Das Telefon zog zunächst eine überspitzte Artikulation nach sich («fünnef»), auch das Buchstabier-Alphabet (Anton-Berta-Cäsar), und später läutete es den Tod einer hochspezialisierten Schreibkultur ein, des privaten Briefes; die wiederum hatte erst entstehen können, als Papier und Alphabetisierung mit einem organisierten Postwesen zusammentrafen.
Das RADIO hat die Geschwätzigkeit zur Einkommensquelle gemacht; die Schnitttechnik des FILMS, das krasse Gegeneinandersetzen des Unzusammenhängenden, hat auf die Erzähltechnik abgefärbt. Das FERNSEHEN wiederum hat den Film verändert: Früher konnte er gemächlich, heute muss er aufregend beginnen, da man im Kino das Programm nicht wechseln kann, im Fernsehen aber allzu leicht; und die hektischen Schnitte im Vorspann amerikanischer Fernsehserien begünstigen vermutlich den Asthma-Stil, für den Rezept 15 Beispiele liefern wird, sowie eine allgemeine Ungeduld in der Kommunikation.
Die Sprechblasen der COMICS riefen eine Stummelsprache ins Leben, dazu eine Fülle neuartiger Interjektionen und Lautmalereien (seufz, krächz, uuugh!), sogar eine Bilderschrift, beispielsweise um einen Wutanfall von Mensch oder Hund auszudrücken. Das DIKTIERGERÄT macht die Geschäftsbriefe länger, weil der Diktierende mühelos dahinschwatzen kann.
Und ausgerechnet der Computer also sollte die Qualität der Sprache nicht verändern? Da er doch an die Stelle von Schriftzeichen, die wir noch nach Jahrtausenden erkennen können, eine elektronische Vision setzt, die per Knopfdruck für immer gelöscht werden kann oder sich gelegentlich auch gegen den Willen des Benutzers in nichts auflöst?
Also: Er verändert die Beschaffenheit von Texten. Zum Besseren oder zum Schlechteren? Da sollte sein Einfluss auf die Schreiber unterschieden werden von seiner Wirkung auf die Kontrollinstanzen: Redakteure, Lektoren; den klassischen Berufsstand der Korrektoren hat der Computer ja schon fast beseitigt.
Korrektoren waren seit Erfindung des Buchdrucks dazu da, die Übertragungs- und Flüchtigkeitsfehler des Mannes an der Setzmaschine aufzuspüren. Dass der Bleisatz starb, benutzten die meisten Druckereien und Verlage als Begründung, um zusammen mit ihm auch den Korrektor abzuschaffen. Dabei übersahen sie oder nahmen sie in Kauf, dass sie ein Überwachungsgremium ersten Ranges ausgemustert hatten: Die Korrektoren waren ja zu Spezialisten der Rechtschreibung, der Zeichensetzung, der Grammatik geworden, den Autoren der Texte darin meist überlegen.
Nun aber haftet jeder Redakteur für jedes Komma selbst, und auch seine Flüchtigkeitsfehler und seine falschen Konjunktive werden munter publiziert. Für Berufsschreiber mit ausgeprägtem Pflichtgefühl ist das eine zusätzliche Belastung, und da die Pflicht nicht immer siegt, enthalten die meisten Zeitungen heute drastisch mehr Verstöße gegen die Spielregeln der deutschen Sprache als vor dreißig Jahren. Auch hat kein Klippschüler je eine so törichte Silbentrennung vorgenommen, wie sie dem Computer unterläuft, sooft sein Programm ihn im Stich lässt: Fehl-erquellen so-nder Zahl, und Tran-sport ist vermutlich die Leibesertüchtigung der Walfische.
Das ist unbestritten. Aber auch für die Lektoren in den Buchverlagen hat sich etwas geändert – es sei denn, sie dürften noch mit Papier umgehen wie eh und je. In vielen, zumal kleineren Verlagen jedoch fehlt es an Geld für genügend Drucker und das viele Papier; der Lektor soll also am Bildschirm arbeiten. Dies 400Seiten lang zu tun ist für kein Auge zumutbar. So werden viele Bücher in großen Passagen überhaupt nicht mehr lektoriert – der Anfang, der Schluss und ein paar Stichproben sollen genügen.
Und die Redigierer in den Redaktionen? Lesen müssen sie alles; aber dass sie in ihre Vorlagen deutlich seltener eingreifen als zur Zeit der Fernschreiber, ist erwiesen. Der Text, den sie begutachten sollen, erscheint ja auf dem Bildschirm optisch schlackenlos, gleichsam mit dem Anspruch: An mir stimmt alles – lass mich in Ruhe! Da wird das Redigieren zur Charakterfrage.
Die Revisoren also, die die Texte prüften und an ihnen feilten, sind nach einem halben Jahrtausend bewährter Arbeit teils entlassen wie die meisten Korrektoren, teils in ihrer Arbeit behindert wie viele Lektoren, teils durch die Elektronik verführt zu einem Quantum Bequemlichkeit und falschem Respekt.
Für alle Schreiber, die noch heute Leser für sich gewinnen wollen, liegt hier die erste von mehreren Chancen der Computerwelt: Ein makelloser Text, vom korrekten Komma über das treffende Wort bis zum eleganten Satz, fällt heute mehr auf als vor dreißig Jahren. Nur einer Minderheit, gewiss – aber es ist die der Interessierten, der Gebildeten, der Meinungsführer. Die Bereitschaft, sich mit Texten abzuquälen, für die Kapitel I plädierte, trägt heute also noch saftigere Früchte als zur Goethezeit.
Und das nicht nur, weil die Kontrollorgane weithin abgedankt haben – auch die Schreiber selber werden durch den Computer tendenziell zu einem sorgloseren Umgang mit ihren Texten verführt. Was geschieht in ihnen, wenn sie in den Rechner tippen, statt sich, wie einst, des Federhalters, des Kugelschreibers oder der Schreibmaschine zu bedienen?
Auf einem Feld sind die Meinungen gespalten. Viele loben die Kürze des Weges vom Kopf in die Schrift, auch das befreiende Gefühl des Drauflosschreibenkönnens, weil es ja so leicht ist, den Text nachträglich umzubauen. Andere fühlen sich durch das Flimmern des Bildschirms und das Blinken des Cursors unter Druck gesetzt (und beklagen überdies den erschwerten Kontakt zu den Kollegen, weil der Computer sie völlig vereinnahmt). Auch kann man über die Vorzüge des Drauflosschreibens verschiedener Meinung sein: Es geht ja oft damit einher, dass viele Autoren schon schreiben, ehe sie sich ein bisschen Zeit zum Nachdenken genommen haben – und das ist nicht immer ein Gewinn (dazu Rezept 34).
Auf einem anderen Feld hat sich eine seufzende Mehrheitsmeinung herausgebildet. Das wunderschöne, das immer wie gedruckte Schriftbild strahlt die Verführung ab: Lass mich so, ich bin gut – die Einladung also, in die Verfeinerung des Textes keine Mühe mehr zu investieren, mindestens weniger als in das schmuddlige Manu- oder das vielfach übertippte Typoskript von einst.
Dem Schreiber winkt hier die nächste Chance: Wenn er die Kraft hat, sein Produkt grundsätzlich für verbesserungsbedürftig zu halten, wie prächtig es sich auch darböte – dann eilt er denen davon, die sich von der Aura ihres Textes haben blenden lassen.
Die E-Mail
Die E-Mailhat sich, über alle sonstigen Vorzüge und Nachteile des Computers hinaus, zu einer eigenständigen Textgattung entwickelt, und die Menge des Geschriebenen hat sie gewaltig erhöht – entgegen allen Prognosen, das Fernsehzeitalter werde der Schriftkultur den Garaus machen. Dies mit zwei Einschränkungen: Der Bestandteil «Kultur» wird von manchen Essayisten mit einem Fragezeichen versehen, und Wörter, ja halbe Sätze werden oft – primär im privaten Austausch – durch ein Emoticon ersetzt, eine Art Bilderschrift aus Satzzeichen wie das bekannte «Smiley» :=), was, um die Achse nach oben gedreht, im «Punkt-Punkt-Komma-Strich»-Stil ein lächelndes Gesicht zeigt. Offensichtlich aber ist dieses:
1. Es werden mehr E-Mails geschrieben als jemals Briefe, Postkarten, Notizen und Hausmitteilungen. Vermutlich hängt das zusammen mit der Beiläufigkeit, der niedrigen Hürde des Schreibbeginns: Da muss kein Papier zurechtgelegt oder eingespannt werden, und am Computer sitzt man sowieso. Dazu kommt der spielerische Charakter der Computer-Nutzung, vielleicht auch das Gefühl: Schick ist es schon. Noch nie lag das Schreiben so dicht am Spaß.
Da die Schwelle vor dem Entschluss «Ich schreibe» so niedrig geworden ist, wird die Frage «Habe ich eigentlich etwas zu sagen?» seltener gestellt – zumal im privaten Umgang; im geschäftlichen jedoch tendenziell nicht anders. Kulturkritiker sprechen von dem hohen Anteil «pseudoinformativer Belanglosigkeiten».
2. Ebenso werden für die jeweilige Aussage im Durchschnitt mehr Wörter verwendet als einst im Brief: Es schreibt sich ja so leicht, nun rasch hinaus damit! Zu prüfen, zu straffen, sich zu korrigieren ist nicht üblich, das Unausgegorene der Normalfall.
Solche Hochgeschwindigkeitsprosa fällt auf einen überwunden geglaubten Ursprung der Sprache zurück – das Geplapper der Horde am Lagerfeuer. Da wird das Kapital an Sprachökonomie vergeudet, das wir den antiken Steinmetzen verdanken: Schrift in Stein zu meißeln ist so mühsam, dass der Pharao die Worte wog, mit denen er sich im Tempelfries zu verewigen wünschte; jede Geschwätzigkeit verbot sich von selbst. Von dort führte eine gerade Linie zur Sprache der Bibel, die in Luthers Version die deutsche Hochsprache begründet hat; auch die raffinierte Wort-Auslese der Lyrik ist ohne die Vorarbeit der Steinmetzen schwer vorstellbar; und in den besten Werbetexten ist sie lebendig geblieben.
3. Vermutlich wiederum durch das spielerische Element begünstigt, macht sich in der E-Mail ein sorgloser Umgang mit Grammatik und Stilistik breit, oft geradezu ein lustvoller Regelbruch – beides in Anlehnung an die mündliche Rede; so ist die Elektropost schon als Zwitter zwischen Geschriebenem und Gesprochenem bezeichnet worden. Das hat, selbst für Sprachkritiker, durchaus Vorzüge: Gestelzter Bürokraten- oder Marketing-Jargon findet da – fand da kaum statt; längst wird auch das herkömmliche PR-Deutsch in die Mail gedrückt, oft in entnervender Menge.
Aber vielleicht hätte ja jener Beamte, der an den Besuchereingang des Reichstags den schönen Satz geschrieben hat: «Wegen Zugerscheinungen muss eine der beiden Türen immer geschlossen bleiben», sich per E-Mail für die schlichte Form entschieden: «Bitte lassen Sie immer eine der beiden Türen zu, sonst zieht’s.»
Neben die kleine Genugtuung tritt ein Kummer bei den Freunden eines gewissen Minimums an Sprachkultur: Die launige Verhohnepipelung der Spielregeln, bedenklich genug, trifft ja in eine Zeit, in der mehr und mehr Schulabsolventen Mühe haben, die Regeln überhaupt noch zu beherrschen (so dass sie oft nicht einmal ihre Verletzung als solche erkennen können). Aus dem Ineinanderfließen dieser beiden Strömungen folgt ein Jargon, der eine ökonomische Verständigung durch präzise Sprache erschwert. Als Netspeak oder Weblish wird er in Amerika verspottet, manche amerikanischen Konzerne erfüllt er mit Sorge, und da die Sprache unser Denken prägt und unsere Kultur transportiert, kann kein denkender Mensch sich darüber freuen.
4. Die Hektik des Büroalltags hat sich durch die E-mail dramatisch verschlimmert. Aus der Allgegenwart des Computers und dem Bewusstsein, dass die Übermittlung sich mit Lichtgeschwindigkeit vollzieht, folgt die Erwartung, ja der Anspruch, die Antwort sollte binnen Minuten, müsse binnen Stunden eintreffen, jedenfalls noch am selben Tag. Es liegt auf der Hand, dass solcher Dauerstress die Sorglosigkeit im Umgang mit Stilistik, Grammatik, Orthographie zusätzlich begünstigt.
5. Nicht genug mit der Überproduktion an oft nur hingestammelten Texten, wird die E-Mail unter Nutzung der elektronischen Möglichkeiten zumeist an fünf-, an zehnmal so viele Adressaten verschickt wie einst der Brief oder die Hausmitteilung– Papier wird ja nicht gebraucht, und der Schreiber hat sich abgesichert: Sage keiner, ich hätte ihn nicht informiert!
In vielen Firmen, Redaktionen, Behörden empfinden die Adressaten, zumal solche in gehobenen Positionen, dies als eine Belästigung. In die Mail-Schwemme nicht einzutauchen, können sie nicht riskieren, und aus dem Urlaub zurückgekehrt, finden sie nicht, wie früher, zehn Hausmitteilungen, sondern hundert E-Mails vor. So hat die Firma Siemens schon 2003 in ihrer Hauszeitschrift gemahnt: «Bei jeder Mail sollte man sich fragen, ob wirklich jeder Empfänger diese Mail benötigt», und mehrere amerikanische Unternehmen haben sich für die interne Kommunikation einen E-Mail-freien Wochentag verordnet.
Die Belästigung kann zur Landplage werden, wenn unverlangte Reklame den Computer verstopft, englisch spam genannt. Mail-Dienste bieten Filter dagegen an, mit unterschiedlichem Erfolg; ein Filter gegen überflüssige PR-Texte und wichtigtuerische Hausmitteilungen dagegen ist nicht in Sicht.
Wo liegt – inmitten all dieses oft hingehudelten, oft unerwünschten Überangebots an Geschriebenem – die Chance für Schreiber, die noch gelesen werden wollen? Dreierlei können sie tun:
sich dieser Inflation in jedem möglichen Grenzfall verweigern
sich, wenn E-Mail, herausheben aus dem Wortmüll durch gedrängte Substanz (nebst antizyklischer Beherzigung aller Regeln der Grammatik)
regelmäßig prüfen, ob nicht ein Fax oder gar ein Brief die bessere Wahl sein könnte – der zunehmenden Seltenheit wegen und weil er dem Adressaten ein leibhaftiges Stück Papier in die Hand legt, einen nobel gestalteten Briefbogen, der Schriftblock eingepasst in gefälligem Design, frei von allem Wirrwarr der Computer-Kürzel. (Unbedingt freilich mit der eigenen E-Mail-Adresse versehen: Denn niemand sollte sich genötigt fühlen, sich für die Antwort ebenfalls des Papiers zu bedienen.)
Im Stil, in der Wortwahl allerdings sollten auch sprachbewusste Schreiber eine Konzession an die E-Mail-Form erwägen. Ein paar Sympathie-Punkte ließen sich vermutlich damit gewinnen, dass der Schreiber sich dem mehr mündlichen Sprachduktus annähert – natürlich in korrekter Grammatik und mit Augenmaß: kriegen statt bekommen zum Beispiel, runter statt herunter, mal statt einmal – und allemal «sonst zieht’s». (mehr in Rezept 40). Dies unbedingt verbunden mit besonders konsequenter Anwendung der Gesetze der Verständlichkeit und der Regeln des attraktiven Deutsch – denn der E-Mail-Leser ist der ungeduldigste, der fluchtbereiteste von allen.
Short Message Service (SMS)
Der Short Message Service ist Stilratschlägen unzugänglich und bedarf ihrer nicht; es könnte aber sein, dass der Umgang mit ihm die Erwartungen verändert, mit denen seine Benutzer den konventionellen Sprachprodukten entgegentreten.
Die 160 möglichen Zeichen wären eigentlich ausreichend für zwei oder drei ganz normale Sätze; weil es aber bis zu siebenmaliges Drücken erfordert, aus den 10Tasten des Handys die 26Buchstaben und dazu die Satzzeichen herauszuholen, regiert ein extremer Telegrammstil, überhöht durch einen Kult der Kürzel wie c u later (see you later) oder rofl (rolling on floor laughing). Dazu tritt gewiss die Lust am Spiel mit diesen, es ist ein Sport, den zu beherrschen Zugehörigkeit beweist. Zwei Folgen: Suchtverhalten mit ruinösen Telefonrechnungen breitet sich aus, und SMS «erhebt Fauldeutsch zur Amtssprache», schrieb 2004 die Weltwoche.
Das Chatten
Die Anonymität dieses Elektronik-Schwatzes wird oft als Einladung zur Selbstinszenierung empfunden, zur spielerischen Lüge, befreit von allen Zwängen bürgerlichen Anstands. So entsteht eine Schnellkommunikation von äußerster Laxheit – man ist ja ungeduldig und haftet für nichts. Obwohl der Chatter für jeden Buchstaben nur einmal zu drücken braucht, feiern die meisten eine ähnliche Orgie der Abkürzungen, vermehrt um Kunstwörter, die oft Züge einer Babysprache haben oder sich an die Sprechblasen der Comics anlehnen: handgeb, kopfschüttel, megaknuddel, luftschnapp.
Was folgt daraus für die Schreiber konventioneller Texte, wenn sie noch auf Leser hoffen? Nie zuvor ist mit der Schrift, einst von Priestern erfunden und verwaltet, ein derart flatterhafter Umgang getrieben worden. Was da mitgeteilt wird, wäre in einem anderen Medium überwiegend der schriftlichen Mitteilung nicht für wert befunden worden; in der Sache also handelt es sich zumeist um redundantes Geplapper.
Doch wie es mitgeteilt wird, in dieser Mischung aus totaler Sorglosigkeit und äußerster Gedrängtheit – das sollte Berufsschreibern wohl drei Einsichten nahe legen: Lange Texte haben es noch schwerer als früher, gelesen zu werden; die Empfindlichkeit gegenüber bombastischen Wörtern steigt (dazu Rezepte 24 bis 28); die Bereitschaft, sich auf komplizierte Satzkonstruktionen einzulassen, sinkt. Schon hat die Kürzelsprache Eingang in die Werbung gefunden: 2BIG 4YOU, inseriert McDonald’s (too big for you). Vielleicht also wird das Drei-Sekunden-Intervall beim Satzbau (in Rezept 3 vorgestellt) bald eine zu hoch angesetzte Obergrenze sein.
Schreiber: Unsere Plage wächst!
IV Ist die Sprache nicht sowieso unlogisch?
Ja, sie ist es – von Vieldeutigkeiten und Widersprüchen schmerzlich durchsetzt. Nur ausnahmsweise sind sie in der Grammatik verwurzelt: «Die Einbrecher erwischten die Polizisten auf frischer Tat», dürfen wir schreiben, falls wir es ertragen, dass die grammatisch nächstliegende Deutung des Satzes lautet, die Einbrecher (Nominativ) hätten die Polizisten ertappt. Für den wahrscheinlicheren Fall, dass die Einbrecher die Erwischten waren (Akkusativ), stellt uns die Grammatik keine unterscheidende Form zur Verfügung. Damit können wir leben; wir sollten lediglich beschließen, einen Satz nur dann mit dem Objekt zu beginnen, wenn es durch seine Form als solches erkennbar wird («Den Einbrechern lauerten die Polizisten…», Rezept 13).
Wer aber in den Wörtern Klarheit sucht, macht peinliche Erfahrungen. Wir bedienen uns eines Mediums, das bei einer Eignungsprüfung «Wie können wir uns optimal verständigen?» ziemlich schlechte Noten bekäme. Zunächst: Viele Wörter, die wir durchaus brauchen könnten, bietet die Sprache uns einfach nicht an, von Wortlücken wird da gesprochen. Einer, der genug gegessen hat, ist satt – was ist einer, der genug getrunken hat? Die «Gesellschaft für deutsche Sprache» hat da 1993 ein Preisausschreiben veranstaltet – vergebens, aber unter anerkennender Nennung des von Robert Gernhardt erfundenen Wortes schmöll.
Fast immer verweigert uns die Sprache die Benennung der Mittellagen: Einer, der nicht lacht und nicht weint, mag ja noch lächeln oder traurig, zornig, finster dreinblicken; der Ausdruck eines typischen U-Bahn-Gesichts jedoch entzieht sich jeder Beschreibung. Zwischen der verschämten Jungfrau und dem unverschämten Erpresser müsste sich die natürliche
Nichtverschämtheit eines Liebespaars formulieren lassen – aber ohne dieses Kunstwort schaffen wir das nicht.