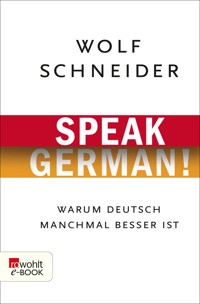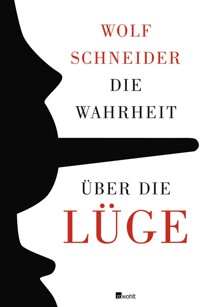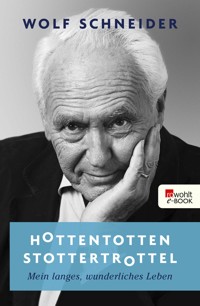9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wer schreibt, möchte auch verstanden werden. Im Zeitalter von Mail und Internet ist das jedoch schwieriger als je zuvor, die Regeln und Formen der Kommunikation werden immer unübersichtlicher. Was aber ein guter, starker Satz ist – das hat sich nicht geändert in tausend Jahren. Es gilt für den Brief und den Blog, die Seminararbeit wie den Geschäftsbericht. Wolf Schneider, «Sprachpapst» und Bestsellerautor, legt mit seinem Werk ein modernes Handbuch des guten Stils vor: In 32 kleinen Schritten zum klaren, verständlichen Deutsch! Anhand zahlreicher Beispiele und in ebenso fröhlicher wie präziser Weise erteilt Schneider unterhaltsame Lektionen: Worauf kommt es beim Textbeginn an? Wie schreibe ich anschaulich? Was ist guter Stil? Worauf muss man bei Mails, Blogs und Twitter achten? Was zeichnet ein erfolgreiches Bewerbungsschreiben aus? Und überhaupt: Wozu eigentlich noch gutes Deutsch?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 186
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Wolf Schneider
Deutsch für junge Profis
Wie man gut und lebendig schreibt
Inhaltsverzeichnis
Wo liegt das Problem?
WAS FÜR ALLE TEXTE GILT:
Das volle Leben
1 Feurig beginnen
2 Also gut: 20 Sekunden!
3 Die Brezeln und der Zimt
4 Nur einen Bruchteil sagen
5 Meistens viel zu viel – manchmal zu wenig
Die Rückkehr des Wortrauschs
6 Die schöne Redundanz
7 Pfeffer und Pfiff
Zwischenbilanz (1)
Das pralle Wort
8 Mit Silben geizen: Yes, we can!
Wortdreimaster
9 Lasst Verben tanzen!
Passiv und falsches Imperfekt
Rote Karte – Gelbe Karte
10 Mit Adjektiven knausern
Schlussverkauf
11 Der Krampf der Synonyme
12 Die Krux mit den Sprachtabus
13 Die Anglomanie
14 Eierkuchen, Leierkasten
Dreizehn bemooste Textbausteine
15 Woran die Zimmerpflanzen sterben
Zwischenbilanz (2)
Der schlanke Satz
16 Phrasen-Leimer am Werk
17 Der schöne Nebensatz
18 Im Hauptsatz ist die Kraft
19 Nach 6 Wörtern: Sense!
20 Der Atem bringt’s
21 Sätze wie Pfeile
22 Anstandshalber sollte man …
23 Mit Kommas Musik machen
Zwischenbilanz (3): Die elf Gebote des Satzbaus
UNTERSCHIEDE – NACH DEM MEDIUM:
24 Fürs Hören schreiben
25 Die Kunst der Rede
Tucholskys «Ratschläge für einen schlechten Redner»
Brillant, aber gemein (Diskussionsbeiträge, in Jahrzehnten aufgespießt)
26 Die (h)eilige Mail
27 Luther und Twitter – Arm in Arm
28 Blogger contra Journalisten
29 Wo wird gelesen?
Satzverhau zerhacken! Aus den «Textstandards» von Spiegel Online
UNTERSCHIEDE – NACH DEM ZWECK:
30 Die nackte Information
«Liebe» – zum Abgewöhnen
31 Doktorarbeit und Bewerbung
«Fleckenoptionen» – zum Liebhaben
32 Ans Werk!
Namen- und Sachregister
Wo liegt das Problem?
Wer schreibt, möchte meistens Leser haben. Aber es wird unendlich viel mehr geschrieben als gelesen. Mails und Briefe haben noch Chancen, weil sie sich an bestimmte Adressaten richten – Blogs, Zeitungsartikel, Pressemitteilungen, Werbetexte landen blind in einer mäßig oder gar nicht interessierten Welt. Sie müssen sich behaupten inmitten von Millionen gedruckter Wörter und der Milliarden, die täglich gemailt, gebloggt, gesimst und getwittert werden. Nicht gelesen zu werden (und schon gar nicht bis zum Schluss) ist ihr bei weitem wahrscheinlichstes Schicksal.
Wer das Unwahrscheinliche schaffen will, der muss sich zwei Einsichten öffnen. Erstens: Der Deutschunterricht hat mich darauf absolut nicht vorbereitet – es reicht nicht, dass die Grammatik stimmt. Ja, stimmen soll sie! Aber gewonnen ist damit noch nichts. Mit perfekter Grammatik lassen sich die scheußlichsten Sätze zimmern – in akademischen, bürokratischen und vielen journalistischen Texten täglich nachzulesen. Auf der Basis der korrekten Grammatik muss ich eine Kunst erlernen, die in der Schule ignoriert worden ist: wie man für Leser schreibt.
Zweitens aber: Ganz ohne Plage geht das nicht. Am Anfang steht die Erkenntnis: Ein Text ist nicht schon deshalb gut, weil er (a) korrekt und (b) von mir ist. «Es trägt Verstand und rechter Sinn mit wenig Kunst sich selber vor»: Dieser Satz ist von Goethe und völlig falsch. Mit wenig Kunst (oder gar von selbst) läuft gar nichts in der Sprache. Auch Goethe hat gefeilt an seinen Texten, und als Bert Brecht der Satz gelungen war «Stell dir vor, es ist Krieg, und keiner geht hin», hatte er ihn möglicherweise herausgemeißelt aus einem Versuch wie diesem: «Man stelle sich vor, dass kriegerische Handlungen in Ermangelung hinlänglicher Teilnehmerzahlen gar nicht stattfinden könnten.»
Goethe und Heine, Kafka und Brecht: Oft und unerschrocken werden sie im Folgenden zitiert. Denn weit mehr als Deutschlehrer oder Professoren der Germanistik, Linguistik und Literaturwissenschaft sind sie es, die uns helfen: Sie hatten den Ehrgeiz, gelesen zu werden – «Wer aber nicht eine Million Leser erwartet, sollte keine Zeile schreiben», sprach Goethe zu Eckermann.
Die Großen wussten auch, wie man das schafft; und sie zeigen: Was ein guter, starker Satz ist – das hat sich in tausend Jahren nicht geändert. Es gilt für die Bibel und den Blog, den Zeitungsartikel wie den Geschäftsbericht. So können die ersten zwei Drittel dieses Buches von den Regeln und Erfahrungssätzen profitieren, die schon Luther beherzigt und eine moderne Wissenschaft abgesichert hat.
Was Sie schreiben, ist Ihre Sache – aber wie Sie es formulieren sollten, damit es die Chance hat, beachtet zu werden, zu wirken, vielleicht sogar Sympathie zu stiften: Das lässt sich lernen. Mit 32Rezepten kommen Sie diesem Ziel schon ziemlich nah – und rasch werden Sie die Heerschar der Einfach-drauflos-Schreiber ebenso hinter sich gelassen haben wie die der verkorksten Germanisten.
Zumal, wenn Sie die Sprache lieben. Nur wer sie umarmt, kann ihr schöne Kinder machen.
WAS FÜR ALLE TEXTE GILT:
Das volle Leben
1Feurig beginnen
«Wir trafen Jesus in der Mittagspause kurz vor der Kreuzigung.» So begann der Stern seinen Bericht über ein Passionsspiel in Florida. Und wer nach diesem ersten Satz den zweiten nicht liest, der ist nicht von dieser Welt. Furios hatte die Illustrierte auf ihre Weise das Problem gelöst, vor dem wir alle stehen, wenn wir uns Leser wünschen – egal, ob für Blogs, Briefe, Prospekte, Artikel oder Bücher: Wer soll das lesen? Wen wünschen wir uns? Und haben wir für ihn den richtigen Köder an der Angel?
Denn ohne Köder widerfährt unserm Text das leider allzu Wahrscheinliche: Gelesen wird er nicht. Meistens ungelesen weggeworfen werden Kundenzeitschriften und Prospekte. Angelesen werden in der Zeitung viele Artikel (falls nicht schon die Überschrift langweilig ist) – zu Ende gelesen die wenigsten. Ganz gelesen werden zuverlässig nur Schulaufsätze, Diplomarbeiten und Erpresserbriefe; schon Liebesbriefe nicht immer.
Diese vier Sonderformen des Geschriebenen aber zielen auf einen einzigen Leser. Der Journalist, der Öffentlichkeitsarbeiter, der Werbetexter möchte Hunderttausende von Lesern haben – und der Blogger ein Echo finden im elektronischen Gewimmel.
Und da sollte ausgerechnet Jesus helfen können? Ja, der aus dem Stern. Als Idealbild nämlich, vor dem ich meinen eigenen ersten Satz auf den Prüfstand stellen sollte: Komme ich diesem Muster wenigstens ein bisschen nahe? Habe ich meinen Ehrgeiz darangesetzt, beim Wettlauf um die Aufmerksamkeit vorn zu liegen? Habe ich mein Vorhaben auf mögliche Pointen abgeklopft? Bin ich bereit, an diesem vielleicht entscheidenden ersten Satz zu feilen – und meinen siebenten Satz nachträglich zum ersten zu machen, wenn ich spüre, dass er der beste ist?
Das setzt voraus, dass der Schreiber von Mails oder Blogs nicht jener Versuchung erliegt, die der Computer bereitstellt: erst mal schreiben – das Denken kommt später oder nie. Wer seinen Text aus dem Ozean des Gedruckten und Gesendeten herausheben will, der kommt an einer uralten Erfahrung nicht vorbei: Denken vor dem Schreiben hat noch keinem geschadet.
Gewiss, bei vielen Mails (Rezept 26) kann man auf ein automatisches Interesse der Empfänger rechnen. Dann aber hat ein klarer, kraftvoller erster Satz immer noch einen wichtigen Vorzug: Der Adressat fühlt sich ohne Umweg informiert; und wenn er das als Ihr Markenzeichen würdigt, dann haben Sie gewonnen.
Wer den Anfang versiebt, der hat verloren. «Wer einen ersten Eindruck machen will, kriegt keine zweite Chance» (You never get a second chance to make a first impression) heißt ein Schlagwort unter Berufsschreibern in den USA, und sie haben recht. Im Grunde verhalten wir uns gegenüber jedem, der um unsere Zuwendung buhlt, so wie einst der berühmte russische Ballett-Impresario Sergej Diaghilew, der sich vor den französischen Dichter, Maler und Designer Jean Cocteau hinsetzte mit den Worten: «Erstaune mich – ich warte.»
Man muss gar nicht mit Jesus ins Haus fallen. «Hast du deinen Arm schon mal in einer Kuh gehabt?», fragte eine Tierärztin eine Fünfzehnjährige, die diesen Beruf ergreifen wollte, und der Bericht darüber begann mit ebendiesem Satz. Und eine Kriminalreportage in der Zeit:
Als ihr das Messer mit einem grässlichen Geräusch in den Rücken fuhr, blieben Barbara R. noch 60Sekunden, um die wahre Natur des Mannes zu erkennen, mit dem sie 35Jahre lang verheiratet gewesen war.
Solche Stoffe, Gott sei Dank, stehen uns selten zur Verfügung. Nur ist dieser erste Satz natürlich nicht aus dem Text herausgesprungen, sondern er wurde raffiniert aus ihm herausgekitzelt. Und mit demselben Ehrgeiz lassen sich Alltagsgeschichten ebenfalls so aufzäumen, dass man weiterlesen möchte: «Wie jeder schlechte Krimi beginnt auch dieser mit dem tragischen Verhältnis eines Polizisten zu seinem Kaffeeapparat» (SZ-Magazin).
Auch ein Blogger sollte darüber nachdenken, wenn er, entgegen aller statistischen Wahrscheinlichkeit, vieltausendfach gelesen werden und sich in der Szene einen Namen machen möchte. Selbst wer gerade beim Zahnarzt gelitten hat, könnte bloggen oder twittern (wie der amerikanische Satiriker Russell Baker): «Der Zahnarzt verbrachte eine Stunde in meinem Unterkiefer» – und hätte sich damit herausgehoben aus dem Gewoge der abgedroschenen Signale.
Das Traurigste, wozu man einen ersten Satz missbrauchen kann, ist eine Binsenweisheit. «Das Internet hat sich zum bedeutenden Informationsmedium entwickelt» musste man noch 2009 als überraschenden Einstieg in einen Vortrag hören. «Wir benutzen immer mehr elektronische Geräte» war auch nicht gerade ein verführerischer Anfang für einen Fachartikel. Die Einsicht, wie viel an möglicher Aufmerksamkeit man da sogleich vergeudet hat, ist überraschend wenig verbreitet – und im akademischen Betrieb weithin geradezu unwillkommen.
Und was können erste Sätze alles leisten, über den Leseanreiz hinaus! Paul Krugman, Nobelpreisträger und Kolumnist der New York Times, war 2009 von einer Studienreise durch China zurückgekehrt – und eröffnete sein Resümee mit dem Paukenschlag: «Ich habe die Zukunft gesehen, und sie wird nicht funktionieren» (I saw the future, and it won’t work). Die Leser sind frappiert, und Manager wünschen sich, sie würden ausschließlich Mails und Vorlagen bekommen, in denen ein komplizierter Sachverhalt sofort auf eine so griffige, erleuchtende Formel gebracht worden ist.
Bosheit, wenn sie passt, kann das Lesevergnügen noch erhöhen. Als Hillary Clinton 2007 gegen Barack Obama um die Präsidentschaftskandidatur kämpfte, begann ein Kommentar der New York Times mit dem herrlich hinterhältigen Satz: «Ehe ich zum ‹Aber!› komme, kann ich versichern, dass Hillary Clinton eine großartige Präsidentin abgeben würde» (Before I get to the ›but!‹, let me say that Hillary Clinton would make a terrific president).
Da fällt einem die frivole Zuspitzung durch den Schriftsteller Wolfgang Hilbig ein: «Mit den ersten Sätzen ist es etwas Ähnliches wie mit einer unverhofften Erektion.»
2Also gut: 20Sekunden!
Wenn der erste Satz sich zäh dahinschleppt, habe ich also den Leser vielleicht schon verjagt. Wirkt er aber nicht direkt abstoßend, so kann der zweite, der dritte Satz noch alles retten: Im Durchschnitt ist das Maß des Gelangweiltseins erst nach 20Sekunden (oder rund 350Zeichen) voll. Praktiker haben das gewittert, wissenschaftliche Studien es bestätigt – mit einer Einschränkung freilich; die steht am Schluss dieses Rezepts.
Kennen Sie den Elevator Check – den Fahrstuhl-Test? Bei McKinsey und in anderen, vor allem amerikanischen Unternehmen stellt man sich vor: Der kleine Angestellte geht schwanger mit einer großen Idee; aber vom Boss empfangen zu werden, sieht er keine Chance. Da trifft er ihn im Lift – und hat nun, realistisch geschätzt, etwa 20Sekunden Zeit, dem Chef seine Idee zu verkaufen; 20Sekunden, unwiderruflich. Dieses Bild soll jeder in der Firma vor Augen haben und als Regel anwenden: Alles, was nach draußen geht, Brief, Mail, Prospekt und Angebot, muss es binnen 20Lesesekunden geschafft haben, dem Adressaten mitzuteilen, worum es sich handelt – und vor allem: warum er weiterlesen soll.
In diesen 20Sekunden oder maximal 350Zeichen oder in zwei, drei Sätzen lässt sich viel erzählen. Zum Beispiel so:
Wie grüßt der Bergwanderer? Kein Problem, denken viele.
Schon falsch.
(Magazin der Süddeutschen Zeitung, 69Zeichen)
Gestern war einer dieser Tage, an denen ich verstanden habe, warum Frauen ihren Männern Strychnin ins Essen rühren. (Katja Kessler, 115)
Oft habe ich mich gefragt, woraus ein Hot Dog eigentlich besteht. Nun weiß ich es. Aber lieber wüsste ich es nicht. (The New Yorker, 115)
Großer Kopf – gescheiter Kopf? Intelligenz muss nicht schwer wiegen. Auf die Dynamik der Hirnentwicklung kommt es an. Können Sie folgen? (Weltwoche, Zürich, 136)
Um fünf Uhr morgens erscholl wie immer der Weckruf: Ein Schlag mit dem Hammer auf eine Eisenschiene an der Stabsbaracke. Schwach drang der unterbrochene Ton durch die zwei Finger dick gefrorenen Scheiben. (Solschenizyn, «Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch», 204)
Wo bleiben die Sondersendungen der Nachtstudios? Warum schweigen die Philosophen? Welcher Bischof ruft zum Dankgebet? Der amerikanische Präsident kündigt eine Welt ohne Kernwaffen an. Und keiner hört hin. (FAZ, 204)
Man muss sich nicht für Rechtsfragen der Haustierhaltung und des Schädlingsbefalls interessieren, um dennoch weiterzulesen, was die Schweizer Ratgeber-Zeitschrift Beobachter so begonnen hat:
Wanzen, Wespen, Würmer sind juristische Leckerbissen. Schon der Hundefloh verursacht Probleme: Ist auch er ein Haustier? Oder vielmehr ein Untermieter? Oder hüpft er gar durch rechtsfreien Raum? (194)
Und wer wollte zum hundertsten Mal von der Überalterung und der dadurch drohenden Rentenkatastrophe lesen, noch dazu eine ganze Sonderseite lang? Die Neue Zürcher Zeitung wahrte ihre Chance, indem sie mit zwei verblüffend erfrischenden Zeilen begann:
Alt werden hat in unserer Gesellschaft einen schlechten Beigeschmack. Mit wohlwollender Zustimmung altern dürfen bei uns nur noch Wein und Käse. (144)
Wer so anfängt, der hat versprochen, dass der ganze Artikel nicht in der gewohnten Routine versacken wird – er animiert zum Lesen!
Und da die Neue Zürcher eine der seriösesten Zeitungen deutscher Sprache und noch dazu die altmodischste von allen ist, riskiere ich den Rat: Wenn dieses Blatt in ein solches Thema mit «Wein und Käse» einsteigt, dann ist überhaupt keine Publikation, kein Text-Angebot, keine Rede vorstellbar, der es nicht gut bekäme, wenn sie ebenfalls den Mut hätte, mit Wein und Käse zu beginnen (Schulaufsätze und Doktorarbeiten ausgenommen – darüber mehr in Rezept 31).
Sich an solche Muster für pfiffigen Journalismus anzulehnen, tut jedem gut, der gelesen werden und noch dazu Sympathie stiften will – für jeden Zweck, in welchem Medium auch immer.
Die 20-Sekunden-Regel hat nur eine Schwäche: Ermittelt worden ist sie vor etwa zwanzig Jahren. Seitdem, so ist zu fürchten, könnte es mit der Geduld potenzieller Leser bergab gegangen sein. Seit Jahrzehnten sinkt ja die Zahl der Siebzehnjährigen, die jemals ein Buch ganz gelesen haben, viele Studenten fluchen über die Zumutung, ein ganzes Buch zu lesen – und durch Kino und Computer werden wir zur Hektik geradezu erzogen. Fünf Indizien:
Ein durchschnittlicher Hollywood-Film von 90Minuten Länge hat heute doppelt so viele Einstellungen wie vor dreißig Jahren.
Im Vorspann amerikanischer, zunehmend auch deutscher Fernsehserien hüpfen die Bilder in einem Zehntel-Sekunden-Tempo, das dem Auge früher niemals zugemutet worden ist.
Immer üblicher wird das Multitasking: Während das Fernsehen läuft und der Wortschwall aus dem Handy nicht enden will, macht sich der Siebzehnjährige am Computer zu schaffen.
Der Teaser im Online-Journalismus (wörtlich: das Neckende, das Verlockende – also der Voraustext, der zur Lektüre des ganzen Angebots verführen soll) ist meist nur 150 bis 250Zeichen lang.
Getwittert werden kann nur in 140Zeichen.
Und das Berliner Online-Magazin «The European» bricht seine Teaser rabiat nach 66Zeichen ab: «Die Geschichte Afghanistans ist reich an Kriegen. Nun kann sich der…»
Einen bemerkenswerten Beitrag zur Kultivierung der Ungeduld hat 2008 die renommierte Werbeagentur Jung von Matt geleistet: Sie lud Bewerber ein, sich in 160Zeichen vorzustellen – «160Zeichen, die dein Leben verändern können».
All dies zusammengenommen muss der Rat an Schreiber, die gelesen werden wollen, wohl lauten:
Nichts geht über einen aufregenden ersten Satz.
Aber 160Zeichen oder 10Sekunden lang haben Sie Zeit, den furiosen ersten Satz anzureichern, auszupolstern.
Nach 20Sekunden oder 350Zeichen jedenfalls ist alles verloren. Anmoderationen im Fernsehen sind oft 30Sekunden lang und folglich schlecht.
Wie schön, dass von den acht Textbeispielen dieses Kapitels fünf auch vor der verschärften 10-Sekunden-Regel bestehen.
3Die Brezeln und der Zimt
In hundert Sprachseminaren habe ich den Test gemacht, und immer hat er funktioniert: «Bitte sagen Sie mir doch mal rasch: Was ist ein Haustier?» Sogleich hagelte es die Zurufe: «Kuh, Hund, Katze, Schwein!» Niemand beantwortete die Frage so, wie sie gestellt war: «Was ist…?» fragte nicht nach Beispielen, sondern nach einer Definition – «Ein Tier, welches…» Doch über diese logische Antwort siegte der übermächtige Wunsch, den abstrakten Oberbegriff sofort ins Konkrete zu verwandeln.
Wir mögen nämlich das Abstrakte nicht, das Theoretische, das Verallgemeinerte – wir lieben das Anschauliche, das Greifbare, das Einzelne. Wir sagen nicht Gemüse, wenn wir Spargel meinen – nicht Niederschläge, wenn es regnet (damit stehen die Meteorologen gegen den Rest der Menschheit allein) – und noch niemals hat einer, der Brezeln kaufen gehen wollte, sich zum Erwerb von Backwaren aus dem Haus begeben (die gibt’s nur für die Bäckerinnung).
Wissenschaftler, Statistiker, Funktionäre, Referenten brauchen das Abstrakte, ja – aber viele sind darin förmlich vernarrt: Bei 0Grad könnte der Meteorologe ja ankündigen, dass es teils regnen, teils schneien werde. Doch seine verdammten «Niederschläge» muss er unterbringen, um uns dann mit dem Zusatz zu trösten, sie würden «teils als Regen, teils als Schnee niedergehen».
Wenn unsereiner eine Mitteilung, einen Blog, einen Artikel unter die Leute bringen will, so tue er das äußerste Gegenteil. «Wenn die Stillehrer sich in einem Punkt einig sind», sagt der Journalist William Strunk in seinem immer wieder aufgelegten Klassiker von 1919 «The Elements of Style», «dann in diesem: Der sicherste Weg, die Aufmerksamkeit des Lesers zu wecken und wachzuhalten, ist der, besonders, bestimmt und konkret zu sein.»
Nehmen wir ein simples Beispiel, singen wir das Lob von Knoblauch und Zimt. Sie sind Gewürze. Was geschieht im Gehirn, wenn ich «Gewürze» lese? Die linke Hirnhälfte fragt «Kenne ich das Wort?» und ist zufrieden. Lese ich aber Zimt, so wird zusätzlich die rechte Hirnhälfte aktiviert, und zwar in derselben Region wie beim Geruch von Zimt. Ich habe also, anders als bei «Gewürze», einen Sinneseindruck, es werden beide Hirnhälften beschäftigt; meine Zuwendung hat sich verdoppelt, der Text hat mich eingefangen.
Daraus folgt: Meine ich «Zimt», so würde ich das kostbare Gut der Aufmerksamkeit verschenken, wenn ich stattdessen «Gewürze» schriebe. Meine ich aber mehrere Gewürze, so sollte ich immer noch überlegen, ob ich es nicht bei «Zimt» oder «Zimt und Knoblauch» bewenden lassen kann, weil sie im Hirn des Lesers so viel mehr bewegen (mit der Stilfigur des Pars pro Toto – nächstes Rezept).
Das Konkrete, das Einzelne bringt selbst dann Gewinn, wenn ich annehmen muss, dass meine Leser es nicht durchweg kennen. Statt zu schreiben «Wir gingen auf einer bunten Bergwiese spazieren» könnte ich (wenn ich es denn wüsste) sagen: «…einer Bergwiese, die war bunt von Akelei, Berghähnlein, Teufelskralle und Vergissmeinnicht.» Was geschieht vermutlich in dem, der das hört oder liest? Die munteren Namen gefallen ihm auch dann, wenn er sie nicht einordnen kann. Und was geschieht bestimmt? Die linke Gehirnhälfte tastet die Wörter ab – so zum Beispiel: «Akelei? Schon mal gehört. Berghähnlein? Nie gehört, aber passt auf die Wiese. Teufelskralle? Na, das ist ja ein Ding! Vergissmeinnicht? Kenn ich, ist blau und weiß.» Viermal rastet für eine Zehntelsekunde Aufmerksamkeit ein – gewonnen!
Fürs konkrete Schreiben freilich muss ich Einzelheiten wirklich kennen – für den Laien ist die Abstraktion also oft eine Nothilfe: Wer Amsel, Drossel, Fink und Star nicht unterscheiden kann, ist mit dem Oberbegriff «Vogel» gut bedient. Auch wo er konkret erzählen könnte, scheut er oft die Mühe, die das macht: «Wir hatten einen lustigen Abend» berichtet sich einfacher, als wenn man ein oder zwei konkrete Beispiele für die Lustigkeit herausgreifen müsste, um das Abstraktum anschaulich zu machen.
Dazu kommt nun oft der falsche, gern als «typisch deutsch» verspottete Respekt vor der amtlichen oder professoralen Ausdrucksweise. Umgekehrt: Sie sollte uns mit Misstrauen erfüllen. Politiker vermeiden das Konkrete gern, weil sie sich nicht festlegen möchten, schon gar nicht im Wahlkampf. Manager sprechen lieber von einer «Reduzierung der Personalkapazitäten im Dienstleistungsbereich», als dass sie Putzfrauen entlassen.
Geisteswissenschaftler brüsten sich mit ihrer Fähigkeit, dem Konkreten das Abstrakte wenigstens vorauszuschicken: «Die interpersonale Kommunikation in Form von Gesprächen mit Verwandten, Bekannten und Kollegen», liest man in einem Fachblatt; hätte der Autor die ersten sechs Wörter weggelassen, so hätte er dasselbe gesagt.
Viele Berufsschreiber– Journalisten, Öffentlichkeitsarbeiter – erkennen häufig das Abstrakte nicht. Sie schreiben beherzt «Die Stadt machte einen verwahrlosten Eindruck» und spüren nicht, dass «verwahrlost» bloß eine abstrakte Schlussfolgerung aus Sinneseindrücken ist, also der rechten Gehirnhälfte nichts anbietet. Die würde tätig, wenn sie erfahren könnte: «Der Putz war in Fladen von den Häusern gefallen, leere Flaschen und Dosen klapperten im Wind, und es stank nach Fäulnis und Urin.» Wer stattdessen «verwahrlost» schreibt, hat seine Leser betrogen (und schon halb verloren); wer zusätzlich «verwahrlost» schreibt, liefert Geschwätz. «Verwahrlost» also schreibt er nie.
Am törichtsten aber verhält sich der Schreiber, wenn er alles Lesevergnügen provokant zerstört, indem er eine Erwartung erst abstrakt weckt und sie dann nicht konkret befriedigt. «Morgen wird es zu ungewöhnlichen Wettererscheinungen kommen» – so bunt treiben es die Meteorologen nicht, sie sprechen dann schon von Hagel und Gewitter. Viele Redakteure aber schreiben so. «Die Rallye-Teilnehmerin gab den Kollegen nützliche Tipps für perfektes Fahrverhalten», liest man da – und kein Tipp folgt!
Eine andere Mitarbeiterzeitung berichtet von «einem speziellen Brainstorming zu Möglichkeiten der Kundenverblüffung, das auf die Kreativität der Teilnehmer zielte» – und kein Wort darüber, wie man Kunden verblüffen kann. Wieder eine andere erzählt von «den extremen topographischen Gegebenheiten des Iran» – und erwähnt nicht das Gebirge, das 5671Meter Höhe erreicht! Und wenn eine Zeitung über die österreichische Außenministerin mitteilt, dass sie in Brüssel «fast alle EU-Kollegen körperlich überragt», so fragen sich tausend Leser um die 1,90Meter, ob das wohl auch für sie gelten würde – und eine Antwort in Zentimetern bekommen sie nicht.
Wirksamer kann man Leser nicht verärgern und verscheuchen. Wer mir einen Witz nicht erzählen will, der soll mir auch nicht sagen, dass er ihn furchtbar komisch findet. Und wie schreibt man konkret? So zum Beispiel:
«Der neue Roboter ist noch nicht ganz so schlau wie ein Toaster, aber doppelt so folgsam wie ein Hund.». (Werbeprospekt)
Quelle kann sich keinen neuen Katalog mehr leisten. (Überschrift der FAZ zur Insolvenz des Versandhauses)
Die Geißel macht Striemen, aber ein böses Maul zerschmettert das Gebein. (Jesus Sirach 28,21)
Ich bin wirklich nur die Maus in deinem großen Haushalt, der man höchstens einmal im Jahr erlauben kann, offen quer über den Teppich zu laufen. (Kafka an seine Freundin Milena)
Der Wind macht die Wolken, dass da Regen ist auf die Äcker, dass da Brot entstehe. Lasst uns jetzt Kinder machen aus Lüsten für das Brot, dass es gefressen werde. (Bert Brecht)
Für unseren Alltag genügt die Faustregel: Man nennt die kleinste Einheit dessen, was man meint. Meint man «Hennen», so schreibt man Hennen – nicht Hühner, nicht Geflügel, nicht Haustiere, nicht Tiere, nicht Lebewesen. Meint man «Hühner und Enten», so sagt man «Hühner und Enten» – nur die Landwirtschaftskammer darf «Geflügel» schreiben. Geht es aber um mehr Federvieh, als man aufzählen kann oder aufzählen möchte, so wählt man das Pars pro Toto. (Von dem gleich mehr.)
4Nur einen Bruchteil sagen
«Kaum macht man mal die Glotze an, wird ein Ei aufgeschlagen.» So verspottete die Süddeutsche Zeitung 2007 die Überzahl der Kochsendungen im Fernsehen. Sie hätte natürlich schreiben können: «Es wird sinnlos viel gekocht».