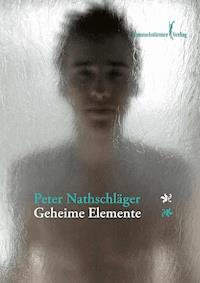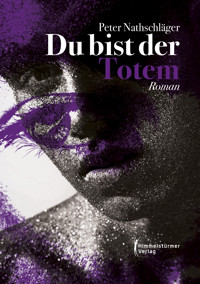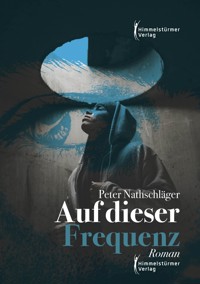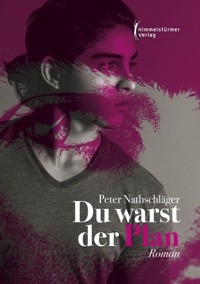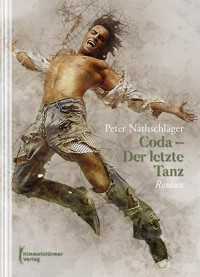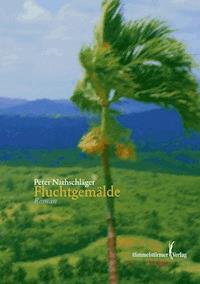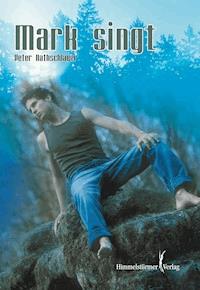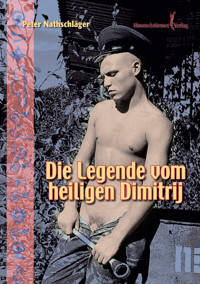Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Größenwahn Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Paolo Meduccini war kein gewöhnlicher Junge. Er sauste mit seinem scheppernden Fahrrad schneller als alle anderen Kinder aus Montaione die toskanischen Hügel hinab, war der Mittelpunkt seiner Clique, träumte fliegen zu können wie ein Flugzeug, roch nach Karamellbonbons und Heu – und immer wieder umhüllte ihn eine seltsame, betrübliche Leere. An einem heißen Sommertag verliebte sich Julia in diesen Jungen, genau an dem Tag, an dem auch der fremde Lucian in Paolos Leben trat. Eine Begegnung mit verheerenden Folgen. Der Sommer 1979 in der Toskana sollte der heißeste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen werden. Ein Sommer, angefüllt mit Träumen, Ölbildern, Geheimnissen, Lügen und der Legende vom Sturmgondoliere, der mit Blitz und Donner gesegelt kommt und die Menschen das Fürchten lehrt. Zehn Jahre später, unter einem ähnlichen Gewitterhimmel, wird Paolo Meduccini in eine Katastrophe und ein Wunder gleichermaßen verwickelt: Als Einziger überlebt er den Absturz eines Flugzeugs beim Landeanflug auf Wien. Aber ist er es wirklich? Oder versucht ein Hochstapler seine Fäden zu ziehen? Die Psychologin Graszyna Zanger und der Ermittler Frank Reinhard folgen einer verwirrenden Spur und ihre Recherchen führen sie in das idyllische Montaione. Was sie dort jedoch entdecken, ist eine Tragödie, die sie an die Grenzen ihrer Vorstellungskraft bringt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 284
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Sturmgondoliere
Die Deutsche Nationalbibliothek – CIP-Einheitsaufnahme.Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet dieses Buchin der Deutschen Nationalbibliografie;detaillierte bibliografische Daten sind im Internet überhttp://dnb.d-nb.de abrufbar.
Erste Auflage März 2016© Größenwahn Verlag Frankfurt am Mainwww.groessenwahn-verlag.deAlle Rechte vorbehalten.ISBN: 978-3-95771-085-7eISBN: 978-3-95771-086-4
Peter Nathschläger
Der Sturmgondoliere
Roman
IMPRESSUM
Der Sturmgondoliere
AutorPeter Nathschläger
SeitengestaltungGrößenwahn Verlag Frankfurt am Main
SchriftenConstantia und Lucida Calligraphy
CovergestaltungMarti O´Sigma
CoverbildTimo Dimitrios Gavridis
LektoratThomas Pregel
Größenwahn Verlag Frankfurt am MainMärz 2016
ISBN: 978-3-95771-085-7eISBN: 978-3-95771-086-4
Meinen ElternundRichard Nathschlägergewidmet
»Das gesamte Leben der menschlichen Seele ist eine Bewegung im Schatten. Wir leben in einem Zwielicht des Bewusstseins, uns nie dessen sicher, was wir sind, oder dessen, was wir zu sein glauben.«
Fernando Pessoa, Das Buch der Unruhe
»Wozu nützt dieses Leben? Die Antwort: Damit Du hier bist. Damit das Leben nicht zu Ende geht. Deine Individualität. Damit das Spiel der Mächte weiterbesteht und Du deinen Vers dazu beitragen kannst.«
Walt Whitman
Der Umriss einer Erinnerung
Am 26. Juli 1979 verliebte sich Julia Varga in einen Jungen, der eigentlich ein Geist war, wie sich später herausstellte. Er war auf einmal da, braun gebrannt und beweglich wie ein Aal, und noch bevor sie seinen Namen kannte, rief sie ihn Indio, weil er aussah wie ein Indianerjunge aus dem Fernsehen, nur mit kurzen, schwarzen Haaren. Sie sah ihn zum ersten Mal, als er auf dem mit verkohltem Unkraut überwachsenen Ascheboden im Hof der Familie Meduccini stand, wie ein Fremder. Hinter ihm rollte ein mächtiges Gewitter durch das goldene Licht der Toskana heran. Neben ihm auf dem Boden lag ein Fahrrad, bereit, mit ihm auf dem Sattel über die Hügel zu fliegen. Die Musik dieses Sommers, die aus kleinen Transistorradios und aus Autos schallte, war »Donna Musica« von I Collage, »Pop Muzik« von M und »Buono Domenica« von Antonello Venditti. Als Julia den Jungen sah, hörte sie in sich die von allen Nebengeräuschen befreite Version von »Donna Musica« und wollte vor Sehnsucht sterben. Julia stand auf einem Feldweg oberhalb der Zufahrt zum verlassenen Hof und sah den Jungen an. Er sah nett aus. Und etwas geheimnisvoll. Fremd.
Sie war Donna Musica, Donna, Donna, Musica tu ... und er war der, der es für sie sang, die Stimme so schön wie sein Gesicht. In ihrer Fantasie wurde die Stimme des Sängers jungenhafter, damit sie zu Indio passte. An diesem frühen Nachmittag, der im Gewitterlicht weite Schatten warf, dachte sie, das Dröhnen eines tief fliegenden Flugzeugs zu hören, aber da war nichts. Die großen Jets flogen anderswo tief, hier jedenfalls nicht, hier gab es nichts zum Landen – ihr Vater sagte gerne, dass hier nur die Weinfliegen tief trudelten. Damit meinte er alle, die nicht wissen, wann sie genug haben. Als sie wieder zum Hof sah, war der fremde Junge samt Fahrrad spurlos verschwunden.
Später in dieser Woche sah sie ihn erneut, als er auf seinem Fahrrad über die Hügel raste, die Arme wie Flugzeugflügel ausgebreitet. Er drehte die Hände locker in den Handgelenken und sah so glücklich aus, dass es ihr ans Herz ging. Als sie ihn am Ende dieser Woche ansprach, erfuhr sie, dass er Paolo hieß, und am Sonntag war sie davon überzeugt, dass sie ihn schon seit immer kannte. Konnte ja auch nicht anders sein, er war ein Junge aus Montaione, und hier kannten sich alle. Er konnte schnell laufen, schneller als alle anderen in seinem Alter, schneller sogar als Samuele, und der war wirklich pfeilschnell. Er lief aufrecht, mit durchgestrecktem Rücken und angewinkelten Armen, die Ellenbogen hochgezogen und breit. Er roch nach Karamellbonbons und Heu, ganz nach Wärme und Badeteich, und Julia erschrak, mit welch sehnsüchtiger Klarheit sie diese Details wahrnahm.
In diesem Sommer schrieb sie einen Brief an ihn. Das Papier hatte sie aus einer Schatulle im Schrank ihrer Mutter genommen, zartgelb mit Blumenwasserzeichen. Sie nutzte einen verregneten Nachmittag, um nach den richtigen Worten zu suchen. Als sie sie gefunden und niedergeschrieben hatte, trocknete sie die Tinte mit der Löschwiege, die sie neben dem Briefpapier im Kasten gefunden hatte, faltete das Blatt sorgfältig und versteckte es unter der Schreibunterlage auf ihrem kleinen Schreibtisch am Fenster. Auf der Oberfläche des Tisches spiegelten sich die am Fenster herablaufenden Regentropfen. Einige Zeit später wanderte der Brief in eine Pappschachtel mit alten Fotos, die ihre Mutter aussortiert hatte. Dort blieb er viele Jahre lang, die Tinte verblasste, das Papier vergilbte. Sie fand ihn erst, als sie das Haus ihrer Eltern verließ und mit ihrem Ehemann in ein kleines Haus im Süden der Stadt zog. Als sie ihn las, an einem Morgen im März des Jahres 1988, konnte sie sich an das reine Gefühl der ersten Liebe erinnern. An die Vollkommenheit des Moments, an die Klarheit, daran, wie wundervoll der Augenblick gewesen war. Aber sie konnte sich nicht an den Paolo erinnern, an den er gerichtet war. Es schien, als wären die Worte in dem Brief von einer Fremden, die sich an etwas erinnerte, das in Wirklichkeit ihr gehörte. Nur ihr. Sie entsann sich der Gefühle, die ihr wie Phantomschmerzen vorkamen. Es gab keine Wunde, nur den Umriss eines Gefühls. Sie las den Brief wieder und wieder, um etwas zu finden, woran sie ihre Erinnerungen festmachen konnte. Sie fand nichts. Um den Namen Paolo Meduccini herum war eine betrübliche Leere, die sie ahnen ließ, dass in dieser Leere etwas Schönes und Kostbares gebettet gewesen war. Sie versuchte, sich ein Gesicht zum Namen vorzustellen. Eine bestimmte Art, sich zu bewegen, eine bestimmte Art, ins Leben zu schauen, an Mundwinkel, die ständig drauf und dran waren, ein Lächeln zu formen – oder ein abenteuerliches Grinsen. Als sie den Brief verfasst hatte, war sie zwölf Jahre alt gewesen, und so, wie sie über ihn geschrieben hatte, musste er in ihrem Alter gewesen sein. Ein Gesicht, dachte sie, ein Blick. Doch da war nur ein wehmütiges Ziehen, ein schöner Gedanke, verloren in der Zeit. Seit diesem Tag bewahrte sie den vergilbten Brief in ihrer Schreibtischlade auf. Von Zeit zu Zeit nahm sie ihn heraus und gönnte sich den Luxus der ziellosen Träumerei. Und was konnte mehr zum Träumen verführen als ein Sommer der Kindheit in der Toskana, gewürzt mit der Sehnsucht der ersten großen Liebe?
Im weißen Raum
Paolos Notizen
»Wovon träumen Sie, Paolo?«, fragt die Psychologin.
Zigarettenrauch, blau im stillen Zimmer. Von draußen drängen die Geräusche des frühen Nachmittags ans Fenster, das Licht fällt zu Boden, von den Jalousien in Scheiben geschnitten. Ich habe meine Zigarette gerade ausgedrückt, langsam und umständlich, die Psychologin mit dem Zungenbrechernamen raucht und hält ihre dünne M’s affektiert vorne beim Filter zwischen den Fingerspitzen, blinzelt wegen des Rauchs, während sie mich ansieht: »Wovon träumen Sie?«
Wäre sie keine Psychologin, würde ich sie für eine Lehrerin halten, die unzählige Unterrichtsjahre an einer Schule für Schwererziehbare und zehntausende Zigaretten im schattigen Eck des Schulhofes hinter sich hat. Sie betrachtet mich aus blauen Augen, kühl und interessiert. Das ist neu. Das Interesse, meine ich – es ist eine andere Art Mitgefühl als das der Journalisten, die mich allesamt schon dutzende Male durch den Fleischwolf gedreht haben.
Ich antworte nach einigem Zögern: »Es ist nicht ein einzelner Traum, der sich wiederholt. Es ist eine Serie von Träumen, und sie werden immer mehr. Und es ist auch nicht ... wissen Sie, es ist nicht der Inhalt der Träume, der mich so irritiert, sondern ihre Wirklichkeit!«
»Was empfinden Sie im Traum oder noch besser: Was empfinden Sie, wenn Sie aufwachen?«
»Trauer. Ich wache auf, und wenn ich mich umsehe, bin ich traurig, weil mir die Träume gefallen. Ich fühle mich wohl, bin voller Tatendrang. Es ist ein Leben, als ob ich in meinen Träumen Erinnerungen wachrufen würde. Als wären sie keine Träume, sondern Erinnerungen an ein Leben, das ich nie gelebt habe. Ich habe Freunde im Traum, bin jung, ein Kind noch, es ist Sommer, diese Art von Sommer, der keine Grenzen kennt außer dem Horizont ...«
»Nennen Sie mir drei Details, Paolo. Nicht nachdenken, los!«
»Weinberge, Kotflügelgeschepper eines Fahrrads, ein aufziehendes Gewitter, erkennbar am dumpfen Poltern und Wetterleuchten.«
»Welche Erinnerungen haben Sie an den Absturz?«
»Ich habe keinen Absturz erlebt. Ich habe ein Leben erlebt.«
»Erzählen Sie mir mehr, Paolo?«
»Ja, Doktor Zanger, das werde ich.«
»Nennen Sie mich Graszyna, bitte.«
»Es ist meine Kindheit. Ich muss davon erzählen, denn ich glaube, ich lebe nur, wenn ich erzähle. Ich muss meine Spuren hinterlassen. Dieses Gefühl ist das Drängendste in mir. Dass ich vergesse und vergessen werde, wenn ich nicht erzähle. Und dass das nicht geschehen darf, solange ich nicht das Gefühl habe, etwas Bestimmtes erledigt zu haben.«
Ich mache eine Pause und sage dann, dem Fenster zugewandt: »Ich glaube manchmal, dass ich den Absturz gar nicht wirklich überlebt habe.«
Doktor Graszyna Zanger sieht mich aufmerksam an: »Sondern?«
»Sondern? Dass ich mit dem Sterben einfach noch nicht fertig bin. Ich lebe nicht wirklich. Ich bin tot, weil ich ... keine Ahnung, weil ich vielleicht mit irgendetwas noch nicht fertig bin. Ich bin tot, verstehen Sie? Was Sie sehen, ist nur ein Geist, Staub, der vorübergehend Gestalt angenommen hat.«
Paolo reitet den Sturm
In der letzten Juliwoche wachte er ein paar Mal vor Morgengrauen auf und fand sich abgekämpft und verschwitzt in seinem Bett. Die Decke halb auf der Matratze, halb auf dem Boden, das Kissen feucht, der Mond tief am Himmel zwischen den Zypressen hinter dem Haus. Im Traum geschah nichts Unheimliches oder etwas, das Furcht und Panik auslöste. Es war vielmehr so, dass er, aus welchem Traum auch immer, in ein Traumszenario glitt, wie eine Hand in einen Handschuh. Er hatte den Eindruck, dass er an der Schwelle, an der der eine Traum endete und der andere begann, beinahe wach wurde, fast um ein Haar. Die Träume waren hell in diesem Sommer, und er erinnerte sich gut. Die einen, die er mochte und nicht fürchtete, zeigten ihm Bilder von wogenden, goldgelben Feldern, überreif und hell, er hörte Samueles Lachen und sah Julia Fioris kirschrot geschminkte Lippen. Er erinnerte sich an Kitzelszenen am Teich mit dem dicken Fabio und wie sie lachten, sich auf dem Boden wälzten, halb ernst, doch immer lachend. Wie Katzen, die fauchten und die Krallen ausfuhren. Sie taumelten aus dieser aus Langeweile geborenen Gewaltbereitschaft heraus zum Spiel zurück, keuchend, schnaufend, oft fluchend – aber sie fanden zurück und lachten voller Abenteuerlust in den Mundwinkeln.
Es waren Sommerferien, und die dauerten ewig, weil man vergaß, die Tage zu zählen. Bis Mitte Juni sagten sie, der Sommer 1978 sei der heißeste, seit es Wetteraufzeichnungen gäbe, doch da wussten sie noch nichts von 1979; das war ein Rekordjahr! Die Oliven und Weinreben reiften zu früh, der Weizen stand schon Mitte Juli golden und reif, das Gras war gelb und grau, die Luft klemmte zwischen den Hügeln, zwischen Olivenplantagen und Weingärten, alles und jeder verkroch sich vor der Hitze in den Häusern oder in den Schatten der Bäume in den Gastgärten der Lokale. Die Tomaten und Paprika aus dem Garten hatten keinen Geschmack und vertrockneten, die Erde war rissig, und obwohl es viele Gewitter gab, trocknete der Boden so schnell, dass man immer eine Staubwolke hinter sich herzuziehen schien, egal ob man langsam ging oder schnell, rannte oder mit dem Fahrrad fuhr. Manchmal stellte er sich vor, Julias Lippen zu küssen, und sie waren im Traum so süß wie Kirschen mit Zuckerguss. Er träumte, etwas Heldenhaftes zu tun oder etwas getan zu haben, das ihn zum Helden machte, der nun gefeiert wird – ohne zu wissen, was es war, das er getan hatte. Alles war verwirrend. Er träumte, in einer Rangelei mit Samuele zu unterliegen, er lag auf dem Rücken und Samuele hockte auf seinem Schoß und drückte mit Siegergrinsen seine Armen nach unten und fixierte ihn auf dem Boden. Und sie sahen sich in die Augen und atmeten und schwiegen und grinsten ein altes, wissendes Grinsen, während Samueles Gesicht immer näher kam, bis sie einander ins Gesicht atmeten und er dachte, sie würden sich küssen. Der Traum war dumm, fand Paolo, mochte ihn aber trotzdem mehr als die kalten Visionen, die sich an die Sommerträume anschlossen.
Er stand in einer hellen Halle. Eine Wand war fast vollständig aus Glas, nur gehalten von weiß lackierten Eisenträgern. Menschen um ihn herum, alle in Bewegung, wie in Zeitlupe. Unheil bahnte sich an, doch er konnte nichts sehen, nichts hören, was auf Kummer schließen ließ. Es war so wie in der Dokumentation über Filmmusik, die er im letzten November gesehen hatte. Lief auf RAI UNO zu Ehren von Ennio Morricones Geburtstag. Es wurde eine Küstenlandschaft gezeigt. Ein Cabrio rollte auf einer Landstraße zwischen blühenden Feldern. Einmal war die Musik schön und sanft und süß, dann war sie wütend und kantig und hart wie ein gefrorener Stein. Die Musik sagte in dieser Szene, auf welche Gefühle und Themen sich das Publikum einstimmen müsste. So ging es ihm in seinen Träumen, nur ohne Soundtrack. Und erst am Freitag begriff er frühmorgens, als er sein verschwitztes Haar rubbelte, dass er sich im Traum auf einem Flughafen befand und die Menschen dort in einer Sprache redeten, die er nicht kannte, die ihm aber sonderbarerweise vertraut war.
Und noch etwas: In diesem Traum war er nicht ein zwölfjähriger Junge, sondern ein junger Mann. Sehr schlank, beinahe knochig, mit dünnen Handgelenken, und einmal, als er im Flughafentraum sein Spiegelbild in der wandhohen Scheibe musterte, erkannte er, dass er schwarzhaarig und um die Zwanzig war. Schmales Gesicht, lange Augenbrauen und lange Wimpern, breiter Mund, sanfte, braune Augen. Der Traum endete, als er eine Frauenstimme sagen hörte: »Über der Stadt geht ein heftiges Gewitter nieder. Es ist fraglich, ob wir überhaupt starten!«
In diesem Sommer, also genau genommen seit jetzt, also Juli oder so, war Paolo Meduccini, der von seinen Freunden Indio gerufen wurde, Kampfpilot. Das Flugzeug war sein Fahrrad, bei dem von Zeit zu Zeit die Kette aus dem Kranz sprang, seine Arme waren die Flügel, und das Sturmtief durch welches er flog, bildeten die endlosen Weizenfelder im späten Juli, die scharfkantig und starr in der windlosen Hitze standen. Paolo überlegte, mit einer ausgetüftelten Mechanik einen Propeller auf der Vorderseite seines Fahrrads anzubringen, und hatte dies auch seinen Freunden Julia, Fabio und Samuele erzählt, die ihn seither aufzogen, weil er nicht und nicht mit den Umbauten begann. Die Frotzeleien waren matt und lustlos wie die Sommertage, die sich endlos dahin zogen. Paolo musste jeden Tag sehr früh aus dem Bett, und er tat so, als ob es ihm zuwider sei, vor dem Morgengrauen aufzustehen, um die Tiere zu versorgen, aber in Wirklichkeit gefiel ihm die ruhige, sich selbst genügende Tätigkeit im Halbdunkel, wenn alles noch schlief und die Luft nachtkühl war. Seinem Vater gehörten zwei Olivenhaine, und er war Teilhaber an einem Weingut. Er war den ganzen Tag und die halbe Nacht draußen, um die Arbeiter anzutreiben, zu kontrollieren und stillzustehen, inmitten seiner Felder, um sich immer wieder ins Bewusstsein zu rufen, was er für die Familie geschaffen hatte – sagte er jedenfalls oft. Paolos Mutter war krank, und ihre Krankheit war das, was sie sich täglich aus dem Kühlschrank holte. Sie war keine Hilfe, sie fiel auch niemandem wirklich zur Last. Sie war da und trank, und dann schlief sie wieder. Einmal am Tag kochte sie, und wenn sie das tat, schmeckte es gut. Sie lächelte wenig, aber wenn sie lächelte, war für den Moment alles in Ordnung. Trotz alledem verhielten sich seine Eltern wie Geister im Haus und hinterließen keine Spuren. Sie lebten ihr hauchdünnes Leben in einem Nebel, der sie von ihm trennte und den er nicht verstand.
In diesen Tagen des Sommers 1979 stand seine Mutter beinahe jeden Tag schon um halb vier Uhr auf und richtete ihm ein Frühstück. Er bekam entweder kalten Kakao und Grießkoch mit Ovomaltine drauf oder eine Schale Malzkaffee und Spiegeleier mit Schinken. Der Malzkaffee schmeckte ihm nicht, gab ihm aber das Gefühl, erwachsen zu sein, ein Arbeiter, der früh aufsteht und sich ans Werk macht. Er wusste nicht, ob sie arm oder reich waren oder einfach so wie alle; zu Essen gab es jeden Tag, und es gab immer reichlich. Paolos Vater war ein einsilbiger Mann mit hartem Gesicht, weichem Herz und unerschöpflicher Energie. Im vorigen Sommer war Paolo ein Kriegsheld gewesen, doch seitdem ihm sein Vater im Herbst erzählt hatte, was der Krieg wirklich sei und dass es keine Helden im Gefecht gäbe, sondern nur Tote, Geister und Überlebende, die vor Kummer wahnsinnig würden, hatte er diese Heldenträume versenkt. Jetzt war Paolo dreizehn Jahre alt und ein Teufelskerl von Pilot, der wilde Manöver durch sich hoch auftürmende Wolkenberge flog und dabei die Sturmdämonen anschrie. Er war sommerbraun und roch nach Schweiß und Stroh, seine bleiche Jeans war an den Knien abgeschnitten und die Sandalen aus Plastik. Er radelte auf den gestampften Feldwegen zwischen den Weinbergen und Olivenhainen, brauste durch die scharf umrissenen Schatten der hohen Zypressen, breitete die Arme aus und flog verwegen und grinste froh mit einer Ähre im rechten Mundwinkel. Manchmal war er so glücklich, dass er sang: »Donna, Donna, Musica tu ...«
Oben am Hügel blieb er stehen, beobachtete den Tanz der Schmetterlinge und dachte an das Schmetterlingsbuch unten im Haus, im Zimmer: da ein Wandergelbling, hier ein paar Zitronenfalter, dort eine Handvoll luftige Tagpfauenaugen. Widerwillig wandte er den Blick ab und spähte hinunter in die Talsenke, wo sein Elternhaus stand. Er hielt sich die Hand über die Augen und schaute zum Hof. Er fluchte, denn Julia war da, er sah sie deutlich auf dem von Sträuchern und Blumenbeeten eingefassten Kiesplatz vor dem Haupthaus. Sie stand neben ihrem auf dem Boden liegenden Fahrrad. Bis zum Frühjahr war sie seine beste Freundin gewesen. Sie kannten sich seit immer schon, aber seit einiger Zeit machte sie ihm merkwürdige Komplimente und kicherte. Früher hatte sie schallend gelacht, war auf Bäume geklettert und kannte ein paar ganz schön üble Schimpfworte von ihrem Vater, dem die Mühle gehörte. Jetzt klimperte sie ihn mit den Augen an, schlug die Hand vor den Mund und machte einen Kussmund nach dem anderen. Paolo ertappte sich bei dem Gedanken, dass es vielleicht doch aufregend sein könnte, ihre Lippen auf seinen zu spüren, nur kurz, rein freundschaftlich, aber dann schüttelte er den Kopf und spuckte männlich auf den Boden – diese blöden Gefühlsduseleien! Fabio und Samuele waren jetzt wahrscheinlich bei dem kühlen Teich hinter dem verlassenen Haus, einer Ruine, bei der sie sich trafen und über die Zukunft der Welt sprachen, über die utopischen Romane, die sie im Licht ihrer Taschenlampen unter dem freien Himmel lasen und tauschten, und um heimlich eine Zigarette zu rauchen. Nie mehr als eine. Eltern hatten einen sechsten Sinn für so etwas, also zum Beispiel wenn Kinder eine Zigarette geraucht hatten. Da half weder Milch noch Kaugummi. Irgendwie kriegten die es immer raus, und wenn sie es rauskriegten, setzte es was. Paolo fürchtete die harte Hand seines Vaters. Er hatte mit dem Unsinn gleich wieder aufgehört, nachdem ihm sein Vater auf den Kopf zugesagt hatte, er hätte geraucht, obwohl Paolo auf Anraten von Samuele einen halben Liter Milch getrunken hatte, um den Rauchgeruch aus dem Mund zu bekommen; nichts half, wenn man Rauch eingeatmet hatte, gar nichts! Paolo hatte geleugnet und Vater es mit fünf Hieben mit dem Ledergürtel geregelt. Paolo fand Rauchen jetzt dumm. Und kindisch. Julia rauchte auch heimlich, und wenn sie das tat, versuchte sie dabei auszusehen wie eine der Schauspielerinnen, die man in den Filmen sah, die Samstagabend auf dem Dorfplatz auf die Rückwand der Kirche projiziert wurden. Das hieß wirklich so: projiziert. Das hatte ihm der Filmvorführer gesagt, der, stets rauchend und gelangweilt, hinter dem Projektor saß und jungen Frauen auf unangenehme Weise nachblickte. Es war eine der Besonderheiten von Montaione, für die Paolo den Ort auf dem Hügel so liebte: diese Hinwendung zu Nostalgie und Gemeinsamkeit. Es gab ein Kino im Nachbarort, in Castelfiorentino, aber die Leute holten lieber die alten Holzstühle aus der Trattoria, die Fabios Vater gehörte, reihten sie auf dem Platz und sahen sich alte Filme mit Sophia Loren und Monsieur Hulot, Jean Paul Belmondo und Yves Montand im Freien an, während sie tratschten, rauchten und Wein tranken. Für Paolo war es das Größte, an solchen Abenden mit seinen Freunden, mit einer Glasflasche Coca Cola in der Hand, die herrlich kalt war, am Platz herumzustreunen, die hallenden, blechernen Stimmen der Schauspieler aus den aufgestellten Lautsprechern zu hören, das Getratsche der Menge, das Geschiebe der Stühle auf dem Kopfsteinpflaster. In diesen Momenten fühlte sich das Leben für ihn perfekt an. Manchmal gab es Bud Spencer- und Terence Hill-Filme oder die mit Giuliano Gemma und Ricky Bruch. Die Sprüche der Stars kannten er, Fabio und Samuele auswendig. »Mir hängt da eine Frage im Gebeiß«, war einer von Paolos Lieblingssprüchen von Tony Curtis aus der Serie »Die Zwei«. Oder Terence Hill in »Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle«: »So wie du sah mein Opa immer aus, wenn er Holz holen musste!« Da kugelten sie sich auf dem Boden und lachten so laut, dass die Leute, die den Film sehen wollten, »Pscht!« zischten.
Paolo wollte sein Flugzeug zur Heimatbasis fliegen, aber Julia war da. Und er wollte ihr nicht in die Arme fliegen. Seit etwa einer Woche war sie so richtig komisch, schminkte sie sich die Lippen und machte irgendetwas mit den Augen, damit sie größer aussahen. Der Mund sah aus wie eine Wunde, durch die man in große Schwierigkeiten geraten konnte. Schlimm war, dass ihre Änderungen ein summendes Ziehen in ihm auslösten, so, als ob das schon seine Richtigkeit hätte und er diese Richtigkeit nur noch nicht wahrhaben wollte. Julia stand neben ihrem Fahrrad auf dem gestampften Platz vor dem Haus, hielt die Hände seitlich an den Mund und rief nach ihm. Er hörte ihr Rufen, leise und weit weg. Er wandte sich ab und sah gen Süden. Dahinziehende Wolken warfen kühlende Schatten. Wind frischte auf, Paolo spürte ein sanftes Ziehen in seinen schwarzen Haaren, das rote Poloshirt flatterte. Wind. Wolken, ein Gewitter, das die Hitze von der Landschaft waschen würde? Er führte einen Tanz auf, schwang sich auf das Fahrrad und rollte bergab nach Süden, um Fabio und Samuele am Teich zu treffen.
Julia stand unschlüssig neben ihrem Fahrrad, das sie umgeworfen hatte, in der Hoffnung, das Scheppern würde Paolo hervorlocken. Niemand war hier. Sie fühlte sich unerklärlicherweise den Tränen nahe und wollte schon mit einem Fuß auf den Boden stampfen, als sie oben auf dem Hügel einen Lichtreflex sah. Wolken zogen turmhoch und grau über den toskanischen Himmel wie Schiffe. War er da oben? Ihre Mutter hatte vor zwei Wochen zu ihr gesagt, dass die Regel bei ihr wirklich sehr früh dran sei. Sie sei ja noch ein Kind, ihr Kind, aber Gott würde sich nie irren, und so sei das gewiss in Ordnung, wenn sie jetzt eine Frau würde.
Sie fuhr langsam zwischen den hellgelben Feldern dahin, den Hügel hinauf und hielt dort, wo sie zuvor den Lichtreflex gesehen hatte. Hier war niemand außer dem Wind in den Feldern und im Himmel, der die Wolken vor sich her schob. Zum Teich musste sie nur geradeaus weiterfahren, zehn Minuten durch die böige Hitze des Julinachmittags, die Langeweile. Paolo war gewiss dort, schlug Mücken tot und kaute auf einem Halm, die Füße im Wasser. Oder er prügelte sich so zum Spaß mit einem seiner Freunde, am liebsten raufte er mit Samuele. Sie rauften nicht wirklich, sie balgten wie Kätzchen, und wenn sie das taten, staubte und wirbelte es und hinter ihren ernsten und kampfbereiten Gesichtern lauerte kindisches Gelächter. Sie drehte sich einmal im Kreis, überblickte die überreife Landschaft; die Zypressen warfen lange, scharfe Schatten auf die goldgelben Felder, die hohen, schlanken Bäume der Windschutzgürtel oben auf den Hügeln waren tiefgrün und verneigten sich im Wind, die Olivenplantagen und Weizenfelder rund um das Haus der Meduccini glänzten silbrig und mattgrün. Sie schwang sich wieder auf das Fahrrad, als sie im Osten eine dunkle Bewegung wahrnahm. Dort unten, weiter drüben, halb auf dem nächsten Hügel, ging eine Gestalt und trug ein merkwürdiges Gestell unter dem Arm. Wer war denn das? Der Schatten auf dem Hügelkamm vor den wogenden Ähren war zu fern, um erkannt zu werden, aber er schritt rasch und zielstrebig aus. Es waren jugendliche Schritte, keine alten. Julia war sich kurz nicht im Klaren darüber, was sie nun tun wollte. Sie schüttelte den Kopf, wie um einen Traum loszuwerden, dann fuhr sie los, und als sie schnell genug war, ließ sie den Lenker los und breitete die Arme aus, wie um zu fliegen, so, wie es Paolo machte, und drehte die Arme sanft, um den Auftrieb zu spüren.
Sie hörte die Jungs schon von weitem. Sie grölten das Lied »Mama Leone« mit einem ganz und gar nicht stubenreinen Text. Sie kicherte und spürte Hitze im Gesicht. Mama Leone, der Papa geht ohne Unterhose ins Schlafgemach, und dort sticht er wie eine Biene, und die Mama, die macht Ach! Das Ach übertrieben sie, indem sie im Falsett schrien und dann in haltloses Gelächter ausbrachen. Fabio und Samuele sahen aus, als hätten sie gerangelt, denn sie waren verschwitzt und voller Staub, ihre Augen wild, weit offen und funkelnd. Sie lachten übermütig und wiederholten die obszöne Textzeile. Paolo saß mit dem Rücken zu ihr auf dem Steg, den ein paar ältere Jungs vor vielen Jahren gezimmert hatten, und sah auf das vom Wind aufgewühlte Wasser hinaus. Er trug ein rotes Polo-Shirt, das ihm zu weit war, und abgeschnittene, hellblaue Jeans. Fabio und Samuele sangen und taten so, als ob sie betrunken seien, Paolo schwieg und sah aus wie der Mittelpunkt der Welt. Fand Julia. Wahrscheinlich sah er in Wirklichkeit nur wie ein Junge aus, der mit gekrümmtem Rücken auf einem wackeligen Steg saß und den Himmel prüfte, während seine nackten Beine kreisrunde Wellen in den Teich strichen. Als er das Klappern ihres blechernen Kotflügels hörte, drehte er sich langsam um und sah sie einen Moment nachdenklich an. Dann lächelte er nett und fragte: »Du warst vorhin unten beim Hof? Ich hab dich vom Hügel aus gesehen.« Er deutete mit dem Kinn auf die Kuppe des höchsten Hügels der Umgebung, von dem aus man fast alle Höfe und die Stadt Montaione sehen konnte. Sie nickte. »Oh, gut. War Mama zu Hause? Oder Papa?«
Sie schüttelte den Kopf: »Ich habe niemand gesehen, alles war still. Vielleicht schlafen sie ja?«
»Ja. Vielleicht.« Paolo zuckte mit den Schultern, als ob es ihm egal wäre, ob seine Mutter schlief oder nicht. Aber Julia sah, dass sich seine Mundwinkel nach unten zogen und dass es ihm eben nicht egal war, ob sie schlief oder nicht. Sie saßen eine Weile ohne zu reden nebeneinander auf dem Steg und blickten in den Himmel. Die Wolken rieben aneinander und verbanden sich, und weit weg war dumpfes Grollen zu hören. Die Luft roch nach Gewitter, die Windböen waren warm und trocken. Um sie herum raschelten und rauschten das Getreide und das hohe, wilde Gras wie eine Meeresbrandung. Julia fragte: »Was machen wir? Hier ist es fad.«
Fabio antwortete gelangweilt: »Es ist überall öd, überall. In Rom vielleicht nicht oder in einer anderen urgroßen Stadt. Oder sonst irgendwo auf der Welt. Aber hier und überall, wo wir hinsehen können, ist es fad, fad, fad, fad.« Er spuckte aus. Paolo murrte: »Ich gehe ins Wasser, mir ist heiß.«
Samuele stand auf und klopfte sich den Staub von der kurzen Hose. Seine Socken waren nach unten gerutscht und hatten sich um die Fußknöchel gewickelt. Niemand außer Samuele trug Socken im Sommer. Paolo wusste, warum er sie anhatte, und Julia und Fabio wussten es auch. Eigentlich war es allgemein bekannt, aber keiner sprach darüber. Das tat man nicht. Es war, weil Samuele Brandmale auf den Fußrücken hatte, denn ihm war als Kind ein Topf mit kochendem Wasser vom Herd gefallen. Das Wasser, dampfend heiß, war auf seine Füße gespritzt und hatte die Haut vollkommen verbrüht. Samuele erzählte gerne, dass ihn seine Mutter in das Krankenhaus gefahren und dass er geschrien hätte wie am Spieß. In den letzten Wochen, nein, in den letzten Monaten, ungefähr seit Mai, redete er nicht mehr darüber. Es war ihm peinlich, und weil Paolo das irgendwie verstand, brachte er auch nicht mehr die Rede drauf, auf Socken, Brandmale und auf Geschrei wie am Spieß. Samuele krächzte in den letzten Wochen, und wenn er sich aufregte, machte seine Stimme lustige Saltos. Paolo hatte seine Mutter gefragt, ob Samuele vielleicht krank sei, ob die Sache mit seiner Stimme etwas mit seinen Verbrennungen zu tun habe. Sie lachte und erklärte ihm, dass Samuele nun ein Mann würde und dass er offensichtlich im Stimmbruch sei. Paolo sagte zu ihr, er hoffe, dass er das niemals sein würde, denn Samueles Gekrächze sei absolut und ganz und gar nicht auszuhalten. Sie hatte ihn liebevoll angesehen, zwischen zwei Schlucken aus dem Weinglas, und den Kopf geschüttelt: »Ihr Jungs müsst alle da durch. Vom Pfeil zum Mann.«
Deswegen sagte Paolo auch nichts mehr wegen Samueles krächzender, brechender Stimme. Wogegen er schon etwas sagen würde, war die merkwürdige Emsigkeit, die er bei seinem besten Freund in letzter Zeit feststellte. Er wusste noch nicht, dass es für das, was er an Samuele bemerkte, eine Bezeichnung gab. Er spürte, dass etwas mit ihm nicht stimmte und dass das, was mit ihm nicht stimmte, früher oder später dazu führen würde, dass sie keine Freunde mehr sein konnten, sein würden. Paolo nannte es Samueles Hetzerei. Erwachsene hätten es wohl kriminelle Energie genannt.
Samuele sagte: »Noch ’ne halbe Stunde, dann pisst’s hier wie verrückt.«
Julia nickte: »Und donnert und blitzt.«
Paolo: »Also?«
Fabio warf ein: »Wir gehen zu Renatos Limogeschäft. Wir können uns unter das Dach setzen und warten, bis es vorbei ist.«
Die anderen nickten. Paolo antwortete: »Renato ist krank, der Laden ist zu.«
Der Wind frischte auf, wurde beharrlicher und kühl. Das sanfte Rauschen der Weizenfelder steigerte sich zu einem wallenden Rollen. Samuele kicherte: »Genau deshalb. Keiner auf den Straßen, niemand beim Laden. Wir brechen ein und holen uns Limo. Und Lire. Der hat sicher was in der Lade.«
»Scheiße, nein!«, entfuhr es Paolo, und er schlug entsetzt die Hand vor den Mund, kicherte aber. Donner grollte, Blitze fuhren fahl hinter den Wolken durch den Nachmittag.
»Na, was jetzt?«, fuhr Samuele hoch, und jetzt krächzte er nicht, sondern seine Stimme klang bedrohlich heiser und drohend.
Fabio stand auf und ging zu Samuele: »Ich gehe mit. Hier ist sowieso gleich Badeschluss.«
Julia sah Paolo an. Er zwinkerte ihr zu und sprang ins Wasser. Als er auftauchte, hörte er Samuele fluchen: »So ein Trottel.«
Julia hatte sich zu Samuele gesellt, stellte ein Bein vor und sagte: »Ich gehe mit ihnen mit. Und du?«
Paolo zog sich mühelos an der Stegkante hoch, setzte sich auf das roh gezimmerte Holz und schüttelte das Wasser aus den schwarzen Locken: »Geht nur. Ich fahr heim. Muss noch was in der Küche helfen. Ihr kennt ja Mama.«
Sie nickten nicht, aber sie wussten, was er meinte. Und weil er Paolo war und weil sie ihn mochten, sagten sie auch nichts Schnippisches. Es würde zu nichts führen außer zu Ärger und Missstimmung. Jeder wusste über die Eltern und die Geschwister der anderen etwas zu sagen. Das machte Freunde aus. Freunde wissen alles und tun einem deswegen nicht weh.
Er wartete, bis sie weg waren, dann zog er sich rasch nackt aus und wrang Hemd und Polo aus, bis sie nicht mehr nass waren, sondern nur noch feucht. Der Wind war fast ein Sturm. Die Wolken glitten wie gespenstische Heerscharen über den Himmel, das Gedonner kam näher und wurde heller, ein funkelndes Krachen über den toskanischen Hügeln. Er zog die verknitterten und klammen Sachen an, fröstelte kurz und setzte sich auf sein Fahrrad. Er flüsterte grimmig: »Ich reite den Sturm.«
Der kubanische Maler
Das tat er, als er hügelabwärts auf das Gut zu rollte, die Arme links und rechts ausstreckte und als Speerspitze unter dem Gewitter einher raste. Kurz bevor er die fünfhundert Meter lange Zufahrt zwischen den Olivenhainen zum Hof erreichte, sah er eine schwarz gekleidete Gestalt auf dem Feldweg stehen. Der Wind zerrte an ihm und an den Haaren, die Kleidung flatterte. Er war jung, die Haut war dunkler als die eines Toskaners, die Augen hatten die Farbe von Tropfen, die sich gerade von der Wolkenunterseite lösten. Paolo, voll auf die Pedalbremse tretend, riss den Lenker nach rechts und kam staubend und Kies verspritzend zum Stehen.
Kurz war es unheimlich still, zwischen zwei Atemzügen, zwei Windböen, zwischen zwei Donnerschlägen. Sie sahen sich an. Paolos Herz raste. Der fremde Junge musterte ihn ohne jede Regung und ohne jede Scheu, aber auch freundlich, nicht herausfordernd. Er war vielleicht drei oder vier Jahre älter als Paolo und er sah exotisch und doch vertraut aus.
Der fremde Junge sagte, kurz vor einem hellen Donnerschlag: »Hallo du.« Seine Stimme klang staubig und sanft.
Paolo nickte und rief in den Krach: »Hallo. Wer bist du? Du bist nicht von hier, was?«
Der Fremde schüttelte den Kopf und antwortete: »Ich heiße Lucian Pereira. Und nein, ich bin nicht von hier!«
Paolo stieg vom Rad und schob es neben sich her auf den Fremden zu.
»Lucian also? Ich heiße Paolo. Woher kommst du? Willst du mit zu mir kommen? Es regnet bald! Es wird stark regnen, vielleicht sogar hageln!«
»Ich bin Kubaner, aus Santiago de Cuba. Mein Vater arbeitet für die Regierung in Rom. Also als Kulturattaché für die Botschaft. Ich bin mit Mama hier auf Sommerferien; Mama fährt gern rum. Ich will malen, siehst du?« Lucian deutete auf das zusammengeklappte Gestänge und den Rahmen. In der Hand hatte er eine harte Papprolle mit Plastikdeckel an den Enden. Paolo vermutete, dass er darin entweder bemaltes Papier hatte oder, was noch aufregender erschien, weißen Karton, unbefleckt, bereit, ein toskanisches Bild auf sich zu laden. »Aus Kuba? Echt? Du malst?«
Lucian nickte. Und in diesem Moment beschloss Paolo, dass er ihn nach Hause einladen musste. Er wollte ihm Limonade anbieten und vielleicht ein Brot mit Käse und Tomaten, leicht gesalzen. Er rief: »Komm mit. Ins Trockene. Aber schnell, wir haben noch ein gutes Stück diesen Weg da runter.«
Lucian deutete auf das auf einem sanften Hügel stehende Gehöft: »Da hin?«