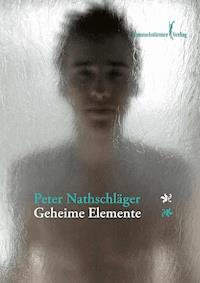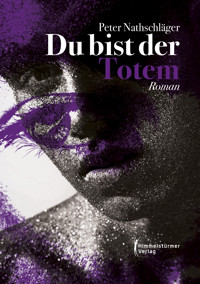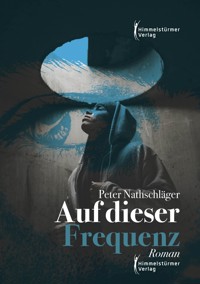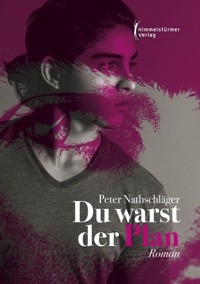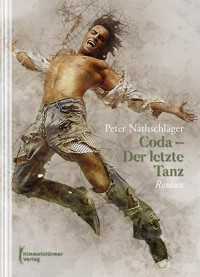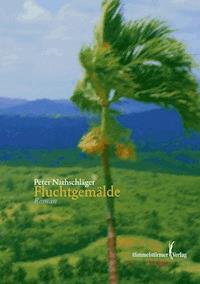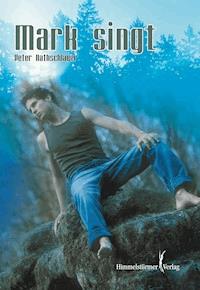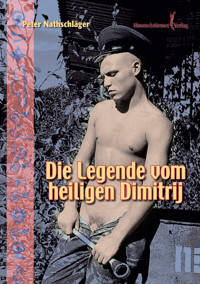Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Himmelstürmer
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Drei Jugendliche überwältigen und foltern einen jungen Camper, der zur falschen Zeit am falschen Ort war, und fesseln ihn mit Stacheldraht an den Begrenzungspfosten eines Weidegrundstücks.Nach einem Unwetter findet der alte Schriftsteller Robert Walden den schwer verletzten Jungen. Er bringt ihn in sein Farmhaus am Fuße des Glacier National Parks und beschließt, sich um ihn zu kümmern, da er keine Möglichkeit hat, mit der Außenwelt Kontakt aufzunehmen, oder den Schwerverletzten in ein Krankenhaus zu bringen.Während in der Stadt Helfer zusammengetrommelt werden, um Patrick, den verschwundenen Sohn von Mark Fletcher zu suchen, entwickelt sich zwischen dem Schriftsteller und dem Jungen eine Freundschaft, die bald von tragischen Ereignissen überschattetwird. Patrick verliert immer öfter das Bewusstsein und wird von Visionen heimgesucht - Erinnerungen an das, was er falsch gemacht hat, aber auch Erinnerungen an seine jungenhafte Liebe zu seinem besten Freund Caio.Ein erschütternder Roman über Freundschaft, Liebe undTod........................................................................................................Peter Nathschläger:Die vorliegende Geschichte, eine Art kurzer Roman, bildet den Abschluss meiner 'Montana' Trilogie, die mit 'Dunkle Flüsse' begann, mit 'Es gibt keine UFOs über Montana' fortgesetzt wurde und nun mit 'Patrick's Landing' beendet wird. Ich wollte noch etwas länger in Montana bleiben, weil die landschaftliche Kulisse einfach gigantisch ist. Ich wollte in Helena bleiben und ich wollte noch einmal Robert Walden begegnen. Vielleicht sogar David Schneiderund Mark Fletcher. Ich wollte erzählen, dass Robert Walden und Walter Crown tatsächlich miteinander alt geworden sind. Und ich machte mich wirklich ambitioniert ans Werk, diese Geschichte aus dem Acker zu befreien. Das Problem war: Je tiefer ich grub, desto tragischer wurde die Geschichte. Und ich dachte: Himmel, dass kann ich so nicht schreiben. Das ist schlimm - echt schlimm. Aber die Geschichte verlangte von mir, so erzählt zu werden, wie ich sie vor mir sah: Schreib die Wahrheit, sagte sie zu mir.Und das tat ich. Und es ist, wie ich finde, ein würdiger Abschlussfür die kleine Trilogie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 203
Veröffentlichungsjahr: 2006
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Peter Nathschläger
Patrick's Landing
Roman
Himmelstürmer Verlag
eBookMedia.biz
© Himmelstürmer Verlag
eBook ISBN EPUB: 978-3-942441-00-1
Danksagung:
Ich möchte mich an dieser Stelle sehr herzlich bei zwei Menschen bedanken, ohne die das Buch nicht so geworden wäre, wie es vor Ihnen liegt:
Richard: Danke, dass es Dich gibt. Die Welt ist viel interessanter mit Dir – und viel lebenswerter. Danke, dass Du mir immer die Zeit und den Platz frei schaufelst, um zu schreiben.
Und vielen Dank an Anke Störmer, die mich unermüdlich beraten und unterstützt hat, während ich das Manuskript verfasst habe.
Vorwort:
Manchmal werden Autoren gefragt: Warum hast Du dieses Buch geschrieben? Oder jenes? Warum schreibst Du überhaupt? Hast Du um Himmels Willen nichts ... Besseres zu tun?
Wenn mir diese Frage gestellt wird, kann ich normalerweise nur beschämt grinsen und mit den Schultern zucken. Ich weiß es nicht. Meistens jedenfalls.
Manchmal ist einfach eine Geschichte da und schreit mich an: Erzähl mich! Tu was! Sitz da nicht so dämlich rum. Ich nehme dann meine Werkzeuge und beginne, die Geschichte auszugraben. Schicht für Schicht. Mal mit Hacke und Schaufel, dann wieder mit Pinsel und Pinzette.
Die vorliegende Geschichte, eine Art kurzer Roman, bildet den Abschluss meiner „Montana“ Trilogie, die mit „Dunkle Flüsse“ begann, mit „Es gibt keine UFOs über Montana“ fortgesetzt wurde und nun mit „Patrick’s Landing beendet wird. Ich wollte noch etwas länger in Montana bleiben, weil die landschaftliche Kulisse einfach gigantisch ist. Ich wollte in Helena bleiben und ich wollte noch einmal Robert Walden begegnen. Vielleicht sogar David Schneider und Mark Fletcher. Ich wollte erzählen, dass Robert Walden und Walter Crown tatsächlich miteinander alt geworden sind. Und ich machte mich wirklich ambitioniert ans Werk, diese Geschichte aus dem Acker zu befreien. Das Problem war: Je tiefer ich grub, desto tragischer wurde die Geschichte. Und ich dachte: Himmel, dass kann ich so nicht schreiben. Das ist schlimm – echt schlimm. Aber die Geschichte verlangte von mir, so erzählt zu werden, wie ich sie vor mir sah: Schreib die Wahrheit, sagte sie zu mir. Und das tat ich. Ich habe mich bemüht, alles wegzulassen, was nicht der Geschichte dient. Es ist ein kurzer und harter Roman über Freundschaft, Liebe und Tod. Und es ist, wie ich finde, ein würdiger Abschluss für die kleine Trilogie.
Alle Geschichten sind hiermit zu Ende erzählt, nichts ist mehr offen. Und ich kann das Kapitel „Montana“ zuklappen und mich neuen Themen widmen.
Was allerdings nichts daran ändert, dass es mir noch nie so schwer gefallen ist, mich von meinen Figuren, den Protagonisten und Antagonisten, den Statisten und den Bufforollen zu verabschieden.
Inhalt
30. Juni 2034
Das machte Robert Walden schon seit Ewigkeiten so: Er stand um vier Uhr früh auf, wusch sich mit kaltem Wasser das Gesicht und die Achseln, zog sich an und frühstückte. Er brühte schwarzen Kaffee auf und röstete sich Toastscheiben, die er mit Käse und Wurst belegte. Mit einem guten Frühstück beginnt ein guter Tag, hatte sein Freund Walter immer gesagt. Und was Walter sagte, das hatte Hand und Fuß, so war das. Nach dem Frühstück ging er aus dem Haus, sah nach den Tieren und setzte sich dann, wenn er sah, dass alles gut war, in seinen Jeep und fuhr über die einsame Landstraße im frühesten Glanz des Morgens nach Norden, um nach dem Zaun zu schauen. Da gab es immer etwas zu tun und Robert Walden war froh, immer etwas zu tun zu haben. Am nördlichen Rand seiner Farm gab es ein paar kleine Teiche, die gegen Ende August regelmäßig austrockneten. Aber von März bis August kamen - vor allem in den frühen Morgenstunden - wilde Tiere, um hier zu trinken. Robert Walden hatte sie alle gesehen: Waschbären und Braunbären, Luchse und Marder, sogar verwilderte Hauskatzen. Und Feldratten. Robert Walden konnte die Biester nicht ausstehen. Und deshalb hatte er meistens ein Gewehr dabei, wenn er den Zaun abfuhr.
Manchmal, wenn er dann beim Zaun stand, um sich eventuelle Schäden anzusehen, dann lachte er aufrichtig die nahen Berge an. Er stemmte die Fäuste in die Hüften und lachte. Er kam sich dabei schon ein wenig verrückt vor, aber das machte nichts. In dem Alter durfte man Schrullen haben, sagte er sich.
Wenn man sie in diesem Alter nicht hatte, dann hatte man sie nie. Und das wäre auch irgendwie schade.
Dann machte er sich an die Arbeit und spulte neuen Draht von der Rolle und wickelte ihn mit bloßen Händen um die alten morschen Pfosten. Robert Walden hatte sich schon vor drei Jahren vorgenommen, neue Pfosten in die Erde zu rammen. Das Holz hatte er schon vor vielen Jahren zum Trocknen vorbereitet und in der Scheune hinter dem Haus gelagert. Da hatte Walter noch gelebt und sie hatten gemeinsam das Holz aufgeschichtet. Aber das war lange her. Länger, als man mit dem Kalender messen konnte. Und wenn Robert Walden durch den Korridor der Jahre zurücksah und sie beobachtete – diese beiden Männer in Jeans und T-Shirt, die gemeinsam Holz aufstapelten, unter der Sommersonne von Montana mit dem Wind in den trockenen Grasbüscheln, erfüllte ihn eine nagende und beängstigende Trauer.
Und an diesem Freitag, dem dreißigsten Juni im Jahre 2034, war es nicht anders. Um halb fünf Uhr morgens stieg Robert Walden aus seinem Jeep, streckte sich und hörte sein Kreuz knacken. Er flüsterte grinsend: „Himmel, bald bin ich so morsch wie das Holz der Pfosten. Das kann ja wohl nicht wahr sein.“ Er kicherte, aber sein Kichern konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass ihm die Jahre zusetzten. Und das taten sie in letzter Zeit immer häufiger. Er schlief weniger, aber nicht schlechter. Er ging meist erst um Mitternacht schlafen und stand in letzter Zeit immer früher auf. Vorige Woche hatte er mit dem Messer das Wort: Endspurt in die Tischplatte geritzt. Und dann hatte er fast eine Stunde lang dagesessen, die schwere Kaffeetasse in den Händen herum gedreht und das Wort angestarrt.
Er holte sich eine Zigarette aus der zerdrückten Schachtel und zündete sie mit einem Streichholz an. Er blies den Rauch aus und bewunderte die großartigen Farben des jungen Tages. Dann ging er steifbeinig am Zaun entlang, um nach Schäden zu suchen.
Gegen Mittag hatte er getan, was getan werden musste, und kehrte zum Haus zurück. Er überlegte kurz, was heute für ein Tag war und ob es nicht an der Zeit wäre, sich mal wieder in der Stadt Helena blicken zu lassen. Und sei es auch nur, um eventuell kursierende Gerüchte über seinen Tod im Keim zu ersticken – nein, nein: Der alte Arsch ist noch nicht kalt. Ein bisschen einkaufen und bei der Post vorbeisehen.
Von der Zufahrtsstraße zum Glacier National Park, der US2, die auch ‚Going To The Sun Road’ genannt wird, ging eine direkte Schotterstraße ab, die links durch den dichten Wald führte; eine steile Straße, die sich in Serpentinen am Berghang hinunter schlängelte und nach fünf Kilometern in einem großartigen, hügeligen Wiesenland mündete. Im Sommer war die US2 zum Glacier Park stark befahren: Busse, Wohnmobile und Limousinen rollten in einer langen, glitzernden Schlange staub-aufwirbelnd zum Park und von dort aus Richtung Helena oder zum Glacier Flughafen. Irgendwo in der Nähe gab es im Wald auf einer Lichtung einen Abstellplatz für die Wohnwagen der Camper, die einmal im Jahr für vier oder fünf Wochen hierher kamen, den Wohnwagen abholten und zu einem der Campingplätze weiter hinauf fuhren. Hin und wieder kamen auch die gelben Schulbusse, voll mit jungem, quirligem Leben, oft Pfadfindern, die im Glacier Park ihr Zeltlager aufschlugen, um dann eine Woche in der Wildnis herum zu streunen.
Waldens Farm unterhalb des Glacierparks, also im Südosten, etwa vier Kilometer vom Apgar Visitor Center, war weit genug weg vom Schuss, um ihm unliebsame Begegnungen zu ersparen. Gleich hinter den malerischen Hügeln des Weidelandes erhoben sich die dunklen Wälder der südlichen Grenze des Parks. Und gleich hinter diesen Wäldern, vielleicht eine Stunde zu Fuß, lag das Südufer des Lake McDonald.
Robert überlegte, ob er wirklich nach Helena fahren wollte. Nein, nein: Die alten Geschichten wären es nicht, die ihn davon abhalten würden, in die Stadt zu fahren. Hin und wieder tat ihm Gesellschaft doch gut und wenn er seine Einkäufe erledigt hatte, könnte er ja in eine Bar gehen, um zwei oder drei Bier zu trinken. Was ihn davon abhielt, gleich wieder in den Wagen zu springen und nach Helena zu fahren, war seine Wetterfühligkeit. Er litt nicht darunter. Aber sein Rücken und die Schläfen sagten ihm, dass große Regenfälle bevorstanden. Nicht lang anhaltende. Aber äußerst ergiebig. Er saß auf der Veranda, trank Kaffee aus einem blechernen Becher und verfolgte das Herumwirbeln seines Mischlingshundes. Robert Walden lächelte. Seit Walters Tod tat er das sehr selten. Er wünschte, er könnte das Lächeln, und das Gefühl dieses Lächelns konservieren. Für die langen Nächte, die noch bevorstanden. Herbstnächte, Winternächte. Alleine zu sein machte ihm nichts aus. Aber einsam zu sein, dachte er sich immer wieder, war eindeutig für’n Arsch.
Er überlegte, ob er das Stoffverdeck über die Überrollbügel des Jeeps ziehen sollte; das wäre in ein paar Minuten gemacht. Regen stand an, aber er wusste nicht genau, ob jetzt oder erst in drei oder vier Stunden. Er beschloss, sich die vier Stunden Fahrt nach Helena heute zu schenken. Er sah immer wieder zum Himmel und schätzte die Zeit ab, bis es so richtig nass werden würde.
Die Jungs und Mädchen wird es da oben auf ihren Campingplätzen ganz schön durchnässen, dachte er und lächelte wieder. Er stand auf und ging über die drei Stufen hinunter auf den Kiesweg, der mit weißen Steinen eingefasst war. Links und rechts und geradeaus hinter dem Schuppen erstreckten sich sanfte Hügel voller satter, grüner Wiesen. Weite, weiche Wellen grünen Grases. Und hinter seinem Haus erhob sich der dunkelgrüne, knarrende Wald. Er zog sich hinauf bis zum Glacierpark, um dort den Sockel für die Ausläufer der Berge zu bilden.
Das Wetter kam aus dem Norden, war er sich sicher. Es kam immer aus dem Norden oder von Westen herein. Wenn er nach Südosten sah, dann sah er nur einen einheitlich stahlblauen Himmel. Die Wolkenfront braute sich über den Bergen zusammen. Dann hob sie eine warme Luftströmung auf und drückte sie über die Berge. Und wenn das geschah, war man gut beraten, sich verdammt schnell einen trockenen Fleck zu suchen: Eine der leer stehenden Lodges im Park zum Beispiel, einen Felsüberhang oder eine Höhle.
„Ach was“, murrte Robert Walden und scharrte mit dem Schuh im Kies, „drauf geschissen. Ich fahre. Und zwar genau jetzt.“
Die nächste kleinere Stadt war Nyack, im Westen auf der Bundesstrasse US-2E,aber dort kannte er niemand. Walter und er waren immer nach Hungry Horse gefahren, wenn sie einkaufen oder in Gesellschaft ein paar Bier trinken wollten. Hungry Horse also. Auch gut. Das bedeutete eine Stunde hin und eine zurück, das könnte sich ausgehen.
Er ging, ohne sich noch einmal umzudrehen oder die Haustür zu schließen. Er verschloss nie die Haustür. Wozu auch? Hier gab es nichts zu holen als Bücher, Bücher, Bücher. Und drei unveröffentlichte Manuskripte von ihm. Es gab zwar mehr als genug Leute, die ein Vermögen für ein unveröffentlichtes Manuskript von Robert Walden zahlen würden. Aber es kam niemand hier heraus. Seitdem er in guter alter Salinger Manier aufdringliche Journalisten mit Gewehrschüssen vertrieben hatte, ließ man ihn weitgehend in Ruhe und sein Leben hier leben. Die uralten Geschichten von seiner Rückkehr aus New York nach Helena im Jahr 2004 schliefen, aber sie starben nicht. Dass er und Walter Crown, der ehemalige Sportstar von Helena, als erwachsene Männer in Crowns Haus ganz offiziell zusammenzogen, das hatte schon einigen Staub aufgewirbelt und die Gralshüter der örtlichen Moral auf die Palmen getrieben, wo sie zeterten und “Mordio“ schrieen. Ruhiger wurde es, als Robert Walden und Walter Crown die alte Steinberg Farm erstanden und sie „Walden’s Landing“ nannten. Aus den Augen - aus dem Sinn, sagt man. Und so war es auch.
Der schwarze Mischling staubte um die Ecke des Schuppens und sprang hechelnd auf die kleine Ladefläche. Er legte den Kopf schief: „Geht’s los?“
Walden streichelte ihm den Kopf, ließ den Motor an und sagte: „Aye, fahren wir, Darkside. Zeigen wir ihnen, dass der Arsch alt, aber noch nicht kalt ist.“
Darkside grinste und stemmte sich gegen den Wind.
Unterwegs blieb er einmal am Straßenrand stehen, um zu pinkeln. Er schüttelte ab und sah zurück zu den Ausläufern der Berge im Glacier Park, und da sah er sie: Fett schimmernde Wolken, die sich zusammen ballten. Er hatte noch einen Grund, gerade hier stehen zu bleiben: Die Silberdisteln kurz vor Martin City. Wenn man vom geschotterten Fahrbahnrand in den Straßengraben kletterte und auf der anderen Seite wieder rauf, sah man eine Silberdistelkolonie, wie Robert das nannte. Sie waren ihm im letzten Sommer zum ersten Mal aufgefallen und jetzt sah er jedes Mal nach den hellweißen Disteln, wenn er in die Stadt fuhr. An den Disteln war nichts Besonderes. Aber er freute sich, wenn er sie sah. Er hockte sich kurz hin und fuhr mit der flachen Hand über die Blätter. „Alles klar, Mädels und Jungs? Immer schön das Gesicht in der Sonne? Jetzt gibt’s bald Wasser.“
Darkside bellte einmal. „Ungeduldig, der Bursche“, flüsterte er grinsend und kehrte zum Wagen zurück. Während er sich hinter das Lenkrad klemmte, sah er in den Rückspiegel. Über den Bergen staute sich eine den Horizont verdunkelnde Wolkenfront, die bald Blitze erbrechen würde, war er sicher. Er tätschelte Darksides Kopf, legte den ersten Gang ein und fuhr los. Darkside bellte und knuffte Robert Walden mit der Schnauze in die Seite. Robert lächelte und sagte knarrend: „Werd mir hier nicht ungezogen, du Rotzlöffel, ich geb ja schon Gas.“
Das Licht änderte sich durch die aufgestauten Wolken über dem Glacierpark und bekam schon am Vormittag einen goldenen Stich. Die Windstille war verräterisch, die Ruhe über dem Land ebenso. Als Robert Walden in Hungry Horse seinen Jeep am Rande der Wilbur Lane abstellte und ausstieg, erinnerte er sich an den Überflug der Meteoriten im Jahre 2004. Die Stille davor war ähnlich beunruhigend gewesen. Allerdings fand Robert Walden, dass die Ruhe vor dem Überflug erst durch die merkwürdige Vibration, die dem Aufblitzen der Lichterscheinungen samt ihrem Getöse voran ging, so entsetzlich geworden war. Er erinnerte sich an diese Schwingungen, die in den Füßen gekribbelt und sich dann hochgearbeitet hatten, wie um den Magen schrumpfen und gleichzeitig wachsen zu lassen.
Hungry Horse war nur wenig mehr als ein paar Häuser, Tankstellen und Motels, an den Rand der US-2E gewürfelt und halb in den Nadelwäldern versteckt. Ein paar alte Knacker saßen vor dem Lebensmittelladen auf der Holzbank, hatten die Hosenbeine hochgerollt und ließen sich die Waden bräunen. Walden grüßte sie mit einem Nicken, das sie erwiderten.
Mit den immer fetter werdenden Wolken im Rücken fühlte sich Walden ziemlich verspannt und er beschloss, heute auf Plaudereien im Drugstore zu verzichten. Die Liste durchgehen, einkaufen und wieder abrauschen. Auch mit der Altherrenrunde auf der Bank draußen wollte er heute kein Schwätzchen halten. Aus dem Augenwinkel sah er drei betagte Damen auf der anderen Strassenseite, die pikiert zu ihm herüber sahen.
Er nahm Darkside an die Leine, legte ihm den Maulkorb an und flüsterte: „Du weißt, dass ich das hasse. Aber diese alten, biestigen Weiber hier beißen mir sonst die Nase ab, OK, Alter? Du kennst ja diese Kleinstadtzicken.“
Darkside sah zu ihm hoch und schien ihm zu zu blinzeln.
Dann ging er in den Laden, grüßte höflich nach allen Seiten und tätigte seine Einkäufe.
Im Glacier Park gab und gibt es einige größere Campingplätze, die mit Strom- und Wasserleitungen ausgestattet sind und die gerne von Pfadfindergruppen aus den ganzen USA besucht werden. Daneben finden sich noch einige kleinere Campingplätze, die sehr idyllisch in Waldlichtungen an kleinen Flüssen und Seeufern eingebettet sind. Über dem nördlichen Glacierpark sollte es an diesem Freitag bereits um etwa elf Uhr vormittags dunkel werden; die Wolkenunterseiten wirkten wie verlaufende, schwarze Farbe. Aus der Ferne sah das spektakulär aus: Gigantische, weiß schimmernde Türme, an der Unterseite metallisch grau. Gegen halb zwölf Uhr mittags brachten aufkommende Windböen das trockene Unterholz der Wälder und die Kornähren auf den Feldern zum Rascheln und Singen. Wind kämmte die klaren Seen. Und die heftigeren Böen trieben die Wassersportler an Land. Überall an den Ufern trillerten Pfeifchen von Aufsehern und Betreuern, Warnfahnen wurden gehisst.
Am südwestlichen Ufer des Lake McDonald campierte eine Pfadfindergruppe aus New York. Sie waren seit einer Woche da und hatten ihre Zelte sehr ordentlich auf dem Campingplatz am östlichen Ufer aufgeschlagen. Mit dem aufkommenden Wind kam auch Bewegung in ihr Zeltlager. Schnüre wurden nachgezurrt, trockene Wäsche wurde von den Leinen geholt und ein paar der frühen Wasserratten wurden mit Trillerpfeifen ans Ufer gerufen. Die New Yorker Pfadfindergruppe bestand aus acht Jungs im Alter von dreizehn bis achtzehn Jahren und zwei Begleitern. Zwei der älteren Jungs, Johnny und Toni, waren bei der Pfadfindergruppe als Teil eines Bewährungsprogrammes, das ihnen ein milder Richter für einen gemeinsam begangenen Überfall in einer U-Bahn Station aufgebrummt hatte, aufgenommen worden. Toni war ein kräftiger schwarzer Bursche mit kleinen, stechenden Augen und kurz geschorenen Haaren, Johnny war aber in so ziemlich allem das genaue Gegenteil von Toni: Er war groß, schlank, hübsch und hatte lange blonde Haare, die sein feminines Gesicht unterstrichen. Trotz seines sanften Aussehens war Johnny der böse Geist dieses Gespanns; Toni war sein gehorsames Werkzeug.
Bevor sie erwischt worden waren, hatten sie es mit kleinen Erpressungen in der Schule versucht, später hatten sie sich von älteren Jungs als Drogenkuriere einspannen lassen. Johnny, der Sohn einer italienischen Einwandererfamilie, die in der dritten Generation in den USA lebte, war immer der Planer, nie der, der durchführt. Das überließ er gerne Toni. Johnny war immer und überall der Erste, wenn es etwas Böses zu tun gab. Erpressung, Drohung, Einschüchterung. Was sein Kumpel Toni nicht wusste, war, dass sich Johnny auch ganz gerne mal ein paar Dollar nebenher verdiente, in dem er sich Männern anbot, die auf Toiletten in Metrostationen nach White Trash Kids Ausschau hielten. Johnny hatte nichts augelassen. Er mochte Toni, auch, wenn er ihn nicht respektierte, weil er so leicht zu manipulieren war.
Ein vierzehnjähriger Junge aus gutem Haus hatte sich den beiden coolen und ständig Sprüche klopfenden Burschen angeschlossen und bewunderte sie - sehr zum Missfallen der Betreuer - mit offenem Mund und fast hündischer Treue. Der Kleine hieß Jim Goodspeed, hatte ebenfalls längere Haare, die er am Hinterkopf zu einem Knäuel zusammengepackt trug. Die straff nach hinten gebundenen Haare gaben seinem Gesicht etwas Asiatisches. Man hätte ihn als schön bezeichnen können, wenn er nicht an einer schrecklichen Akne gelitten hätte. Sein Gesicht war von Pusteln übersät.
Und genau diese drei Jungs hatten sich schon um neun Uhr vormittags vom Zeltlager abgeseilt und waren am Ufer des Lake McDonald nach Süden gewandert, um in einer der leer stehenden Holzblockhütten während des Gewitters ein paar Joints zu rauchen, etwas zu trinken und, so wie Johnny das angekündigt hatte, sich etwas Speed in die Nase zu ziehen. Joints waren ja nichts Neues, auch ein bisschen Sauferei hie und da. Aber Speed? Wie die Typen in den Filmen, lässig einen Geldschein zu ’nem Röhrchen drehen und dann: Schnief? Das war was!
Die drei Jungs stromerten, voller Vorfreude auf das bevorstehende Besäufnis, am See entlang Richtung Süden, vom immer heftiger werdenden Wind angeschoben. Der See lag rechter Hand, aufgeraut und wie gegen den Strich gebürstet. Der Wind griff ihnen in die Haare und Regenjacken. Johnny trug ein geheimnisvolles Grinsen zur Schau, in dem auch viel heitere Boshaftigkeit lag. Hätte Jim Goodspeed in diesem Moment den Gesichtsausdruck von Johnny gesehen, wäre alles anders gekommen; vielleicht. Er hätte vielleicht beschlossen, doch zurück zum Campingplatz zu gehen, um mit dem Jungen, mit dem er das Zweimannzelt teilte, Karten zu spielen. Aber Jim sah diesen speziellen Gesichtsausdruck nicht, weil Johnny vor ihm ging. Johnny wusste, wann er grinsen konnte, ohne andere dadurch zu erschrecken.
Ungefähr zu der Zeit, als die drei Halbwüchsigen eine alte Blockhütte erreichten, die sie schon auf der Herfahrt im Bus von der Straße aus gesehen hatten, knatterte der sechzehnjährige Patrick Fletcher auf dem Motorrad seines Vaters über die staubige Schotterstraße durch den Wald Richtung Norden und näherte sich rasch dem Südufer des Lake McDonald. Er war nun seit knapp vier Stunden unterwegs. Und das nur, weil er sich nicht immer an die Geschwindigkeitsgrenzen gehalten hatte. Das Straßennetz war gut ausgebaut, aber Patrick Fletcher nutzte gerne auch die weniger befahrenen Strecken, weil sie landschaftlich einfach vielmehr zu bieten hatten.
Patrick wollte über das Wochenende allein zelten. Überraschenderweise hatte er seine Eltern nicht lange überreden müssen. Sein Vater, Mark Fletcher, hatte ihm zugehört, gegrinst und genickt und ihm mit einer Handbewegung erlaubt, sich Motorrad und Lederkleidung auszuborgen. Die Unterhaltung war einseitig: Patrick redete leise, aber deutlich und sein Vater antwortete entweder in Zeichensprache oder indem er kurze Sätze auf Papier schrieb; Mark Fletcher war stumm. Patrick verstand die Stummensprache genauso gut wie das gesprochene Wort; es war seine Zweitsprache, er war damit aufgewachsen. Während Patrick all die Sachen zusammen packte, die er brauchte, hatte sein Vater mit einem Bleistift ein paar Zeilen auf ein unliniertes Stück Papier geschrieben und es ihm später unter die Nase gehalten: Sie standen um fünf Uhr morgens in der offenen Garage: Patrick belud gerade die Satteltaschen, als sein Vater zu ihm kam. Die Sonne stand noch tief und blinzelte in die offene Einfahrt der Garage, Chrom glänzte, Patrick war ein biegsamer, schimmernder Schatten, dessen Bewegungen leicht knarrten.
Auf dem Zettel stand:
Für Onkel David waren die Seen des Glacier Parks immer ein Zeichen der Hoffnung. Sie waren Symbol für Klarheit, Reinheit und Unschuld. David sagte immer: Wolken und Berge, Fische und Vögel.
Das ist ein Bild voller Klarheit.
Wenn Du dort oben bist, solltest Du vielleicht am Grab von Onkel David vorbeisehen. Kannst Du mir das versprechen, Patrick?
Patrick sah ihn an und lächelte zustimmend. Dann faltete er den Zettel zusammen und schob ihn in seine Brieftasche, die mit einer verchromten Kette an einer Gürtelschlaufe der Lederhose gesichert war.
Mark Fletcher grinste und machte mit den Händen das Symbol für ‚Knackarsch’. Patrick wurde rot und wandte sich mit einem verschämten Grinsen ab. Die Lederhose und die Lederjacke seines Vaters passten ihm wie angegossen, beide hatten beinahe die gleiche Statur. Sie waren beide eins achtzig groß und schlank. Wobei man um der Wahrheit Willen anmerken muss, dass Mark Fletcher in den letzten zwei Jahren um die Hüften rum ein wenig zugelegt hatte.
David Schneider, Onkel David, hatte von Patricks Geburt an eine große Rolle in dessen Leben gespielt. Nicht nur, weil er ihm wie aus dem Gesicht geschnitten war. Während sein Vater blond war, hatte Patrick, so wie David, pechschwarze Haare und dunkelgrüne Augen. Patrick war bei den Mädchen recht beliebt, interessierte sich aber mehr für das Motorrad seines Vaters, für lange Ausfahrten über die kurvenreichen Straßen unterhalb des Glacierparks. Er interessierte sich für seine Kumpels und für Freitagabendbier im Hinterzimmer ihrer Stammkneipe. Über Mädchen machte man Scherze, fand er – keine wirklich bösen. Aber eben doch ... Scherze.
Patrick trug die Haare an den Schläfen und im Nacken kurz geschoren und oben mit Gel hoch gestachelt. Er sah gut aus, war schlank und biegsam und entsprach eigentlich nicht wirklich dem Ideal des All American Stars. Er wirkte zu europäisch. Nicht nur in seinem Aussehen. Auch in seinem Gleichmut, seiner Geduld und der inneren Ruhe. Manche Leute aber fanden in seinen Augen ein beunruhigendes Funkeln, das man als obszönen Hochmut hätte auslegen können. Aber ‚manche Leute’ sahen eben immer das, was sie sehen wollten, zu sehen hofften oder einfach erwarteten.