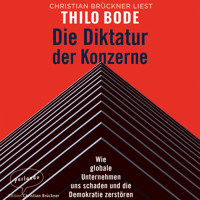12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was uns der Supermarkt serviert – und was sich ändern muss Wir alle gehen in den Supermarkt. Doch zwischen Preissteigerungen und dem Wunsch nach guten Lebensmitteln gleicht der Wocheneinkauf einem Blindflug: Billig ist nicht schlecht, teuer ist nicht gut. Unverständliche Zutatenlisten, undurchsichtige Qualitätsversprechen und fehlende Informationen verhindern, dass wir als Kunden unsere Wahlfreiheit ausüben können. In seinem Buch nimmt Thilo Bode uns darum mit auf einen aufklärerischen Gang durch den Supermarkt. Verständlich und übersichtlich unterzieht er die wichtigsten Lebensmittel von der Frische- bis zur Tiefkühltheke – Obst, Gemüse, Fleisch, Backwaren, Milchprodukte und mehr – einem radikalen Qualitätscheck. Und er beschreibt, was passieren muss, damit Supermärkte die Erwartungen der Verbraucher nach Transparenz und Qualität erfüllen. »Der Supermarkt-Kompass« ist ein unverzichtbares Buch mit direktem Gebrauchswert – für alle, die endlich informiert einkaufen wollen. Mit praktischen Info-Boxen zu den wichtigsten Lebensmitteln und allen wichtigen Fakten zu unserer Ernährung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 336
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Thilo Bode
Der Supermarkt-Kompass
Informiert einkaufen, was wir essen
Über dieses Buch
Was uns der Supermarkt serviert – und was sich ändern muss
Wir alle gehen in den Supermarkt. Doch zwischen Preissteigerungen und dem Wunsch nach guten Lebensmitteln gleicht der Wocheneinkauf einem Blindflug: Billig ist nicht schlecht, teuer ist nicht gut. Unverständliche Zutatenlisten, undurchsichtige Qualitätsversprechen und fehlende Informationen verhindern, dass wir als Kunden unsere Wahlfreiheit ausüben können. In seinem Buch nimmt Thilo Bode uns darum mit auf einen aufklärerischen Gang durch den Supermarkt. Verständlich und übersichtlich unterzieht er die wichtigsten Lebensmittel einem radikalen Qualitätscheck. Und er beschreibt, was passieren muss, damit Supermärkte die Erwartungen der Verbraucher nach Transparenz und Qualität erfüllen.
Mit praktischen Info-Boxen zu den wichtigsten Lebensmitteln und allen wichtigen Fakten zu unserer Ernährung.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Thilo Bode, geboren 1947, studierte Soziologie und Volkswirtschaft in München und Regensburg. 1989 wurde er Geschäftsführer von Greenpeace Deutschland, 1995 von Greenpeace International. 2002 gründete er die Verbraucherrechtsorganisation Foodwatch, um Täuschung und Gesundheitsgefährdung im Lebensmittelmarkt zu dokumentieren sowie die Schwachstellen in der Gesetzgebung aufzudecken. Bei S. FISCHER erschienen seine Sachbücher »Die Diktatur der Konzerne. Wie globale Unternehmen uns schaden und die Demokratie zerstören« (2021), »Die Essensfälscher. Was uns die Lebensmittelkonzerne auf die Teller lügen« (2010) und »Abgespeist. Wie wir beim Essen betrogen werden und was wir dagegen tun können« (2007). Er lebt in Berlin.
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2023 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, 60596 Frankfurt am Main
Redaktionsschluss: 1. November 2022
Covergestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich, unter Verwendung von Motiven von Shutterstock und Getty Images
Coverabbildung: Hauptmann & Kompanie unter Verwendung von Motiven von Shutterstock und Getty Images
ISBN 978-3-10-491617-0
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Motto]
Betriebsgeheimnis Lidl-Brötchen
1. Die allmächtigen Vier: Aldi, Lidl, Rewe, Edeka
Preiswettbewerb statt Qualitätswettbewerb
Die Preis-Diktatoren
Teuer ist nicht gut, billig ist nicht schlecht
2. Brot + Brötchen
Alchemie in der Backstube
Die deutsche Verbrauchertäuschungskommission
Vollautomatisierte Tradition
Infobox: BIO
Infobox: GENTECHNIK
3. Tomaten
Billig um jeden Preis
Pestizide als Beikost
Infobox: PESTIZIDE
4. Gemüse
Klimakiller Lebensmittelmüll
Grün gefärbter Verpackungswahn
Bioabfall: ins Meer und aufs Feld
Infobox: TIEFKÜHLKOST
Infobox: FISCH
5. Erdbeeren
Wasserimport aus Regionen ohne Wasser
Erdbeeren und Menschenrechte
6. Äpfel
Apfelallergie gratis
7. Fruchtsäfte + Limonaden
Im Blindflug durch die Saftregale
Dickmacher als Durstlöscher
Infobox: AROMEN
8. Konfitüren + Marmeladen
9. Honig
Honig ist Fälschers Liebling
10. Verarbeitete Lebensmittel
Spitzenköche: Pesto (fast) ohne Basilikum
Die Basiszutat: E-Nummern
Verarbeitete Lebensmittel – ein toxisches Ernährungskonzept
Infobox: ZUSATZSTOFFE
Infobox: GÜTESIEGEL
Infobox: QUALITÄTSTÄUSCHUNG
11. Fleisch + Wurst
Die Metzgerei – ein Auslaufmodell
Die Mär vom »Tierwohl«
Große Ställe – kranke Tiere
Tiere als Ausschussware
12. Milch
Existenznot trotz Milliardengeschäfts
Warum Milch nicht billig ist
13. Eier
Die Eierbarone
14. Olivenöl
Auf schlechte Qualität ist Verlass
»Wie ein Kochbuch für Fälscher«
15. Vegan + Vegetarisch
Vegan – keine Gesundheitsgarantie
16. Snacks, salzig + süß
Supermärkte verantworten Fehlernährung
17. Nahrungsergänzungsmittel + »Superfoods«
Der Supermarkt als Apotheke
18. Illusion Verbrauchermacht
Der rationale Griff zur Billigware
Regeln steuern den Markt, nicht Verbraucher
Verantwortung ohne Haftung
Missbrauchtes Vertrauen
19. Ampel auf Grün schalten!
Verursacherprinzip statt Subventionswahnsinn
Ampel-Koalition: Rückschritt statt Fortschritt
Dank
Register
Es sind nicht die Verbraucher, die durch ihren Einkauf im Supermarkt das Sortiment und die Qualität der Lebensmittel bestimmen. Es sind die gesetzlichen Regeln und Vorschriften, die die Konsumentensouveränität aushebeln und den Lebensmittelmarkt steuern.
Betriebsgeheimnis Lidl-Brötchen
Wie die allermeisten Menschen in Deutschland gehe ich regelmäßig in den Supermarkt, oft mehrmals in der Woche, und an meinem Wohnort Berlin habe ich dabei reichlich Auswahl. Doch egal ob bei Lidl, Rewe, Aldi, Edeka, Bio Company, denn’s Biomarkt, Netto, Penny oder Kaufland – überall fühle ich mich als Supermarktbesucher in einer Doppelrolle: Da ist zum einen die Rolle des Staatsbürgers, in der ich erwarte, dass mich der Staat durch Gesetze und Kontrollen vor krank machenden, gefährlichen Lebensmitteln schützt; und natürlich davor, dass mich Herstellerinnen und Händler mit frei erfundenen Behauptungen über die Qualität ihrer Lebensmittel nach Belieben täuschen können. In meinen zwanzig Jahren als Gründer und Geschäftsführer von foodwatch ging es oft um solche Aspekte, wenn wir uns mit Verbraucher- und Landwirtschaftsministerinnen stritten, wenn wir politische Forderungen stellten und Konzerne und ihre Lobbymacht kritisierten.
Meine andere Rolle im Supermarkt ist die des Konsumenten, der seine sogenannte Konsumentensouveränität ausüben will, so wie sie in ökonomischen Lehrbüchern beschrieben wird: Verbraucher auf Augenhöhe mit den Anbieterinnen, die eine Vielfalt von Waren in unterschiedlicher Qualität zur Wahl stellen; und aus der Fülle dieses differenzierten Angebots entscheidet sich der Konsument für dasjenige Produkt, das seinen Erwartungen an die Qualität – sei es Geschmack, Rezeptur oder Herkunft – und Preiswürdigkeit am meisten entspricht.
An dieser Stelle möchte ich eine Episode wiedergeben, die beispielhaft dafür steht, warum ich mich im Supermarkt sowohl in meiner Staatsbürgerrolle als auch in meiner Konsumentenrolle ganz und gar nicht ernst genommen fühle. Beschert hat sie uns der Einzelhandelskonzern Lidl, dem wir als ganz normale Kunden via E-Mail eine denkbar einfache Frage stellten: Wir wollten wissen, ob das Lidl-Weizenbrötchen, auf dessen Zutatenliste nur »Weizen, Roggen« steht und das man für 17 Cent aus dem Fach fischt, mit Verarbeitungshilfsstoffen hergestellt wird, zum Beispiel mit zugesetzten, sogenannten »technischen Enzymen«. Technische Enzyme sind Eiweiße und wahre Alleskönner, die zielgenau die Eigenschaften eines Brötchens oder Brotes im Produktionsprozess steuern. Zum Beispiel sorgen sie dafür, dass der Teig einförmig und damit »maschinengängig« ist und die Brötchen dadurch vollautomatisiert zu Zehntausenden vom Fließband fallen können. Enzyme machen Brötchen aber auch lockerer und luftiger oder zaubern eine verlockend knusprige, goldbraune Kruste auf die Oberfläche. Diese technischen Enzyme und andere Verarbeitungshilfsstoffe ersetzen zunehmend die klassischen Zusatzstoffe, die durch E-Nummern gekennzeichnet werden und bei Verbraucherinnen kein besonderes Ansehen genießen. Für den Brötchenbäcker haben diese Enzyme den Vorteil, dass sie nicht auf der Zutatenliste deklariert werden müssen. Warum eigentlich? Sie seien im Endprodukt nicht mehr aktiv, sie seien »de-aktiviert«, heißt die lebensmittelrechtliche Begründung. Man brauche deshalb, so muss man diese Regel wohl lesen, über mögliche negative Auswirkungen wie zum Beispiel Allergien nicht besorgt sein.
Diese wenig verbraucherfreundliche Haltung hat der Lidl-Kundenservice, der den Namen nach dieser Erfahrung nicht verdient, in seiner Reaktion auf unsere Frage voll bestätigt. Denn es entspann sich ein E-Mail-Austausch mit vielen Schleifen, bei denen der Mitarbeiter fortwährend auswich oder nicht gestellte Fragen beantwortete. Drei Monate nach Beginn der elektronischen Korrespondenz wussten wir immer noch nicht, welche Verarbeitungshilfsstoffe verwendet werden, um ein Lidl-Weizenbrötchen zu backen. Erst auf wiederholtes, energisches und mit einer Beschwerde bei der Konzernspitze drohendes Nachhaken ließ der Service-Mitarbeiter die Katze aus dem Sack: »Wir möchten dem Verbraucher mitteilen, dass Zusatzstoffe, die keine technologische Wirkung im Endprodukt haben, nicht deklarationspflichtig sind. Leider können wir dem Verbraucher keine Auskunft darüber geben, welche Zusatzstoffe in unserem Produkt enthalten sind, da dies unter das Betriebsgeheimnis fällt.«
Was ist das für eine absurde Lebensmittelwelt, in der der Inhalt eines Grundnahrungsmittels zum Betriebsgeheimnis eines privaten Konzerns erklärt wird! Und was ist das für ein Lebensmittelmarkt, der den Kunden signalisiert, es sei nicht nötig, zwischen einem Enzym-gesteuerten und einem handwerklich gebackenen Brötchen, das seine braune Kruste der Fähigkeit der Bäckerin verdankt, auswählen zu können, weil ja schließlich nichts drin sei, das krank machen kann?
Die Episode mit dem Lidl-Brötchen ist für mich kein Ausrutscher, kein Einzelfall, keine hochgespielte Petitesse, vorgebracht von einem notorischen Nörgler. Nein, diese Episode macht mich wütend, weil sie meiner Meinung nach für die gestörte Funktionsweise unseres Lebensmittelmarktes steht, und damit auch der Supermärkte: Wir können dort kaum noch eine informierte Auswahl treffen; wir werden im Supermarkt in einem Ausmaß allein gelassen und Konzerninteressen ausgesetzt, wie ich es vor der Recherche für dieses Buch nicht für möglich gehalten hätte.
In den folgenden Kapiteln möchte ich darlegen, wie ich zu dieser Auffassung gekommen bin. Zu diesem Zweck lade ich Sie zu einem Einkaufsrundgang ein, bei dem ich eine Auswahl von Lebensmittel-Gruppen genauer betrachte und nach Antworten suche auf Fragen wie »Welches Angebot gibt es, und wie transparent ist es?«, »Welche ökologischen Auswirkungen hat das Lebensmittel, und wie gesund ist es?«, »Wie steht es um Bio-Alternativen im Vergleich zu konventionellen Produkten?«. Zuletzt will ich der entscheidenden Frage nachgehen: »Welche Wahlfreiheit habe ich? Bekomme ich eigentlich das, was ich haben möchte, oder nur das, was ich kaufen muss, weil es keine Alternativen gibt?« Geht es nach dem Rewe-Konzern, ist die Antwort leicht: »An den Kassen unserer Supermärkte findet jeden Tag eine Volksabstimmung statt, an der sich Millionen von Menschen beteiligen. Wir verkaufen diesen Menschen also genau das, was sie wollen.«
Ausgesucht habe ich für die Einkaufstour Brot, Obst, Gemüse, Fruchtsäfte, Konfitüren, Honig, Olivenöl, verarbeitete Lebensmittel, Milch und Käse, Fleisch, Schinken und Wurst, Eier, Snacks und Nahrungsergänzungsmittel. Zusätzlich erkläre ich sortimentsübergreifend unter anderem was »Bio« wirklich ausmacht, was man über Pestizide, Zusatzstoffe und Aromen wissen muss, was Gentechnologie in der Landwirtschaft bedeutet und wie vegane Lebensmittel einzuschätzen sind.
Natürlich konnte ich nicht alle Produktgruppen unter die Lupe nehmen. Dennoch bin ich überzeugt, dass die Auswahl sehr gut abbildet, was Verbraucherinnen und Verbraucher im Supermarkt erfahren können und was ihnen an Informationen verwehrt wird. Zur Übersichtlichkeit sind zwischen die Texte, die die Produktgruppen beschreiben, Infoboxen eingefügt, die die wichtigsten Eigenschaften der Produkte beschreiben und darüber hinaus produktübergreifende Informationen (z.B. zu Pestiziden, Kennzeichnungssiegeln oder Gentechnik) beinhalten und somit auch beim Einkauf nützlich sein können.
Dieses Buch will aber mehr sein als ein »Einkaufsführer«. Die Erkenntnisse des Rundganges dienen dazu, im letzten Kapitel zu analysieren, wie es so weit kommen konnte und was sich ändern muss, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern in Europa. Viel zu oft übersieht man, dass unabhängiges nationalstaatliches Handeln in der Agrar- und Lebensmittelpolitik nicht mehr möglich ist. Zu dieser Analyse gehört auch die Antwort auf die Frage, was eigentlich Brüssel und die deutsche Regierung planen und ob ihre Vorhaben und Programme geeignet sind, die fundamentalen Probleme des Sektors zu lösen.
Diese Fragen sind umso drängender, als während der Arbeit an diesem Buch die Preise für Lebensmittel so stark steigen wie seit Jahrzehnten nicht mehr. »Ernährungsarmut«, vor allem in den einkommensschwachen Schichten der Bevölkerung, hat sich in erschreckendem Maße verbreitet. Familien, die davon betroffen sind, müssen an einer ausgewogenen Ernährung sparen, um andere lebensnotwendige Ausgaben tätigen zu können, zum Beispiel für Energie und Mieten. In einer solchen Situation kommt auf die Supermärkte eine besondere Verantwortung zu: Sie sind es, die die Bevölkerung mit guten und erschwinglichen Lebensmitteln versorgen sollen.
An dieser Stelle möchte ich eine Lanze für die Discounter brechen: Sie bieten keine schlechtere Qualität als herkömmliche Supermärkte und erfüllen mit preisgünstigeren Lebensmitteln eine wichtige soziale Funktion. Sie können billiger anbieten, weil sie ein kleineres Sortiment, geringere Lager- und Verpackungskosten und damit generell geringere Logistikkosten haben, nicht weil sie schlechtere Produkte verkaufen. In diesem Buch soll prinzipiell kein Supermarkt-Bashing betrieben werden. Zwar sehe ich manche Methoden und Strategien der Supermärkte sehr kritisch und bin auch der Überzeugung, sie könnten mehr dazu beitragen, den Lebensmittelmarkt im Sinne der Verbraucherinnen zu verändern. Aber klar ist auch: Die Supermärkte sind Teil des Systems, eines bis ins Detail staatlich regulierten Agrar- und Lebensmittelmarktes. Es wäre deshalb naiv zu erwarten, dass einzelne Unternehmen so weit aus dem System ausbrechen, dass sie gegenüber Wettbewerbern in Rückstand geraten. Deshalb übernehmen die Konzerne ja auch am liebsten dort Verantwortung, wo es sie nichts kostet und wo sie keiner übergeordneten Institution gegenüber Rechenschaft ablegen müssen – nämlich beim Thema »Nachhaltigkeit«. Bei diesem Thema suggerieren sie ihren Kundinnen, man könne durch den Kauf von Produkten die Welt nachhaltiger machen – eine gefährliche Verbraucherverdummung.
Wenn sich der Sektor ändern soll, und er muss sich ändern, gelingt das weder durch moralische Appelle an das Kaufverhalten noch durch Appelle an die Verantwortung der Supermärkte. Und es wird auch nur gelingen, wenn Sie sich, verehrte Leserinnen und Leser, von manchen bequemen Illusionen über Ihren Einfluss als Käufer auf das Warensortiment verabschieden. Die Veränderung des immer zerstörerischeren Agrar- und Ernährungssystems ist eine originär politische Aufgabe, eine Pflicht des Staates gegenüber seinen Bürgerinnen. Doch die deutsche und die europäische Politik drückt sich vor dieser Aufgabe und simuliert Handeln in Form untauglicher Trippelschritte, aus Angst vor der Macht der Agrar- und Chemiekonzerne, der Bauernverbände, der Nahrungsmittelhersteller und der marktbeherrschenden »Big Four« des Einzelhandels. Es liegt also an uns, sich nicht damit zufriedenzugeben, Bio-Eier von Zweinutzungshühnern zu kaufen. Stattdessen müssen wir nach unseren Möglichkeiten als Staatsbürgerinnen den Politikern und Parteien die rote Karte zeigen.
1.Die allmächtigen Vier: Aldi, Lidl, Rewe, Edeka
Supermärkte sind für uns Verbraucher eine Art zweites Wohnzimmer: Weit über 200-mal im Jahr kauft ein Haushalt durchschnittlich im Lebensmitteleinzelhandel ein; drei Viertel der Menschen geben an, dass sie ihren angestammten Lebensmittelladen ein- bis viermal in der Woche aufsuchen, zwölf Prozent halten sich dort sogar »fast täglich« auf. Und mit 34000 Verkaufsstellen ist das Filialnetz so dicht gewoben, dass der nächste Supermarkt oder Discounter im Schnitt innerhalb von drei bis vier Minuten mit dem Auto erreichbar ist.
Doch so alltäglich der Gang zu Aldi & Co., so vertraut dort die Wege vom Obst und Gemüse zu den Milchprodukten und Getränken, so skeptisch blicken wir auf das, was wir aus den Regalen nehmen und am Ende jedes Supermarktgangs vom Einkaufswagen aufs Kassenband legen. Wir trauen unseren Lebensmittelhändlern nicht. Unser zweites Wohnzimmer bleibt uns fremd, sein Inventar macht uns misstrauisch.
Das ist nicht meine Privatthese, sondern gesichertes Wissen unter Marktforscherinnen. Der Aussage »Es ist für den Verbraucher sehr schwierig, die Qualität von Lebensmitteln richtig beurteilen zu können« stimmten bei einer Befragung von 30000 Haushalten 81 Prozent zu, weitere 14 Prozent waren unentschieden, und nur knapp fünf Prozent befanden ihr Orientierungsvermögen in Sachen Lebensmittelqualität für gut. Welch katastrophaler Befund: Mehr als vier von fünf Verbraucherinnen können die Qualität ihrer Lebensmittel nicht richtig einschätzen!
Darum soll es in diesem Buch gehen: Wie kann es sein, dass die versammelte Lebensmittelwirtschaft, deren Zehntausende von Mitarbeitern sich tagtäglich Gedanken um Lebensmittel machen, ihre Kundschaft derart im Stich lassen? Wie ist es möglich, dass wir ausgerechnet bei Produkten, die unseren Tag strukturieren, die uns kulturell charakterisieren, ohne die wir kein Fest begehen und die wir zum (Über-)Leben so dringend brauchen wie sonst keine anderen, so unsicher geworden sind? Den großen Handelskonzernen ist in diesem Zusammenhang vieles vorzuwerfen, aber am Ende, so viel sei an dieser Stelle schon gesagt, geht es um Marktversagen infolge von Politikversagen.
In der eingangs erwähnten Befragung, die übrigens einem Report der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE) entstammt,[1] steht nicht nur das bemerkenswerte Eingeständnis, dass Verbraucherinnen die »Qualität kaum oder gar nicht zu beurteilen vermögen«, weil es ihnen »an der nötigen Transparenz des Produktionsprozesses fehlt, und sie folglich unsicher sind, was die Einhaltung von Qualitätsstandards durch Industrie und Handel betrifft«. In dem Report wird auch der wichtige Gedanke geäußert, dass »viele Qualitätsmerkmale Vertrauenssache sind«. So ist es: Lebensmittel sind das, was Wirtschaftswissenschaftler »Vertrauensgüter« nennen. Denn wie bei der Ärztin, deren Ratschlägen und Rezepten wir vertrauen müssen, weil wir selbst keine Mediziner sind, müssen wir im Supermarkt darauf vertrauen, dass ein Lebensmittel frei von Rückständen und Keimen ist, dass der angegebene Gehalt an gesundheitsfördernden Substanzen, die behauptete Güte der Zutaten stimmen. »Der Verbraucher muss sich auf die Arbeit der Lebensmittelwirtschaft verlassen können«, heißt es in dem Report der Ernährungsindustrie.
Doch dann müssen die Autorinnen einräumen, dass es um das Vertrauen der Kunden tatsächlich miserabel bestellt ist. Bei der Frage »Wem vertrauen Sie wie stark, wenn es um die Qualität von Lebensmitteln geht?«, nennen die Teilnehmerinnen an erster Stelle Zeitschriften wie Stiftung Warentest und Ökotest, es folgen Verbraucherschutzorganisationen, Bäckereien und Metzgereien, Landwirte und Expertinnen. Und erst unter »ferner liefen«, auf den Rängen 14 und 15 von insgesamt 17, nennen die Befragten die Lebensmittelhändler und -herstellerinnen: Ihnen vertrauen in Sachen Lebensmittelqualität uneingeschränkt nur 21 bzw. 18 Prozent der Befragten. Dass dennoch täglich Millionen von Kunden ihren Supermarkt aufsuchen, ist deshalb nicht als Vertrauensbeweis zu werten, wie es manchmal zu hören und zu lesen ist. Denn was bleibt den Menschen anderes übrig? Millionen von Menschen nutzen auch täglich Busse und Bahnen, was weder etwas über deren Qualität aussagt noch über die Zufriedenheit der Fahrgäste.
Der erwähnte Report der Ernährungsindustrie stammt aus dem Jahr 2011. Und wie es scheint, ist es der Branche seither nicht gelungen, erkennbar neues Vertrauen bei ihren Kundinnen aufzubauen. 2018 schrieben Autoren der Marketingberatung Zühlsdorf + Partner und des Lehrstuhls »Marketing für Lebensmittel und Agrarprodukte« der Universität Göttingen in einer Studie zum Thema Qualitätstransparenz: Nur knapp 15 Prozent der Befragten geben an, die Angaben auf Lebensmitteln zu verstehen; 85 Prozent gestehen, gar nicht mehr oder nur noch teilweise durchzublicken; 44 Prozent finden es schwer, die Qualität von Lebensmitteln zu beurteilen, und weitere 41 Prozent empfinden es zumindest teilweise genauso. Besonders aufschlussreich ist in der Studie der Vergleich der Erwartungen der Verbraucherinnen bezüglich ganz bestimmter Qualitätsdimensionen mit der tatsächlichen Erkennbarkeit dieser Qualitäten am Produkt: Die größten Differenzen finden sich bei sozialen Aspekten wie Arbeitsschutz und Kinderarbeit, beim Geschmack, der Tierfreundlichkeit, Gentechnikfreiheit und Gesundheit. »Bei diesen Merkmalen sind die für den Kauf als wichtig angegebenen Eigenschaften für viele Verbraucher am Produkt nicht gut erkennbar«, schreiben die Autorinnen und konstatieren, die Vertrauensdefizite in die Unternehmen seien alarmierend. Einer der vielen Belege dafür ist, dass 64 Prozent der Verbraucher der Meinung sind, dass es auf dem Lebensmittelmarkt viele »schwarze Schafe« gibt, weitere 29 Prozent gehen davon »teils/teils« aus.[2]
Preiswettbewerb statt Qualitätswettbewerb
Wie konnte es so weit kommen? Woher rührt das tiefe Misstrauen der Verbraucherinnen, und warum sind wir nicht in der Lage, unsere Nahrungsmittel qualitativ zu beurteilen? Die Fragen berühren die Lebensmittelwirtschaft insgesamt, aber vor allem die großen finanzstarken Handelskonzerne Edeka, Aldi, Rewe und Lidl. Denn diese vier Konzerne – oft als »Big Four« bezeichnet – bestimmen mehr denn je, was wir essen, welche Qualität und Nicht-Qualität diese Lebensmittel haben und mit welcher Transparenz oder Intransparenz uns die Produkte angeboten werden. Die »Big Four« mit ihren Discounter-Töchtern Netto (gehört zu Edeka), Kaufland (Lidl) und Penny (Rewe) sind die Großmeister des Angebots, während ihre Lieferanten – die Lebensmittelherstellerinnen und Landwirte – oft nur noch die Bittsteller sind. Der Hamburger Wettbewerbsökonom und Einzelhandelsexperte Prof. Dr. Rainer Lademann sagt: »Die Top 4 des Lebensmitteleinzelhandels verhalten sich auf den Beschaffungsmärkten inzwischen als Marktbeherrscher.«[1]
Ein Pfeiler ihrer Macht ist die Tatsache, dass diese vier Handelsketten mehr als 85 Prozent des deutschen Lebensmittelmarkts dominieren und damit ein Oligopol bilden;[2] an manchen Orten und Regionen entfalten sie sogar quasi monopolistische Marktmacht, weil es für Kundinnen dort schlicht keine anderen Anbieter mehr in erreichbarer Nähe gibt. 85 Prozent für ganze vier Unternehmen – das ist unter Wettbewerbsgesichtspunkten eine Katastrophe. Dieser Zustand ist so verbraucherfeindlich wie die Dominanz weniger Mineralölkonzerne im deutschen Tankstellennetz oder so, als würde es hierzulande nur noch VW, BMW, Mercedes und Opel geben – bei geschlossenen Grenzen für ausländische Autobauer. Verantwortlich dafür ist die Politik, die diese Entwicklung seit Jahrzehnten ignoriert, zum Teil sogar fördert – etwa im Jahr 2016 durch eine Sondergenehmigung des damaligen Wirtschaftsministers Sigmar Gabriel (SPD) für Marktführer Edeka, der die Erlaubnis zur Übernahme der Supermarktkette Kaiser’s Tengelmann erhielt, gegen den ausdrücklichen Rat des Bundeskartellamts und der Monopolkommission.
Verbraucherinnen mögen die 85 Prozent Marktanteil für nur vier Konzerne zunächst unbedeutend erscheinen. Für Lebensmittelhersteller und Landwirtinnen hingegen wirkt diese 85-Prozent-Marke wie ein langer dünner Flaschenhals: Wenn sie es mit ihren Lebensmitteln nicht in die Mega-Ketten schaffen, haben sie kaum noch Alternativen, ihre Produkte zu verkaufen. Überdies sind die Regalflächen in den Supermärkten begrenzt, gerade bei den Discountern, die meist weniger als 2000 Artikel führen, ist oft nur Platz für zwei oder drei Alternativen eines Produkts. Bei den Supermärkten, deren Sortimente etwa 10000 Artikel umfassen, ist die Auswahl zwar größer, aber immer noch weit entfernt von den rund 170000 Produkten, die die Lebensmittelwirtschaft anbietet. Das ist die simple deutsche Supermarkt-Ökonomie: Auf der einen Seite vier Mega-Händler, die den Platz in ihren Regalen knapp halten, auf der anderen Seite viele Lebensmittelproduzentinnen mit einem mehr oder weniger austauschbaren Warenangebot. Im Grunde ist es überall so wie bei Aldi in Großbritannien: Dort rief der Discounter Anfang 2022 in einem landesweiten Wettbewerb britische Lebensmittelproduzenten dazu auf, sich um einen Platz in seinen Regalen zu bewerben, der Titel des Castings, »Stars in their Aisles« (dt. »Stars in den Gängen«), war eine Anspielung auf die im Vereinten Königreich populäre TV-Talentshow »Stars in their Eyes«. Die Bittstellerrolle der Herstellerinnen liegt auf der Hand.
Wie sich die Machtverhältnisse verschoben haben, ist fast täglich in Fachmedien der Lebensmittelwirtschaft nachzulesen, wenn sie berichten, wie die großen Handelskonzerne selbst Konflikten mit mächtigen Markenherstellern wie Nestlé oder PepsiCo nicht mehr aus dem Weg gehen und deren Produkte einfach »auslisten« – sprich: aus dem Sortiment schmeißen –, sobald die geforderten Preise und sonstigen Konditionen nicht passen. Inzwischen werden solche Verhandlungen von manchen Supermarktketten auch gern über die Medien ausgetragen wie zum Beispiel durch Edekas Discount-Tochter Netto. Über Instagram und Facebook warf Netto dem Riegelproduzenten Mars vor, »Mondpreise« zu verlangen, also völlig überhöhte Preise, und stellte der Packung »M&M’s« von Mars die viel billigeren Süßigkeiten der Netto-Eigenmarke »Schokoliebe« entgegen, Tenor: »Keine Lust auf Mondpreise von Mars? Dann geh’ doch zu Netto!«
Nun ist bei Giganten wie Mars, Nestlé oder PepsiCo Mitleid unangebracht, doch solch öffentlich ausgetragene Preisverhandlungen mit Schwergewichten der multinationalen Lebensmittelwirtschaft sind eine wirksame Drohkulisse für die vielen kleineren Herstellerinnen: Auf diese Weise erfahren sie, was ihnen blühen kann, wenn sie dem Diktat der Ketten nicht folgen. »Nur wenige Hersteller haben sehr starke Marken, von denen sie wissen, dass der Handel nur ungern auf sie verzichtet«, sagt Ökonom Rainer Lademann. »Fällt nur eine der vier Supermarkt-Ketten als Auftraggeber weg, kommen viele Hersteller schon in ernsthafte Schwierigkeiten. Die ›Big Four‹ sind für fast alle Produzenten inzwischen mehr oder weniger unverzichtbar. Damit bleibt wirksamer Wettbewerb auf der Strecke, und das ist kein guter Zustand.«
Eine weitere Säule der Marktmacht bilden die Eigen- oder Handelsmarken von Lidl & Co.: Sie werden entweder im Auftrag und nach den ganz spezifischen Anforderungen der Supermärkte von Lebensmittelfirmen hergestellt, oder die Händler produzieren sie selbst in ihren eigenen Werken. Edeka zum Beispiel gehören die Safthersteller »Sonnländer« und »Albi«, dazu zwölf Fleischwerke, 14 regionale Backbetriebe und eine Kellerei; Rewe betreibt seine eigene Großbäckerei (»Glocken«) und stellt unter der Eigenmarke »Wilhelm Brandenburg« in Eigenregie Fleisch- und Wurstwaren her; Aldi röstet seinen Kaffee selbst, und Lidl produziert in den eigenen Fabriken Schokolade, Knabbersnacks, Eis, Getränke, Trockenfrüchte, Backwaren und seit neuestem auch Nudeln.
Im deutschen Lebensmitteleinzelhandel machen Eigenmarken knapp 40 Prozent aus, bei Discountern wie Aldi können sogar neun von zehn Produkten Handelsmarken sein. Durch sie nehmen die ohnehin großen Einflussmöglichkeiten des Handels auf das Sortiment weiter zu: Denn die »Big Four« sind gleichzeitig Händler und Produzent – und damit auch Konkurrenten ihrer Lieferantinnen, denen sie die billigeren Eigenmarken vor die Nase halten wie im oben genannten Beispiel von Nettos »Schokoliebe«, das gegen »M&M’s« von Mars in Stellung gebracht wurde. Mitunter werden auch gleich ganze Warenkörbe verglichen, wie das im Sommer 2022 Aldi ungeniert in einer Werbekampagne praktizierte: Die großformatigen Zeitungsanzeigen präsentierten 16 Produkte vom Pesto über Sekt bis zu Ketchup und Bier, mal als Eigenmarken »von Aldi«, mal als Herstellermarken »bei Aldi«. Daneben die zwei unterschiedlichen Kassenzettel und der Hinweis: »-51 % sparen mit der Eigenmarke«.
Die Preis-Diktatoren
Die Kehrseite solch öffentlicher Preisvergleiche ist oft dunkel, so dunkel, dass selbst die Bundesregierung auf ihrer Website schreibt, die vier großen Handelsketten mit ihrem Marktanteil von mehr als 85 Prozent würden »ihr Preisdumping bei den Verkaufspreisen nach unten weitergeben«.[1] »Unten« – das sind in diesem Fall Milchbauern, Schweinemästerinnen, Obst- und Gemüsebauern, mittelständische Lebensmittelherstellerinnen. Ihre Situation im ungleichen Machtkampf mit den »Big Four« war und ist in vielen Fällen so prekär, dass es seit Mitte 2021 ein eigenes Gesetz gibt, um wenigstens die schlimmsten Auswüchse einzudämmen.[2] Dieses »Gesetz zur Stärkung der Organisationen und Lieferketten im Agrarbereich« setzt eine Richtlinie der EU um und verbietet Praktiken einer sogenannten »schwarzen Liste« beziehungsweise schränkt Praktiken einer »grauen Liste« ein. Dass der europäische und der deutsche Gesetzgeber ein solches Regelwerk überhaupt erlassen haben, gibt eine Ahnung davon, wie es zuging und teilweise immer noch zugeht im Verhältnis der Handelskonzerne und ihrer Lieferantinnen: Verboten ist jetzt zum Beispiel, dass Händler unverkaufte Ware zurückschicken, ohne den Kaufpreis zu zahlen; verboten ist die kurzfristige Stornierung verderblicher Agrarerzeugnisse; Händler dürfen jetzt nicht mehr mit geschäftlichen Vergeltungsmaßnahmen drohen, geschweige denn solche anwenden, »wenn der Lieferant von seinen vertraglichen oder gesetzlichen Rechten Gebrauch macht oder seine gesetzlichen Pflichten erfüllt«; Supermärkte und Discounter dürfen auf ihre Lieferanten jetzt weder eigene Lagerkosten abwälzen noch Kosten, die durch Fehlverhalten des eigenen Personals entstehen; und die Händler müssen nun für verderbliche Erzeugnisse innerhalb von 30 Tagen zahlen.
Vielleicht verhindert das Gesetz hierzulande tatsächlich, dass Supermärkte über Nacht einen Auftrag für 20 Paletten Salatköpfe stornieren, während sie die Zahlung der längst verkauften 30 anderen Paletten seit zwei Monaten verweigern. Ob das Gesetz auch internationale Lieferketten zum Besseren verändert, muss bezweifelt werden. Warum diese Zweifel begründet sind, beschreibt ausgerechnet eine Publikation von Lidl, die sich mit der menschenrechtlichen Situation von Pflückerinnen und Pflückern in der spanischen Region Huelva beschäftigt, aus der ein Großteil der Beeren in deutschen Supermärkten kommt. Als »strukturelle Ursachen« für die beklagenswerten Arbeits- und Lebensbedingungen der Saisonarbeiter nennt der Report überraschend offen die »Marktdynamik«: »Der Lebensmitteleinzelhandel zeichnet sich durch eine hohe Wettbewerbsintensität aus. Niedrigpreisstrategien haben sich dabei für Supermärkte als erfolgreiches Geschäftsmodell erwiesen (…) Da lediglich vier Supermärkte den deutschen Einzelhandel kontrollieren, haben sie einen großen Einfluss zum Beispiel auf Qualitäts- und Einkaufsbedingungen. Dadurch können sie erheblichen Druck auf Lieferanten ausüben (…) Von den Erzeuger:innen wird erwartet, dass sie hohe Qualitäts- und Verpackungsstandards zu einem möglichst niedrigen Preis erfüllen. Der Anreiz, die Kosten zu senken, ist für die Erzeuger:innen daher hoch. Einsparungen finden vor allem auf Ebene der Arbeiter:innen statt.« Der Beerensektor in Huelva, resümiert die Studie, sei charakterisiert durch die »Konkurrenz zwischen dem Wohlergehen der Saisonkräfte und dem Profit«.[3]
Man kann diese Analyse von Europas größtem Lebensmittel-Einzelhändler als versteckten oder unfreiwilligen Aufruf für mehr staatliche Regulierung lesen. Denn die von Lidl beschriebene »Konkurrenz zwischen dem Wohlergehen der Saisonkräfte und dem Profit« – ein klassisches Dilemma – ist nichts, was Lidl allein auflösen könnte. Das beste Beispiel dafür lieferte Lidl selbst, als man vor wenigen Jahren versuchte, nur noch »fair« gehandelte Bananen zu verkaufen – zu höheren Preisen als die Konkurrenz. Das Projekt scheiterte nach kurzer Zeit, weil die anderen Händler nicht mitzogen und Lidl Marktanteile abnahmen. Mit dem Satz »Der Kunde will eine billige Banane« beendete der damalige Lidl-Chef das Experiment.[4]
Dieser Ausgang war abzusehen, es hätte nicht anders kommen können. Weil man von keinem Unternehmen, schon gar nicht von einem Supermarkt-Giganten wie Lidl, erwarten kann, dass es sich freiwillig aus dem Markt schießt. So funktioniert Marktwirtschaft nicht. Wenn man unterstellt, dass auch Supermarkt-Manager die Welt lieber retten als zerstören wollen, bleibt ihnen in der Billig-Preis-Logik der vier deutschen Supermarkt-Riesen nichts anderes übrig, als die Welt immer nur ein ganz klein bisschen besser zu machen. Mit einem Faire-Bananen-Projekt hier und einer »Klima-Offensive« dort. Oder wie Lidl mit der Selbstverpflichtung, bis Ende 2025 bei den Eigenmarken mit Kinderoptik auf der Verpackung, also z.B. Comic- oder Tierfiguren auf Fruchtjoghurts oder Frühstückscerealien, nur noch solche Produkte verkaufen zu wollen, die die Kriterien der Weltgesundheitsorganisation für ausgewogene Produkte erfüllen – »ausgenommen Aktionsartikel zu Weihnachten, Ostern und Halloween«. Die »gute Tat« gilt also nur für Eigenmarken und auch nicht in jenen Zeiten, in denen diese Produkte besonders gern gekauft werden. Man kann deshalb sagen: Lidl täuscht Verantwortung vor. Man kann aber auch sagen: Lidl tut, was Lidl tun kann, ohne sich selbst zu schaden.
Teuer ist nicht gut, billig ist nicht schlecht
Seit vielen Jahren antworten die Deutschen relativ konstant auf die Frage, ob sie beim Einkaufen vor allem auf den Preis oder auf die Qualität achten: Die Verteilung ist in etwa halbe-halbe mit leichten Überhängen für die Qualitätsbewussten. Den tiefsten Wert (41 Prozent) hatte die Qualitätsorientierung interessanterweise 2003, im Jahr zuvor wurde der Werbeslogan »Geiz ist geil« zum geflügelten Wort in Deutschland. Das Discounter-Prinzip erfanden die Gebrüder Albrecht mit Aldi bereits in den 1960er Jahren und pflügten so den Lebensmitteleinzelhandel kräftig um.
Zu billigen Lebensmitteln zu greifen, ist für viele Menschen eine Notwendigkeit und hat mit Geiz nichts zu tun. Aber für noch viel mehr Menschen ist der Griff zum Billig-Produkt auch deshalb eine völlig rationale Entscheidung, weil der Preis zum letzten Differenzierungsmerkmal im Supermarkt geworden ist. Wo die Qualität von Produkten verschleiert, verzerrt, verheimlicht wird, leuchtet das Preisschild umso greller.
Verantwortlich für den Qualitätsblindflug in Deutschlands Supermärkten ist am Ende die Politik. Sie hat zugelassen, dass aus dem Vertrauensgut Lebensmittel Produkte wurden, denen immer weniger Menschen trauen: Die Politik hat entschieden, dass bestimmte Stoffe in Lebensmitteln, die den Ausschlag geben für ein informiertes Qualitätsurteil, nicht deklariert werden müssen. Die Politik toleriert, dass auf dem Fleisch gequälter Tiere das »Tierwohl«-Label klebt. Die Politik akzeptiert, dass die Herkunft vieler Lebensmittel im Dunkeln bleiben kann und sich jeder Fabrikbäcker als traditioneller Handwerksbetrieb darstellen darf. Die Politik verantwortet verantwortungslose Werbung für ungesunde Süßigkeiten, die sich gezielt an Kinder richtet, und tut nichts gegen einen Siegel-Dschungel, den keine normale Supermarktkundin mehr durchdringt. Wo Intransparenz und Irreführung über die Qualität von Produkten die beherrschenden Merkmale des Marktes sind, darf sich niemand wundern, dass der Preis regiert. Aus dem hilfreichen Preis-Leistungs-Verhältnis sind eindimensionale Preis-»Leistungs«-Verhältnisse geworden.
Für das Geschäftsmodell der Supermärkte sind das ideale Verhältnisse. Denn wo Qualität durch ganz legale Praktiken für den Kunden unkenntlich gemacht werden kann, ist der Anreiz umso größer, mit billigen Rohstoffen, nicht deklarierungspflichtigen Zusatzstoffen, täuschender Aufmachung und anderen Strategien die Gewinnmargen zu steigern. Und billige Produkte »drehen sich schneller« – sie werden eher verkauft als teure –, das hilft der Umsatzrendite.
Die »Großen Vier« sind mächtige Player. Sie allein entscheiden, was sie uns Verbraucherinnen in die Regale stellen. Mit ihrer Nachfragemacht und ihren Eigenmarken haben sie eine immense Wirkung darauf, wie Landwirtschaft betrieben wird, wie es arbeitenden Menschen und Nutztieren geht, wie sich die Strukturen der Lebensmittelwirtschaft verändern, wie gesund oder ungesund wir uns ernähren. Aber keiner der »Großen Vier« kann die Billig-Preis-Logik alleine aufbrechen, ohne sich selbst zu schaden – was niemand erwarten kann und sollte.
Nur Politik kann Regeln setzen, die im Sinne der Verbraucher den gesamten Markt verbessern und nicht nur einzelne Nischen einzelner Anbieterinnen. Politik muss endlich dafür sorgen, dass durch Transparenzpflichten echter Qualitätswettbewerb entsteht, der Kundenbedürfnisse bedient und Qualitätshersteller und -händlerinnen belohnt. Ein Wettbewerb, der Preis und Qualität endlich ins Verhältnis bringt. Der Kunden zu Königen macht und nicht zu Dienern wirtschaftlicher Interessen.
2.Brot + Brötchen
Seltsame Handwerker sind sie, diese Supermarktbäcker. Sind sie überhaupt noch Handwerker? Und was verkaufen sie uns da eigentlich? Eine ebenso kurze wie sarkastische Antwort darauf hat der Twitterstar El Hotzo gegeben: »Man kann der Menschheit viel vorwerfen, aber aus der Kombination aus Wasser und Mehl hat sie echt absolut alles rausgeholt.«
An der »Vorkassenbäckerei« eines Edeka-Supermarkts, in dem ich gelegentlich einkaufe, hängt ein rundes Pappschild von der Decke. Darauf stehen die Jahreszahl 1919 und die Wörter »Leidenschaft« und »Tradition«. Schaut man auf der Website der »Markt-Bäckerei« – so heißt die Edeka-Tochter mit ihren Hunderten von Filialen – nach, wie sie sich selbst beschreibt, stößt man auf ein Selbstlob, das selbst unter Marketinggesichtspunkten nur schwer erträglich ist. »Wir sind nicht irgendein Bäcker und auch kein Industriebetrieb, der Industrieware produziert«, heißt es dort. »Backkultur, das ist die pure Freude am Handwerk, das ist Leidenschaft bis ins Detail, das ist Stolz auf die wunderbare Welt des Backens (…). Backen heißt vor allen Dingen: Arbeiten mit den Erzeugnissen, die uns die Natur zu Verfügung stellt, echte Handarbeit mit den Elementen.« In einem begleitenden minutenlangen Imagefilm, der kein Klischee und kein Schlagwort auslässt, sagt eine sonore Erzählerstimme – untermalt von reichlich Klaviermusik – Sätze, für die man sich fremdschämt: »Bäcker machen die Nacht zum Tage, bevor der erste Hahn kräht (….) Kaum jemand bekommt sie je wirklich zu Gesicht, aber ihre Arbeit, ihre Arbeit verbreitet jeden Morgen jenen herrlichen Duft in der Bäckerei, der uns ein Leben lang begleitet: der Duft unserer Kindheit, der Erinnerungen weckt an Heimat, der uns zurückkehren lässt ans offene Feuer, zu Gemeinsamkeit, zu natürlichen Rohstoffen, zurück zum Geschmack (…). Brot reflektiert Kulturen, Brauchtum, Traditionen, Geschichte, (…) wir teilen es seit Hunderten von Jahren (…). Ohne Brot ist der Tisch nur ein Brett. Füllen wir die Tische mit Leben.«
Man sieht Kinderzeichnungen von Traktoren, knisterndes Feuer, lachende Menschen beim Brotessen am Tisch, eine Hand, die in Zeitlupe in Erde greift, ein Getreidefeld vor untergehender Sonne. Es ist die Rede von Nachhaltigkeit, zukünftigen Generationen, von Bodenständigkeit, Verlässlichkeit, Wertschätzung, von der Vielfalt des heimischen Obsts und dem Reichtum der Region. »Liebe, die durch den Magen geht.« »Weil Brot für uns mehr ist als nur Mehl und Wasser.« Und als großes Finale der Satz: »Die Nacht weiß viel zu erzählen, vor allem wenn man Bäcker ist.«
Gut möglich, dass es auch derlei Prosa war, mit der die Unesco dazu gebracht wurde, das deutsche Bäckerhandwerk als »immaterielles Kulturerbe« anzuerkennen: Es habe die Vielfalt – mehr als 3000 (!) eingetragene Brotsorten – und Qualität des deutschen Brotes über die Jahrhunderte entwickelt und bewahrt, so die Unesco; im Brot lebten die alten Traditionen fort, »wobei neueste Erkenntnisse der Wissenschaft stets in die Herstellung der Backwaren einfließen«.
So kann man es sehen. Aber auch ganz anders – vor allem bezüglich der »neuesten Erkenntnisse der Wissenschaft«, die in die Backwarenproduktion einfließen. Man kann es nämlich so sehen wie der Lebensmittelchemiker Udo Pollmer in seinem Buch Zusatzstoffe von A bis Z. Den reichlichen und den meisten Kundinnen unbekannten Gebrauch von Zusatzstoffen und anderen Zugaben in allerlei Backwaren verdichtet Pollmer zu der These: »Fabrikbrot vom Bäcker: Ein Handwerk gibt sich auf.«[1]
Alchemie in der Backstube
Die Fundamentalkritik gründet auf der Tatsache, dass die klassischen Zutaten für Backwaren längst um eine lange Liste Dutzender Zusatzstoffe erweitert wurden, ohne die die meisten Supermarktbackwaren heute nicht denkbar sind. EU-weit sind rund 380 Zusatzstoffe zugelassen, knapp 160 davon können in Brot und Brötchen zum Einsatz kommen. Es gibt Süßungs- und Antioxidationsmittel, Konservierungs- und Trägerstoffe, Mehlbehandlungs-, Backtrieb- und Feuchthaltemittel, Stabilisatoren und Emulgatoren, Geliermittel, modifizierte Stärken und noch viele Helfer mehr. Sie alle dienen dazu, die Backwaren haltbarer, größer, knuspriger, farbiger, frischer, schmackhafter, geruchsintensiver zu machen, als es »nur« mit Mehl, Wasser, Salz und Hefe möglich wäre. Die einen Stoffe machen die Poren größer, die anderen bleichen Toastbrot, die dritten ersetzen die mehrstündige Teiggärung, die vierten stabilisieren die Prozesse beim Einfrieren und Auftauen der Teiglinge, die fünften verhindern das Anbacken auf der Unterlage.
Nicht zu vergessen die üppig verwendeten technischen Enzyme, die zu den Verarbeitungshilfsstoffen (früher »technische Hilfsstoffe«) gerechnet werden. Enzyme stecken zwar auch natürlicherweise im Mehl, aber in unterschiedlicher Menge und von unterschiedlicher Qualität, weshalb beim Backen zu Hause am einen Tag ein geschmeidiger Teig gelingt und am nächsten ein klebriger entsteht. »Die Natur ist von Natur aus unzuverlässig«, schreibt dazu das »Wissensforum Backwaren« des Backzutatenverbands: Manche Enzyme seien »sehr strenge Drill Instructors und machen ihren Substanzen richtig Dampf unterm Hintern«, während andere »genauso faul sind wie die Stoffe, die sie zum Reagieren bringen sollen«.[1]
Derlei natürliche Schwankungen sind mit den Anforderungen einer Backfabrik, in der viele Maschinen miteinander vertaktet sind und alles sehr schnell gehen muss, nicht kompatibel: Wo mehrere zehntausend Backteile in der Stunde nahezu vollautomatisch produziert werden – Lidls konzerneigene Großbäckerei »Bonback« produziert mehr als acht Millionen Brötchen in der Woche –, muss das bearbeitete Teigmaterial immer gleich »maschinengängig« sein, also dehnbar, elastisch, unempfindlich. Deshalb die zusätzlichen Enzyme, die aus dem »unzuverlässigen« Naturprodukt Mehl mit seinem eigenen defizitären Enzymspektrum einen maschinentauglichen Rohstoff zaubern. Deshalb die oft mit gentechnisch veränderten Mikroorganismen hergestellten Glucoseoxidasen, Xylanasen, Lipasen, Proteasen und anderen High-Tech-Enzymen als zusätzliche Mehl-Zugaben, die für die gewünschten »special effects« im Teig sorgen, vom beschleunigten Aufgehen bis zum verzögerten Austrocknen. Deshalb »Wunder-Enzyme« wie die Amylasen, die verpacktes Toastbrot auf Wunsch des Handels bis zu neun Wochen haltbar machen.[2]
Traditionelle Backkunst? Handwerksarbeit? Kein Schreinermeister prahlt damit, dass er auch die schwierigsten Holzverbindungen noch von Hand mit dem Fuchsschwanz sägt – obwohl in seiner Werkstatt teure CNC-Maschinen stehen. Und jede Heizungsinstallateurin, die sich mit digitalen Heizungsanlagen auskennt, stellt das als modernes Leistungsmerkmal ins Schaufenster. Bäcker hingegen versuchen selbst dann noch jeden Eindruck von industrieller Fertigung weit von sich zu weisen, wenn sie längst zur quasi-industriellen Großbäckerei gewachsen sind, die Dutzende von Supermarktfilialen beliefert.
Es sieht so aus, als säßen die Backbranche und mit ihr die Supermärkte in der selbst gestellten Traditionsfalle: In ihren Backwaren-Fabriken suchen sie nach den letzten Krumen handwerklicher Arbeit, die aufgeblasen werden wie Brötchen mit enzymatischen Backmitteln. Dabei sind selbst in Bio-Großbäckereien zwei Drittel der Beschäftigten angelernte Mitarbeiterinnen – und eben keine Bäckermeister und -gesellinnen. Selbst dort wird rund um die Uhr gearbeitet und jeder Handgriff, der automatisierbar ist, wird von Maschinen übernommen, wenn es sich betriebswirtschaftlich rechnet. Auch in Bio-Bäckereien werden Teiglinge schockgefrostet und dann an Filialbäckereien und (Bio)-Supermärkte verschickt, wo sie zum Aufbacken im Ofen landen. Und auch bei Bio-Backwaren ist der Einsatz technischer Enzyme keine Seltenheit.[3]
Oder nehmen wir das Massenprodukt Laugenbrezel. Über sie schreibt die Allgemeine Bäckerzeitung (die natürlich kein normaler Supermarkt- oder Bäckereikunde liest): »Die Herstellung in industriellen Stückzahlen gegenüber der mühevollen Handarbeit gebot es vielen Bäckern, mit der Zeit auf die Zulieferung der Laugenteiglinge durch industrielle Anbieter (…) zurückzugreifen. Zählte es einst zum handwerklichen Geschick eines Bäckers, die Brezel in einem ›Wurf‹ zu schlingen, so übernehmen heute moderne Maschinentechnik und Geräte diese Handwerkskunst.« So soll eine Anlage zur vollautomatisierten Brezelformung sogar in der Lage sein, verschiedene Brezel-Varianten zu beherrschen: die mit »einfachem oder doppeltem Knoten, nach schwäbischer oder bayrischer Art, also mit bauchigem, konischem oder zylindrischem Brezelstrang«. Über die vollautomatischen Brezelbackautomaten schreibt die Bäckerzeitung außerdem, es gebe Geräte, deren Bedienung »kinderleicht« sei: Man müsse die tiefgefrorenen Teiglinge nur aus dem Froster auf ein laufendes Netzband legen; »die Brezeln werden dann vom Brezelbackautomaten aufgetaut, gesalzen, knusprig braun gebacken, aus dem Ofen in einen Auffangkorb geleitet und dort warmgehalten.« So könnten Bäckereien laut der Automatenhersteller zu jeder Tageszeit warme Brezeln anbieten.
Mit Sicherheit gibt es noch Bäckerinnen, die handwerklich arbeiten, wenige Zusatzstoffe verwenden und ohne technische Enzyme auskommen. Die in Kauf nehmen, dass ihre Waren teurer sind, weil mehr Handarbeit und mehr Gärzeit in ihnen stecken. Die damit leben, dass ihre Brötchen ein wenig kleiner sind und in ihren Auslagen nur acht Kleingebäcksorten liegen, während die Konkurrenz mit dem Doppelten aufwartet. Handwerker wie das Netzwerk der »Freien Bäcker«, die auf industriell gefertigte Teiglinge ebenso verzichten wie auf Backvormischungen, technische Enzyme und Emulgatoren. Es gibt solche Bäckereien noch, nur sind sie für die Kundin wegen unzureichender Regulierung kaum identifizierbar in einer Branche, die sich fast flächendeckend – und ganz legal – als Handwerksbäcker geriert. Die Chance, dass man sie im Supermarkt oder in dessen Vorkassenbereich findet, ist jedenfalls sehr gering.
Vor ein paar Jahren stritten der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks und Aldi Süd vor Gericht über die Frage, ob man es »Backen« nennen dürfe, wenn aus Backautomaten auf Knopfdruck Backwaren in ein Fach fallen. Aldi Süd bewarb die Produkte aus seinem »Backtresor« damals als frisch gebackene Brötchen und Brote, während die Handwerksbäcker das für Irreführung hielten, weil in den Backöfen nur Teiglinge aufgetaut und angebräunt würden. Der berühmte Brötchenstreit endete mit einem Vergleich, ohne dass die Frage juristisch geklärt worden wäre. Interessant daran war, wie ausgerechnet die Deutsche Handwerkszeitungdarüber berichtete: Bei der Verhandlung vor dem Landgericht habe der sachverständige Gutachter – ein anerkannter Brotexperte mit Professorentitel – trotz eines zweistündigen Vortrags über Brot und Brötchen keine klare Antwort auf die Frage geben können, ob in den Aldi-Automaten gebacken wird oder nicht. Nach Ansicht des Gutachters, so die Handwerkszeitung