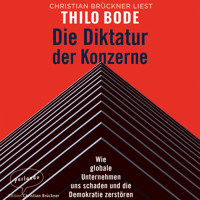9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Bestsellerautor, TTIP-Aktivist und Anwalt der Bürger Thilo Bode über die neue Macht der Konzerne: Wie sie den Staat als Geisel nehmen und uns beherrschen. Internationale Konzerne hinterziehen Steuern, schädigen die Umwelt, verstoßen gegen Menschenrechte und diktieren den Politikern die Gesetzesvorlagen. Und das oft ganz legal. Doch damit nicht genug: Sie werden immer dreister, nutzen die Freiräume und Schlupflöcher immer hemmungsloser, eine neue Qualität der Ausbeutung ist erreicht. In seinem neuen Buch zeigt Thilo Bode erstmals das ganze Bild dieser neuen Diktatur der Konzerne, in deren Würgegriff wir Bürger immer stärker geraten. Anhand zahlreicher Beispiele erklärt der unabhängige und leidenschaftliche »Anwalt der Bürger« anschaulich die Zusammenhänge und stellt klar: Die Macht der Konzerne lässt sich brechen – wir können unsere Souveränität zurückerobern!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 248
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Thilo Bode
Die Diktatur der Konzerne
Wie globale Unternehmen uns schaden und die Demokratie zerstören
Über dieses Buch
Internationale Konzerne hinterziehen Steuern, schädigen die Umwelt, verstoßen gegen Menschenrechte und diktieren den Politikern die Gesetzesvorlagen. Und das oft ganz legal. Doch damit nicht genug: Sie werden immer dreister, nutzen die Freiräume und Schlupflöcher immer hemmungsloser, eine neue Qualität der Ausbeutung ist erreicht.
In seinem neuen Buch zeigt Thilo Bode erstmals das ganze Bild dieser neuen Diktatur der Konzerne, in deren Würgegriff wir Bürger immer stärker geraten. Anhand zahlreicher Beispiele erklärt der unabhängige und leidenschaftliche Anwalt der Bürger anschaulich die Zusammenhänge und stellt klar: Die Macht der Konzerne lässt sich brechen- wir können unsere Souveränität zurückerobern.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2018 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Sonja Steven, Büro KLASS
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490687-4
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Vorwort
1. Die neue Macht
Konzerne außer Kontrolle
Das Ende der Systemkonkurrenz
Die Grenzen der Kartellpolitik
Supermächte
Wirtschaftliche Macht wird politische Macht
2. Der industriell-politische Komplex
Der »Drehtüren«-Mechanismus
»Die Regierung in die Tasche stecken«
Davos: Konzernideologie auf der Weltbühne
Wie der industriell-politische Komplex regiert
»Drecksforschung«
Konzerne kaufen Wissenschaft
3. Schaden ohne Verantwortung Beispiele
3.1. Der Klimawandel: die Energie- und Autokonzerne
Subventioniertes Treibhaus
Konzern- und Kohlekanzlerin Merkel
Klima-Lügen als Strategie
Die Sprit-Lüge
Peruanischer Bergbauer gegen deutschen Stromkonzern
3.2. Bürger müssen zahlen: die Banken
Bis zur Halskrause verschuldet
Zocker und »besoffene« Politiker
»Government Sachs«
3.3. Globale Diabetesepidemie: die Nahrungsmittelkonzerne
Brasilien: Nestlé als Wohltäter der Armen
Malaysia: Wirtschaft kapert Wissenschaft
Afrika: Geschäfte mit der Mangelernährung
»Better business, better world«?
Der »Krieg« von Coke & Co.
3.4. Softe Diktatur: die Digitalkonzerne
Kontrollverlust
Algorithmen sind nicht neutral
Digitale Polizei
Amazon
Essensmarken für Amazon-Beschäftigte
Apple
Ist der Geist aus der Flasche?
4. Haftung als Konsequenz
Die Architektur der Straffreiheit und die Alternativen
Die Serientäter von VW
Deutsches Konzernprivileg: Ordnungswidrigkeit statt Straftat
Sammelklagen für Verbraucher: »Komplett streichen!«
Justiz ohne Mittel
Der Fall DuPont: Schäden, die sich rechnen
Verantwortungs-PR
Haftung und Macht
Was geschehen muss – eine Schlussbemerkung
Dank
Vorwort
Zum Zeitpunkt, als ich dieses Vorwort schreibe, steigt in Deutschland gerade wieder die Zahl der Corona-Infizierten, droht die »dritte Welle« der Pandemie. So erratisch das Krisenmanagement der Regierung auch ist, so klar zeichnet sich ab, wie die Lasten der Krise verteilt werden: Während die Lufthansa zur Freude ihrer Aktionäre mit Milliarden von Euro gestützt wird, warten kleine und mittlere Unternehmen vergeblich auf Hilfen; während beim Online-Giganten Amazon die Umsätze explodieren, sterben die Läden in den Innenstädten noch schneller; und während kommunale Krankenhäuser, die Corona-Kranke versorgen, Millionenverluste einfahren, steigern private Kliniken, die sich aus der Daseinsvorsorge verabschiedet und auf lukrative Behandlungen spezialisiert haben, ihre Renditen.
Dass das Virus alle gleichermaßen treffe, wie es zu Beginn der Pandemie oft hieß – damals wurden auch noch Krankenschwestern beklatscht –, entpuppt sich als Gerede. Das Gegenteil ist wahr: Die Krise verschärft die Ungleichheit, und zwar sowohl auf privater Ebene wie in der Wirtschaft: Diejenigen, die ohnehin schon reichlich von allem haben, werden noch größer, reicher, systemrelevanter. Die Konzentration wächst – und mit ihr die demokratiezerstörende ungleiche Verteilung von Macht. Insofern ist die Analyse meines 2018 vorgelegten Buchs leider aktueller denn je.
Und auch ein weiterer Aspekt verknüpft meine Betrachtungen vor der Pandemie nahtlos mit dem aktuellen Geschehen in der Corona-Krise: Angesichts historisch einmaliger gigantischer Rettungsschirme und harter regulatorischer Eingriffe von Regierungen in aller Welt stellen viele Menschen zu recht die Frage, warum es keine auch nur annähernd so entschlossene politische Antworten auf die Klimakrise gibt, die ungleich existenzieller für uns ist.
Die Fridays for Future-Bewegung hat so viele Menschen wie nie zuvor auf die Straßen gebracht. Die Klimapolitik hat das aber überhaupt nicht verändert, geschweige denn die Macht der Konzerne geschwächt. Zu befürchten ist, dass die finanziellen Belastungen durch Corona in Zukunft sogar noch als Ausrede missbraucht werden, jetzt sei nicht der richtige Zeitpunkt für weitere Belastungen für die Wirtschaft durch klimarelevante staatliche Eingriffe.
Seit 30 Jahren liegen die Instrumente für den Schutz des Klimas auf dem Tisch: CO2-Steuer, Tempolimit, Drei-Liter-Autos, mehr Strom aus Wind und Sonne und einige mehr. Was jedoch schmerzlich fehlt ist die Debatte darüber, warum all diese Instrumente nicht schon längst so eingesetzt werden, dass sie relevante Wirkung entfalten können. Mit anderen Worten: Die Machtfrage wird nicht gestellt. Dabei ist sie der Kern der Tragödie.
In der Klimapolitik wird die Macht der Konzerne so sichtbar wie sonst nirgendwo: Durch jahrzehntelanges Leugnen der Klimaerwärmung und mit gekaufter Wissenschaft in Zusammenarbeit mit dem Staat haben die Konzerne längst überfällige Regulierungen verwässert und verzögert. Diese Politik in gegenseitigem Einvernehmen ist charakteristisch für den symbiotisch agierenden, industriell-politischen Komplex: Die Geschäftsmodelle der Konzerne bleiben so gut wie unangetastet, während die Politik den Schein des Handelns aufrechterhalten kann. Die Konsequenz des verspäteten und halbherzigen Eingreifens ist, dass die Maßnahmen immer teurer werden, wie der milliardenschwere Kohleausstieg zeigt.
Hätte der Staat vorsorglich verantwortlich gehandelt und Ende der 1990er Jahre, spätestens Anfang des Jahrtausends, mit einer kontinuierlichen Absenkung der CO2-Emissionen begonnen, würden wir heute nicht über den »zulässigen« Anstieg der globalen Temperatur reden, sondern über das tatsächliche Verhindern des Anstiegs. Gleiches gilt für den Kohleausstieg: Das seit langem absehbare Ende der Kohlkraftwerke hätte – vor 15 Jahren begonnen – relativ billig und sozialverträglich gestaltet werden können. Gleichzeitig hätte die Zunahme des regenerativen Stroms zu geringeren CO2-Emissionen geführt und nicht wie jetzt zum klimaschädlichen Export von Kohlestrom in Nachbarländer.
Die Macht der Konzerne zeigt sich aber nicht nur in der gescheiterten Klimapolitik, sondern auch darin, wie schwach die Zivilgesellschaft in Wahrheit ist. Seit 30 Jahren warnen Umweltverbände vor der Klimakatastrophe. Wie recht sie hatten, zeigt sich mit jeder neuen Studie. Doch die Umweltverbände und die Zivilgesellschaft haben den Kampf verloren. Gegen die Interessen der Konzerne ist der Bürgerwille machtlos. Während Politiker einerseits zivilgesellschaftliches Engagement fordern und es zynischerweise auch noch loben wie im Fall der Fridays for Future-Bewegung, scheren sie sich einen Dreck um die wissenschaftlich belegten Forderungen dieser Zivilgesellschaft.
Es ist an der Zeit, dass sich Zivilgesellschaft und Umweltverbände diese Niederlage eingestehen: Die Zusammenarbeit mit den Konzernen und der Politik hat nichts Substanzielles bewirkt. Wir müssen deshalb unsere Strategie überdenken, uns selbst und den Menschen reinen Wein einschenken. Dazu gehört auch, nicht länger die angebliche »Macht des Einzelnen« zu beschwören, der mit seiner Kaufentscheidung im Supermarkt oder mit umweltschonender Mobilität doch so viel bewirken könne. Tatsächlich steht hinter dem Gerede von der »Macht des Einzelnen« nichts anderes als die Absicht, die Politik aus der notwendigen Regulierung herauszuhalten.
Diese Strategie verfolgen bedauerlicherweise auch viele Umweltverbände, die ihre Unterstützer mit positiven Botschaften bei Laune halten wollen. So sind manche Verbände schleichend zum Mitspieler im endlosen und wirkungslosen Klimakonferenz-Zirkus geworden. Ich jedenfalls empfinde es als Desaster, dass Umweltverbände den katastrophalen »Kohlekompromiss« unterzeichnet haben.
Unser System muss sich ändern. Wir brauchen einen Schritt zurück – zurück zu einer sozialen Marktwirtschaft, die diesen Namen verdient, und zurück zu einer Demokratie, in der wir nicht von Konzernen regiert werden, sondern von den gewählten Vertretern des Volkes.
Demokratie bedeutet nicht nur Delegation von Macht durch Wahlen, sondern auch Kontrolle von Macht. Daran fehlt es. Staatliche Macht und Konzernmacht müssen entflochten werden, damit staatliche Macht endlich wieder in der Lage ist, Konzerne im Sinne des Allgemeinwohls zu regulieren.
Nichts deutet darauf hin, dass diese Entflechtung stattfindet. Die Corona-Krise bietet dafür ein Fenster. Ob es genutzt wird, erscheint mir in diesen Tagen mehr als fraglich.
Thilo Bode, im März 2021
1.Die neue Macht
Konzerne außer Kontrolle
Als der weltgrößte Onlinehändler Amazon im Spätsommer 2017 bekanntgibt, einen Standort für eine zweite Konzernzentrale in Nordamerika zu suchen, beginnt ein wochenlanges Buhlen von 238 Städten, Regionen, Bundesstaaten und Territorien in den USA, Kanada und Puerto Rico. Amazon lässt die Bewerber wissen, man präferiere ein »wirtschaftsfreundliches Umfeld« und konkretisiert: Eine wichtige Rolle bei der Entscheidung über den Zuschlag spielen die angebotenen »Anreize« – gemeint sind damit Steuervergünstigungen, Umzugszuschüsse, Gebührennachlässe und anderes mehr. Seit dem Jahr 2000 hat der Konzern nach Recherchen von Good Jobs First annähernd 1,4 Milliarden Dollar an staatlichen Subventionen von Städten, Landkreisen und Bundesstaaten dafür eingestrichen, dass er seine Verteil- und Datenzentren bei ihnen und nicht anderswo ansiedelte.[1] Und auch diesmal soll es nach diesem Muster laufen: Investitionen und Arbeitsplätze nur gegen üppige Staatshilfe. »Amazon verkauft seine neue Firmenzentrale meistbietend«, ätzt der U.S. News & World Report und warnt die Politiker: »Beteiligen Sie sich nicht an Amazons Steuersparspiel, der Internetgigant spielt die Bewerber gegeneinander aus.«[2] Tatsächlich verweigern sich manche Städte demonstrativ, aber ausreichend viele beteiligen sich eben doch. Der Bundesstaat New Jersey zum Beispiel und seine größte Stadt, Newark, versprechen, im Fall der Zusage ein Fördergesetz so anzupassen, dass Amazon während der folgenden zwanzig Jahre Steuervorteile bis zu sieben Milliarden Dollar abgreifen kann. Eher putzig – und dennoch vielsagend in seiner Anbiederung – nimmt sich das Angebot einer Kleinstadt aus, einen Ortsteil in »Amazon City« umzubenennen und Konzernchef Jeff Bezos, den reichsten Mann der Welt, zum Bürgermeister auf Lebenszeit zu ernennen.[3] Mayor for sale – Amt zu verkaufen.
Diesel-Deutschland ist keinen Deut besser dran. Mitte 2017 wird bekannt, dass Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) zwei Jahre zuvor den Entwurf einer Regierungserklärung »mit der Bitte um Überprüfung« an den Cheflobbyisten von Volkswagen schickte, bevor er sich in der Lage sah, im Landtag über den VW-Abgasskandal zu sprechen. Die Staatskanzlei muss einräumen, dass sie Pressemitteilungen und andere Veröffentlichungen zum VW-Skandal sogar regelmäßig mit VW abgesprochen hat, um juristische Fakten überprüfen zu lassen – ausgerechnet von jenem Konzern, der mit seinen manipulierten Motoren das Recht millionenfach verletzte. Gibt es, so fragt man sich, in der niedersächsischen Staatskanzlei keine Juristen, die ihre Faktenchecks unabhängig von VW leisten könnten?[4] Wie sich in der Affäre dann noch herausstellt, hat auch die schwarzgelbe Vorgängerregierung Formulierungen mit VW abgesprochen. Wenn gilt, was ein CDU-Oberer über den ertappten SPD-Ministerpräsidenten sagt – der habe sich zum »Handlanger eines VW-Vorstandsvorsitzenden« gemacht –, dann müssen wohl alle Vorgänger in der Hannover’schen Staatskanzlei als »Handlanger« von VW gelten.[5] Inklusive Sigmar Gabriel (SPD), der selbst einmal Ministerpräsident von Niedersachsen war.
Denn nur wenige Wochen nach der aufgeflogenen Abstimmung mit VW, als es in Brüssel um schärfere CO2-Grenzwerte für Pkw geht,[6] schreibt Sigmar Gabriel, obwohl damals Außenminister, an den EU-Klimakommissar: Er fordert »genügend Freiraum« für die deutsche Automobilindustrie, deren »Innovationskraft« dürfe »nicht durch zu eng gestrickte EU-Gesetzgebung erstickt« werden.[7] Man wusste schon immer, dass für Gabriel die Interessen von VW ganz oben standen. Neu war in diesem Fall, dass er gar nicht mehr wahrzunehmen schien, wie ihm dabei die Metaphorik entglitt: »Freiraum« für die »Innovationskraft« einer Branche zu fordern, die ihre unternehmerische Freiheit für die »Innovation« einer millionenfach eingesetzten Betrugssoftware missbrauchte – darauf musste Gabriel erst mal kommen; und vor Gesetzen zu warnen, die Autobauer »ersticken«, war nur noch geschmacklos, wo es um geschädigte Atemwege und Lungen durch Abgase aus manipulierten Motoren ging.[8]
Politiker, die Konzerninteressen über Bürger- und Verbraucherinteressen stellen, sind leider etwas, woran man sich zu gewöhnen droht. Umso wichtiger ist es, die Hintergründe auszuleuchten, in denen sich Politik und Wirtschaft gefährlich vermengen. Ein weiteres Beispiel: Als es Mitte 2017 um die Übernahme der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin geht, bekommt das private Unternehmen nicht nur einen 150-Millionen-Euro-Überbrückungskredit der Bundesregierung, der zu großen Teilen verlorengegangen sein dürfte;[9] zudem sprechen sich zahlreiche Politiker dafür aus, dass der innerdeutsche Beinahe-Monopolist Lufthansa den Zuschlag für die Reste von Air Berlin erhalten solle. Das Argument: Deutschland brauche nun mal einen »nationalen Champion«. Jeder Ökonom weiß, dass das wettbewerbspolitisch blanker Unsinn ist: Kein Fluggast, kein Geschäftspartner wünschen sich einen von der Politik protegierten »nationalen Airline-Champion« – es wäre nur zu ihrem Schaden. Daniel Zimmer, ehemaliger Vorsitzender der Monopolkommission, warnt denn auch mit deutlichen Worten vor einer Komplettübernahme durch Lufthansa, deren enorme Marktmacht dadurch weiter steigen würde: »Ich habe den Eindruck, dass wir in Deutschland eine bedenkliche Nähe mancher führender Politiker zu den Leitungen großer Unternehmen haben (…) Diese Politiker merken vielleicht zum Teil nicht einmal, dass sie gerade der Entstehung eines Monopols das Wort reden, das zur Ausbeutung der eigenen Bevölkerung in diesem Falle durch überhöhte Ticket-Preise führen würde.«[10]
Amazon, VW, Lufthansa – drei fast beliebig herausgegriffene Beispiele aus jüngster Zeit, die als erste Belege für die Entwicklung dienen sollen, die in diesem Buch beschrieben wird: Große transnationale Konzerne sind immer besser in der Lage, ihre wachsende Marktmacht zu instrumentalisieren und in politische Macht zu transformieren. Immer erfolgreicher sind sie darin, ihre eigenen Interessen gegen die Ansprüche der Gesellschaft durchzusetzen. Ein beunruhigender Befund, der es notwendig macht, genauer hinzuschauen.
Zum Beispiel auf internationale Handels- und Investitionsschutzabkommen, die solchen transnationalen Unternehmen das Sonderrecht einräumen, vor privaten Schiedsgerichten Schadensersatzklagen gegen Regierungen des Gastlandes anzustrengen. Auf diese Weise halten sie den Staat von Regulierungen für das Allgemeinwohl ab, wie es im gescheiterten Freihandelsabkommen TTIP vorgesehen war und im CETA-Abkommen zwischen der EU und Kanada realisiert wurde. Allein die Androhung von Schadensersatzklagen hat Regierungen oder Kommunen schon einknicken und von Regulierungsvorhaben Abstand nehmen lassen. In einer Studie[11] von 2016 zeigen zwei kanadische Wissenschaftler, dass in 214 untersuchten Investor-Staat-Klagen »extra große« Unternehmen (Jahresumsatz über 10 Mrd. US-Dollar) und große Unternehmen (zwischen 1 und 10 Mrd. US-Dollar Umsatz) von den beklagten Staaten Entschädigungen in Höhe von 7,5 Milliarden Dollar erhielten und »superreiche« Einzelpersonen weitere rund 1,1 Milliarden Dollar. Demgegenüber erstritten Firmen und Einzelpersonen von geringerer Größe »nur« eine Entschädigungssumme von insgesamt rund 600 Millionen Dollar. Bitter daran ist, dass für die höchst fragwürdigen privaten Schiedsgerichte stets mit dem Argument geworben wird, sie würden Rechtssicherheit gerade für kleinere Firmen herstellen. Tatsächlich liest sich die Liste in der Studie jedoch wie ein »Who is who« der internationalen Großkonzerne: Occidental Petroleum (USA) gegen Ecuador (Entschädigung plus Zinsen: 2,4 Mrd. Dollar), Mobil (Niederlande) gegen Venezuela (2,1 Mrd.), EDF (Belgien, Frankreich) gegen Argentinien (205 Mio.), Siemens gegen Argentinien (278 Mio.), Cargill (USA) gegen Mexiko (86 Mio.), Deutsche Bank gegen Sri Lanka (70 Mio.) …
Eigene Interessen über die Ansprüche der Gesellschaft zu stellen – das kennt man auch von der Finanzbranche. Bei ihr handelt es sich zweifellos um eine Macht im Staat, die diese Macht weidlich auslebt – Finanzkrise hin oder her. Kaum beachtet feierte sie im Herbst 2017 einen großen Erfolg: »Heimlich und verschämt«, notierte das Handelsblatt, zog die EU-Kommission ihren Entwurf für ein Trennbanken-Gesetz zurück – es hätte große Geldhäuser gezwungen, riskante Manöver im Wertpapierhandel vom klassischen Bankgeschäft mit Einlagen und Krediten zu trennen. Damit sollte eine Lehre aus der Finanzkrise 2008 gezogen werden, als zockende Banken durch viele Steuermilliarden mit der Behauptung gerettet wurden, sie seien »too big to fail« – zu groß, zu »systemrelevant«.[12] Zeitgleich jubelte auch die Finanzbranche in den USA, diesmal, weil der US-Senat Sammelklagen gegen Banken und Kreditkartenunternehmen verbot. Seither müssen ihre Kunden im Streitfall vor privaten Schiedsstellen verhandeln anstatt vor ordentlichen Gerichten. »Ein großer Rückschlag für jeden Kunden in diesem Land. Die Wall Street hat gewonnen, normale Menschen stehen als Verlierer da«, kommentierte der inzwischen ausgeschiedene Chef der US-Verbraucherschutzbehörde CFPB.[13]
Oft sind derlei politische Entscheidungen, die negative Konsequenzen für Millionen von Menschen haben, nicht das Ergebnis öffentlich ausgetragener Debatten. Sie werden in vertraulichen Gesprächen vorbereitet, die nur durch Leaks ans Licht kommen oder wenn zivilgesellschaftliche Organisationen ihre Veröffentlichung einklagen. So wie die US-Organisation American Oversight, die Ende 2017 den Terminkalender von Scott Pruitt öffentlich machte.[14] Scott Pruitt war der Chef der US-Umweltschutzbehörde E.P.A., bis er Anfang Juli wegen Korruptionsvorwürfen zurücktrat. Pruitt ist ein ausgewiesener Freund und Spendenempfänger der Öl- und Gasförderer, der im Auftrag von Donald Trump den umweltpolitischen Rollback im Land organisierte.[15] Er hat kritische Wissenschaftler seiner Behörde entlassen, Führungspositionen mit Leugnern des Klimawandels besetzt und viele Umweltstandards abgeschafft oder eingefroren;[16] so unterzeichnete er etwa die formelle Ankündigung zum Ausstieg aus Barack Obamas Klimaschutzplan.[17] Wie Pruitts Terminkalender zeigt, traf er sich in den ersten Monaten seiner Amtszeit so gut wie nie mit Umwelt- und Verbraucherschützern, dafür umso öfter mit Wirtschaftsvertretern aus Branchen, die er regulieren sollte – Pruitt galt als ihr oberster Lobbyist. Zu seinen Gesprächspartnern gehörten fast täglich die Manager großer Kraftwerks- und Kohleminenbetreiber, von Chemie- und Pestizidfirmen, darunter das deutsche Unternehmen Bayer CropScience.
Doch auch die internationale Automobilindustrie lieh sich mehrfach Pruitts Ohr. Gleich nach seinem Amtsantritt forderte sie ihn in einem Brief auf, die geplanten strengeren Abgasregeln zurückzuziehen, andernfalls seien 1,1 Millionen Arbeitsplätze bedroht.[18] Zwei Monate später sprachen die Absender persönlich bei ihm vor, darunter laut Pruitts Terminkalender die Chefs von Ford, General Motors, Toyota, Mercedes Benz, VW, BMW und Porsche. Der BMW-Vorstandsvorsitzende Harald Krüger bekam sogar einen weiteren Exklusivtermin.
Im Fall des Anti-Umweltschützers Pruitt war der Hinweis auf die angeblich bedrohten Arbeitsplätze sicher unnötig. Aber die offene Demonstration des Erpressungspotentials gehört zum strategischen Repertoire der Konzerne. Wenn der frühere VW-Chef Matthias Müller sein Unternehmen als »systemrelevant« bezeichnet – also bewusst jenen Begriff verwendet, mit dem während der Finanzkrise die Rettung maroder Banken durch Steuergelder gerechtfertigt wurde –, dann baut er unverfroren eine Drohkulisse auf, mit der die Autobosse in Sachen Dieselgate die deutsche Politik seit Jahren höchst effektiv vorführen.
Schon diese wenigen, schlaglichtartigen Beispiele legen die Fragen nahe: Wer regiert uns eigentlich? Sind es noch unsere Regierungen? Oder sind es einige zehntausend transnationale Unternehmen, die sich im Zuge der Globalisierung in allen Erdteilen ausgebreitet haben? Wie kommt es, dass diese Konzerne so viel Macht haben und die Regierungen offensichtlich zu wenig? Und wie funktioniert diese Macht und welche Folgen erwachsen daraus?
Das Ende der Systemkonkurrenz
Es ist gerade mal 26 Jahre her, dass der US-amerikanische Politikwissenschaftler Francis Fukuyama nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion das »Ende der Geschichte« ausrief: eine nun anbrechende goldene Zeit, in der Demokratie und Marktwirtschaft wie ein Zwillingspärchen auf globaler Werbetour Land für Land für das westliche Werte- und Fortschrittsmodell gewinnen würden, mit den Konzernen als ihrer Vorhut. Nicht bedacht ist in Fukuyamas Großentwurf, dass mit dem Ende der Systemkonkurrenz zwischen Ost und West der Kapitalismus förmlich explodierte. Erst nach 1989 nahm die Globalisierung richtig Fahrt auf und ermöglichte den Konzernen eine beispiellose Expansion, angetrieben vom Siegeszug des Shareholder-Value-Prinzips, das die Interessen der Aktionäre über alles stellt. Die Umsätze und Gewinne der Konzerne wachsen seither rapide und weltweit, ebenso ihre Vernetzung und ihre Macht. So bildet sich seit Jahren ein zunehmend autoritärer Kapitalismus heraus, repräsentiert durch global agierende Konzerne, die ihre Vorteile, die ihnen die Globalisierung bietet, rücksichtslos ausspielen: von der Steuervermeidung bis hin zur Androhung von Standortverlagerungen und Arbeitsplatzabbau. Die demokratischen Prozesse und Regeln liberaler Gesellschaften sind ihnen dabei ebenso lästige Hindernisse wie der Wettbewerb selbst. Die Demokratie, die Marktordnung, die gesamte Gesellschaft erleiden unter dieser Macht der Konzerne massive Schäden, die in diesem Buch anhand ausgewählter Branchen untersucht werden.
Der in Harvard forschende[1] Publizist Evgeny Morozov spricht im Zusammenhang mit den übermächtigen Internetkonzernen bereits von einer »Rückkehr des Feudalismus«: Die Frage sei, »welche Art von politischer, ökonomischer und sozialer Zukunft in einer Welt möglich ist, in der die Bedingungen dieser Zukunft nicht mehr von Nationalstaaten, sondern von Technologiekonzernen festgelegt werden.« Mit ihrem einzigartigen Schatz an Daten und mit ihrer Infrastruktur könnten die Digitalkonzerne »jedem ihre Bedingungen diktieren – auch den Regierungen«, die ihre »technologische Souveränität« längst eingebüßt hätten. »Kein anderer Akteur«, schreibt Morozov, »kann es mit der Macht aufnehmen, die von jenen Plattformen ausgeübt wird (…) Die Pfeiler der Politik halten kaum noch. Wir treten in ein neues Zeitalter des Feudalismus ein, in dem eine Handvoll amerikanischer Technologiefirmen den Rest von uns in das undemokratischste Projekt in der Geschichte der Menschheit hineinzieht.«[2]
An der Universität in Chicago, ausgerechnet dort, wo berühmte Ökonomen der »Chicago School« in den 1970er Jahren predigten, dass großmächtige Unternehmen keine Gefahr für den Wettbewerb und die Demokratie darstellten,[3] treffen sich im Frühjahr 2017 Wissenschaftler zu einer Konferenz mit dem Titel »Hat Amerika ein Konzentrationsproblem?«. Einer von ihnen beginnt seinen Vortrag mit einer Erzählung, die vielen nur allzu bekannt vorkommen dürfte:[4] Auf dem Weg nach Chicago habe er in New York ein Taxi des Plattform-Dienstleisters Uber benutzt, der dort einen Marktanteil von 50 Prozent habe; das Uber-Taxi habe er mit einem iPhone von Apple gerufen, das in den USA 40 Prozent des Marktes beherrsche; er sei mit United Airlines geflogen, einer der vier großen Fluggesellschaften, die zusammen mehr als 80 Prozent des Marktes[5] auf sich vereinen; während des Flugs habe er Direct TV geschaut, ein Medienunternehmen, das vor einiger Zeit vom Telekom-Giganten AT&T, einem ehemaligen Monopolisten, übernommen wurde; dann sei er im Hotel Interconti abgestiegen, das zu einer Branche gehöre, die sich wie viele andere immer weiter konsolidiere. Er hätte auch sagen können: Vor den Multis ist kein Entkommen.
Derlei Zahlen zeigen die strukturelle Misere. Es gibt sie in fast jeder beliebigen Branche, jedem Markt, jedem Land:[6]
In der Europäischen Union entfallen fast 50 Prozent des Lebensmitteleinzelhandels auf die zehn größten Branchenunternehmen, darunter vier deutsche, vier französische und zwei britische.[7] In Deutschland teilen sich diese vier Großkonzerne – Aldi, Edeka, Rewe und die Schwarzgruppe mit Lidl und Kaufland – 85 Prozent des Lebensmittelmarktes.[8] In Berlin gibt es Stadtteile, in denen zwei große Supermarktketten auf 70 Prozent Marktanteil kommen.[9] Zu den 85 Prozent Marktanteil von Aldi, Edeka, Rewe, Lidl und Kaufland sagt der Präsident des Bundeskartellamts, Andreas Mundt: »Das ist schon viel. Aber das heißt nicht, dass es nicht auch in Zukunft zu kleineren Übernahmen kommen kann. (…) Es bleibt natürlich bei der hohen Konzentration, die weder für Lieferanten noch für Kunden gut ist.«[10] In Erinnerung ist die Ministererlaubnis im Fall Edeka und Kaiser’s/Tengelmann, mit der Ende 2016 der damalige Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel das Urteil des Bundeskartellamts aushebelte und der weiteren Marktkonzentration die Tür öffnete.[11]
2016 fusionierten die weltweiten Nr. 1 und Nr. 2 im Biermarkt, die fünf größten Brauereien teilen sich rund 50 Prozent des Marktes.[12]
Beim Tee kontrollieren drei Konzerne – Unilever, der indische Konzern Tata und Associated British Foods – rund 80 Prozent des globalen Handels.[13]
Im globalen Fischgeschäft vereinen die zehn größten Firmen 38 Prozent des Umsatzes auf sich. Die Europäische Umweltagentur EEA warnt: »Die Konzentration von wirtschaftlicher Macht und Kontrolle über mehrere Stufen in der Lieferkette erhöht die Fähigkeit dieser Firmen, Produktionsstandards und Preise zu bestimmen, so gewinnen sie einen unverhältnismäßig starken Einfluss auf das globale marine Ökosystem.«[14]
60 Prozent der Babynahrung weltweit werden von nur vier Herstellern produziert, in Westeuropa macht ihr Stück vom Kuchen 74 Prozent des Marktes aus, in Australien 92 Prozent.[15]
Mitte 2016 referierte die US-Senatorin Elizabeth Warren über »Amerikas Monopoly-Problem«: Wenige Jahre nach der Finanzkrise sind drei der vier größten Banken größer als vor der Krise; in den vergangenen zehn Jahren sank die Zahl der großen Fluglinien von neun auf vier, und diese vier stellen insgesamt mehr als 80 Prozent der Kapazitäten, zuletzt fuhren sie zusammen Rekordgewinne von 22 Milliarden Dollar ein; eine Handvoll Versicherungen beherrscht zu 83 Prozent den Markt für Krankenversicherungen; drei Drogerieketten haben zusammen 99 Prozent des Marktes vereinnahmt; vier Firmen stehen für fast 85 Prozent des Rindfleischmarkts; drei Schlachtunternehmen produzieren fast die Hälfte aller Schlachthühner; mehr als 50 Prozent aller Kabelnetz- und Internetnutzer sind Kunden von Comcast, das im Vorjahr sein bestes Geschäftsjahr seit zehn Jahren feierte;[16] vier Firmen wickeln 90 Prozent des Eisenbahn-Frachtgeschäfts ab;[17] im Leihwagengeschäft kommen drei Anbieter auf einen Marktanteil von zusammen 90 Prozent.[18]
In einer Studie über den US-Pharmamarkt warnt die Wettbewerbsökonomin und Kartellrechtsexpertin Fiona Scott Morton von der Yale University: »In den vergangenen 10 bis 15 Jahren ist es Branchenteilnehmern gelungen, viele Wettbewerbsmechanismen auszuschalten und Nischen zu schaffen, in denen Medikamente ohne oder fast ohne Wettbewerb verkauft werden können.«[19] Es gebe immer mehr Studien, die zu dem Ergebnis kommen, »dass wir zu wenig Wettbewerb haben.«[20]
Google hat bei den Suchmaschinen einen weltweiten Marktanteil um die 90 Prozent.[21] In den USA laufen 43 Prozent aller Onlineverkäufe und 50 Prozent aller Suchanfragen zum Internetkauf über Amazon.[22] Die Plattformen profitieren dabei vom Netzwerkeffekt: Indem die Nutzer einkaufen, Suchanfragen starten oder mit anderen Menschen kommunizieren, erhöhen sie die Attraktivität der Plattform für neue Nutzer, die wiederum neue Teilnehmer generieren. Je mehr Kunden, Teilnehmer und Daten eine Plattform hat, desto attraktiver wird sie für zusätzliche, noch nicht teilnehmende Akteure. Das Wachstum einer Plattform schafft damit weiteres Wachstum und gleichzeitig mächtige Monopole.
Die Grenzen der Kartellpolitik
Die Fusionswelle der vergangenen Jahrzehnte war gigantisch. In den USA hat sie dazu geführt, dass zwei Drittel bis drei Viertel der rund 900 Wirtschaftsbereiche heute eine höhere Marktkonzentration aufweisen als in den 1990er Jahren.[1] Und wenig deutet darauf hin,[2] dass die Welle abebbt – das Gesetz der wachsenden Unternehmensgrößen scheint so unumkehrbar wie die Schwerkraft. Allein in der Europäischen Union wurden im Jahr 2017 Firmenfusionen und -übernahmen im Wert von mehr als 200 Milliarden Dollar abgewickelt, der höchste Wert seit zehn Jahren.[3] In den USA gaben die Unternehmen seit 2008 zehn Billionen Dollar aus, um andere Firmen zu schlucken.[4] Die täglichen Meldungen in den Medien über den nächsten »großen Deal«, über die neueste »Mega-Fusion« irgendwelcher in- und ausländischer Unternehmen sind nichts anderes als Nachrichten über die Verwandlung der Marktwirtschaft, wie sie einmal gedacht war, in eine Machtwirtschaft.
Allein diese Entwicklung ist alarmierend genug. Doch den Konzernen reichen ihr Markt- und damit ihr Machtzuwachs nicht aus. Davon zeugen unzählige Kartellverfahren, die offenlegen, wie sehr selbst große mächtige Unternehmen den Wettbewerb, der sie groß und mächtig gemacht hat, aushebeln. »Früher ist man davon ausgegangen, dass es bei gleichartigen Massengütern wie zum Beispiel Transportbeton öfter zu Preisabsprachen kommt«, sagt Bundeskartellamtschef Andreas Mundt, »aber allein in den vergangenen Jahren hatten wir es auch mit Absprachen auf so unterschiedlichen Märkten wie Süßwaren, Bahnschienen, Dekorpapier, Bier, Wurst, Brillen oder Betonpflastersteinen zu tun.«[5] Die Liste ließe sich schier endlos verlängern mit Kartellen bei Reißverschlüssen, Druckknöpfen, Autoscheiben,[6] Onlinereiseportalen[7] oder bei den drei großen deutschen Zuckerherstellern Pfeifer & Langen, Nordzucker und Südzucker.[8] Zum Schaden ihrer Kunden und des Marktes sprachen sich Fluggesellschaften über Treibstoff- und Sicherheitszuschläge ab (darunter Lufthansa),[9] Banken über die internationalen Interbank-Zinssätze Libor und Euribor (darunter die Deutsche Bank),[10] Konsumgüterriesen wie Procter&Gamble,[11] Unilever[12] und Henkel[13] über Waschpulverpreise. Und 14 Jahre lang sprachen sich Lkw-Hersteller wie Daimler, MAN und Volvo/Renault über Preise und die Kostenweitergabe für die Einhaltung von Umweltnormen ab,[14] was die EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager so kommentierte: »Mir scheint, dass es in dieser Branche nichts gibt, woraus sich nicht ein Kartell formen ließe.«[15]
Weil Löhne und Gehälter ebenfalls der Preisbildung unterliegen, gibt es auch hier Arbeitgeberkartelle. Apple, Google, Adobe, Intel und weitere Hightechfirmen im Silicon Valley etablierten ab 2005 ein solches Kartell. Die Konzerne, die zu den reichsten Unternehmen der Welt gehören, vereinbarten, sich generell gegenseitig keine Mitarbeiter abzuwerben. »Wenn ihr nur einen einzigen dieser Leute anstellt, bedeutet das Krieg«, warnte der damalige Apple-Chef Steve Jobs in einer E-Mail an Google. Lohnwettbewerb? – Lieber nicht, no thanks![16] Gegenüber dem US-Justizministerium verpflichteten sich Apple & Co. schließlich, diese Praxis zu beenden. 2015 stimmten sie im Rahmen einer zivilen Sammelklage von 64000 Mitarbeitern einem Vergleich zu und zahlten 415 Millionen Dollar.[17] Den jüngsten großen Fall über ein mögliches Kartell enthüllte Mitte 2017 der Spiegel, wonach die Dieselaffäre auch das Ergebnis jahrelanger Absprachen zwischen Audi, BMW, Daimler, Volkswagen und Porsche war. Seit den 1990er Jahren sollen sie sich in rund 60 Arbeitskreisen in mehr als 1000 Besprechungen über Technik, Lieferanten und Märkte abgestimmt haben.[18]
Wenig bringt das Selbstverständnis und die faktische Macht der Konzerne besser zum Ausdruck als ihre Neigung zur Kartellbildung: Sie fühlen sich über den Gesetzen stehend, sie attackieren mit hohem organisatorischen Aufwand die Marktordnung und die Rechte ihrer Kunden. Das ist Verrat an der Marktwirtschaft – von der die Konzerne leben. Die Absicht der Väter der Marktwirtschaft war es gerade, Machtbildung durch Wettbewerb zu verhindern; sie verstanden Wettbewerb als das wirtschaftliche Pendant zur Demokratie. Dass nationale Kartellbehörden und in jüngster Zeit vor allem die EU-Kommission Bußgelder in Millionen- und Milliardenhöhe gegen die Konzernkartellanten ausgesprochen haben, zeigt zwar, dass die Aufseher durchaus Mut und Zähne haben, auch gegen die ganz Großen vorzugehen. Andrerseits entfalten selbst höchste Bußgelder offensichtlich wenig abschreckende Wirkung. Sie scheinen schon eingepreist zu sein ins kriminelle Handeln und eine lösbare Aufgabe durch den berühmten Griff in die Portokasse. VW jedenfalls, das für seine Machenschaften in den USA rund 25 Milliarden Dollar bezahlte, fährt Rekordgewinne ein und zahlt seinen Vorständen Millionengehälter. Das Geschäftsmodell, es funktioniert unverändert.
Zu relativieren ist die Arbeit der Kartellwächter auch deshalb, weil sie Marktmacht ausschließlich anhand ökonomischer Kriterien messen. Die politische Macht der Konzerne, die sich aus der Marktkonzentration ergibt, liegt außerhalb ihres ökonomischen Prüfauftrags. Die Kartellämter sind von Amts wegen blind für derlei Fragen, wie jüngst die Megafusion des deutschen Chemiekonzerns Bayer mit dem US