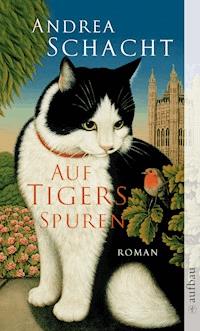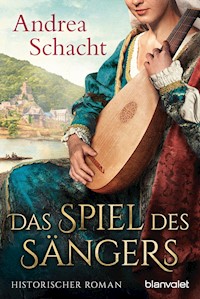8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Eigentlich läuft es für den charmanten Streunerkater Ghizmo wunderbar: Mit Jenny van Rosmalen, seiner Mitbewohnerin (und Besitzerin des Gehöfts), lebt es sich sehr harmonisch, die Nachbarschaft verhält sich friedlich, und die Futterdosen sind stets offen. Doch da schreckt eine Einbruchsserie das verschlafene Örtchen auf. Als Jenny in diesen Fall verwickelt wird, nimmt Ghizmo sich der Sache an. Und je tiefer er sein vorwitziges Näschen in die Angelegenheit steckt, desto sicherer ist er, dass mehr hinter den Einbrüchen steckt als gedacht ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 338
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Inhalt
Titel
Zu diesem Buch
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Wichtigste Personen
Die Autorin
Die Romane von Andrea Schacht bei LYX
Impressum
ANDREA SCHACHT
Der Tag, an dem die Katze kam
Roman
Zu diesem Buch
Ghizmo hatte ganz offensichtlich die Nacht auf dem grünen Sessel verbracht. Eine feine Schicht grauer Katzenhaare überzog die Sitzfläche. Jenny wischte sie weg und legte eine gelbe Decke darauf, auf der er schon mal gelegen hatte. Viel Hoffnung, dass er sie demnächst als Liegeplatz benutzen würde, hatte sie zwar nicht, aber es war einen Versuch wert. Sie beschloss, ihren Kopf an der frischen Luft freizubekommen und einkaufen zu gehen. Vornehmlich Katzenfutter, da nicht nur Ghizmo, sondern auch Kater Jaromir seinen Anteil brauchte. Der Gang in den Ort brachte den gewünschten Erfolg, doch als Jenny mit einem Beutel Trockenfutter und einer Kiste Huhn in Gelee bei Nachbar Woody klingelte, blieb die Tür verschlossen. Das wunderte sie, denn um die Mittagszeit war der alte Herr immer zu Hause. Sie ging den Seitenweg um das Haus, um zu schauen, ob er sich hinten im Garten aufhielt. Aber auch da war keine Spur von ihm zu sehen. Also war Jenny so dreist und ging zum Terrassenfenster. Und hier hörte sie es. »Hilfe! Hilfe!«, drang es leise aus dem Haus.
1
Träge Tage
Etwas Feuchtes bohrte sich in mein rechtes Ohr. Etwas, das von einem laut brummenden Motor angetrieben wurde. Das passte nicht zu dem, was ich eben geträumt hatte. In meinem seltsam verworrenen Traum ging es nicht um Motoren, sondern um kopflose Pferde.
Mühsam hob ich die Lider und tastete benommen an mein Ohr.
Meine Hand traf Pelz.
Der Motor wurde lauter, und eine Raspel fuhr über meine Wange.
Das störte mich, und ich drehte mich weg.
»Schurrrrrr!«
»Mhm?«
»Maumau!«
»Oh.«
»Ungerrrrr!«
»Ah!«
In mein vom Schlaf benebeltes Bewusstsein drang der herrische Befehl eines hungrigen Katers, der seine Morgenmahlzeit verlangte.
»Gleich, Ghizmo. Gleich. Gott, bin ich müde!«
Plumps.
Trappeln auf der Holztreppe.
Halb benommen drehte ich mich um und warf einen Blick auf den Wecker.
Das durfte doch nicht wahr sein. Halb elf?
Ich raffte meinen gesamten Willen zusammen und taumelte nach unten in die Küche, um dem Herrn des Hauses den Napf zu füllen.
»Du warst sehr geduldig, Ghizmo.«
In seinem Blick lag ein milder Vorwurf, dann stürzte er sich auf das Futter. Während er es laut schmatzend verputzte, streichelte ich entschuldigend über seinen Rücken. Es störte ihn nicht.
Also trottete ich wieder nach oben und versuchte, mit kaltem Wasser die Reste der Benommenheit abzuspülen. Es gelang mit Maßen.
Zwei Wochen war es her, dass der Fall des Pferdemörders gelöst worden war, und heimlich war ich ein bisschen stolz darauf, dass ich dazu beigetragen hatte.
Dann aber folgte der Fluch der Tat, und ich musste mich mit schlaflosen Nächten und Anfällen von Panik herumschlagen. Nach drei Tagen gab ich übernächtigt auf und rief Dr. Werla an. Die nette Psychiaterin aus der Klinik im Nachbarort gab mir umgehend einen Termin, hörte sich mein Jammern an und verschrieb mir Medikamente.
Damit konnte ich schlafen.
Aber um welchen Preis.
Wenn ich morgens das Bett verlassen hatte, wanderte ich wie ein Geist durch die Räume meines Hauses. Es gehörte seit dem vergangenen Monat mir, und ich hatte einiges an Renovierungsarbeiten in Auftrag gegeben. Meister Baumstark, der schmächtige Malermeister, hatte die Wände tapeziert und gestrichen, Isabell den grauenvollen Teppichboden entfernt und das darunterliegende Parkett so wunderbar bearbeitet, dass es golden im Licht schimmerte. Die alten Möbel waren in die Scheune geräumt worden, gestern waren die neuen gekommen. Eine Orgie von Blau, Türkis, Maigrün und roten und gelben Tupfern beherrschte den großen Wohn-/Essbereich jetzt und hätte mich aufmuntern sollen.
Mich munterte leider nichts auf, und Ghizmo war sauer. Er kam seit Tagen nur noch zu seinen Futterzeiten ins Haus.
Katzen lieben Veränderungen nicht, hatte ich damit gelernt. Und pünktlich serviert wurde zu allem Überfluss auch nicht mehr. Zumindest das konnte ich ändern. Ich würde mir den Wecker stellen, damit der arme kleine Kerl wenigstens regelmäßig sein Essen bekam. Und der magere Streuner in der Scheune ebenfalls.
Weshalb ich den nächsten Napf füllte und mich auf den Weg zu seinem Asyl machte.
Mein Anwesen – ha, wie sich das anhörte – bestand aus dem L-förmigen Wohnhaus, einer breiten Garage, in die ich mich bisher geweigert hatte, einen Blick zu werfen, und einer Scheune, die, als der Feyenhof noch landwirtschaftlich genutzt wurde, als Lager für Heu und Stroh und allen möglichen Müll benutzt worden war. Ich hatte sie entrümpeln lassen und wartete auf eine zündende Idee, was man aus ihr machen sollte.
Bis der Funke flog, nutzte ich sie wie mein Vorgänger – ich hatte Gerümpel darin angesammelt. Das ging erstaunlich schnell. Inzwischen war sie mit den betagten Sitzmöbeln, dem zerschrammten Esstisch, etlichen Stühlen, Kommoden und Regalen möbliert. Mehrere Decken, manche farbbekleckst, hatten sich auch eingefunden. Und auf einer davon, in der Ecke des Sofas, lag ein schwarzer Kringel.
Ich hatte den Verdacht, dass Ghizmo diesem zerzausten Streuner Gastrecht gewährt hatte. Der Kater trug die Blessuren eines langen, entbehrungsreichen Lebens an seinem Körper. Er war menschenscheu und unfreundlich, dennoch besaß er so viel Überlebenswillen, dass er das gebotene Fressen nicht ausschlug. Durch vorsichtiges Beobachten hatte ich bemerkt, dass der arme Kerl so gut wie keine Zähne mehr hatte.
Vermutlich hatte er auch noch diverse andere Leiden, aber ich konnte ihm nicht nahe genug kommen, um ihn in einen Tragekorb zu packen und zur Tierärztin zu bringen.
Krallen hatte er nämlich noch.
Als ich zu ihm trat und den Napf abstellte, schreckte er auf und fauchte mich an.
»Schon gut. Ist nur dein Futter.«
Grüne Augen funkelten mich an, aber ich vermeinte darin nicht nur Misstrauen, sondern auch ein wenig Gier zu sehen. Doch ich wusste schon, dass er erst über sein Mahl herfallen würde, wenn ich ihm den Rücken zugedreht hatte. Ich respektierte sein Verhalten und ließ ihn allein.
Irgendwann, wenn nicht mehr ganz so viel Watte in meinem Gehirn war, würde ich eine Entscheidung treffen müssen, was ich mit dieser Scheune anfangen wollte. Als Wohnraum war sie ungeeignet, außerdem war das Haus für mich groß genug. Isabell, die quirlige Schreinerin, hätte gerne einen Fitnessbereich daraus gemacht, samt Sauna und Whirlpool. Vermutlich hegte sie die Hoffnung, zur Mitnutzung eingeladen zu werden. Na ja, schick wäre das schon.
Kalt wehte der Herbstwind durch meinen Pyjama, als ich über den Hof zurück in meine warme Höhle hastete. Zeit, mir mein eigenes Frühstück zu richten. Oder sollte ich gleich mit dem Mittagessen beginnen? Entscheidungen zu treffen fiel mir schwer, aber die Kaffeemaschine setzte ich doch schon mal in Gang. Und ein molliger Trainingsanzug fand sich auch im Badezimmer.
Noch immer taumelig setzte ich mich mit Zeitung, Kaffee und ein paar Keksen an meinen schönen neuen Esstisch und döste vor mich hin. Die Tabletten hatten zwar die Anfälle von atemloser Angst verscheucht, aber alles war mir nun so gleichgültig. Und meine Konzentrationsfähigkeit ließ auch zu wünschen übrig.
Immerhin las ich mit einigem Interesse die lokalen Nachrichten, die von der Renovierung des Hallenbades, den Veranstaltungen des Reitvereins, dem Auftritt des Gesangsvereins und der Verhaftung einer Bande von Einbrechern berichteten. In diesem Zusammenhang bat die Polizei, wachsam die Nachbarschaft zu beobachten, und gab Ratschläge, wie Fenster und Türen zu sichern seien.
Meine Fenster und vor allem meine Haustür entsprachen, wie mir dabei klar wurde, nicht dem einbruchsicheren Standard. Aber fest verschlossene Türen machten mir mehr Angst als offen stehende. Und ich war auch leichtsinnig – mehr als einmal hatte ich schon vergessen, die Fenster zu schließen, wenn ich das Haus verließ.
Vielleicht sollte ich solchen Dingen zukünftig etwas mehr Aufmerksamkeit widmen.
Aber hatte man die Einbrecher nicht gefasst? Und gab es bei mir überhaupt etwas, das solche Leute reizen könnte, hier einzudringen?
Diese Gedanken gingen mir durch den Kopf und lösten sich wieder auf. Wichtig waren sie mir nicht.
Die übrigen Nachrichten fesselten mich ebenfalls nicht besonders, ich überlas sie flüchtig und blieb auf der letzten Seite lediglich an einem kleinen Artikel hängen, der von einem Banküberfall im Taunus berichtete. Zwei maskierte und bewaffnete Männer waren in einer Kleinstadt in die örtliche Bankfiliale gestürmt und hatten die Kassiererin bedroht, die ihnen fünftausend Euro in großen Scheinen aushändigte. Allerdings hatte sie dabei vergessen, den Alarm auszulösen. Das war dann erst dem Filialleiter eingefallen, nachdem die Räuber bereits das Weite gesucht hatten. Das Bild aus der Überwachungskamera war unscharf und zeigte nur zwei vermummte Typen.
Man hatte es den Tätern wahrlich leicht gemacht.
Leichtsinnig war also nicht nur ich. Komischerweise beruhigte mich das, und irgendwie verdämmerte ich den Nachmittag. Später ließ ich meine eifrige Putzfrau Inge ein, die wortreich die neue Einrichtung kommentierte – sie fand nicht wirklich ihre Zustimmung. Inge war der Typ für rustikale Eichenmöbel und wuchtige Polster in gedämpften Brauntönen. Ich entfloh ihr und machte einen gemächlichen Spaziergang zum herbstlich duftenden Wald.
Die kühle Luft endlich belebte meine Sinne, und auf dem Rückweg wechselte ich einige Worte mit meinem Nachbarn, Grandpa Woody, der in seinem Garten ein paar Blätter zusammenfegte.
»Die Kleine übt sehr eifrig mit ihrem neuen Pony«, sagte er und wies auf die Koppel gegenüber von meinem Haus.
»War Lili heute schon da?«
»Natürlich. Zwei Stunden hat sie ihre Runden gedreht. Ein munteres Ding, nicht wahr? Schön, dass sie jetzt wieder ein Pferdchen hat.«
Lili, die Tochter des Weingutbesitzers Raoul Pfeiffer, hatte ein weißes Pony namens Tinkerbell besessen, das bedauerlicherweise dem Pferdemörder zum Opfer gefallen war. Ihre Trauer war unermesslich gewesen, und da ihr Vater wegen eines Problems mit seinen Weingärten derzeit einen finanziellen Engpass zu bewältigen hatte, konnte er ihr keinen Ersatz beschaffen.
Ich hatte dafür gesorgt, dass Goldbeere auf die Weide kam. Aber das wusste niemand.
»Ich kann es schlecht beurteilen, Woody, aber möglicherweise ist sie eine recht begabte Reiterin.«
»Das ist sie ohne Zweifel. Und es war nett von Ihnen, ihr zu ermöglichen, ihre Fähigkeiten weiter zu vervollkommnen.«
»Was? Ich?«
»Aber Jenny …«
So viel zu niemand und wissen.
»Sagen Sie es ihr bloß nicht.«
»Gute Taten muss man nicht verheimlichen. Sie füttern ja auch einen Streuner durch, oder?«
»Ich scheine irgendein Plakat auf der Stirn zu tragen.«
Woody lachte leise und vergnügt.
»Ich bin ein alter Mann, Jenny. Ich habe viel Zeit, meine Mitmenschen zu beobachten. Aber keine Angst, Ihre kleinen Geheimnisse sind bei mir gut aufgehoben.«
»Oh, na dann. Sagen Sie, wo ist eigentlich Sandra? Ich habe Ihre reizende Pflegekraft schon einige Tage nicht mehr gesehen.«
»Sandra ist in ihre Heimat geeilt, um ihrer kranken Mutter zur Seite zu stehen. Sie kommt in zwei, drei Wochen zurück.«
»Kommen Sie denn ohne sie zurecht?«
»Schwester Immaculata vertritt sie. Das ist die Gemeindeschwester vom katholischen Sozialdienst.«
Woody schnitt eine kleine Grimasse.
»Die unbefleckte Schwester? Ist Nomen gleich Omen?«
»Sie ist sehr streng, sehr ordentlich, sehr diszipliniert und verlangt Gleiches von mir.«
Ich musste grinsen.
»Polnische Wirtschaft gefällt Ihnen besser?«
»Sandra ist auch streng …«
»Ja, ja. Aber Sie entkommen ihr häufig!«
»Verraten auch Sie meine kleinen Geheimnisse nicht weiter.«
»Wie könnte ich?«
Kleine Verschwörungen in der Nachbarschaft erleichterten das Zusammenleben. Grandpa Woody war ein angenehmer Nachbar. Er war Amerikaner, doch er hatte eine Deutsche geheiratet. Soweit ich wusste, war er in seinem Berufsleben Ingenieur gewesen, aber jetzt, mit Mitte siebzig und einer leicht angeschlagenen Gesundheit, widmete er sich seinem Garten, seinem Kater Jaromir und einem Haufen Büchern. Seine Frau war vor sechs Jahren gestorben, ein Einschnitt in seinem Leben, der ihn tief getroffen hatte. Seine beiden Söhne waren nach Amerika gezogen, und er war stolz auf deren Familien und Karrieren. Diese Dinge hatte er mir bei unseren gelegentlichen Treffen zu Kaffee und Kuchen anvertraut, kleine Besuche, die ihm große Freude zu bereiten schienen. Wahrscheinlich auch deswegen, weil Sandra dabei nicht zugegen war.
Die polnische Pflegerin mochte sich ja aufmerksam um ihn kümmern, aber ich mochte ihr zähnefletschendes Lächeln nicht sonderlich. Es wirkte so professionell aufgesetzt. Aber vielleicht tat ich ihr unrecht.
»Ach, Jenny. Ich müsste Sie um einen kleinen Gefallen bitten«, meinte Woody.
»Natürlich. Was darf’s sein?«
»Die unbefleckte Schwester hat beim Einkaufen wieder einmal das Katzenfutter vergessen, und Jaromir und ich geraten langsam in ein kleines Problem. Könnten Sie uns mit ein, zwei Tütchen aushelfen?«
»Aber selbstverständlich. Was speist der Herr denn gerne?«
»Der frisst alles, einschließlich Socken und Bierdeckeln.«
»Meine Socken gehören mir!«
Ich hatte am Vortag unsere Vorräte aufgefüllt, mehr als üblich, da ja der Streuner Kostgänger geworden war, und brachte Woody eine kleine Auswahl an Futtertüten. Dann hörte ich mir noch eine Viertelstunde lang Inges Dorftratsch an und sank, als sie gegangen war, erschöpft auf mein neues knallblaues Sofa.
Der Tag ging in die Dämmerung über, doch ich war wieder zu träge geworden, um das Licht anzumachen. Mit meinen langsam dahinplätschernden Gedanken fragte ich mich, ob es wirklich ein solcher Gewinn war, schlafen zu können und die Angstzustände abzuwehren, dafür aber zu einem halb ausgewrungenen Waschlappen zu werden. Ich fühlte mich nicht unwohl, das nicht. Aber es ging alles so gemächlich ineinander über, und die Zeit verstrich auf seltsam unbemerkte Weise.
Das Klappen der Katzenklappe brachte mich endlich wieder in eine bewusstere Gegenwart zurück.
Mein Mitbewohner war von seinen Geschäften heimgekehrt und verlangte sein Abendessen. Mit mildem Erstaunen erkannte ich, dass es bereits acht Uhr und stockdunkel war. Wir richteten uns ein leichtes Mahl, von dem Ghizmo eine halbe Scheibe meines gekochten Schinkens erhielt. Dann füllte ich den Streunernapf und ging zur Scheune hinüber. Der Schwarze hatte sich eingefunden, funkelte mich an, fauchte aber nicht. Ein Fortschritt. Nur sein Fressen rührte er in meiner Gegenwart nicht an. Ich füllte die Wasserschüssel auf und ließ ihn allein.
Der Himmel, der den ganzen Tag bedeckt gewesen war, war inzwischen aufgerissen, und Sterne glitzerten zwischen den Wolken. Ich trat zu dem schmiedeeisernen Tor, das ich so sorgfältig restauriert hatte, und blickte über die Weiden. Gegenüber hob sich Goldbeeres Unterstand schwarz gegen den Himmel ab. Das Pony war nicht zu sehen, vermutlich hatte es sich an seine Krippe zurückgezogen. Auf der Weide daneben lehnten sich Bartels Pferde aneinander, und schräg gegenüber leuchtete mir das Licht aus Grandpa Woodys Küchenfenster entgegen.
Ich hatte Miriam, meine Anwältin und Freundin, gebeten, mir ein Haus in einer ruhigen Gegend zu suchen, und mit dem Feyenhof am Fuße des Pfälzer Waldes hatte sie wahrhaftig ein Goldstück gefunden. Er lag abseits, der Ort war fußläufig zwanzig Minuten entfernt, und die Straße, die an dem Haus vorbeiführte, wurde nur von wenigen Anliegern benutzt, die weiter oben am Waldrand ihre Ferienhäuser hatten.
Ich genoss die Stille des Abends, den leichten Wind, der über die Felder wehte, roch den Herbst in der Luft und beobachtete den roten Kater, der unter dem gelblichen Licht der Straßenlaterne seine Reviergrenzen kontrollierte.
Jaromir, Ghizmos Erzfeind.
Ihm folgte kurz darauf eine schlanke helle Katze mit dunklem Gesicht. Selena, wie ich wusste, eine hochnäsige Siamesin aus einem der Häuser weiter unten an der Straße.
Und dann erklang in der Ferne das tiefe Dröhnen eines schweren Motorrads.
Ich zog meine Jacke enger um mich, es war empfindlich kühl geworden. Dennoch blieb ich am Tor stehen. Denn gleich würde ich dem Teufel begegnen.
Die Scheinwerfer näherten sich, das Dröhnen wurde zu einem Blubbern, dann hielt die Maschine, und der Fahrer schob sein Visier nach oben.
»Und? Was geht ab, Schwester? Wieder Katzen gegen den Strich gebürstet? Oder es bei Menschen versucht?«
Mit bedrückter Stimme klagte ich:
»Selbst wenn ich spräche,
Die kalten Lippen wären
Nur Wind des Herbstes.«
Es war mir ein inniges Vergnügen, die Sprachlosigkeit des Bikers zu genießen.
Doch dann zitierte er:
»Sogar das Wildschwein
Mit allem anderen fortstob
Im Sturm des Herbstes.«
Mit einem röhrenden Lachen stob das Wildschwein davon und ließ mich perplex stehen.
Ich hätte nicht gedacht, dass dieser verrückte Biker, der auf der Rückseite seiner Jacke einen Totenkopf mit Schweineohren trug, auch die Haikus von Basho kannte. Seit ich hier wohnte, tauchte er regelmäßig auf, hielt an und ließ einen seiner losen Sprüche ab. Zuerst fürchtete ich, dass er ein aufdringlicher Stalker sein könnte, doch allmählich kam ich dahinter, dass er einfach seinen Spaß daran hatte, mit mir kleine Sticheleien auszutauschen. Vor zwei Wochen endlich war ich dahintergekommen, dass Darius Hellwig ein erfolgreicher Schauspieler war und derzeit an den Städtischen Bühnen den Mephisto gab.
Die Rolle des Teufels schien ihm zu liegen.
Mit einem Lächeln auf den Lippen kehrte ich ins Haus zurück.
2
Ghizmo macht sich Sorgen
Ghizmo knabberte einige Krümel Trockenfutter und lauschte. Ja, da kam sie. Das wurde aber auch Zeit. Das Licht in der Küche flammte auf, und sie ging um die Theke. Er ihr nach, umdrehen, große, hungrige Augen machen, klagendes Maunzen.
»Hast du schon wieder Hunger?«
Was heißt hier wieder?
»Ich habe dir doch … Oh, nein, habe ich nicht.«
Sie kramte im Schrank und – ahh – der Duft!
Und der Geschmack.
Mit Soße.
Als der Boden der Schüssel sauber geleckt war und Ghizmo seine abschließenden Waschungen beendet hatte, schlenderte er über den sanft glänzenden Holzboden zu den bunten neuen Möbeln. Er war mit den Veränderungen nicht einverstanden. Gar nicht einverstanden. Das war alles so neu und roch kein bisschen wie die eigene Höhle. Und auf dem Boden war er schon zweimal ausgerutscht, als er es eilig gehabt hatte. Mit der Nase gegen den Sessel war er geflogen. Einen grünen Sessel. Er hatte erwogen, dem ein paar Fetzen aus dem Bezug zu krallen, aber der Stoff hatte sich widersetzt. Nicht einmal ein Fädchen hatte er herausziehen können. Da war der Vorgänger doch ganz anders gestrickt gewesen. Den hatte er bis auf die Eingeweide zerfetzt. Jetzt stand er in der Scheune, weil Jenny ihn nicht mehr mochte.
Dumme Jenny.
Tagelang hatte sie ihn aus dem Haus vertrieben. Na ja, nicht sie selbst, sondern diese Leute. Die mit den Farben und den Eimern und den Heulmaschinen. Er hatte mal wieder Obdach im Unterstand suchen müssen. An kalten, feuchten Tagen. Aber wenigstens war dort wieder ein Pony eingezogen. Goldbeere hatte anfangs ein bisschen Angst vor ihm gehabt. Verständlich, denn schließlich waren solche Weidetiere wie sie einst die Beute seiner Vorfahren gewesen. Aber da er lediglich Mäuse und Spinnen im Stroh aufscheuchte, war sie ruhiger geworden. Schließlich hatte er sich dann in die Krippe gelegt, und Goldbeere traute sich näher. Ihren warmen Atem empfand er als tröstlich, und ihr leises Schnobern wiegte ihn in einen erholsamen Schlaf.
Den konnte er ja im Haus nicht finden.
Oder besser, er hätte ihn nachts finden können, doch da hatte er andere Verpflichtungen.
Außerdem war Jenny so komisch. Sie vergaß sogar manchmal, ihm sein Essen zu richten. Und morgens wurde sie nicht wach. Jetzt saß sie auch schon wieder so da.
Ghizmo umrundete das blaue Sofa, strich an Jennys Beinen entlang und sprang dann auf das Polster. Sie rührte sich nicht.
In den ersten Tagen seiner Bekanntschaft mit ihr hatte er manchmal eine Art grauen Nebel um sie herum bemerkt. Dann wirkte sie düster und betrübt. Aber das war es nicht. Nein, Düsternis lag nicht um sie herum, eher so etwas wie eine rosige Glasschicht. Man kam nicht so richtig durch. Meistens reagierte sie ganz ordentlich auf Blicke und Gesten, aber inzwischen musste man richtig laut und drastisch werden, damit sie einen bemerkte.
Er drückte seinen Kopf an ihren Arm.
Das funktionierte.
»Hallo, mein Kleiner.«
Hallo, Jenny.
Finger krabbelten durch sein Fell, streichelten, kneteten an den richtigen Stellen, kratzten ein bisschen. In seiner Kehle sammelte sich das Schnurren und durchbebte ihn lustvoll.
Es hätte länger anhalten können, aber dann erschlafften ihre Finger.
»Ich sollte zu Bett gehen.«
Könntest du.
Sie langte zu einem Päckchen, das auf dem Tisch lag.
»Ich sollte meine Tablette nehmen.«
Musst du?
»Dann würde ich gleich einschlafen.«
Macht die das?
Jetzt hielt sie eine kleine gelbe Kapsel in den Fingern und betrachtete sie nachdenklich.
»Ich weiß nicht. Es ist nicht schlecht, die ganze Nacht zu schlafen. Aber ich fühle mich so seltsam. Nicht so ganz wie ich selbst. Aber was soll’s.«
Ghizmo sah zu, wie sie die kleine Kapsel in den Mund steckte und schluckte. Dann stand sie auf und ging langsam die Treppe nach oben, ohne ihn weiter zu beachten.
Ihm gefiel das nicht, und als er die Tür zum Badezimmer zufallen hörte, krallte er nach der Packung. Sie fiel auf den Boden. Eingehend beschnüffelte er sie, aber er roch nur Pappe. Darum kickte er sie über das glatte Parkett, und als sie unter das Regal rutschte, machte er sich nicht die Mühe, sie von dort wieder herauszuangeln.
Es war Zeit, sich draußen um die diversen Angelegenheiten zu kümmern.
Sein erstes Ziel war die Scheune. Wenigstens hier war seit einigen Tagen nichts verändert worden. In der Sofaecke lag der Schwarze und schlief. Der halb leere Napf stand auf dem Boden vor ihm. Offenbar hatte er nicht viel Appetit gehabt. Und besonders wachsam war er auch nicht. Ghizmo störte seinen Schlaf nicht, sondern schlüpfte nach draußen, um seine Runde zu beginnen. Im Garten lagen feuchte Blätter auf der Wiese, die Hecke durchfeuchtete sein Fell, als er sich hindurchwand, die Straße glänzte ebenfalls noch nass im Licht der Lampe. Jaromirs lässige Botschaft am Zaun sagte ihm, dass es keine besonderen Vorfälle gegeben hatte, Selena hatte ein paar helle Flusen an der Rinde des alten Apfelbaumes hinterlassen. Die großen Pferdebiester verhielten sich ruhig, und Goldbeere stand in ihrem Unterstand. Zu ihr begab sich Ghizmo, um sich ein wenig aufzuwärmen.
Das Pony begrüßte ihn mit einem leisen Schnauben und scharrte mit den Hufen. Das war neu und ungewöhnlich. Irgendetwas irritierte Goldbeere.
Vorsichtig sah Ghizmo sich um. Stroh lag auf dem Boden, die Krippe war gefüllt, das Geschirr hing wie üblich ordentlich an den Haken, an der Rückwand stapelten sich einige Heuballen, die süß nach Klee dufteten.
Hinter den Ballen lag ein Schwanz.
Ein strohfarbener verfilzter, schmutziger Schwanz aus langen Haaren.
Ghizmo schlug mit der Tatze darauf.
Der Schwanz zuckte.
Er schlug fester, aber noch immer mit eingezogenen Krallen.
Ein leiser Jammerlaut erklang.
Er legte die Pfote mit Krallen darauf und zog.
Es heulte.
Dann raschelte es. Der Schwanz verschwand, eine bräunliche Nase erschien, und zwei goldene Augen starrten ihn drohend an.
»Was machst du hier?«, fauchte Ghizmo die Fremde an.
»Geht dich nichts an.«
»Geht mich wohl. Du hältst dich in meinem Revier auf.«
»Na und?«
»Sag mal, bist du schwer von Verstand? Oder willst du Dresche?«
Die goldenen Augen wirkten verunsichert.
»Dresche?«
»Haue. Prügel. Hiebe.«
»N… nein. Will ich nicht. Ich will einen Platz zum Schlafen. Trocken und warm.«
»Dann geh nach Hause.«
»Hab kein Zuhause mehr.«
Goldbeere schnaubte wieder nervös. Zwei Katzen in ihrem Unterstand waren ganz offensichtlich zu viel für sie. Ghizmo schenkte der Fremden noch einen hochmütigen Blick und verließ die heimelige Stätte.
Er hatte immerhin ein Zuhause.
Auch wenn es jetzt sehr bunt war und noch nicht nach Höhle roch.
Aber vielleicht konnte man ja was daran ändern.
3
Lili weckt auf
Das Klingeln des Weckers hatte mir geholfen, aufzustehen und meinen Pflichten nachzukommen. Ghizmo blieb auch nach dem Frühstück noch eine Weile im Haus. Das mochte dem schlechten Wetter geschuldet sein, oder er vergab mir allmählich die Veränderungen an der Einrichtung. Als dann aber gegen Mittag die Sonne durch die Wolken brach, verließ er das Haus. Ich hatte mich schließlich aufgerafft, meine Korrespondenz zu erledigen, die überwiegend aus Rechnungen bestand. Es kostete mich noch immer ziemlich viel Zeit, diese Dinge am PC zu erledigen, aber schließlich musste ich mal ein wenig Routine darin entwickeln. Eben stand ich kurz davor, die Tastatur zu zertrümmern, nachdem mir eine Transaktion zum fünften Mal misslungen war, da rettete die Türklingel das Gerät.
Lili stürmte herein.
»Jenny, warum haben Sie mir das nicht gesagt? Ach, Jenny, Sie sind ja so lieb! Sie sind ja so ein Schatz! Sie sind die wundervollste Jenny, die es gibt!«
Ich wurde wild gedrückt und wild geküsst, und tränennasse Wangen schmiegten sich an mein Gesicht.
»Langsam, Lili.«
»Kann ich nicht. Ich hab’s Papa entlockt. Er wollte es erst nicht sagen, aber ich habe ihn so lange gelöchert, bis er gestanden hat. Sie haben Goldbeere für mich gekauft. Sie haben das getan. Ach Jenny …«
Man konnte sich aber auch auf niemanden verlassen.
»Woher wusste dein Vater das nur?«
»Er hat im Gestüt angerufen. Die haben gesagt, dass eine Frau Miriam Gardner das Pony gekauft hat. Und die hat sich doch auch um den Kauf dieses Hauses gekümmert. Das wusste er vom Hermann, der ist im Vorstand vom Gesangsverein.«
»So funktioniert also die Dorftrommel.«
»Ja, klasse, nicht?«
»Nein, gar nicht. Man kann nichts geheim halten.«
»Aber warum denn? Ich meine, das war doch eine furchtbar liebe Tat. Und ich bin so glücklich mit Goldbeere. Sie ist sanft und folgsam. Ein bisschen temperamentvoller als Tinkerbell, aber das macht auch mehr Spaß. Und wissen Sie, nächsten Monat werde ich vierzehn, und dann kann ich mit ihr an den Wettkämpfen teilnehmen.«
Lilis Überschwang erschlug mich beinahe.
»Könntest du ein bisschen langsamer mit einer alten Frau sprechen?«
»Wo ist hier eine alte Frau?«
Ich ließ mich auf mein blaues Sofa fallen, und Lili schien jetzt auch die Veränderung zu bemerken.
»Oh, wow! Das sieht ja irre aus hier. Mann, toll. In echt!«
»Gefällt es dir? Ghizmo ist nicht begeistert.«
»Katzen mögen es nicht, wenn Möbel umgestellt werden. Aber er wird sich dran gewöhnen. Vor allem, weil seine Klappe jetzt viel besser erreichbar ist.«
»Ich hoffe auch, dass das geschieht. Und nun noch einmal zum Sortieren: Was für einen Wettkampf willst du gewinnen?«
Lilis Kichern war ansteckend.
»Gewinnen … Ich will dabei sein. Voltigieren. Da darf man mit vierzehn antreten. Es gibt ein Pflichtprogramm, und ich denke, die Übungen beherrsche ich ziemlich gut. Und dann eine Kür von zwei Minuten. Da habe ich auch schon eine Idee. Wissen Sie, als wir neulich im Zirkus waren und diese gigantische Feuershow gesehen haben … also diese Musik, die würde ich gerne nehmen. Den Phoenix-Song. Was meinen Sie?«
»Ich sehe dich schon das Feuer-Poi auf Goldbeere schwingen.«
»Geniaaaal!«
»Spaß beiseite, Lili. Der Song ist nicht ganz einfach.«
»Ich weiß. Aber gerade das macht es so reizvoll. Ich würde gerne den Refrain am Ende nehmen. Da, wo sich Ignacias Stimme so gigantisch gegen das Orchester durchsetzt.«
»Da hast du dir aber wirklich Großes vorgenommen.«
»Klar, darum übe ich ja schon die Sprünge. Kleines Hoppeln geht da nicht.«
Plötzlich wirkte das Mädchen vollkommen versonnen und schwieg.
Ich konnte es verstehen. Der Phoenix-Song hatte äußerst dramatisches Potenzial. Wenn sie es gut choreografieren würde, könnte das eine beeindruckende Vorführung werden. Vom Voltigieren hatte ich wenig Ahnung, von Choreografie und Musik schon.
»Wenn es so weit ist, kann ich versuchen, dir zu helfen. Mit Musik habe ich mich eine Zeit lang intensiv beschäftigt.«
»Das wär super, Jenny. Ich wollte meine Musiklehrerin fragen, aber die mag moderne Sachen nicht so. Und für die Weihnachtsfeier wollte ich mit Joly zusammen ein Doppel einüben. Aber nur zu Jingle Bells oder so.«
»Ein Doppel? Ich dachte, Jolys Pony kann nicht mehr – mh – auftreten.«
»Nee, nicht mit zwei Ponys, sondern wir zwei auf Goldbeere.«
Ein ehrgeiziges Mädchen, das musste man ihr lassen.
»Das stelle ich mir nicht ganz einfach vor.«
»Ach, geht schon. Joly ist gut. Und sie ist etwas größer als ich. Sie wird mich heben können. Und ihre Mutter wird uns die Kostüme schneidern.«
»Mein Gott, ich seh es direkt vor mir: Zwei Engelchen auf einem weißen Pony!«
Das Kichern erreichte seine ekstatische Phase.
»Wir werden Lichterkränze auf dem Kopf tragen müssen«, keuchte sie schließlich.
»Einfache Heiligenscheine reichen.«
Irgendwie war das Herumalbern ansteckend. Und es tat mir richtig gut. Die lähmenden Schwaden verschwanden aus meinem Kopf, und ich fühlte mich wieder richtig lebendig.
»Ich sehe nur ein kleines Problem, Lili. Das Wetter wird unangenehmer und die Tage immer kürzer. Wo wollt ihr üben?«
»Ach, das ist nicht schlimm. Erst mal stellen wir die Übungen trocken zusammen, das können wir in der Sporthalle machen. Und dann bringen wir Goldbeere in die Reithalle von Bartels.«
Plötzlich wurde ihr sommersprossiges Gesicht ernst.
»Mist!«, sagte sie.
»Was ist?«
»Ich hab mich heute mit der Sauertopf angelegt. Das ist aber auch eine blöde Zicke.«
»Sauertopf hört sich nicht gut an. Was hast du ihr angetan?«
»Sie ist unsere Sportlehrerin. Und sie hat’s irgendwie nicht wirklich drauf. Entweder wir müssen so Pipi-Übungen an den Geräten machen oder Völkerball spielen. Ich hab ihr gesagt, dass wir lieber richtig turnen wollen. Am Barren oder am Pferd. Oder wenigstens Bodenübungen. Aber sie sagt, das steht nicht im Lehrplan. Und da hab ich ihr gesagt, wahrscheinlich ist sie zu steif dazu mit ihren alten Knochen. Und da hatte ich einen Eintrag weg. Mist.«
»Sagen wir mal – sehr höflich war die Bemerkung nicht.«
»Aber sie ist eine lahme Krücke und sollte besser Häkeln unterrichten statt Sport. Es ist so erbärmlich langweilig bei ihr. Das finden wir alle. Wirklich.«
»Hier wären möglicherweise die Eltern gefragt, damit die sich bei der Schulleitung darüber beschweren?«
»Vielleicht. Aber dann müsste ich Papa das alles erklären.«
»Und? Würde er dir nicht zuhören?«
Sie schien abzuwägen, dann nickte sie.
»Ich werde das versuchen. Denn von ihr brauchen wir die Genehmigung, in der Halle zu üben.«
Dann nahm sie plötzlich meine Hand und sagte in tiefernster Stimme: »Jenny, wegen Goldbeere – wenn Sie jemals etwas möchten, das ich für Sie tun soll, dann werde ich das machen. Egal, was es ist.«
»Das ist ein gefährliches Versprechen, Lili. Ich könnte etwas Ungesetzliches fordern …«
»Ach, Jenny. Sie doch nicht!«
Ich musste über ihr bedingungsloses Vertrauen lächeln. Ich sollte ihr wohl besser nie verraten, dass ich die letzten fünf Jahre im Gefängnis verbracht hatte.
Kurz darauf verließ mich Lili, und ich konnte von meinem Fenster aus zusehen, wie sie auf ihrem Pony ihre Kreise zog und dabei anmutig allerlei Übungen absolvierte.
4
Jaromirs Ärger
Lili brachte Goldbeere zurück in den Unterstand, und Ghizmo begrüßte sie mit einem leichten Kopfstoß an ihren Beinen. Sogleich wurde sein Gruß mit einem ausgiebigen Streicheln erwidert.
»Hab ich mir doch gedacht, dass du hier bist. Schau, ich habe dir ein paar Leckerchen mitgebracht. Hast du dich mit Goldbeere angefreundet?«
Lili war immer nett zu ihm gewesen, und in der schlimmen Zeit, als man ihm sein Haus versperrt hatte, hatte sie ihm oft Futter mitgebracht. Von dem Knabberzeug, das sie großzügig für ihn ausgestreut hatte, naschte er ein paar Krümel, doch er war noch zu satt, um alles zu fressen. Er schnurrte sie freundlich an und sah dann zu, wie sie sich um das Pony kümmerte. Das tat sie immer sehr aufmerksam, und Goldbeere schien es ihr auch zu danken. Als sie frisches Heu in die Krippe füllte, beobachtete er, wie der strohfarbene Katzenschwanz sich weiter hinter die Ballen verzog. Die Fremde war also noch immer hier, und sie hatte Angst. Er nahm sich vor, sie später, wenn Lili fort war, aus ihrem Versteck zu locken.
Das Mädchen bürstete ihr Pony ziemlich lange und sang dabei dieses Lied, das auch Jenny manchmal summte. Lilis Stimme war klarer, Jennys war rau und kratzig. Aber die Melodie beherrschte Jenny besser. Zumindest so für Katzenohren. Dann verabschiedete Lili sich, und Ghizmo schlich sich zu den Heuballen an der hinteren Wand. Von dem Schwanz war nur die Spitze zu sehen.
»Komm raus. Lili ist weg.«
Es raschelte und kruschelte, und ein strohfarbener Kopf tauchte zwischen den Ballen auf. Die goldenen Augen blickten ängstlich, die Schnurrhaare bebten.
Ghizmo sah sie an und senkte die Lider, um ihr zu zeigen, dass er friedlich gestimmt war.
»Wer bist du?«, fragte er.
»Milena.«
»Komm raus, Milena.«
»Ist … ist da auch niemand?«
»Nur Goldbeere, und die ist freundlich, wenn du sie nicht erschreckst.«
Die Katze wand sich zwischen den Ballen heraus, und Ghizmo konnte sehen, dass ihr langes Fell verfilzt und schmutzig war. Außerdem machte sie einen sehr mageren Eindruck, schien aber nicht krank zu sein.
»Was ist dir passiert?«
»Sie sind weg. Haben mich rausgesetzt. Haben gesagt, eine Katze kommt alleine zurecht.«
»Sicher, tun wir doch auch.«
»Aber ich war noch nie … noch nie draußen. Es ist alles so … fremd. Und niemand gibt mir zu essen.«
»Hier im Stroh und draußen auf der Weide gibt es ausreichend Mäuse, Maulwürfe, Vögel …«
»Kann schon sein, aber ich weiß nicht, wie ich die fangen soll.«
»Hast du das nicht gelernt?«
»Hab keine Mama gehabt. Kam gleich zu meinen Menschen.«
Manche Menschen waren nicht sehr klug, eigentlich dümmer als manches Weidetier. Wie konnten sie eine Katze nur einsperren?
»Und wo sind sie jetzt?«
»Weg. Sie haben alles eingepackt und sind weg. Ich … ich wusste nicht, wohin ich sollte. Und es hat so geregnet. Und ich bin ganz schmutzig geworden, und niemand bürstete mein Fell aus.«
Nicht mal allein putzen konnte sie sich. Aber vermutlich war das schwierig, bei dem langen Fell. Ghizmo rollte sich zusammen und betrachtete das verwahrloste Tier.
»Hungrig bist du wohl auch.«
»Sehr.«
»Komm mit!«
»Wo… wohin?«
»Zu meinem Haus.«
»Ich trau mich nicht.«
»Warum nicht?«
»Da leben fremde Menschen. Ich mag fremde Menschen nicht.«
»Du musst sie nicht treffen. Es gibt da eine Scheune. Da stört uns keiner.«
»Muss ich über die Straße laufen?«
»Ja. Nun komm!«
Vorsichtig und langsam folgte Milena Ghizmo, doch als ein Auto vorbeifuhr, hetzte sie zum Unterstand zurück.
Ghizmo ließ sie ziehen. Seine Fürsorge aufdrängen wollte er ihr nicht. Immerhin lag noch das Trockenfutter auf dem Boden. Das würde sie wohl allein fressen können.
Er hätte zu seinem Haus zurückkehren können, aber es war ihm nach kätzischer Unterhaltung. Um es genau zu sagen, nach einer kleinen Prügelei. Und wer war als Gegner besser geeignet als Jaromir, der rote Teufelsbraten? Es war nicht schwer, seine Fährte aufzunehmen. Er hatte seine Runde in der alten Apfelplantage beendet, die an Jennys Scheune grenzte. Die Äpfel waren nicht mehr geerntet worden, und viele lagen auf dem Boden, ein willkommenes Mahl für allerlei Kleingetier. Mäuse mit Apfelgeschmack hatten ein vorzügliches Aroma, und Ghizmo war nicht der Meinung, dass sie ausschließlich seinem Konkurrenten den Magen füllen sollten.
Jaromir verzehrte eben eine dieser Mäuse, als Ghizmo ihn fand. Er ließ ihn seine Beute auffressen, dann sprang er ihn aus seiner Deckung heraus an. Es war ein prächtiges Getümmel mit Kreischen und Fauchen, gesträubten Haaren und drohenden Gebärden, wilden Fluchten und wüsten Beschimpfungen.
Es endete damit, dass sie beide steif voreinander standen und sich mit starren Blicken maßen. Schließlich senkte sich Ghizmo auf seinen Bauch und machte zwei sehr langsame Schritte rückwärts.
Jaromir setzte sich auf seine Hinterpfoten und begann, ausgiebig sein Fell zu glätten. Ghizmo blieb noch einen Moment auf Distanz und verdaute seine Niederlage. Dann widmete er sich ebenso seiner Fellpflege, und als das zur Genüge erfolgt war, fragte er: »Gibt’s was Neues?«
»Der Alte kann mit der Neuen nicht. Und ich auch nicht. Die ist giftig. Und muffelt.«
»Zeig ihr die Kralle.«
»Schwierig. Die hat ein dickes schwarzes Fell an.«
»Pinkel drauf.«
»Hab ich schon gemacht. Hat sie nicht bemerkt.«
»Zeig dem Alten die Kralle.«
»Niemals!«
»Du kannst in die Scheune ziehen. Da hat Jenny ihre Möbel reingestellt.«
»Ich will aber nicht aus dem Haus. Der Alte braucht mich.«
»Dann bleib. Ich bleib auch, obwohl Jenny alles umgestellt hat. Riecht nicht mehr richtig.«
»Verteil deine Haare überall, dann wird es besser.«
»Guter Plan.«
Sie schlenderten unter den Bäumen entlang und haschten dann und wann nach einem trockenen Blatt. Ghizmo überlegte, ob er von der fremden Katze bei Goldbeere berichten sollte, aber in der Sache war mit Jaromir nicht zu spaßen. Er würde sie verprügeln wollen. Und Milena wäre ihm wahrscheinlich hilflos unterlegen. Dafür sagte er: »Der Streuner ist krank.«
»Woher weißt du das?«
»Er liegt nur rum und frisst nicht.«
»Wo liegt der rum?«
»Auf dem Sofa. In der Scheune.«
»Du hast ihn in dein Revier gelassen?«
»Na und?«
»Weichpfote.«
»Stört’ s dich?«
»Ist ja nicht mein Revier.«
»Bleib weg von ihm.«
»Mal sehen.«
»Könnte sein, dass meine weiche Pfote dir einen Fetzen aus deinen Schlappohren krallt.«
»Schaffst du nie!«
»Pah!«
Und schon fing das Gerangel wieder an. Blätter flogen, matschige Äpfel rollten, Spinnen flüchteten, grelles Kreischen durchbrach die nächtliche Stille.
Es endete in einem langen, sonoren Brummen, und diesmal war es Jaromir, der sich langsam von dannen schlich.
Zufrieden mit dem Ergebnis trottete Ghizmo zu seinem Haus, huschte durch die Klappe und prüfte die Futterschüssel in der Küche. Ein paar Knabberfischchen knusperten zwischen seinen Zähnen, dann begutachtete er den Sessel.
Haare drauf.
Eine Option. Er sprang auf das Polster und wälzte sich darauf. Das Gefühl war recht angenehm. Und so rollte er sich nach ausgiebigem Putzen zusammen und wanderte in sein Traumland.
5
Schauriges Erwachen
Er erwachte aus dem Traumland. Aus einem Land wirrester Träume. Musik war da gewesen. Laute. Und Farben. Wild zuckende. Genau wie Menschen. Eine Party? Träge schüttelte er den Kopf. Der brummte. Es war schwierig, sich richtig zu erinnern. Ein Mädchen, weich und heiß und verschwitzt vom Tanzen. Ein Glas mit einem kühlen, süffigen Getränk. Stickige Luft, Enge, Wärme. Und Musik. Tosende laute Musik, hämmernde Bässe.
Ah, es war diese Diskothek, jetzt fiel es ihm wieder ein. Freunde hatten ihn mitgenommen. Ihn da reingeschmuggelt, weil ihm noch so ein dämliches Jahr zur Volljährigkeit fehlte. Er hatte ihnen die erste Runde Getränke dafür ausgegeben. Die zweite auch. Danach verlor sich das etwas. Sie hatten Mädchen angesprochen, die anderen hatten weitere Getränke spendiert. Er hatte getanzt. Ja, getanzt hatte er, obwohl er das gar nicht konnte. Aber die Bässe, die Beats – es war plötzlich ganz einfach.
Und jetzt?
Totenstille.
Dunkelheit.
Und ein fürchterlich brummender Kopf. Der lag auf irgendwas Nachgiebigem. Der Rest seines Körpers ebenfalls. Eine Luftmatratze. Über ihm eine Decke.
Jemand hatte ihn von dort weggebracht.
Okay, das war nett gedacht. Einem Menschen mit einem Filmriss aus einer Disko zu bringen war vernünftig. Auf gute Freunde war eben Verlass.
Gute Freunde?
Viele hatte er nicht von denen.
Inzwischen hatten sich seine Augen an das Dunkel gewöhnt, und er erkannte einen Lichtschimmer, der durch eine hohe Öffnung in der Wand fiel. Und dieser Schimmer fiel auf eine Wasserflasche gleich neben ihm.
Wie ein Verdurstender griff er nach ihr.
6
Treppensturz
Ghizmo hatte ganz offensichtlich die Nacht auf dem grünen Sessel verbracht. Eine feine Schicht grauer Katzenhaare überzog die Sitzfläche. Ich wischte sie weg und legte eine gelbe Decke darauf, auf der er schon mal gelegen hatte. Viel Hoffnung, dass er sie demnächst als Liegeplatz benutzen würde, hatte ich zwar nicht, aber es war einen Versuch wert.
Weil ich mich wieder leicht benommen fühlte, beschloss ich, meinen Kopf an der frischen Luft zu lüften und einkaufen zu gehen. Vornehmlich Katzenfutter, da auch Jaromir seinen Anteil brauchte. Der Gang in den Ort brachte den gewünschten Erfolg, doch als ich mit einem Beutel Trockenfutter und einer Kiste Huhn in Gelee bei Woody klingelte, blieb die Tür verschlossen. Das wunderte mich etwas, denn um die Mittagszeit war der alte Herr immer zu Hause. Ich stellte meine Last ab und ging den Seitenweg um das Haus, um zu schauen, ob er sich hinten im Garten aufhielt. Aber auch da war keine Spur von ihm zu sehen. Also war ich so dreist und ging an das Terrassenfenster.
Und hier hörte ich es.
»Hilfe! Hilfe!«, drang es leise aus dem Haus.
Kurz überlegte ich, ob ich mein Handy nehmen und ihn anrufen sollte, aber dann wurde mir klar, dass er, wenn er ans Telefon könnte, sicher schon jemanden alarmiert hätte.
Wie kam ich in das Haus?
Die Haustür war verschlossen, einen Schlüssel hatte ich nicht. Vermutlich hatte die Pflegerin einen, aber deren Telefonnummer kannte ich nicht. Blieben die Fenster. Vielleicht war eines offen. Ich ging noch einmal um das Haus herum, aber nirgendwo war eines auch nur gekippt. Meine Fähigkeiten als Einbrecher ließen zu wünschen übrig, und wie man ein geschlossenes Fenster aushebelte, wusste ich bedauerlicherweise nicht.
Woody rief noch immer um Hilfe. Es musste ihm etwas Gravierendes passiert sein.
Ein Stein fiel mir in die Hand.
Das Fenster an der Vorderseite des Hauses schien mir das günstigste für meinen Einbruch. Die bodentiefen Terrassentüren würden vermutlich fürchterlich splittern. Zum Glück handelte es sich um ein Kassettenfenster mit kleinen Scheiben. Ich wickelte mir meinen Schal um die Hand und schlug mit dem Stein auf die Scheibe neben dem Griff. Ein Riss bildete sich. Mehr nicht. Also mehr Kraft dahintersetzen. Der Riss verbreiterte sich. Noch mal zuschlagen. Es klirrte, als die Scherben nach innen fielen. Ich warf den Stein zur Seite und holte mir einen der Gartenstühle, um das Fenster zu öffnen und einzusteigen. Es war eine turnerische Leistung, die Lili sicher weit eleganter gelöst hätte. Aber dann saß ich auf der Küchenarbeitsplatte neben der Spüle und rief Woody zu: »Ich komme und helfe Ihnen!«
»Jenny! Hier!«
Er lag mit einem abgewinkelten Bein unten an der Treppe in der Diele, sein Stock außer Reichweite. Jaromir saß neben ihm und sah mich an, lief aber nicht weg.
»Gefallen?«