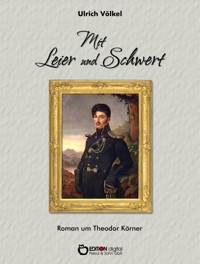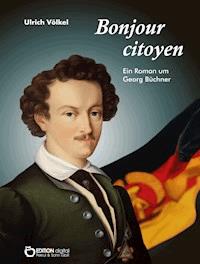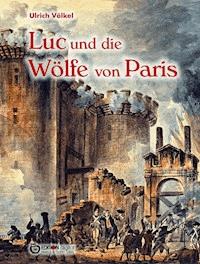7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der Vizepräsident und der Chef des Geheimdienstes putschen gegen den Präsidenten der Republik, um einer drohenden Revolution zuvorzukommen. Der Coup gelingt. Aber wohin nun mit dem gestürzten Diktator? Er muss, wenn die Putschisten wenigstens scheinbar ihr Gesicht wahren wollen, vor Gericht gestellt werden. Aber welche Aussagen haben der ehemalige Vizepräsident, nunmehr selbst an der Macht, und der Chef des Geheimdienstes von ihrem Gefangenen zu erwarten? Sie entschließen sich zu einem “Handel” dergestalt, dass dem Gefangenen eine Villa in einem gutbewachten weitläufigen Park zur Verfügung gestellt wird, wo er ohne Rücksicht auf irgendwelche Personen seine Memoiren schreiben und in einem Safe bis zu seinem Tode verwahren kann; erst dann sollen sie veröffentlicht werden. Der Preis: die Aussagen vor Gericht müssen in den wesentlichen Punkten vorher vereinbart werden. Die nur mühsam kaschierte Drohung: geht der Gefangene nicht auf den Deal ein, wird er im Staatsgefängnis sehr lang auf seinen Prozess warten müssen. Der gestürzte Diktator ist ein alter Mann. Er willigt ein. Oberst Lu Mores vom Geheimdienst, ein integrer Mann, und Dr. Ines Rebelius, eine Historikerin, werden beauftragt, den Plan mit “flankierenden Maßnahmen” abzusichern. Sie wissen nichts von den wahren Absichten ihrer Auftraggeber; jedenfalls zunächst nicht. Am Tage des Prozessbeginnes feuert ein Scharfschütze auf den Anzuklagenden, als der das gepanzerte Auto verlässt, um seinen Richtern vorgeführt zu werden. Er ist sofort tot. Auf seinem Gesicht ein merkwürdig zufriedenes Lächeln. Wenige Stunden später geschieht ein weiteres Unglück. Die Ereignisse spielen nicht in Deutschland, auch nicht in einem Teil Deutschlands. Sie könnten sich beispielsweise in Südamerika ereignet haben. Oder in Afrika. Oder vielleicht doch in Deutschland?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 217
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Impressum
Ulrich Völkel
Der Tresor des Diktators
Polit-Thriller
ISBN 978-3-95655-512-1 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien erstmals 1993 im Verlagshaus Thüringen, Erfurt.
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2015 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
In Ansehung jüngerer und jüngster Vorgänge sieht sich der Verfasser dieses Buches verpflichtet, unmissverständlich zu erklären, dass es sich bei dem vorliegenden Werk um eine reine literarische Erfindung handelt. Auch er ist bestürzt von der frappierenden Ähnlichkeit mit Vorgängen aus der Realität.
1. Kapitel
Der Platz der Republik, umgeben von imposanten, Macht protzenden, kalten Gebäuden aus weißem Marmor, blitzendem Stahl und getöntem Glas, füllte sich mit Menschen.
Der Präsident feierte seinen siebenundsiebzigsten Geburtstag. Das Volk war aufgefordert worden, dem Großen Vater, wie er sich gern nennen ließ, seine Glückwünsche darzubringen. Das Volk, stand in allen Zeitungen, liebt ihn und vertraut seinem Großen Vater. Der Geburtstag des Präsidenten, das hatte sich so ergeben, war gleichzeitig Nationalfeiertag. Es galt als widerspenstig, an diesem Tag einer anderen Beschäftigung nachzugehen denn einer Huldigung des Großen Vaters. Es war sogar gefährlich. Hundertschaften der Sicherheit patrouillierten durch die Straßen. Wer nicht zum Platz der Republik ging, wurde gefragt, ob er den Präsidenten nicht liebe. Der siebenundsiebzigste Geburtstag des Großen Vaters fiel auf den vierzehnten Jahrestag der Republik. Die Republik war eine Diktatur.
Der Platz war so angelegt, dass auch die mehr als hunderttausend Menschen, die sich auf ihm versammelten, das Gefühl haben sollten, eine homogene Masse zu sein, die, erschiene der Präsident nicht auf dem großen Balkon seines Palastes, hilflos, führerlos, eigentlich recht unglücklich war; eine Herde ohne Leittier, dem ungewissen Schicksal ausgeliefert ohne ihn. Der Palast selbst überragte alle Gebäude rundum. Das Licht der Sonne brach sich im chromblitzenden Stahl, in der blanken Verglasung und im gleißenden Gold des Staatswappens, das der Präsident selbst entworfen hatte.
Seit vierzehn Jahren beherrschte der Mann das Land. Sein Bild hing in allen öffentlichen Gebäuden, in jedem Zimmer, auf sämtlichen Fluren und Korridoren. Keine Tageszeitung wagte es, eine Ausgabe ohne sein Konterfei auf der Titelseite aufzumachen. Der GENERALANZEIGER DER REPUBLIK, das führende Organ, wurde von ihm persönlich redigiert. Der Präsident empfängt den König von ... Der Präsident besucht eine Schule ... Der Große Vater lächelt ... Der Präsident hat gesagt ... Das Volk liebte ihn nicht. Das Volk vertraute ihm nicht. Das Volk lebte in Furcht; denn die Sicherheit war allgegenwärtig. Nichts blieb ihr verborgen, alles wurde dem Großen Vater hinterbracht. Es kam vor, dass jemand in den frühen Morgenstunden in ein Auto steigen musste, weil er am Abend beim Bier eine Bemerkung gemacht hatte, die darauf schließen ließ, dass der Betreffende möglicherweise unzufrieden sein könnte. Er kam selten zurück. Und wenn er zurückkam, schwieg er fortan. Einem Fremden hätte auffallen müssen, dass viele in diesem Land schwiegen. Aber Fremde kamen selten ins Land. Und kamen sie doch, wurden sie stets von ortskundigen Führern begleitet, die anschließend einen ausführlichen Bericht mit neun Kopien abliefern mussten. Man merkte sich Fremde, die unbotmäßig auftraten. Vielleicht war das einer der Gründe, weshalb das Ausland nicht unbedingt mit Respekt, aber eigentlich auch nicht mit Verachtung von dieser Republik sprach, die, das wusste man natürlich, alles andere als eine Demokratie war. Das viel gebrauchte Wort Geborgenheit hatte einen seltsam bitteren Beigeschmack bekommen.
Das Volk hatte keinen Grund zu Unzufriedenheit, stand in allen Zeitungen zu lesen. Es gab reichlich zu essen, sogar sehr gesunde Kost. Jedem war das Recht auf Arbeit garantiert. Die Löhne konnten nicht übermäßig hoch genannt werden, aber das Volk war auf Luxus nicht aus, den es eh nicht zu kaufen gab.
Die besondere Aufmerksamkeit des Großen Vaters galt den Kindern. Und was man auch sonst über ihn sagen (oder lieber nicht sagen) konnte, Kinder liebte er, freilich auf seine Art. Er besuchte häufig Schulen oder Kindergärten und fand alles in bester Ordnung, denn seine Visiten wurden gründlich vorbereitet. Der Präsident liebte gesunde, sportlich durchtrainierte junge Menschen. In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist, zitierte er so oft, dass es bald als seine eigene Schöpfung zitiert wurde. Es war üblich, Aussprüche des Präsidenten, auch wenn es sich um bekannte Zitate handelte, in Leitartikeln und öffentlichen Reden zu wiederholen. Und wie unser geliebter Präsident so treffend sagt: Der Mensch lebt nicht von Brot allein. Zum Beispiel.
Dem Volk ging es gut, denn es hatte einen gütigen Vater. Das war so oft behauptet, geschrieben und festgeredet worden, dass es wahr sein musste. Der Präsident glaubte es jedenfalls.
Es muss aus Gründen objektiver Berichterstattung gesagt werden, dass die Revolution vor vierzehn Jahren einen Tyrannen gestürzt hatte. Das schreiende Elend der Massen war so unerträglich geworden, dass das Volk schließlich mit bloßen Fäusten, mit Knüppeln und Steinen, mit den Waffen der Straße auf die Soldaten losgegangen war, blutig zurückgeschlagen wurde und wahrscheinlich gänzlich zerschmettert worden wäre, wenn nicht ein in Ehren ergrauter Schreibstubengehilfe des Tyrannen in einem Anfall von Verzweiflung über die fahrlässige Tötung seines gänzlich unschuldigen Enkels durch betrunkene Soldaten mit einem Bürohocker und für alle Anwesenden unerwartet den Tyrannen erschlagen hätte, weil der eine abfällige und gemeine Redensart über den trauernden Großvater sehr zum Gaudi der ihn begleitenden Speichellecker gemacht hatte. Der Augenblick von Führerlosigkeit genügte, die nur auf die Person des Landesherren eingeschworenen Soldaten und Beamten mit einem letzten, zu aller Erstaunen unblutigen Angriff zu überrumpeln.
Der alte Mann, in dessen Schreibpult leicht widerspenstige Gedichte - oder besser: leicht als widerspenstig interpretierbar - gefunden wurden, denn er war ein heimlicher, leider nicht sonderlich begabter Poet, avancierte über Nacht zu einer Legende. Ein Held, ein Dichter des Widerstandes, ein unbestechlicher Charakter, von der Brutalität des Tyrannen gezeichneter, in seinen künstlerischen Talenten unterdrückter Protagonist der Freiheit. Es war nicht mehr auszumachen, wer ihn zum ersten Mal VATER genannt hatte, aber von Anfang an trug er diesen Namen wie eine besondere Auszeichnung. Niemand war geeigneter, den Willen des Volkes nach Gerechtigkeit und Demokratie unverwechselbarer zu präsentieren, als dieser mutige Mann, den sie fortan Vater nannten. Er wurde Präsident der Republik. Er regierte, wie er meinte, dass ein Land regiert werden müsste: mit Liebe, mit Sinn für Ordnung und Disziplin; mit Strenge, wo es not tat. Vielleicht hätte es sogar gelingen können, wenn er nicht begonnen hätte, an seine eigene Legende, und damit an seine Unfehlbarkeit zu glauben.
Das Amt überforderte die Fähigkeiten des Mannes bei Weitem. Er wäre in der Lage gewesen, die Schreibstube zu leiten, aber nicht den Staat. In den ersten Monaten, auch das muss der Ehrlichkeit halber gesagt werden, trug er sich mit dem Gedanken zurückzutreten, aber seine Berater redeten entsetzt auf ihn ein, er möge ausharren. Er personifiziere die Revolution. Träte er zurück, müsste das Volk annehmen, die Tyrannei kehre zurück. Ihre Angst war begründet insofern, als sie noch nicht fest genug auf ihren Stühlen saßen.
Die Wirtschaft des Landes, nach der Revolution von einem bemerkenswerten Aufschwung erfasst, stagnierte längst. Die Künste erstarrten in langweiligen Elogen. Aufgabe der Wissenschaft war es, den Beweis für die Richtigkeit der Ideen des Großen Vaters zu liefern. Das vornehmste Ziel der Pädagogik bestand darin, treue Staatsbürger zu erziehen. Sport, ja, Sport als der Beweis für den gesunden Volkskörper, koste es, was es wolle.
Es schmerzte den inzwischen greisen Präsidenten heftig zu erfahren, dass es Leute im Lande geben sollte, die seine gerechte Strenge nicht als Beweis seiner Liebe begriffen, sondern in völliger Verkennung der Wahrheit, wie er sie sah, ihn für einen Tyrannen hielten, der sein Volk einschloss wie ein penibler Beamter die Utensilien seines Schreibtisches. Wenn am Anfang immer nur von Ordnung die Rede war, so hieß es bald Ordnung und Disziplin, bis nur noch Disziplin gesagt und gefordert wurde. Wenn es möglich gewesen wäre, die Gedanken zu disziplinieren, wäre das angeordnet worden. Es gab bereits sehr viele Leute, die das im Selbstversuch probierten. Denken war gefährlich geworden. Die Gefängnisse füllten sich. Für Leute mit einem gewissen Bekanntheitsgrad gab es die Psychiatrie, wenn andere Formen der Disziplinierung nicht fruchteten.
Sollte das Land nicht völlig in sich selbst zusammenbrechen, wäre eine Absetzung des Präsidenten dringend notwendig gewesen. Aber wer konnte das tun? Selbst entschiedene Gegner des Präsidenten verteidigten die Ideale der Revolution, weil sie an den Sieg der Vernunft glaubten. Diese Ideale hätte man, sagte ein Spötter hinter vorgehaltener Hand im engsten Freundeskreise, zuerst einmal an den Ameisen ausprobieren müssen, denn die verfügten über ein geordnetes Staatswesen. Es wäre vermutlich die sicherste Methode, Ameisen auszurotten, sagte ein anderer sarkastisch. Da also weit und breit keine wirkliche Alternative sichtbar war, und es denen, die Widerstand hätten leisten können, am erforderlichen Mut gebrach, Verantwortung zu übernehmen, wartete man allgemein auf die natürlich Lösung des Problems. Der Präsident war ein alter Mann.
Einer, der den Präsidenten zu Lebzeiten hätte ersetzen könne, war Pal Griener, Vizepräsident der Republik, schon lange als Kronprinz gehandelt, aber sich selbst nie als solcher positionierend. Er war jung genug, Anfang vierzig, um warten zu können. In der Öffentlichkeit trat er als der treueste Anhänger des Präsidenten auf. Freilich vermied er es in den letzten Jahren vor allem dem Ausland gegenüber, sich bei zweifelhaften Entscheidungen des Präsidenten allzu deutlich aus dem Fenster zu lehnen; reiste er aber durchs Land, nahm er sich den einen oder anderen unwirschen Gebietsfürsten zur Seite und sagte: „Warte es ab.“ Dabei spielte es keine Rolle für ihn, dass manch eine dieser drakonischen Maßnahmen, gegen welche die Untergebenen vorsichtig opponierten, aus seinem, Pal Grieners, Kopfe gekommen waren. Er beherrschte die Grundregeln der Demagogie perfekt. Sie hätten von ihm stammen können. Jedenfalls gelang es ihm, weithin den Eindruck zu vermitteln, dass er, wäre er erst einmal Präsident, das schlingernde Staatsschiff schon wieder auf Kurs bringen könne, ihm aber menschliche Gründe die Hände bänden, gegen den alten Mann mit der erforderlichen brachialen Gewalt vorzugehen. Man müsse dem Präsidenten, sagte er damals noch, zugutehalten, dass er seine Verdienste um das Vaterland habe, wenn die auch schon Jahre zurücklägen. Immerhin habe er sich seine Sporen im Kampf gegen einen Tyrannen verdient.
Pal Griener wusste, dass die Zeit für ihn arbeitet. Er hatte ein vertrautes Verhältnis zum Leibarzt des Präsidenten. Um seine eigene Position nicht zu gefährden, ließ er es an Devotheit nicht fehlen. Der Präsident seinerseits, zunehmend unter dem Argwohn alter Herrscher leidend, man wolle ihn verdrängen oder gar stürzen, vertraute ausgerechnet ihm blind.
Der Unmut im Volk wuchs. Die allgegenwärtige Sicherheit registrierte eine Sammlung progressiver Kräfte, die sich den Namen AGORA gegeben hatte, Aktionsgemeinschaft oppositionelle Résistance Andersdenkender. Dabei handelte es sich nicht etwa um eine Partei, die gar nicht zugelassen worden wäre, nicht einmal um eine wirklich organisierte und nach Konzept handelnde Gruppierung, sondern um mehr oder weniger lose miteinander in Verbindung stehende Freundeskreise, denen Landesverrat nicht ohne Weiteres nachgewiesen werden konnte, weil es sich in aller Regel um Leute handelte, die Reformen wollten, aber um Himmels willen keine blutige Revolution. Um wirksam gegen sie vorgehen zu können, war der Geheimdienst dazu übergegangen, seine eigenen Leute einzuschleusen, die, wenn sie zu Einfluss gelangt waren, eine schärfere Tonart anschlugen, wirklich von Umsturz redeten und gelegentlich überschaubare Aktionen starteten, die selbst in einem demokratisch organisierten Staatswesen für kriminelle Handlungen angesehen werden konnten. Dies wiederum nutzten der Chef des Geheimdienstes und Pal Griener, um den Präsidenten zu schärferen Gesetzen zu animieren und sich selbst zu größeren Vollmachten zu verhelfen. Es war ein Balance-Akt, der Absturz ins Bodenlose immer möglich. Und es konnte, dafür war die Verzweiflungstat des damaligen Schreibstubengehilfen und nachmaligen Präsidenten eine deutliche Warnung, urplötzlich zu einer Eruption gleich der eines über lange Zeit scheinbar friedlich rauchenden Vulkans kommen, die mit Urgewalt jede kühle Berechnung zerfetzte und zerstob. Der Chef des Geheimdienstes und der Vizepräsident hatten ihre Seismografen installiert. Sie wussten um die Stimmung im Volk. Wenn sie sich jetzt nicht mit einem entschlossenen Putsch an die Spitze der noch nicht wirklich organisierten Opposition stellten, liefen sie Gefahr, im Strudel einer unkontrollierbaren Revolution selbst in den Abgrund gezogen zu werden. Sie mussten handeln. Sie handelten kalt und präzise.
Das Volk versammelte sich auf dem Platz der Republik gemäß der Anordnung, dem Großen Vater, dem von allen geliebten Präsidenten, die Glückwünsche zu seinem Geburtstage und die Hochrufe auf die Republik darzubringen.
Zehn Uhr sollte das festliche Ereignisse mit einer Ansprache des Präsidenten, gehalten auf dem Balkon des Palastes, beginnen. Die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen waren getroffen worden. Punkt neun Uhr erschienen Pal Griener und der Chef des Geheimdienstes mit ernsten Gesichtern beim Präsidenten. Sie erklärten, dass nach gründlicher Auswertung aller geheimdienstlicher Ermittlungen alles darauf hindeute, dass subversive, natürlich vom Ausland mit viel Geld gesteuerte Kräfte, diesen Anlass zu einem Sturm auf den Palast der Republik nutzen wollten mit dem Ziel, eine Konterrevolution in Gang zu setzen, bei der die Ermordung des Präsidenten und aller Mitglieder der Regierung eingeplant sei. Sie beschworen ihn, der sonst nicht mehr aufzuhaltenden Katastrophe dergestalt entgegenzuwirken, dass er, der Präsident der Republik, der Große Vater, von seinem Amt zurückträte, um den Weg für freie, demokratische Wahlen vorzubereiten. Sie hätten, sagten sie, eine entsprechende Rede entworfen, die er lediglich ablesen müsse wie seine Reden sonst auch. Es sei dafür Sorge getragen, dass er seinen Lebensabend mit allen ihm zustehenden Privilegien und Bequemlichkeiten genießen könne. Er habe, sagten sie, Übermenschliches für die Republik geleistet, und jedes Recht, sich zur Ruhe zu setzen. Das Volk, sagten sie, liebe seinen Vater und werde ihn verstehen. Nähme er mit seinem Rücktritt den Aufwieglern den Wind aus den Segeln, wäre dies seiner heroischen Tat, mit der er die Tyrannei gestürzt habe, gleichzusetzen. Er werde, sagten sie im Brustton der Überzeugung, als ein weiser Vater seines Volkes in die Geschichte eingehen und im Herzen der einfachen Menschen für alle Zeiten fortleben.
Der Präsident, der nach den ersten Worten der beiden aufbrausen wollte in seiner zur Gewohnheit gewordenen Art, der sie unflätig zu beschimpfen vorhatte als feige Verräter der Ideale der Revolution, der sie mit herrischer Geste aus seinem Zimmer zu weisen gedachte, hatte urplötzlich begriffen, was wirklich seit Monaten, wenn nicht gar seit Jahren hinter seinem Rücken gespielt wurde. Er hörte sich die Vorstellungen an, er lächelte zur Überraschung und Verunsicherung beider maliziös, er ließ sie ausreden und hätte, wäre ihm der Gedanke gekommen, nach der angeblich vorbereiteten Rücktrittserklärung zu fragen, sie gänzlich aus dem Konzept bringen können, denn ein solches Papier existierte gar nicht, weil die Putschisten sicher waren, davon ausgehen zu können, dass er starrsinnig wie immer reagieren werde und sie ihn lediglich bluffen wollten.
Er hörte ihnen fast heiter zu, weil er sie endlich durchschaut hatte. Und er sagte freundlich: „Passt mal auf, ihr zwei Spaßvögel, wenn ihr denkt, ihr könnt mich aufs Kreuz legen, dann müsst ihr schon ein bisschen früher aufstehen.” Und dann brüllte er doch los. „Raus! Eine andere Rede soll ich halten? Das könnt ihr haben, ihr Arschlöcher!” Und er griff das bereitliegende Papier und warf es ihnen an den Kopf. „Raus! Noch bin ich Präsident der Republik! Und du, Pal Griener, sieh dich schon mal nach einer ordentlichen Arbeit um, bevor dich dein Freund und Geheimdienstchef in eine geschlossene Anstalt einweisen lässt, in der er anschließend auch als Patient einziehen darf. Raus!”
Er wusste nicht, dass er keine Chance mehr hatte. Sie wussten, dass der Coup im Grunde genommen schon gelaufen war. Sie ließen ihn in dem Glauben, dass er die Zügel nach wie vor fest in der Hand habe. Draußen vor der Tür sagte Pal Griener: „Ich bin ihm richtig dankbar. Es hätte gar keinen Spaß gemacht, auf anständige Weise Präsident zu werden. Wo wir doch einen so schönen Putsch Vorhaben, gelle?” Und der Chef des Geheimdienstes sagte: „Worauf du einen lassen kannst!”
Nun also versammelte sich das Volk auf dem Platz der Republik, um dem Großen Vater, dem von allen geliebten Präsidenten, die Glückwünsche zu seinem Geburtstag und die Hochrufe auf die Republik darzubringen. Dieses Fest war seit Monaten mit großer Umsicht vorbereitet worden. Der Präsident selbst hatte Festlegungen getroffen, wie dieser Tag zu begehen ist. Da er schon längst kein Gespür mehr für die Volksseele hatte, falls er das je besessen haben sollte (und weil der Apparat alles vom Präsidenten fernhielt, was dessen Laune hätte nachteilig beeinträchtigen können, die sich, wurde sie gestört, zuerst, wie Erfahrung lehrte, an seinen engsten Mitarbeitern austobte), wusste der Große Vater nicht, welche Stimmung in der Bevölkerung mehr und mehr um sich gegriffen hatte.
Die AGORA, deren Existenz man ihm nicht völlig verheimlichen konnte, war, als sie um ihre offizielle Zulassung als gemeinnützige Organisation ersuchte, vom dafür gar nicht zuständigen Innenminister auf Anordnung des Präsidenten per Verdikt als vom Ausland gesteuerte Terrororganisation verboten worden. Diese in allen Tageszeitungen und Meldungen der elektronischen Medien ausgestreute Verordnung bewirkte exakt das Gegenteil der Absicht seines eigentlichen Verfasser. Es war dabei aufgefallen, dass sich der Kronprinz seit Wochen in einer bemerkenswerten Zurückhaltung übte. Gerüchte liefen um, er sei in Ungnade gefallen, weil er die vorzubereitenden Feierlichkeiten für übertrieben und der schwierigen wirtschaftlichen Lage, in der sich das Land befindet, unangemessen halte. Es hieß außerdem, der Präsident habe einen Befehl unterschrieben, der den Einsatz bewaffneter Kräfte vorsah, falls es im Zusammenhang mit der zu erwartenden machtvollen Demonstration auf dem Platz der Republik zu öffentlicher Unmutsäußerung gegen das herrschende System kommen solle. Von Internierungslagern in stillgelegten Bergwerken war die Rede und von Namenslisten zu verhaftender Personen.
Die AGORA, der die Mehrheit der Bevölkerung bislang eher skeptisch gegenübergestanden hatte, weil es sich in aller Regel um Intellektuelle handelte, die man eh misstrauisch beobachtetete, und weil die Masse gar nicht wusste, wer und was sich hinter diesem fremdländischen Namen verbirgt, wurde plötzlich zum Hoffnungsträger der Nation.
Die in den letzten Jahren gewachsene, nicht immer exakt zu definierende Staatsverdrossenheit besonders der jungen Menschen sah sich zunehmend in den Forderungen der AGORA nach Demokratie und Freiheit artikuliert. Die Opposition formierte sich. Sie verließ die geheimen Orte und trat mit ihren Forderungen öffentlich auf. Auffällig war, dass die Sicherheitskräfte des Landes, sonst gnadenlos einschreitend, wenn sich Unbotmäßigkeit auch nur in Ansätzen zeigte, sich weitgehendst zurückhielten. Es kam sogar vor, dass höhere Dienstgrade im Gespräch mit führenden AGORA-Leuten Sympathie bekundeten und teilweise sogar Übereinstimmung erkennen ließen. In solchen vertraulichen Gesprächen hieß es dann: Wir bitten darum, von unbedachten Aktionen abzusehen, eine Veränderung steht bevor. Jede spontan ausbrechende Aktion könne diesen Prozess nur gefährden.
Der Platz der Republik hatte sich dicht gefüllt. Viele Menschen trugen Fahnen und Spruchbänder, auch überlebensgroße Bildnisse des Präsidenten wurden hochgehalten. Die Menge wartete, während fröhliche Musik aus den Lautsprechern auf sie herniederflutete. In den Seitenstraßen, nicht gerade drohend, aber ihre Anwesenheit deutlich demonstrierend, standen die Fahrzeuge der Polizei.
Wer diese Veranstaltungen über Jahre hinweg miterlebt hatte und ein besonders feines Gespür besaß, hätte feststellen müssen, dass es in diesem Jahr irgendwie anders war als sonst. Das allgemeine Stimmengewirr klang merkwürdig unruhig, als gewärtige ein riesiger Bienenschwarm den Angriff eines nicht genau zu beschreibenden Feindes. Die muntere Lautsprechermusik konnte die unruhige Stimmung nicht gänzlich zudecken. Und hielten die Fahnenträger ihre Banner wirklich mit innerer Anteilnahme so hoch wie sonst? Waren es in diesem Jahr weniger Konterfeis des Präsidenten? Ja, die Spruchbänder mit den vorgegebenen, vom Großen Vater selbst ausgesuchten Losungen - davon gab es wohl reichlich.
Hoch lebe unser Großer Vater, der Präsident unserer ruhmreichen Republik!
Nieder mit den ausländischen Agenten! Nieder mit den Feinden des Vaterlandes!
Unser täglicher Kampf für den Frieden ist unser täglich Brot! Wir geloben ewige Treue unserem Großen Vater zum Wohle der Republik!
Es waren die üblichen Sprüche. Kaum einer las sie mehr genau außer den Beauftragten, welche bereits seit dem Vortage unterwegs waren, um die Fahnen an den öffentlichen Gebäuden zu zählen und im Foto festzuhalten, aus welchen Fenstern der Wohnhäuser keine Staatsflagge wehte.
Punkt zehn Uhr, man hätte nicht auf die Uhr schauen müssen, schmetterten die Fanfaren den Marsch der Republik aus allen Lautsprechern, dass die Scheiben in den Fenstern der umliegenden Gebäude klirrten. Dann ein Tusch, der abrupt abbrach. Für wenige Sekunden herrschte eine schmerzliche Stille, in die hinein die Stimme des Ersten Staatsschauspielers mit dem diesjährigen Festgedicht auf den Präsidenten dröhnte.
Das Glück des Volkes hat einen Namen!
Der Wohlstand des Volkes hat einen Rahmen!
Die Zukunft des Volkes hat ein Gesicht!
Hört auf die Stimme, die zu euch spricht!
Danket dem einen, den jeder kennt,
den schon ein Kind mit Ehrfurcht nennt:
Es ist unser Vater, der Präsident!
Der Refrain „Danket dem einen ...” war in jedem Jahr der gleiche, und es hatte sich die Liturgie herausgebildet, dass diese Zeilen von allen laut mitgesprochen wurden. So auch in diesem Jahr. In der Menge gab es hinreichend Beauftragte, die genau beobachteten, ob vielleicht einer nicht mit einstimmte oder die Lippen anders bewegte; denn es hatte Lästerer gegeben, die den Refrain entstellten, indem sie murmelten: Es ist unser Vater, der alles verpennt.
Mit Widerstand hatte diese Verunglimpfung noch nichts zu tun. Erst später werden Leute kommen, die sich darauf berufen werden, den gestürzten Präsidenten einen senilen, unfähigen Machthaber genannt zu haben zu einer Zeit, als jene Passage zu murmeln nachgerade lebensgefährliche Majestätsbeleidigung war, Leute, die es vielleicht nicht einmal gewagt haben, eine andere Zeile zu denken.
Zehn Strophen hatte das Gedicht. Auch das war vorgeschrieben. Gesagt werden muss aber aus Gründen objektiver Berichterstattung unbedingt, dass der Erste Staatsschauspieler die Verse mit einer solchen Inbrunst rezitierte, dass man sich der Gewalt seiner Stimme nicht völlig entziehen konnte, wenn man dem Text weniger nachsann.
Dem Festgedicht folgte erneut ein schmetternder Tusch der Fanfaren. Um so verblüffender war die Wirkung der Nationalhymne, die nunmehr erklang. Kein rauschendes Orchester, keine Fanfaren und schlagende Becken, kein Crescendo und keine Tutti. Eine einsame, schlichte Blockflöte mit der schmucklosen, an eine Volksweise erinnernden Melodie. Als ob ein Kind sänge. Wenn etwas nicht zu diesem Staate passte, dann war es seine auf einer Blockflöte gespielte Nationalhymne. Lobend erwähnt werden muss in diesem Zusammenhang die umfassenden musische Erziehung an den Volksschule, in denen der Unterricht in Flötespielen bereits von der ersten Klasse an praktiziert wurde.
Die Hymne verklang. Nun schlugen die Klöppel gegen die bronzene Glocke im Turm des Palastes. Die mächtige Tür zum Balkon wurde aufgetan. Mit Gold und Silber und blitzenden Trossen behängt marschierte eine Abordnung der Garde heraus, um sich rechts und links der Balustrade zu postieren. Ihnen folgten die Fahnenträger, flankiert von je drei Offizieren mit gezogenen Säbeln, die in der Sonne blitzten. Nunmehr wurde auf dem Dach des Palastes ein ohrenbetäubendes, farbenprächtiges Tagesfeuerwerk abgebrannt, das mit staunendem Ah und Oh vom Volke quittiert wurde. Gleichzeitig lief eine Schar blonder Mädchen auf den Balkon, jede mit einem riesigen Strauß Feldblumen in der Hand, die auf der Brüstung des Balkons abgelegt wurden. Dann liefen die Kinder wie an Fäden gezogen auf die Abordnung der Garde zu, wurden von ihnen nach genau einstudierter Choreografie hochgehoben und auf den Armen gehalten. Jubelrufe wurden über die Lautsprecher eingespielt.
Plötzlich verwandelte sich die Wand des Palastes hinter dem Balkon in einen großen Bildschirm. Der Präsident trat auf. Die Kamera fing nur sein Gesicht ein, das dank der Kunst des Chefmaskenbildners des Staatlichen Fernsehens Güte und väterliche Zufriedenheit ausstrahlte. Der Präsident ging einen Schritt vor seinen engsten Mitarbeitern auf einem gesonderten Laufsteg zur Brüstung hin, der durch eine Hydraulik am vorderen Ende so angehoben wurde, dass der eigentlich kleine Mann auf ihm schreitend seine tatsächlich um wenigstens einen Kopf größeren Kabinettsmitglieder schließlich um Haupteslänge überragte, als er am Rand des Balkons stand und gemessen zum Volk hinabwinkte.
Jetzt hätte geschehen müssen, was sonst immer geschehen war, dass nämlich, wieder über Lautsprecher eingespielt, Hochrufe erklängen, die den Großen Vater feiern sollten. Und der Anfang des Satzes, vom Ensemble des Staatsschauspiels lange geprobt und durch den Staatsrundfunk mit aller technischen Perfektion aufgezeichnet, dröhnte über den Platz.
ES LEBE DER GROSSE VA...
Mehr kam nicht. Nur noch ein Rauschen und Knacken und schrilles Pfeifen aus allen Lautsprechern. Dann Stille. Erneuter Versuch. ES LEBE DER GROSSE VAAAAAAAAA...
Knack. Rauschen. Fauchen. Pfeifen.
Der Kameramann richtete das Objektiv gnadenlos auf das Gesicht des zunächst nur verunsicherten, verwirrten Präsidenten, dessen Züge langsam entgleisten. Auf dem überdimensionalen Bildschirm war schließlich nur noch der wutverzerrte, geifernde Mund eines bösen alten Mannes zu sehen, weil die Menge, sich von der Verblüffung schnell erholend, zunächst nur vereinzelt, dann aber alle und alles mit sich reißend, in schallendes, befreiendes homerisches Gelächter ausbrach.
Der Präsident war unfähig sich von der Stelle zu bewegen. Er nahm nicht einmal wahr, dass die Hydraulik ihn auf normale Größe absenkte, sodass er nunmehr von allen Umstehenden überragt wurde. Mit überkippender schriller Greisenstimme herrschte er seinen Nebenmann, den Kronprinzen an: „Lass sie zusammenhauen, diese Schweine!” Er ahnte nicht, dass der Tonmeister diesen Satz bei scheinbar abgeschalteten Mikrofonen aufzeichnete, um ihn mit der Verzögerung weniger Sekunde über die Lautsprecher dröhnen zu lassen. Die Wirkung war verheerend. Das Volk schrie auf, als sei tatsächlich eine Salve in seine Mitte abgefeuert worden. Fast gleichzeitig wurden die Bilder des Präsidenten heruntergerissen, die Spruchbänder zerfetzt, die Fahnen in den Staub geworfen.
Hysterisch kreischte der Präsident ungeachtet der nunmehr direkt zugeschalteten Mikrofone, dass die Bereitschaftspolizei den Haufen auseinanderjagen solle und jeder zu verhaften wäre, der über ihn, den Großen Vater, lache. Aber er wusste bereits, dass er verloren hatte.
„Exzellenz”, hörte man nun die sonore, um Besonnenheit flehende Stimme des Kronprinzen eindringlich bitten: „Exzellenz, geben Sie diesen Befehl nicht!”
Die Kamera schwenkte auf das zutiefst besorgte Gesicht Pal Grieners. Ein Film lief ab, schien es, ein absurdes Theater. Der kleine, giftige, böse Zwerg fuchtelte mit den Händen und kreischte. Schwenk über die versteinerten Gesichter der Kabinettsmitglieder. Das entschlossene Antlitz Grieners in der Totalen. „Ich verweigere Ihnen den Gehorsam.”
Das Volk jubelte.
„Attacke! Gebt mir einen Schreibstubenhocker, damit ich diesem Kerl den Schädel einschlagen kann!”
Der Chef des Geheimdienstes, groß im Bild, schüttelte betrübt sein Haupt. Er blickte zum Kronprinzen. Die Kamera folgte. Pal Griener nickte. Er machte ein große Bewegung mit der rechten Hand, um Ruhe zu erbitten. Da alles auf dem Bildschirm zu verfolgen war, trat tatsächlich Stille ein.
Der Kronprinz sagte: „Im Namen der Republik und des Volkes!” Er legte dem alten Mann die Hand auf die Schulter. „Ich klage Sie an, die Ideale unserer Revolution verraten zu haben. Ich berufe mich auf den Artikel eins der Verfassung. Das Volk ist der Souverän. Im Namen des Volkes: Sie sind verhaftet und aller Ämter enthoben. Es lebe die Republik! Es lebe das Volk! Nieder mit der Diktatur!“
Das Volk schrie und tanzte vor Begeisterung. Einander fremde Menschen fielen sich weinend in die Arme. Niemand hatte geglaubt, dass es so einfach, so unblutig, ja, so heiter sein könnte, die alles überschattende Macht des Präsidenten zu brechen. Als der Name des Kronprinzen gerufen wurde, und dies geschah ganz eindeutig nicht über Lautsprecher, stimmten viele ein. Diejenigen aber, die sich den Sturz der Diktatur anders vorgestellt hatten, begriffen bereits auf diesem Platze, dass sie kaum zu den Siegern gehören würden.
2. Kapitel
Oberst Lu Mores, der Sonderbeauftragte des neuen Präsidenten der Republik und Vertraute des neuen alten Geheimdienstchefes, besuchte den gestürzten Diktator im Gefängnis. Die Begegnung war gründlich und lange vorbereitet worden. Die Auftraggeber kannten die Eigenheiten ihres Opfers genau. Oberst Mores wusste nicht, worauf er sich tatsächlich einließ und welche Rolle er in dem abgekarteten Spiel zu übernehmen hatte. Er war überzeugt, seine Mission geschähe im Interesse der Revolution. Er war ein integerer Mann.
Die Republik ging in ihr zweites Jahr. Zweifellos hatte die Revolution verkrustete, die dynamische Entwicklung der Industrie hindernde Strukturen aufgebrochen. Es wäre übertrieben zu behaupten, der Umsturz habe das stagnierende Land generell in einen blühenden Staat verwandelt. Noch saßen viele der vormaligen Beamten auf ihren Stühlen, die unbeschadet des gesellschaftlichen Umbruches in alten Denkweisen verhaftet handelten. Es wäre aber unsinnig, ja eigentlich leichtsinnig gewesen, sie mit einem Schlag auszuwechseln, weil ihre Fachkenntnisse und ihre stupide Treue nicht einfach ersetzt werden konnten. Die Euphorie jenes Tages, an dem der neue Präsident mit seiner Junta die Macht übernommen hatte, hatte sehr schnell praktischem Überlegen den Platz machen müssen. Dennoch konnte nicht übersehen werden, dass sich die Wirtschaft konsolidierte, das öffentliche Leben freizügiger, die Menschen zuversichtlich geworden waren.
Die AGORA, einst im Widerstand gebildet, hatte sich offiziell als die führende Partei installiert. Auf dem Gründungsparteitag, wenige Wochen nach dem Umsturz, war heftig um die Identität und die Ziele der AGORA gestritten worden. Es gab Kräfte, die entschieden der Bildung einer Partei unter diesem Markenzeichen widersprachen. Es sollte eine demokratische Volksbewegung bleiben, verlangten mehrere Delegierte der Basis. Von einer Partei, noch dazu mit Regierungsverantwortung betraut, war nicht zu erwarten, dass sie die Interessen des Volkes vertreten würde, weil sie die Interessen des Staates zu verwalten hatte. Das ist nicht in jedem Fall identisch.