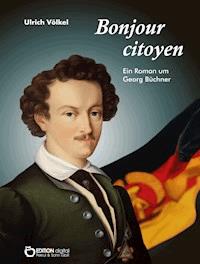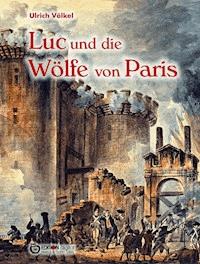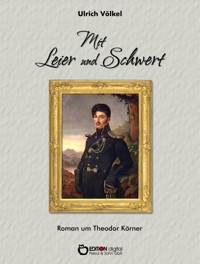
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
An einem sonnigen Augusttag des Jahres 1811 trifft der neunzehnjährige Studiosus Theodor Körner in Wien ein, wegen Händel von der Universität Leipzig verwiesen und dennoch ein Glückskind: Schon nach kurzer Zeit ist er erfolgreicher Autor, k.k. Hoftheaterdichter und Verlobter der von den Wienern vergötterter Schauspielerin Toni Adamberger. Doch im März 1813 schließt er sich spontan den Freiwilligen Jägern an, wird mit Liedern wie „Lützows wilder Jagd“ zum Dichter der Befreiungskriege und fällt im Gefecht bei Gadebusch im August 1813. Ulrich Völkel vermeidet es ebenso, Körner als „Nationalhelden“ überzubewerten wie als „Schillerepigonen“ und unreifen politischen Brausekopf abzutun, indem er ihn aus seiner Zeit heraus verstehbar macht und die Befreiungsbewegung gegen Napoleon in die Handlung einbezieht. Er bietet als Zentralfigur günstige Voraussetzungen, da er durch die engen Beziehungen seines Vaters zu Schiller und Goethe mit den beiden Klassikern von Kind auf bekannt war, von Wilhelm von Humboldt in Wien freundschaftlich aufgenommen wurde und während des Feldzuges von 1813 mit Patrioten wie Lützow und Arndt in enger Beziehung stand. Es ist Ulrich Völkel gelungen, das Theodor-Körner-Bild von Verzerrungen und Entstellungen zu befreien, die seit dem 19. Jahrhundert das Verständnis dieses Dichters erschwerten, und dem Leser eine bedeutende Epoche nahezubringen. INHALT: Wien Er will ein Dichter werden Pläne Erfolg Toni Dresden Döbling Der Besuch Zweifel Ein wechselhafter Herbst Der große Erfolg Der k. k. Hoftheaterdichter Abschied von Wien Breslau Der Aufruf Attacke ins Leere Lorenz Juranitsch Steig, Flügelross
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 647
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Impressum
Ulrich Völkel
Mit Leier und Schwert
Roman um Theodor Körner
ISBN 978-3-95655-538-1 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien erstmals 1983 im Verlag der Nation Berlin.
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2015 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
Wien
Wenn die Kutsche den Hügel erreicht hat auf dem holpernden Weg, wird er die Stadt sehen können, die Metropole am Donaufluss, die Kaiserstadt Wien. Dann liegen gut sechzig Meilen Fahrt hinter ihm, der am 12. August 1811 Karlsbad verlassen hat und an diesem 26., einem Montag, ankommt in Wien, der Herr Studiosus Karl Theodor Körner, der Liebling der Götter, das Sonntagskind, relegiert von der Alma Mater Lipsiensis wegen Händel, mit der Waffe ausgetragen, und nicht geduldet an jenen deutschen Universitäten, die mit der von Leipzig im Vertragsverhältnis stehen, also den meisten.
Wien war ihm geblieben oder Heidelberg, um die Studien fortzusetzen. Wien sollte es sein, wenngleich er Heidelberg vorgezogen hätte, ja, er hatte, schon in Versen besungen, Sehnsucht nach dem Rhein; dorthin zog es ihn. Aber der Vater hatte entschieden, diesmal fordernd, unwiderruflich: „Du gehst nach Wien.“
Der Vater, Appellationsgerichtsrat, Doktor beider Rechte, Beamter im Sachsen Friedrich Augusts, des Königs von Napoleons Gnaden, hatte Gründe genug. Sein Sohn lief Gefahr, vom Strudel studentischen Lebens in eine bodenlose Tiefe gerissen zu werden, aus der aufzutauchen aus eigener Kraft nicht oder doch nur schwer möglich war.
Das Verbindungswesen, mit der Vehemenz einer Epidemie ausgebrochen, hatte die Parteien schroff gegenübergestellt, besonders in Leipzig, wohin die studentische Jugend von Halle gezogen war in Scharen, nachdem ihre Universität in Folge der katastrophalen Niederlage Preußens bei Jena und Auerstedt von Napoleon geschlossen wurde. Sie brachten die neuen Formen landsmannschaftlicher Verbindungen mit, doch Leipzig war nicht Halle. Hier gab eine adlige Clique den Ton an, der das Prinzip der allgemeinen Gleichheit zu französisch roch. Vielleicht auch noch Liberté und Fraternité als Zugabe? Drauf! Auf sie! Und manch einer, der sich zu wehren nicht gelernt hatte, zog sich heftige Blessuren zu, wenn nicht gar ärgere Wunden.
Theodor Körner war der Verbindung „Thuringia“ beigetreten und bald, geistig so beweglich wie körperlich tüchtig, zählte er zu den Wort- und Waffenführern dieser Landsmannschaft. Als die Adligen der Forderung, die besonderen Fechtstunden aufzugeben, nicht nachkamen, suchten die von der „Thuringia“ Streit bei aller Gelegenheit, worauf ihnen die Satisfaktion verweigert wurde und eine Berufung vor den Rektor erfolgte.
Nun erst und gerade beschloss man, vom Alkohol in die rechte Stimmung gebracht, das Adelspack in verschiss zu nehmen, und rief den Knüppelkonvent aus, als die sich weigerten,
Genugtuung zu geben. Körner war einer der Wildesten unter ihnen.
„Wollen wir uns von dieser Koterie beschimpfen lassen?“, rief er in den Saal.
„Nein!“, erscholl es vielstimmig.
„Wollen wir von der Schwefelbande verhöhnt werden?“ Und wieder erscholl das vielstimmige Nein.
„Sind wir bereit, für die Freiheit unserer Gesinnung das bisschen Haut zu wagen?“
„Ja, ja!“, brüllten sie, trunken, berauscht auch vom Gefühl eigener Wichtigkeit. „Hoch lebe unser Theodor!“, rief einer, und: „Hoch lebe unser Theodor!“, fiel die Masse ein.
Körners Augen blitzten vor Unternehmungslust, erhitzt rief er mit kippender Stimme: „Attacke!“, und: „Ohne Waffen geht mir keiner, sei s auch nur der Ziegenhainer!“
Die Masse johlte. Mit den Fäusten schlugen sie den Takt auf Tisch und Bänke. Gläser klirrten. Die Kellnerinnen brachten sich in Sicherheit, wussten sie doch, dass manch einer der Herren Studenten seinen stumpfen Degen lieber gegen sie führte, als mit dem Knüppel auf die Adligen einzuschlagen.
„Gegen die Sulphuria, Attacke!“ Wieder war es Körner, der sich als ein Eskadronführer sah, im Galopp auf dem rassigen Pferd der einfallenden Truppe voranjagend, der gebogene Degen blitzt auf im Licht der Morgensonne, das vielstimmige Hurra seiner Gefolgschaft treibt ihn voran, wie er sie antreibt mit seinem Tod verachtenden Mut. „Schlagt sie! Durch!“
Und da kam einer, der wollte den Feind gesichtet haben im Rosengarten, unweit von hier, nicht übermäßig stark, aber lästerliche Reden führend wider die „Thuringia“. Denen wollten sie eins aufs Maul geben. Besonnene gab es kaum. Einer, Karl Mordechai, der Mut schon dort bewiesen hatte, wo er Besserem galt als studentischem Händel, riet zur Vernunft. Aber Körner, sonst nicht abgeneigt, den Freund anzuhören, war schon zu arg in Hitze geraten und hatte das Volk zu wild schon in Schwung gebracht, sodass er nun nicht mehr zurückwollte und auch gar nicht mehr konnte.
„Jud Hasenherz“, sagte er lachend, „wenn ich zwei Wunden davontrage, bringe ich dir eine als Schmuck mit, dass du uns nicht ewig mit nacktem Gesicht herumläufst!“
Er war nicht davon abzubringen, die von der Adelspartei zu Duellen aufzufordern, und selbst, als er deswegen eine achttägige Karzerstrafe zu erwarten hatte, ließ er sich zu einer Mensur verleiten, denn er brannte darauf, den Adelssöhnen sein Monogramm in die Haut zu schlagen.
„Attacke!“ Und plötzlich ein Schlag. Was war das? Blut floss. „Körner!“, schrie einer. Dann sank er vornüber und wachte auf mit heftigen Schmerzen im verbundenen Schädel, lag versteckt in der Kammer seines Freundes Karl Mordechai.
„Wo bin ich?“ Hochfahren wollte er, fiel aber gleich wieder in die Kissen und stöhnte.
Karl hatte am Tisch gesessen und gelesen. Er trat zu ihm. „Du bringst dich noch einmal um Kopf und Kragen, Feuerherz. Und der Schmiss ist von schlechten Eltern nicht, den du nun mit dir herumtragen wirst. Bleib liegen!“ Er drückte den Freund zurück. „Der Wundarzt kommt erst zur Nacht. Man weiß nicht, wo du dich verborgen hältst.“
„Wie steht’s um mich?“
„Leidlich“, sagte Karl. Er mochte Körner, schätzte dessen Aufrichtigkeit und liebte die Gesellschaft des stets heiteren Freundes, der mit einem Witz schneller zur Hand war, als sich zu ernsthaftem Disput bereitzufinden, obgleich es ihm an Verstand nicht mangelte. Er dagegen, Mordechai, war ein Grübler, der begreifen wollte, weshalb die Welt in Unordnung geraten war und wie sie zu ordnen wäre. Er wollte die Welt ändern, verändern zu Besserem hin, was ihn nicht stumpf machte gegen Heiterkeit. Und mit diesem Theodor Körner saß er gern zusammen im kleinen Kreise. Da galt der Lärm der Schenken nichts. Hoffnungen, hochfliegende Pläne mitunter, fantastische Bilder kommender Zeiten beschäftigten sie. Oder Körner nahm seine Gitarre zur Hand, seine Leier, wie er zu sagen liebte, die er mit Geschick schlug, und sang Selbstgedichtetes zu eigenen oder fremden Melodien.
„Leidlich“, wiederholte Karl. „Doch es ist die Wunde nicht, die mir Sorge macht.“
„Was sonst? Das Strafgesetz? Hach! Man muss mich erst einmal fassen, ehe man mir das Fell über die Ohren zieht, sagte der Fuchs.“
„Was planst du? Flucht?“
„Flucht!“, erwiderte Theodor verächtlich. „Wer flieht denn? Zum Abend will ich ins Gewandhaus, da weiß ich eine Loge, Karl, eine Loge ... Und morgen in der Früh besorg mir eine Kutsche. Ich gehe nach Berlin zu Fichte.“
Mordechai wollte das nicht ernst nehmen. „Du fieberst, Theodor. In deinem Zustand reisen wäre Wahnsinn. Und was die Loge anlangt, Freund, nimm’s mir nicht Übel, du betest ein Idol an, eine schöne Maske über einer kalten Larve. Mach deine Fortune auf andere Weise und schmiede Verse auf einem besseren Amboss. Was soll’s? Eine adelige Schnepfe, deren Herr Bruder es vielleicht war, dem du diesen blutigen Scheitel verdankst. Man kann sich nicht mit den Herrensöhnen schlagen und der Herren Töchter lieben wollen.“
„Warum nicht? Die Rose pflück ich auch, und hat sie tausend Dornen!“
„Poet!“ Mordechai winkte ab. „Gut, ins Gewandhaus komme ich mit. Wir werden ein wenig Mummenschanz treiben müssen, damit du incognito bleibst, Bruder Leichtfuß, aber eine Kutsche morgen früh nach Berlin - das schlag dir aus dem Sinn.“
Tags darauf, noch mit verbundenem Kopf, am 23. März 1811, floh Körner nach Berlin. Zu seinem Glücke übrigens; denn man hatte den Universitätschirurgen geschickt, um die Wunde zu untersuchen, von der dem Pedell gesagt worden war, Körner habe sie sich bei einem Fall auf der Treppe zugezogen. Das hätte eine merkwürdige Treppe sein müssen! Und die Gesetze waren hart. Von einem Studenten der Rechte wurde erzählt, der in Wittenberg wegen eines harmlos verlaufenen Duells nach sechsmonatiger Untersuchungshaft zu acht Jahren Gefängnis, das erste davon bei Wasser und Brot, verurteilt worden war. Nur dem Gnadenakt des Königs war es zu danken, dass es bei einem Jahr Haft blieb.
Freilich, mit der Flucht aus Leipzig nach Berlin war nicht viel mehr als Zeit gewonnen, wusste man doch, dass die Relegationspapiere früher oder später an die zahlreichen, mit Leipzig im Vertragsverhältnis stehenden Universitäten geschickt werden würden. Fürs erste aber war er dort in Sicherheit und konnte, nun etwas ernsthafter als zu Leipzig, seine Studien fortsetzen. Die väterlichen Ermahnungen waren dafür der eigentliche Grund, nicht bessere Einsicht.
„Du weißt, dass es mir schwer wird, dir nicht zu vergeben, selbst wenn ich Ursache habe, mit dir unzufrieden zu sein.“ Es war Erziehungsprinzip des Vaters, unverleugbar der Einfluss Rousseaus, nichts zu pflanzen, sondern das zu hegen, was von selbst wuchs. Doch die Ereignisse in Leipzig hatten Bedenken wachgerufen. Ihm war schon verständlich, dass sich der Herr Sohn nicht freiwillig in den Kerker setzte. „Aber eine andere Frage ist“, fuhr der Vater fort, „ob das Vorgefallene nicht zu vermeiden gewesen wäre.“
Theodor spürte zwar an dem ernsten Ton, wie ungehalten der Vater sein musste, wollte aber nicht einsehen, dass der Anlass solchen Aufwandes wert war, und erwiderte leichthin: „Ich bin der erste Student nicht mit einer Blessur, Vater. Du solltest den sehen, der mir vor die Klinge gekommen ist!“
Doch der Rat war nicht willens, die Sache wie so oft auf sich beruhen zu lassen. „So ungern ich über vergangene Dinge predige, die nicht zu ändern sind, so muss ich dich doch diesmal auf einige Punkte aufmerksam machen, weil es scheint, dass du im Taumel der Leidenschaft alle deine Verhältnisse zu vergessen gewohnt bist und besonders nicht daran denkst, was deinen Eltern Kummer und Sorge machen muss.“
„Vater“, fragte Theodor, um Verständnis bemüht, „soll ich ein Philister sein?“
„Wer verlangt das? Aber von einem Jüngling von zwanzig Jahren, dem es nicht an Verstand und Stärke der Seele fehlt, kann man in wichtigen Fällen einige Besonnenheit fordern. Man kann erwarten, dass er nicht wie ein Trunkener sich von jeder“, er betonte das Wort auf besondere Weise, war ihm doch auch von Schwärmereien in Richtung einer bestimmten Loge gemeldet worden, „von jeder Leidenschaft fortreißen lasse.“
Wie in Leipzig, so hatte Christian Gottfried Körner, einer der aufgeschlossensten Geister seiner Zeit, Freund Schillers und Goethes, auch in der preußischen Hauptstadt zahlreiche Bekannte, die er sich zu Dank verpflichtet und steter Hilfe bereit wusste. Aber in Leipzig war der Sohn lieber in die Wirtshäuser gelaufen und bei seinesgleichen zu Gast gewesen, als sich in wohlgesitteten Häusern am väterlichen Gängelband, zumindest aber unter ständiger Aufsicht zu wissen. Nach den Ermahnungen und dem Versprechen, Besserung zu üben in Berlin, belegte er Vorlesungen bei Fichte und Schleiermacher, hörte Römische Geschichte bei Niebuhr, auch Botanik und Zoologie. Und mit den Empfehlungsbriefen des Vaters ausgestattet, fand er Eingang in den ersten Häusern. Zwar empfing ihn Schleiermacher freundlich, aber wohler fühlte sich Theodor bei Parthey, dem Besitzer der Nicolaischen Verlagsbuchhandlung. Er sang in Zelters Akademie, lernte Jahn und Friesen kennen.
In Körners Gesinnung vollzog sich ein Wandel, den er selbst kaum bemerkte. Karl Mordechai hätte seine Freude gehabt, zu sehen, mit welchem Interesse sich der Freund den vaterländischen Dingen zuwandte. Und das war so gefahrlos nicht in Berlin; denn eifriger als die Franzosen war die preußische Polizei mit ihrem weitverzweigten Spitzelsystem bemüht, verdächtige Elemente aufzuspüren, die den Tilsiter Frieden schmachvoll und des Königs Verhalten feige nannten. Und wehe, es fiel ein Wort gegen Napoleon! Da war die preußische Polizei französischer als die Franzosen.
„Ich höre von geheimen Gesellschaften in Berlin“, sagte der Vater besorgt.
„Davon weiß ich nichts“, erwiderte Theodor. „Es gibt allerdings Stimmen, die von Befreiung reden. Sollen wir alle Franzosen werden?“
Der Rat hob abwehrend die Hand. Von politischen Dingen wurde in seinem Hause nicht gesprochen. Er war Beamter. Und wenn der Kurfürst von Sachsen, sein Brotherr, König geworden war durch Napoleons Gnade, dem er sich unterworfen hatte wie die Rheinbundstaaten, so war er doch König. Es stand einem Staatsdiener nicht an, darüber zu rechten, ob billiger Vorteil und gehässige Kabale die Geschäfte führten anstelle staatspolitischer Weisheit und Liebe zum Vaterland. Unter welchen Einfluss war der Sohn geraten, dass er solche Sprache führte?
„Es gibt diese geheimen Gesellschaften, Theodor. Ich weiß es von meinen Freunden. Und was als Zweck dieser Verbindungen angegeben wird, ist oft begeisternd für eine hochherzige poetische Natur. Aber durch eine glänzende Außenseite darf man sich nicht blenden lassen.“
Sollten die Leipziger Eskapaden des Sohnes ihre Fortsetzung nicht auf Berliner Art erfahren, musste eingeschritten, Einhalt geboten werden, ehe der nächste Hieb womöglich den Kopf oder doch langjährige Haft kostete.
„Was ich glaube und fühle, Vater, werde ich zu jeder Stunde auch mit Blut besiegeln“, entgegnete Theodor etwas überspannt, sodass der Rat ein Lächeln nicht verbergen konnte.
„Du redest hier nicht in einer deiner Versammlungen. Sag es schlichter.“
Doch Theodor, der es wieder in sich prickeln fühlte, konnte der fatalen Neigung zu großen Worten nicht widerstehen, vergaß, zu wem er redete, hob die Stimme wie zum Schwur und rief: „Lieber auf dem Schilde als ohne ihn!“
Der Vater hatte eine Entgegnung auf der Zunge, die ihn vielleicht gereut hätte, als Emma, Theodors um drei Jahre ältere Schwester, von einem Spaziergang zurückkam, überrascht, ihren Bruder zu Hause zu sehen, aufschrie vor Freude und ihm um den Hals fiel.
Das Gespräch unter Männern war beendet, selbst in Gegenwart der Mutter wäre es nicht fortgesetzt worden. Theodor, der nachträglich spürte, wie unpassend seine Antwort und wie unnatürlich seine Haltung gewesen waren, bat den Vater mit einem Blick um Verzeihung, die ihm lächelnd gewährt wurde - herzliches Einverständnis zwischen dem Alten und dem Jungen.
Theodor verlebte ungetrübte Tage im Elternhaus, fernab scheinbar den Wirren der Zeit wie Krieg, Einquartierung und Besatzung. Kein Wort wurde in der Sache mehr zwischen Vater und Sohn gewechselt.
Emma hatte ihren Freundinnen berichtet, dass Theodor zu Besuch wäre. Bald füllte fröhliche Jugend das Haus. Und während der Bruder sang oder erzählte oder seine neuesten Verse vortrug, schwärmerisch bewundert von den jungen Demoiselles, saß sie, die ihn am glühendsten verehrte, mit Stift und Zeichenkarton abseits, um ihn zum wiederholten Male zu porträtieren. Theodor war schlecht zu fassen, Wenn es auch mühelos schien, den hoch aufgeschossenen, dunkelhaarigen Jungen mit wenigen Strichen zu charakterisieren. Emma wusste, dass ihr Talent angesichts des sprudelnden Übermutes von Theodor auf besondere Weise herausgefordert wurde, zumal ihr sonst unbestechliches Malerauge, blickte sie ihn an, meist von einem leichten Schleier überzogen war, wie ihn bedingungslose Liebe nicht selten entstehen lässt.
An jenem Tage, als er zurückreisen wollte und die Kutsche schon vorgefahren war, schüttelte ihn plötzlich ein kalter Schauer.
„Du bleibst!“, entschied die Mutter erschreckt. „Lasst den Medizinalrat kommen.“
Theodor, selbst erschrocken über den Anfall, mühte sich, heiter zu wirken, weil er die Mutter nicht beunruhigen wollte. „Eine Bagatelle“, sagte er, wandte sich, vielleicht eine Idee zu hastig, weil er seine Gesundheit demonstrieren wollte, zum Wagen, schwarz wurde ihm vor Augen, er verlor den Halt, der Vater und der herbeigeeilte Kutscher mussten ihn stützen.
„Kaltes Fieber“, stellte der alte Medizinalrat fest. „An eine Reise ist vorerst nicht zu denken, junger Freund.“ Und mit dem Vater allein, warnte er davor, den Sohn wieder nach Berlin zu schicken in das ungesunde Klima. „Mir scheint, der Körper ist noch zu sehr geschwächt, als habe er einen stärkeren Blutverlust“ - näher ließ der Arzt sich nicht aus, er wusste, dass er verstanden wurde - „noch nicht überwunden. Eine Kur, vielleicht Karlsbad, könnte ihn wiederherstellen. Übrigens, Ihnen wäre das Bad auch zuträglich. Die Luft ist derzeit recht drückend in Dresden.“ Die Bemerkung bezog sich weniger aufs Wetter.
Also Karlsbad. Die Wege des Herrn sind oft seltsam. Er schickt das kalte Fieber, um einen vor dem heißen zu bewahren. Denn es stand fest, dass Berlin der ungeeignetste Ort war für den Studenten Theodor Körner. Während er nämlich krank darniederlag, traf der Senatsbeschluss der Berliner Universität ein, die ihn, dem Kompaktatverhältnis mit Leipzig folgend, ausgeschlossen hatte. Zwar nutzte der Vater seine vielfältigen Verbindungen für den Sohn, doch es konnte Monate, wenn nicht Jahre dauern, bis der König die Aufhebung der Relegation verfügte.
Die Hörsäle der meisten deutschen Universitäten waren mithin für Theodor verschlossen. Aber dieser Ausschluss hatte auch sein Gutes, sagte sich der Vater. Wer weiß, wohin der aufrührerische Geist in Berlin den Sohn noch verführt hätte, diesen schnell aufbrausenden, leicht zu gewinnenden, allzu gutgläubigen Burschen. Es wurde Zeit, dass sein Leben in ruhigere Bahnen mündete, mehr Ernst in seine Handlung und mehr Tiefe in seine Gedanken kam.
Unter den noch für ihn möglichen Universitäten musste die geeignetste gefunden werden. Deshalb hatte sich der Vater an Wilhelm von Humboldt gewandt, der als preußischer Gesandter in Wien Einfluss besaß und von dem er sich erhoffen durfte, dass Theodor, unter seine Fittiche gestellt, ganz im väterlichen Sinne gelenkt würde.
Heidelberg nicht. Heidelberg hätte nicht nur die Fortsetzung der Leipziger und Berliner Capricen bedeutet, sondern eine Auseinandersetzung mit den französischen Zuständen. Der Weg von da auf eine Galeere war jedenfalls um einige Meilen kürzer.
Also Wien. Zuvor aber traf die Familie Anstalten, nach Karlsbad zu reisen. Die Frauen, Minna Körner, ihre Schwester Dora Stock und Emma, hatten Sorge, die rechte Garderobe auszuwählen. War der klassische Stil, griechisch gewandet, noch modern, oder trug man die gewagten Kleider à la francaise mit dem unerhörten Dekolleté.
Und Christian Körner wollte sich noch einmal in Muße mit seiner Schillerbiografie beschäftigen, ehe er sie dem Sohn an Humboldt mitgab. Leider würde Goethe zu der Zeit nicht in Karlsbad sein, mit dem hätte sich vieles erörtern lassen.
Theodor freute sich auf die ausgedehnten Fußwanderungen an der Tepl entlang oder die Berge hinauf mit ihren herrlichen Rundblicken und durch die romantischen Wälder. Er wusste auch, dass manche hübsche Demoiselle ihren Zeitvertreib suchte in Karlsbad. Da wollte er nicht müde sein. Einige Exemplare seines ersten Gedichtbandes,, der im Sommer vergangenen Jahres unter dem Titel „Knospen“ bei Göschen in Leipzig herausgekommen war, legte er in der eitlen Überzeugung zu seinem Reisegepäck, dass er den Weg zu mancher Schönheit auf Versfüßen am erfolgreichsten gehen könne. Die Wirkung war bereits erprobt an den Freundinnen der Schwester Emma und denen Julias, die als Adoptivkind im Hause Körners lebte.
Süßes Liebchen, komm zu mir!
Tausend Küsse geb ich dir! '
Sieh mich hier zu deinen Füßen!
Mädchen, deiner Lippen Glut
Gibt mir Kraft und Lebensmut.
Lass dich küssen!
hatte er gereimt. Das verfehlte seine Wirkung nicht, zumal er seine Lieder zur Gitarre und mit seiner warmen Bassstimme, in deren Timbre mühsam gedämpfte Leidenschaft zitterte, vorzutragen wusste.
Was tat es schon in den Augen der Schönen, wenn das ganze Bändchen „schillerte“? Sie waren keine Rezensenten wie der einstige Lehrer Dippold, der bei allem Wohlwollen dem jungen Dichter vorhielt, dass er nicht Maß halte und dass seine wuchernden Bilder mehr Bilder des Begriffes als der Anschauung wären. Das Publikum, vom letzten Krieg noch erschüttert und den nächsten ahnend, applaudierte dem jungen Talent freundlich. Die strengen und hämischen Kritiker, vom Vater befürchtet, weil er, handelte es sich nicht um seinen Sohn, der strengste gewesen wäre, schwiegen.
Die jungen Mädchen, vor denen Theodor deklamierte, waren hingerissen. Mitunter streute er auch atemberaubende Geschichten ein, wie er sie als Knappe und Student in Freiberg unter Tage erlebt hatte oder erlebt zu haben meinte. Übrigens machte das nach dem dritten Bericht keinen Unterschied für ihn, glaubte er doch selber an die erfundenen Geschichten mehr als an die erlebten, weil sie schöner waren, gruseliger und gespenstischer, und also eine nachhaltigere Wirkung auf Zuhörer wie Erzähler ausübten.
Der Vater freute sich, seinen Sohn täglich um sich zu haben. Er beobachtete mit Erstaunen, dass der ungeduldige Jüngling allmählich zu einem Manne heranreifte, der zwar noch burschikoses Verhalten und studentische Manieren zur Schau trug, sich aber mitunter schon zu recht ernsthaften Gedanken aufschwang, die der Vater beachtlich fand, fern aller Eitelkeit. Er sah, das Werk seiner Liebe gedieh, die Saat der Vernunft ging auf, wenn auch immer wieder von den Aprilschauern jugendlicher Unausgegorenheit überschüttet.
Als sie sich während eines Ausfluges von den Frauen etwas abgesondert hatten, zufällig, wie es Theodor schien, war es der Vater, der die Rede auf politische Dinge brachte. Und erst antwortend wurde sich der Sohn bewusst, dass hier Erstaunliches vonstattenging. Lag es an der Entfernung von Sachsen oder dem aufgeschlosseneren Geist dieses Treffpunktes der Welt oder daran, dass sich Napoleons Herrschsucht immer offener enthüllte? Jedenfalls hatte der Vater den Kaiser der Franzosen einen Eroberer genannt, der die großen Ideale der Voltaire und Rousseau an eine kleine Gruppe machthungriger Emporkömmlinge verriet und sich anschickte, ganz Europa unter seine Herrschaft zu zwingen. „Das Vaterland durchlebt eine schwere Zeit“, sagte er..
„Das Vaterland?“, fragte Theodor erstaunt, weil er sich nicht erinnern konnte, dass der Vater diesem Wort je solch einen ernsten Unterton gegeben hatte. Ja, war nicht sogar etwas verächtlich davon geredet worden? „Das Vaterland?“ wiederholte er. „Welches meinst du? Sachsen? Preußen? Oder - Deutschland?“
Das war keck gefragt, hatte aber seine Berechtigung, denn Christian Gottfried Körner hatte den Sohn gelehrt, andere Werte höher zu setzen. Wo sollte auch Vaterlandsliebe bei einem herkommen, der mit Bitternis die Zersplitterung des deutschen Reiches beobachtete und mit Widerwillen die Gefallsucht und Ruhmhascherei unzähliger kleiner Despoten sah. Da war nichts geblieben vom hochherzigen „dulce et decorum est pro patria mori“ des Horaz, von Homers Preisen des Vaterlandes und den Gesängen des Tyrtaeus. Ja, Goethes Weltbürgertum und Schillers „Seid umschlungen, Millionen! Diesen Kuss der ganzen Welt!“ - das war etwas, dem man begeistert zustimmen konnte.
Theodor, in diesem Sinne gebildet, freilich mit Fichtes Vorlesungen im Gedächtnis nunmehr, fragte weiter: „Ich denke, das vaterländische Interesse ist nur für unreife Nationen wichtig und ein philosophischer Geist kann sich für das Nationale nicht erwärmen?“
Der Vater verbarg ein Lächeln der Zufriedenheit über die Akkuratesse, mit der sein Sohn die Klinge im Disput zu führen gelernt hatte. „Du zitierst Schiller, nicht mich, und vergiss nicht seinen <Wilhelm Tell>. Dass sich mein Sinn gewandelt hat, hängt mit den unglücklichen Zeitläuften zusammen, die uns der Franzose aufzwingt. Wie anders soll man sich gegen die Gewaltherrschaft wehren als durch Einigkeit. Jede Erfahrung ist eine Lehre. Die bittersten sind die nachhaltigsten unter ihnen.“ Das sagte der sächsische Beamte im böhmischen Karlsbad.
Theodor betrachtete nachdenklich den Vater, der aussprach, was er selbst in Berlin gehört hatte. Und war das nicht der gleiche Geist wie in den Schriften Ludens aus Jena oder denen von Fries zu Heidelberg? Er schöpfte wieder Hoffnung; denn er wollte nicht nach Wien.
Doch der Vater blieb fest in diesem Punkt; denn außer all den Sorgen, die er sich bei dem leicht entzündbaren Charakter seines Sohnes machte, dass er sich nämlich in neue Händel verstricken oder dem politischen Treiben der Zeit mehr Eifer widmen könnte als den notwendigen Studien - außer diesen berechtigten Bedenken war da noch eine Befürchtung, die das Herz des Vaters ängstlich schlagen ließ: Geßlers und Humboldts Andeutungen über einen möglichen Krieg. Der Vater wollte den Sohn in keine preußische oder sächsische Uniform gepresst wissen. In Wien sah er keine Not. Österreich würde so lange lavieren und taktieren, bis es alle Vorteile eines Siegers erhandelt hatte, ohne selbst einen einzigen Schuss abgefeuert zu haben. „Es bleibt bei Wien“, sagte er, ohne diesen letzten Grund zu offenbaren.
Theodor war nicht so veranlagt, dass er deswegen ins Grübeln geraten wäre. Zudem bot Karlsbad, Treffpunkt der monde elegant, genug Abwechslungen, die er heiter und intensiv genoss.
Noch war die Tinte nicht trocken, mit der er schwärmerische Verse auf die Berliner Schauspielerin Beck geschrieben hatte, da entzückte ihn schon eine neue Muse zu überschwänglichen Gesängen.
Die Familie Körner war zu den Thermalquellen gewandert. Dort begegnete sie der Baronin Pereira aus Wien und ihrer Nichte Marianne Saling. Ein Zufall wollte es, dass sie einander vorgestellt wurden. Die Baronin horchte auf. „Körner? Doch nicht etwa Doktor Körner aus Dresden?“ Und als Vater Körner ihr das bestätigte, erklärte sie ihm hocherfreut, durch Goethe von seiner verdienstvollen Arbeit gehört zu haben, der zu erwartenden Gesamtausgabe des Schillerschen Werkes eine würdige Biografie voranzustellen.
„Ich bemühe mich um ein getreues Bild des Dichters“, sagte der Appellationsrat zurückhaltend.
Sie nickte lebhaft. „Das ist um so notwendiger, als dieser unglückliche Aufsatz von Oemler erschienen ist. Ein Skandal, finden Sie nicht auch? In unserem cercle - ich betreibe einen solchen in Wien, die Dichterin Pichler besucht uns häufig - haben wir davon gesprochen. Wann ist denn zu rechnen mit Ihrer Publikation?“
„Es wird noch dauern. Ich arbeite wohl zu langsam“, erwiderte Körner, der sich auf Termine nicht gern festlegte. Auch misshagte ihm das zur Schau gestellte Interesse an seiner Person.
„Er arbeitet gründlich“, ergänzte Minna Körner mit Betonung, um einen besseren Eindruck bei der Baronin bemüht.
„Sie müssen uns unbedingt besuchen“, sagte die Pereira. „Darf ich Sie und Ihre Familie für morgen zum Kaffee bitten?“
Kaffee? Ach ja, die Damen kamen aus Wien. Die Türken waren vertrieben, ihr Getränk hatte sich erhalten. Manchmal ist das einzige, was von stolzen Eroberern bleibt, ein bitterer Schluck, mit Zucker versüßt.
Kölner sah die Erwartungsfreude in den Augen seiner Minna und sagte zu. Als die Familie gemächlichen Schrittes zum Hotel zurückkehrte, beobachtete Emma ihren Bruder, der mit verträumten Augen wie abwesend an ihrer Seite ging und sich wiederholt umdrehte, als suchte er, ein bestimmtes Bild festzuhalten.
„Hast du schon einen Vers auf sie gefunden?“, fragte sie mit liebenswertem Spott.
„Wer sagt denn, dass sie Eindruck auf mich gemacht hat, diese Demoiselle Saling?“
Emma lachte herzlich. „Habe ich ihren Namen genannt?“
All die Flammen seines Herzens waren erloschen, als ob es die Seufzer, Schwüre und Sehnsüchte nie gegeben hätte um Adelaide, Henriette, Dorothea, Wirtstöchter und Prinzessinnen, Schauspielerinnen und Tänzerinnen; denn alle Sehnsucht trug den neuen Namen.
Die Körners waren nicht arm. Sie hatten auch Luxus kennengelernt auf den Besitzungen ihrer adligen Freunde. Der Appellationsrat blieb solchem Reichtum gegenüber kalt, wenngleich er auf seinen Vorteil zu rechnen wohl verstand. Um so mehr konnte sich seine Frau dafür erwärmen. Schöne Kleider, reich gedeckte Tafeln, eilfertige Dienerschaft - das genoss sie. Der Baron Pereira war ein einflussreicher, vor allem aber reicher Bankier in Wien. Der konnte von Nutzen sein für Theodor.
„Und der Herr Sohn ist ein Dichter?“, fragte die Baronin, als die Körners sie besuchten am nächsten Tag. „Wie reizend! Ob er nicht eine Probe seines Talents zum besten geben kann?“
Zufällig, natürlich, hatte er sein kleines Büchlein bei sich, „Die Knospen“. Er schlug es auf, ließ sich nicht lange bitten, hatte ja gewartet auf diese Gelegenheit und mit Bedacht dieses eine Gedicht vorher schon ausgesucht. „Sehnsucht der Liebe“, stellte er es vor. Er blickte nur zu einer, an sie wollte er seine Verse richten, die einst einer anderen galten. Aber was machte das? Es war doch immer sie, die er gesucht hatte.
Wie die Nacht mit heil’gem Beben
Auf der stillen Erde liegt!
Wie sie sanft der Seele Streben,
Üpp’ge Kraft und volles Leben
In den süßen Schlummer wiegt!
Seine Stimme klang kraftvoll, seine Augen blitzten, die Begeisterung machte ihn schön.
Marianne empfing diese Botschaft, fühlte sich geschmeichelt, war sich tieferer Empfindung noch nicht bewusst, aber sie hielt den Atem an, bebte. Und als er endete:
Sehnsucht der Liebe schlummert nie,
Sehnsucht der Liebe wacht spät und früh!
da nickte sie, spürte eine Saite angeschlagen, die anders schwang als harmlose Koketterie.
„Très bien!“, rief die Baronin aus. „Très bien, Herr von Körner!“ Und schnell, um ihrer Nichte zuvorzukommen, reichte sie Theodor eine Limonade. Der trank sie aus, setzte das Glas ab und nickte dankend zu Marianne, die betroffen errötete.
Alle im Salon fühlten sich in gehobene Stimmung versetzt. Selbst Tante Dora hatte sich der Wirkung des Vortrages nicht ganz entziehen können, wenngleich sie die Verse für tönerne Rede hielt. Nur einer hob skeptisch die Brauen: der Vater. Schneller Erfolg verdirbt gute Grundsätze, sagte er sich. Und „von“ Körner hieß hier keiner.
Theodor aber war glücklich. Während des vierwöchigen Aufenthaltes in Karlsbad traf man sich öfter im Hause der Baronin und ihrer schönen Nichte. Theodor fand manche Gelegenheit, in die Nähe der Angebeteten zu gelangen. Die Mutter sah es gern. Emma neckte den Bruder mit harmlosen Anspielungen. Und aus ihm sprudelten die Verse wie das Wasser aus den vielen Quellen. Er schrieb drauflos, arbeitete nicht an den Bildern, hatte keine Mühe mit Reim und Metrik. Er nahm sich nicht die Zeit, Empfindungen und Beobachtungen zu ergründen, sondern brachte die Erscheinung zu Papier und verlor dabei das Wesen. Dennoch,, seine poetischen Ergüsse hatten den gewünschten Effekt.
Marianne begegnete ihm von Mal zu Mal freundlicher. Und als sie eines Morgens am Brunnen nebeneinanderstanden, berührte er wie zufällig ihre Finger. Sie erschrak zwar, zog die Hand aber nicht zurück. Da erfüllte ihn ein heißes Verlangen. Wären sie allein gewesen, hätte er sie in seine Arme gerissen und den schönen Mund mit leidenschaftlichen Küssen überschüttet; so stellte er es sich jedenfalls vor.
Marianne - seufzte er, wenn er des Abends in seinem schmalen Bette lag. Marianne! Und kein Wort mehr von Heidelberg zum Vater. Wien, natürlich Wien! Dort lebte sie.
Nun endlich hatte die Postkutsche den Hügel erreicht auf dem holpernden Weg. Da sah er die Stadt, vom Sonnenlicht überstrahlt. Dort würde er sein Glück machen. Er spürte es. Er war ein Dichter. Ich komme, werde sehen und siegen.
Karl Mordechai hätte ihn einen verquasten Poeten genannt, aber der Freund war ja nicht in der Kutsche.
„Wien!“, rief Theodor, und er dachte: Marianne.
Angesichts der Hoffnungen, die er seit Karlsbad an diese Stadt knüpfte, und in dem Augenblick, da er sie betrat, durchströmte ihn eine Erwartung besonders, verflüchtigte sich, was noch Sehnsucht nach dem Rhein gewesen, lösten sich die Bilder vom tollen Leipzig auf, und im Nebel des Vergessens versanken die Berliner Ereignisse.
Wien hieß Marianne Saling, hieß glänzende Stadt, hieß Erfolg. Ja, hier wollte er ankommen wie Cäsar in Zela: Veni, vidi, vici.
Der Bergbau, die Kameralwissenschaften, das Studium der Philosophie - weg damit! Kein blinder Maulwurf, kein fleißiger Beamter, ein kränkelnder Grübler gar - nein! Dichter, Dichter wollte er werden, nur um der Poesie willen war er in die Welt gekommen. Ein Dichter wollte er sein, ohne ablenkendes Amt, frei, unabhängig. Groß wie des Vaters Freund.
Vom Postplatz, wo die Kutsche hielt, war es nicht weit zu der Herberge, die man ihm empfohlen hatte. Er nahm einen Fiaker und fuhr zum Köllnerhof. Da war ein Zimmer frei, vier Treppen hoch, ein Schlauch von zehn Schritt Länge und vier Schritt Breite. Nicht gerade herrschaftlich eingerichtet, aber ein hübsches Mädchen war ihm die Treppe voraufgegangen und hatte ihm mit einem anmutigen Knicks die Tür geöffnet. „Der Herr Student muss sich gleich bei der Polizei anmelden.“
„Gut, ich gehe morgen hin.“
Doch sie erklärte, dass es noch am heutigen Tage geschehen müsse. Die Polizei sei streng. „Ist der Herr Preuße?“
Bei Gott nicht. Und er hielt sich auch einiges zugute, darauf, keiner zu sein, sondern ein Sachse. Schön, zur Polizei geht er, ja, heute noch. Ihr zuliebe. Sind die Väter auch so streng in Wien wie die Polizei? Sie machte einen Knicks, sah an ihm herab. Er missdeutete den Blick, glaubte, das gelte seiner stattlichen Erscheinung. Das war er gewohnt. Aber sie dachte: Was trägt man in Sachsen für altmodische Kleider!
Körner packte seine wenigen Habseligkeiten aus dem Reisekoffer und hängte die Gitarre an einen Haken. Der Rest sollte nachkommen, Bücher, Wäsche. Dann machte er sich frisch, verließ sein Zimmer und stieß, als er um die Ecke zur Treppe ging, mit einem anderen Herbergsbewohner zusammen. „Pardon!“, bat er, sah den Mann an, der blickte ihn an, verblüfft beide, und jauchzend fielen sie sich in die Arme.
„Mordechai, du hier?“ Und: „Körner, alter Hosenhuster!“
Das war ein Wiedersehen wie ein Fest. Keiner hatte gewusst, was aus dem anderen nach Leipzig geworden war. Dass sie sich hier begegneten, in Wien - nein, die Welt war ein Dorf.
Mordechai begleitete Körner zur Polizei. Anschließend wollten sie ein Lokal aufsuchen, um das Wiedersehen zu feiern. Es gab unendlich viel zu erzählen.
„Wann bist du weggegangen aus Leipzig und warum?“, wollte Körner wissen.
„Weggegangen“, wiederholte Mordechai mehrdeutig. „Irgendein gemeinsamer Freund muss dem Pedell gesungen haben von uns. Da zog ich es vor, schneller zu sein als die Ladung vor das Gericht zur Verkündung der Relegation. Was mir gerade noch gelang.“
Körner bedauerte, dass der Freund in die Angelegenheit hineingezogen worden war. Aber Karl Mordechai lachte. „Früher oder später wäre ich ihnen vielleicht in einer viel diffizileren Sache aufgefallen. Da sind sie noch empfindlicher. Zumal ich Jude bin.“
Körner widersprach. Das galt doch nicht mehr als Makel, seit Napoleon die neuen Gesetze mit nach Sachsen gebracht hatte.
Mordechai winkte ab. „Ich merke schon, du glaubst noch an Märchen. Lassen wir das. Was ist mit dir? Wolltest du nicht zu den Preußen nach Berlin?“
Körner erzählte, wie es ihm ergangen war. „Weißt du, Leipzig und Berlin - ich will es hinter mir lassen. Es war wohl zu arg, wie wir es getrieben haben. Nicht, dass ich bereue!“ Er lachte hell auf. „Haben wir die verdroschen!“
Es war zwar ein bisschen anders, erinnerte sich Mordechai, aber er widersprach nicht. Wenn ihm das besser ins Bild passte, sollte er selig damit werden. Er fragte anzüglich: „Du hast das Studieren entdeckt?“
Körner hörte den Unterton. Es kratzte ihn. Deshalb erwiderte er mit einer Überzeugung, die ihm der Moment eingab: „Mordechai, die Zeit der Dummenjungenstreiche ist passé.
Man lebt für ernstere Dinge. Ja, ich will die Wissenschaft am Kragen packen. Geschichte zum Beispiel. Oder Philosophie. Man muss gerüstet sein, vielseitig gebildet und zu hoher Vollendung veredelt, um gegen die Verdorbenheit des Zeitalters zu kämpfen.“
Das waren zwar des Vaters mahnende Worte, aber sie ließen sich gut gebrauchen. Freilich, von dem, was damit gemeint war, worauf das zielte, nämlich ihn davor zu warnen, ein Dichter ohne berufliche Sicherung werden zu wollen, darüber sprach er vor Karl nicht. Der hätte bestenfalls gegrinst.
Mordechai lachte. „Wie heißt sie?“
„Wovon redest du?“, fragte Körner. Wollte der Kerl nicht begreifen, dass er tatsächlich nicht mehr der Raufbold von Leipzig war?
„Wenn du solchen Unfug daherredest und solch ein Kalbsgesicht machst, steckt allemal eine hübsche Larve hinter deiner Philosophie. Lehr du mich den Körner kennen! Also, heraus mit der Sprache. Wie heißt sie?“
Körner schwankte einen Moment. Sollte er ihm eine derbe Antwort geben? Als er aber das Spitzbubengesicht des Freundes sah, vergaß er den hochtrabenden Ton, lachte plötzlich los und schlug Mordechai herzhaft auf die Schulter. „Alter, du hast ja keine Ahnung. Solch ein Engel ist sie, meine Marianne, solch ein Engel!“
„Der Körner und die Weiber! Eine Prinzessin oder die Tochter unseres Wirtes? Sicher ist man bei dir nie.“
Sollte er ihm nicht doch besser eins draufgeben, diesem Lästerschlund? Er winkte ab mit großzügiger Geste. „Du wirst sie kennenlernen. Ich nehme dich mit, wenn ich zur Baronin gehe. Pereira-Arnstein, der Bankier. Müsste dir doch etwas sagen, der Name, weil ...“ Er unterbrach sich.
„Schön, dass du wenigstens rot wirst dabei. Weil es Juden sind, wolltest du doch sagen. Und Juden kennen einander, wie sich Straßenköter kennen. - Ach, Körner, ich glaube, ihr Gojim habt jüdischere Komplexe als unsereiner. Na komm, melde dich an. Und eh du wieder in Konflikt gerätst, Körnerleben, weil ich jetzt Zeugnis für dich ablegen muss ...“
„Zeugnis für mich?“, fragte Körner erstaunt, der die Ironie nicht herausgehört hatte.
„Du bist ein Ausländer in Wien, noch dazu evangelisch. Man will einen ehrbaren Bürgen haben, das sind die Gesetze vom Franz. Er hat das Toleranzedikt vom Joseph noch nicht aufgehoben, und so bin ich ehrbar. Oder ist es dir nicht recht?“
Körner schaute etwas verwirrt drein. Wien war doch eine merkwürdige Stadt. Er vertraute sich jedenfalls dem Älteren an, wenngleich nach der ersten Wiedersehensfreude die alte Spannung zwischen ihnen erneut aufgebrochen war. Einerseits schätzte er Mordechais scharfen Verstand. Der konnte einem Dinge erklären, die der ungeübte Betrachter nicht durchschaute. Obwohl er direkt in seinem Urteil war, konnte man ihm nichts übel nehmen, auf keinen Fall aber als Boshaftigkeit anlasten. Jedoch mitunter war ein Tonfall kränkender Ironie dabei, wie oft bei gescheiten Leuten. Woher sollte er wissen, dass sich Mordechai auf diese Weise vor seiner eigenen Gutmütigkeit schützen wollte?
Körner vertraute ihm. Und Karl war Körner ehrlich zugetan. Er mochte diesen langbeinigen, sich manchmal wild gebärdenden, aber mit einer Mädchenseele ausgestatteten Jungen. Der gab den letzten Taler her, schlug sich mit Leidenschaft für die Schwächeren, hatte ein weites Herz für alles Weibliche und war integer vom Scheitel bis zur Sohle. Falschheit war ihm fremd, wenn er auch gern ein bisschen aufschnitt und sich manchmal zu Höherem berufen fühlte. Vielleicht war er’s wirklich. Jedenfalls konnte man heiter sein in Körners Gesellschaft. Und gelang es, ernsthaft mit ihm zu reden, war er ein gescheiter, geistreicher Gesprächspartner. Es gärt in ihm, dachte Mordechai in Abwandlung eines Lichtenberg-Wortes, ob es Wein oder Essig werden wird, ist noch ungewiss.
Nein, er zweifelte nicht an Theodors Begabung für die Poesie. Der reimte schneller, als andere den Katechismus herbeteten. Sein Nachteil war, dass er leichtfertig mit seinem Talent umging, statt es reifen zu lassen. Vor allem aber störte Karl, wie oberflächlich Körner, wenn überhaupt, von politischen Dingen redete. Spätestens seit dem Sturm auf die Bastille war schließlich etwas in Gang gesetzt worden, was selbst der sehr in sich ruhende Goethe empfunden hatte nach der Schlacht bei Valmy. Wenn diese Zeit einen Dichter Körner brauchte, dann sollte er sich dessen auch wirklich bewusst werden und nicht aus Eitelkeit drauflosreimen.
Die Polizei war peinlich genau beim Aufnehmen der Personalien des Studenten Körner aus Sachsen. Mordechai sah erheitert zu, wie das Protokoll Seite für Seite und mit Akribie ausgefüllt wurde.
Körner atmete erleichtert auf, als sie endlich wieder auf der Straße standen. „Und nun?“, fragte Mordechai.
„Ich muss ein Quart Wein haben, um das hinunterzuspülen. Und danach - Theater? Wien soll damit reichlich gesegnet sein, hat mir Parthey in Berlin erzählt, und die besten Mimen haben. Was meinst du?“
„Malaga“, schlug Karl vor.
Körner pfiff anerkennend. „Guter Wein, teurer Wein. Wien scheint einiges zu bieten für uns Epikureer!“
„Was delikat ist, mein Lieber, kannst du hier alle naselang haben. Die Läden sind voll. Fremdländische Weine, alle denkbaren Gaumenfreuden, jeden modischen Firlefanz kannst du kaufen in Wien. Wenn du kaufen kannst. Fressen, saufen, huren ist erlaubt, ja, staatlich sanktioniert. Nur wer denkt, macht sich verdächtig. Wien tanzt und trinkt auf einem Vulkan.“
„Mordechai, du unkst. Seit wann hast du etwas gegen ein lustiges Leben?“
„Schon immer, wenn es auf Kosten anderer geht.“ Karl bekam seinen belehrenden Blick.
Körner hatte kein Bedürfnis, Lektionen anzuhören. Unterschiede hatte es seit je gegeben. Was soll’s? Aufmucken? In Sachsen hatten die Lohnarbeiter und Landarmen revoltiert. Erfolg? Ein Regierungsmandat „wider Gewalt und Aufruhr“ hatte ihre Lage nur verschlechtert. Nein, ihm war nicht nach Belehrung zumute. „Malaga!“, verlangte er. „Und danach ein Spectaculum.“
Mordechai ging auf diesen Ton ein. „Wenn du Theater sagst, meinst du Schauspielerinnen. Gut denn, wohin willst du? Die Adamberger ist die interessanteste, die Krüger die hübscheste.“
Körner tat, als sei da viel zu überlegen. „Gibt es kein Stück, in dem sie gemeinsam auftreten?“, fragte er schließlich.
Mordechai zog sein Chronometer aus der Tasche. „Es ist jetzt drei Uhr. Du hättest vier Stunden Zeit, um eines nach deinem Gusto aufs Papier zu werfen. Wenn ich Akt für Akt, wie es dir aus der Feder fließt, ins Nationaltheater schleppe, damit dort geprobt werden kann, dürfte es heute Abend ein Stück geben mit beiden Demoiselles.“
„Was gilt die Wette, dass ich schneller schreiben als du laufen kannst, krummbeiniger Jude?“ Körner schien bereit, es darauf ankommen zu lassen.
Mordechai wehrte lachend ab. „Du hast bereits gewonnen. Ich zahle den Wein!“ Herzhaft fasste er den Freund um die Schulter und bugsierte ihn zur nächsten Schenke. „Lieber saufe ich mit dir, als dass ich dich so dichten sehe. Hernach begaffen wir die Adamberger.“
Die Schenke war zu Körners Erstaunen trotz der frühen Stunde schon gut besucht. An einem längeren Tisch hatten junge Leute Platz genommen, Studenten, wie unschwer zu erkennen war, und herausgeputzte Mädchen. Das ganze Volk bereits in aufgeräumter Stimmung. Bei Gott, man verstand zu leben in Wien!
Mordechai wurde herzlich begrüßt. Er stellte Körner vor. Die Runde nahm ihn mit Beifall auf. Der wusste, was zu tun war, und rief den Wirt. Mordechai konnte ihm gerade noch zuflüstern: „Bestell keinen Malaga für die Bande, das kostet dein Salär für einen Monat. Lass Heurigen kommen.“
Körner verlangte natürlich Malaga. Karl schüttelte unwillig den Kopf und überschlug im Stillen seine Barschaft, falls er dem Freund aushelfen musste.
Kaum hatte Theodor „Malaga“ gesagt, drängten sich auch schon zwei der Mädchen an seine Seite. Sie dufteten nach einem aufregenden, fremdländischen Parfüm. Vorsichtig griff er der einen, herzhaft bald der anderen um die Taille. Sie ließen es sich gefallen. Und da er keine Hand mehr freihatte, hielten sie ihm abwechselnd den Becher an den Mund.
„Du hast kräftige Arme“, sagte die Linke schmeichlerisch.
„Ich war Bergmann, unter Tage!“ Er stand auf, umfasste den Stuhl, auf dem die Demoiselle saß, und hob sie auf den Tisch. Beifall brandete auf. Nur Karl Mordechai verzog den Mund zu einem schiefen Grinsen. Der will sich geändert haben? Ernsthaft studieren? Das Wesentliche in der Poesie finden? Ach, Theodor Körner, du bist ein Filou und weit entfernt von dem, was du sein willst, dachte Karl. Er hätte den Freund gern anders gewusst.
Doch mitten im Trubel geschah das Seltsame. Körner hatte unversehens das eigentümliche Gefühl, als ob sich sein Geist vom Körper trennte, und er sah sich plötzlich selber sitzen unter dem lärmenden Volk. Er hob der Reihe nach die Mädchen samt ihren Stühlen auf den Tisch, bestellte lauthals die nächste Kanne Wein. Er hieß Mordechai eine alte Unke. Sah das, hörte es, als ob ein irres Spektakel vor ihm abliefe, erkannte sich als Hanswurst in der groben Posse, empfand plötzlich einen Widerwillen, der bitter schmeckte. O Gott, sollte der Spuk nicht zu verjagen sein? Schlug dröhnend mit harter Faust auf den Tisch, dass die Krüge sprangen. Die Mädchen kreischten entsetzt auf, die Burschen glotzten zu ihm herüber. Was war in diesen Kerl gefahren? Der Wirt trat hinter seinem Schanktisch hervor. Die anderen Gäste sahen unwillig auf. Das mochte man hier nicht.
Körner warf die Gulden auf den Tisch. „Lass uns gehen“, bat er leise den Freund. Sie verließen die Schenke. Vorwurfsvolle Blicke begleiteten sie. Erst als sie an der frischen Luft waren, hatte Körner das Gefühl, Körper und Geist seien wieder eins.
Sie waren schon eine Weile gegangen, ohne zu reden, da fragte Körner: „Warum bin ich so?“
Weniger die Frage, der Ton ließ Karl Mordechai aufhorchen. „Ich glaube, du bist auf der Suche nach dir selbst“, antwortete er. „Und da du noch nicht weißt, wer du bist, stürzt du dich von Abenteuer in Abenteuer und hoffst, dich irgendwo zu finden.“
„Nein, nein!“, wehrte Körner ab. „Ich weiß doch, was ich will.“
„Du willst es zu schnell. Du hast keine Geduld, am wenigsten mit dir selber. Aber um ein Dichter zu sein, braucht es außer Talent und Witz - Arbeit. Ich glaube an dich, Körner, an dein Talent. Ob du die Geduld aufbringst, deinen Pegasus noch weiden zu lassen, oder ob du ihn zu früh in Sonetten verschnitzelst, das wird sich erweisen. Im Übrigen“, das sollte ein Trost sein, „wer will denn von einem Zwanzigjährigen schon reife Kunst verlangen?“
„Schiller war ebenso alt, als er die <Räuber> schrieb“, entgegnete Körner trotzig.
Mordechai blickte den Freund schräg an. „Ich weiß“, sagte er spöttisch. „Und Mozart hat sechsjährig vor dem Kaiser gespielt. Im Ernst“, fuhr er in verändertem Tone fort, „hängt es nun von den Jahren ab oder der Reife eines Talents, das man haben muss? Sind die Früchte des Herbstes besser als die des Sommers? Verse schmieden kann mancher, Theodor. Kunst gelingt nur wenigen. Und keinem ohne Mühe. Wenn du wirklich ein Dichter sein willst, dann nicht wegen des Ruhmes, des fraglichen Beifalls der Menge oder des der Oberen, auch nicht wegen Geld, das sich vielleicht, vielleicht damit verdienen lässt. Sieh dich um in der Welt. Studiere nicht nur die Wissenschaften, aber die auch - studiere das Leben. Suche nicht bloß den Effekt in allem, den schnellen Erfolg, den gefälligen Rhythmus. Werde wesentlich, Körner, wesentlich!“ Er betonte jede Silbe des Wortes.
Körner hatte mit zunehmendem Erstaunen den Worten des Freundes gelauscht. Was war es, das verborgen brannte unter dieser Stirn und in diesem Herzen? Welche Hoffnungen, welche Sehnsüchte durchpulsten den Freund?
„Karl Mordechai, ich verpflichte dich, mich immer daran zu erinnern, wenn du glaubst, ich werde meiner Absicht untreu“, sagte Körner feierlich ernst. „Denn wenn ich um der Poesie willen in die Welt gekommen bin, was ich fest glaube, dann will ich meines Auftrages auch würdig sein.“ Er reichte dem Freund die Hand. „Gilt das?“
„Abgemacht!“ Mordechai schlug gern ein. „Du wirst mich fürchten lernen“, fügte er lachend hinzu, damit die Szene nicht ins Deklamatorische abglitt. „Das erste Gebot: Ich bin dein Freund und Kritiker. Du sollst nicht andere haben neben mir. Was ist das? Du sollst mich lieben, fürchten und mir vertrauen.“
„Verflixter Jud!“, erwiderte Körner, ebenfalls heiter gelöst „Mach mir die Gebote nicht zuschande.“
So gingen sie, untergehakt, lachend über den Michaelerplatz auf das Nationaltheater nächst der Burg zu. Ihre Fröhlichkeit war von anderer Art als in der Schenke.
Der Prunk, die Raffinesse, mit der der einstige Ballsaal zum Theater verwandelt worden war, beeindruckte Körner. Das aufgeräumte, fröhlich daherschwatzende Wiener Publikum in seiner gemütlichen Mundart bezauberte den jungen Sachsen nicht minder. Er hatte schon einiges gesehen in Leipzig und Berlin, auch in seiner Heimatstadt Dresden, die von jeher als kunstfreundlich galt - aber sei es nun, dass Wien wirklich etwas Besonderes war, sei es, dass seine hochgestimmten Erwartungen ihm mehr vorspiegelten, als tatsächlich vorhanden war: Theodor Körner atmete den Duft der fremden Parfüms, lauschte begierig der belanglosen Konversation rundum, sah neidvoll die Eleganz der Kavaliere und entzückt die Garderoben der Damen, kurzum, er fühlte sich in himmlische Gefilde versetzt, durch besondere Gunst des Schicksals aufgenommen und mit dem Versprechen versehen, in der Kaiserstadt sein Glück zu machen.
Seit einigen Jahren war Schiller in Mode gekommen. Man spielte die meisten Stücke des Dichters, der vor sechs Jahren gestorben war, mit großem Erfolg und pietätvoll. Aber das war schon wieder der Spötter Mordechai, der das behauptete. „Du wirst sehen“, fügte er an. „Übrigens, beim Logenmeister kann man die Programmzettel kaufen und das gedruckte Stück. Kostet 20 Kreuzer. Ist auch teurer geworden.“
„Den Programmzettel nehme ich. Doch das Stück, Karl, ich könnte soufflieren, so oft haben wir < Kabale und Liebe > gelesen daheim. Ich erinnere mich sogar gut, wie Schiller selbst einen Part übernommen hat. Er machte' den Präsidenten von Walter.“
„Ich verspreche dir einen Schiller, wie du ihn dein Lebtag noch nicht gehört hast!“, sagte Mordechai so laut, dass einige der Umstehenden aufmerksam wurden.
Aber mochte Mordechai auch älter sein und mehr von der Welt gesehen haben als er - von Schiller konnte er ihm nichts vormachen. Auf dessen Knien hatte er schon Hoppereiter gespielt. Und wenn er die Werke eines Dichters gleichsam mit der Muttermilch eingesogen, hatte, dann waren es die von Schiller. Als Knabe hatte er ganze Partien im Wechsel mit Emma und Julia aufgesagt. „Von Schiller kannst du mir nichts erzählen“, sagte Körner etwas herablassend.
„Wir werden sehen“, antwortete der andere ungerührt. „Kauf dir das Stück. Es ist seine Kreuzer wert.“
„Also schön, damit du Ruhe gibst.“ Körner langte das Geld aus dem Beutel und kaufte Programmzettel samt Textbuch beim Logenmeister. Allerdings fand er keine Zeit, hineinzusehen, als sie ihre Plätze im zweiten Rang eingenommen hatten.
Körners Blick wanderte von der prachtvollen Bühne zu den glitzernden Leuchtern und über die reich verzierten Logen. Er ließ sich tragen von der stimmungsvollen Kulisse des munteren Publikums bis hoch in den vierten Stock.
„Die Besetzung ist vorzüglich“, sagte Mordechai mit Unterton. „Langer gibt den Vicedom.“
„Den was?“, fragte Körner noch ohne Argwohn.
„Den Vicedom von Walter, sagte ich, spielt der berühmte Langer. Und seinen Neffen Ferdinand...“
„Was redest du da?“, unterbrach ihn Körner. „Vicedom, Neffe!“
„Obergarderobenmeister von Kalb nicht zu vergessen“, warf Mordechai mit gespieltem Ernst ein.
Da nahm Körner endlich den Besetzungszettel zur Hand, um selbst nachzulesen, welches Stück statt Schillers „Kabale und Liebe“ gespielt werden sollte. Aber da stand es: „Kabale und Liebe, ein Schauspiel in fünf Aufzügen, von Friedrich von Schiller“. Und der Präsident von Walter - Körner stutzte. Da gab es keinen Präsidenten. Statt seiner stand tatsächlich ein Vicedom von Walter auf dem Programmzettel. Und Ferdinand war nicht der Sohn, sondern sein Neffe? Aus dem Hofmarschall von Kalb war wirklich ein Obergarderobenmeister geworden.
„Was ist das?“, fragte Körner bestürzt den Freund.
„Zensur“, antwortete der sarkastisch. „Das ist die Zensur. Irgendein Schreibtischhengst mit Theaterambitionen erhält den Auftrag, das Stück, das zur Aufführung endlich zugelassen ist, so zu bearbeiten, dass keiner mehr Anstoß nehmen kann. Das Nationaltheater heißt darum bei den Wienern schon lange Komtesstheater. Alles so fein züchtig, dass auch die geschämigste Demoiselle nicht erröten kann, und natürlich politisch entschärft.“
„Aber das ist doch ...“, erwiderte Körner, verstummte jedoch, durch unwillige Blicke und verärgertes Zischen zurechtgewiesen. Mordechai legte ihm die Hand auf den Arm. „Sieh es dir an. Sieh es dir gut an“, sagte er leise. Schadenfreude, Triumph gar war nicht herauszuhören, wohl aber Bitternis. Auch du, Habsburg, auch du, Austria felix.
Körners Verblüffung hielt nicht lange an. Sei’s drum! Jeder Staat bewegte sich innerhalb von Grenzen, die nicht allein territorialer Natur waren. Da gab es gewisse Konvenienzen. Und auf das sittliche Gefühl des Publikums musste Rücksicht genommen werden. Das wollte er der Theaterleitung konzidieren. Lass den Präsidenten einen Vicedom sein und Kalb einen Obergewandmeister. Was konnte das Schiller anhaben? Der Geist des Werkes war nicht zu verfälschen.
Zudem zog ihn das Spiel sofort in den Bann, als Luise auftrat. Ein Raunen ging durchs Publikum. Wahrhaftig, das war eine Luise nach Körners Geschmack! Gespannt folgte er ihren Bewegungen, fasziniert lauschte er der geschulten, warmen Stimme. Welche Anmut, welche Grazie! Der Freund hatte nicht zuviel versprochen.
Und das Publikum war so hingerissen wie er. „Die Toni!“. hörte er um sich die begeisterten Kommentare. „Unsere Toni Adamberger! Das tut ihr keine gleich.“
Lass den Mordechai unken, das ist seine Natur, er meint es nicht übel, dachte Körner und streifte den Freund mit einem kameradschaftlichen Blick. Doch gleich wandte er sich wieder dem Geschehen auf der Bühne zu: die vierte Szene des ersten Aktes, Luise und Ferdinand allein, der wunderbare Gleichklang ihrer Seelen! Körner genoss das Spiel, fühlte sich bald als Major und hörte die Adamberger reden, als spräche sie zu ihm. Körner vergaß, dass er im Theater war.
Karl Mordechai unterließ es, den Freund auf die blöde Handhabung der Zensur zu verweisen. Die Lächerlichkeit der Striche und Verfälschungen würde sich von selbst ad absurdum führen, zumal bei einem, der das Original kannte und genug Witz hatte, die Originalität des Stoffes zu erfassen. Dass der Präsident eines regierenden Fürsten zum Statthalter auf einer Domäne geworden war, machte die Kabale zu bloßer Charakterlosigkeit und aus der Staatsangelegenheit schäbigen Familienzank. Das Stück hätte auch von Kotzebue sein können. Körner würde schon ein Licht aufgehen, falls er sich nicht an der hübschen Adamberger festguckte. Und der Wahrheit die Ehre - sie sah nicht nur gut aus, sie spielte auch mit einer Kunst, die der Bearbeitung des Stücks spottete.
Körner war Ferdinand. Er hatte die Szene - „ein teutscher Jüngling“ - verlassen und war auf dem Weg zu dieser Metze aus England.
Die Kammerdienerszene war gestrichen. Körner vermisste sie nicht sonderlich; denn er brannte darauf, der Lady als zorniger Ferdinand gegenüberzutreten. Aber Mordechai, der konnte sich den Kommentar nicht verbeißen, zumal er sah, wie wenig Anstoß der Freund an diesem Eingriff nahm. „Was übrig bleibt, ist eine fade Romanze. Und hätte sich Schiller den Schmarren ansehen müssen, dann hätte er statt Ferdinand die vergiftete Limonade getrunken. Man sollte die gestrichenen Bilder auf dem Michaelerplatz geben, das wäre ein Spektakel! Aber freilich, wo der Kaiser seine Tochter verhökert an einen Usurpator, wer will da schelten, wenn ein Herzog seine Landeskinder verkauft, um Brillanten für seine Mätresse anzuschaffen?“
Ein Ungar, der hinter ihnen saß - man erkannte ihn gleich an der Montur -, klopfte Karl Mordechai anerkennend auf die Schulter. „Du gefällst mir, Bruder. Lass uns hernach bei einem guten Weine sitzen. Aber halt ’s Maul solange, sonst sitzt du schnell woanders.“
Karl nickte. „Ich bring den Träumer mit“, sagte er gutmütig spottend, „falls er nicht gleich nach der Vorstellung in eine bestimmte Garderobe muss.“
„Lästermaul!“, wehrte sich Theodor. „Wein läuft schneller fort als Weib. Ich werde mich schon sputen. Trotzdem, Alter, das muss selbst so ein verstockter Banause wie du sehen, dass hier Theater gespielt wird wie sonst auf keiner deutschen Bühne!“!
„Die Adamberger jedenfalls agiert so gut, dass ich annehmen muss, sie kennt das Original. Aber dem Ferdinand fehlt das ch zum Schauspieler.“
Körner war entschlossen, nicht mehr auf Mordechais Räsonieren zu hören, konnte sich aber eines Kopfschüttelns nicht enthalten, als Ferdinand auf der Bühne in hohem Diskant ausrief: „Es gibt eine Gegend in meinem Herzen, worin das Wort Onkel noch nie gehört worden ist - dringen Sie nicht bis in diese!“ Und insgeheim gab er Karl recht. Was hier mit dem Rotstift verdorben worden war, machte auch die gute Darstellung nicht wett.
Diese Einsicht hielt an, solange der Vicedom seine Kabalen spann auf der Bühne. War aber Ferdinand bei seiner Luise, wurde aus dem Spiel wieder Ernst. Ohne Zweifel, die Kunst der Adamberger brachte das zuwege. Körner nahm so heftig Anteil am Geschehen, dass ihm schließlich der kalte Schweiß ausbrach, als Ferdinand die Limonade mit dem Gift trank und danach Luise das Glas reichte.
Als das Trauerspiel beendet war, die Liebenden gestorben waren und der Bösewicht sich bekehrt in die Hand der Gerechtigkeit begeben hatte, meinte Mordechai: „Das verzeih ich dem Schiller nicht! Solch einem Stoff am Ende den Pfropfen herauszuziehen, statt das Fass zum Überlaufen zu bringen. Was ein Gewitter sein könnte, wird am Ende ein Furz.“
„Lästerling!“, fuhr ihn Körner an. „Ist dir denn gar nichts heilig?“
„Einiges schon“, erwiderte Mordechai ernst. „Allerdings mache ich mir nicht gleich in die Hosen vor Rührung, wenn ich Liberté, Egalité, Fraternité sage.“ Und er hob die Stimme bewusst, provokant. Der Ungar nahm ihn schnell zur Seite und schob ihn in die Gruppe seiner Freunde.
Ein Kerl mit falschem Gesicht hielt Körner am Ärmel fest. „Kennt Er den?“ Der schiefe Blick zu Mordechai lag zwischen Kumpanei und Drohung.
Theodor begriff. „Ein regierender Fürst incognito, du Hundsfott!“
Da zog es der andere vor zu verschwinden. Bei den hohen Herren wusste man nie genau, woran man war. Das Denunzieren kleiner Leute lohnte sich mehr. Und die konnten’s einem nicht vergelten, wenn es einmal anders kam.
Schnell folgte Theodor seinem Freund, den die Ungarn wohlgesichert aus dem Foyer gebracht hatten. Die ersten Zeilen eines Gedichtes auf die Adamberger hatte Körner schon im Kopf, während die Ungarn vom Tokajer redeten.
Es wurde getrunken und gelacht. Es waren auch Mädchen an ihrem Tisch. Und doch unterschied sich die Heiterkeit der Runde erheblich von den studentischen Feten, die Körner erlebt hatte. Er suchte hinter die Ursache des Unterschiedes zu kommen. Vielleicht lag es daran, dass nicht verbale Kraftmeierei den Ton machte, sondern das Selbstbewusstsein dieser Nation?
„Wir Ungarn“, sagte Imre Sándor, jener, der Karl während der Vorstellung angesprochen hatte, „wir Ungarn sind keine Böhmen und Mähren!“ Wie viel Stolz lag in dem Satz, vielleicht aber auch Hochmut.
„Zweckoptimismus“, konstatierte Mordechai später, als ihn Körner deswegen befragte. „Ja, Ungarn genießt mehr Autonomie als die anderen Teile Habsburgs. Jeder neue Herrscher des Reiches muss in Ungarn noch einmal gekrönt werden. Alle Gesetze und Maßnahmen bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Ständevertretung. Jedoch, im Ernstfalle fragt die Krone nicht.“
„Ein Dichter bist du?“, fragte Sándor Körner. „Machst schöne Verse auf hübsche Weiber, was? Schwärmerei! Wirf die Romanzen in die Donau und blas mit deinen Liedern die Glut, die im ganzen Lande schwelt, zu hellem Feuer an. Nimm dir ein Beispiel an unserem Pál Öz. Er war kaum älter als du und angeklagt wegen Hochverrats! Hat er um Gnade gebettelt bei Franz? Gerechtigkeit hat er verlangt. Da schlugen sie ihm den Kopf ab. Ja!“
Körner griff sich unwillkürlich an den Hals. Die anderen lachten, und Sándor sagte: „Keine Angst, Sachse, erst rollt der meine. Aber das eine merke dir: Willst du je ein Heldenepos machen, so sieh dir die Geschichte Ungarns an, und du wirst nicht wissen, wo zuerst anfangen. Ich sage nur Zriny! Oder Rákóczi. Denk an die Kurutzen und Albert Kiss. Servus!“ Er stieß mit Körner an und trank sein Glas in einem Zuge leer.
Körner, erfreut, in diese Runde aufgenommen und mit Vorschuss auf künftigen Dichterruhm bedacht zu werden, tat es dem Ungarn gleich. Und als er dem sechsten oder siebenten seiner neuen Freunde Bescheid geben wollte, wusste er nicht mehr genau, ob es nicht auch die goldenen Knöpfe an ihren schmucken Dolmanen waren, die ihm zulachten. Von einem aber hatten ihn die Ungarn fest überzeugt: böhmische Hosen, wie sie ihnen der Kaiser gern angezogen hätte, um sie sich ganz zu unterwerfen, trugen sie allesamt nicht.
Mordechai hatte seine Mühe, den zukünftigen Sänger von Ungarns Freiheit ins Bett seiner Wiener Herberge zu transportieren. So endete Körners erster Tag in der Stadt am Donaufluss, der Kaiserstadt, in der er sein Glück machen wollte. „Trink die Limonade nicht, Luise!“, brummelte er. „Es ist der reine Spiritus.“ Und schnarchte bereits.
Er will ein Dichter werden
Gentz war gekommen. Er hatte Humboldt in der Kanzlei aufgesucht, nicht in der Wohnung.
Geld wird er brauchen, dachte Humboldt. Hatten ihm seine englischen, russischen oder österreichischen Freunde nicht genug Silberlinge geschickt, oder waren seine Liebschaften wieder einmal größer als seine Barschaften? Natürlich brauchte er Geld, bestätigte sich Humboldt, als er den einstigen Jugendfreund reden hörte von geheimen Kenntnissen, die nur er habe, und wenn Metternich auch, dann erst durch ihn, Friedrich Gentz. Der hatte keine Bedenken, vor Humboldt mit seinen Informationen zu prahlen, konnte er doch sicher sein, dass der preußische Außerordentliche Gesandte und bevollmächtigte Minister in Wien, Wilhelm von Humboldt, die gezielten Indiskretionen nicht nur mit einem Dankeschön honorieren würde. Und dann, die einst gemeinsamen abenteuerlichen Streifzüge durch Kneipen und Bordelle - das verband mehr als Blutsverwandtschaft und adlige Herkunft. Nein, Gentz hatte keine Skrupel.
Freilich, so herzlich war Wilhelm von Humboldt diesem Manne nicht mehr zugetan. Spätestens seit seiner Bekanntschaft mit Schiller, dessen moralische und geistige Integrität ihn tief beeindruckte, erkalteten die Gefühle für den Jugendfreund. Doch war er ihm von Nutzen in Wien, wohin Gentz schon acht Jahre früher gegangen war, um das Wort Flucht nicht zu gebrauchen. Und seit dem Jahre 1806 betraute ihn die österreichische Regierung mit besonderen politisch-diplomatischen Aufgaben, die offiziell schwer durchzuführen und nicht immer sauberster Natur waren, ihn, der einst in preußischen Diensten gestanden hatte.
Karoline machte kein Hehl daraus, dass sie Gentz nicht mochte. Sie traute ihm nicht. Der kannte keine aufrichtigen Gefühle. Und: „Er liebt die Unseren nicht, unser Preußen.“
Humboldt war klug genug, sich vor dem Vertrauten Metternichs nicht gänzlich zu offenbaren, brauchte aber andererseits keine besondere Mühe, Friedrich zum Reden zu bringen, dessen Mitteilungs- und Geldbedürfnis das Dunkel österreichischer Diplomatie gelegentlich erhellte.
Der Kaiser von Österreich, der sich Franz I. nannte, seit das Heilige Römische Reich deutscher Nation nach den Siegen Napoleons auseinandergebrochen war, dieser Kaiser fürchtete das Nationalgefühl seiner Untertanen mehr als den Korsen, den er sich mit seiner Tochter Maria Luise zum gewogenen Schwiegersohn erhandelt zu haben glaubte. Der Schock von 1809, als die Tiroler sich selbst bewaffneten und gegen die französischen Besetzer samt ihren bayrischen Statthaltern einen Volkskrieg führten unter Andreas Hofer, saß Franz tief in den Knochen.
„Der Kaiser ist ein Schwachkopf“, sagte Gentz wegwerfend. „Weißt du, was er gemeint hat, als Wagram verloren gegangen war gegen die Franzosen? - Hab ich’s nicht gesagt, dass es so ausgehen wird? Jetzt können wir alle nach Hause gehen. - Das ist der Kaiser Franz, mein Lieber. Gib dich keiner Illusion hin, dass der auch nur einen Kreuzer riskiert für eine Allianz gegen den Korsen. Der nicht!“
„Solange Napoleon siegt - kaum“, erwiderte Humboldt hintergründig.
Gentz lachte. „Und noch siegt er. Für Kommendes ist Vorkehrung getroffen.“
„Russland?“, warf Humboldt ein.
Gentz hob die Brauen. „Russland ist groß, und der Zar ist weit. Man macht sich Raubtiere gewogen, indem man ihnen schmackhafte Brocken zum Fraß vorwirft, ein Stück Galizien dem einen, während man dem anderen wenigstens einen Teil Tirols zurückgibt. Solange sie fressen, beißen sie uns nicht.“
„Bis nichts mehr bleibt, was man ihnen vorwerfen kann. Dann wird es Habsburg selber sein, das sie zerreißen.“
„Zwei Riesen hauen sich um einen Zwerg. Sie werden einer auf den anderen losgehen und zertrampeln, was zwischen ihnen liegt.“
Humboldt verblüffte die Offenheit. „Preußen“, sagte er. „Du meinst Preußen. Wenn du auch nach Wien gegangen bist, so ist Preußen noch immer dein Vaterland, Friedrich!“
„Ich brauche kein Vaterland. Ich brauche Geld.“
Da war es, nackt ausgesprochen, um dessentwillen er gekommen war. Doch Humboldt überhörte es geflissentlich, erwiderte mit Betonung: „Vor der Welt muss man das Vaterland ehren, wenn es auch eine Sandwüste ist.“
Es machte keinen Eindruck auf Gentz oder doch einen ganz anderen als den gewünschten. „Das sagst du?“, fragte er mit einem mokanten Lächeln. „Hat man dich nicht abgeschoben nach Wien, weil du ihnen als Minister zu gescheit gewesen wärest? Unser gemeinsamer Freund Dohna und Hardenberg und dieser feige König! Was hat es dir genützt, dass du recht erfolgreich in deinem Departement für Kultus gewirkt hast oder, wie man weiß, auch nicht faul warst bei einer gewissen Dame in der Nähe deiner hübschen, aber einfältigen Königin. Jetzt hockst du in Wien, das du nicht sonderlich magst, und bist nicht mehr als ein mittelmäßig bezahlter Neuigkeitsschreiber. Du, Wilhelm von Humboldt, dessen Name die Welt mit Achtung nennt, dienst einem König, der noch schlechter deutsch spricht, als er deutsch denkt. Red mir nicht von Vaterland. Eine Hure betreibt ein ehrlicheres Geschäft. Dreihundert Taler fürs erste würden mir genügen. Er hat dich abgeschoben.“
„Wer?“
„Dein König.“
„Ich hatte selbst um eine Versetzung gebeten.“
„Die Toren werden den Gescheitesten unter sich immer mehr fürchten, als sie dem Dümmsten vertrauen, Wilhelm. Das weißt du. Du müsstest alles Selbstgefühl verloren haben, wenn du dich nicht nur Ministern überhaupt, sondern namentlich diesen, denen du keine Superiorität zuerkennen kannst, auf jedwede Weise unterordnen wolltest. Deswegen hast du um deinen Rücktritt ersucht. Und ihn bekommen.“
Humboldt widersprach nicht. Gentz hatte recht. Ja, er fühlte sich nicht sonderlich wohl in Wien. Wenn es Rom wäre! Dorthin zog es ihn zurück. Aber in Wien vermochte er nicht heimisch zu werden. Die Lebensweise seiner Bewohner, der Reiz der Landschaft, der Ruf als Metropole zeitgenössischer Musik - das ging ihn nichts an. Blieb das Studium der Alten, seine Übertragung des „Agamemnon“, die vergleichenden Sprachuntersuchungen und die Beschäftigung mit indianischen Dialekten, wofür er von seinem Bruder Alexander wertvolles Material bekommen hatte.
Er machte sich nichts vor. Der Staatskanzler Hardenberg misstraute ihm noch mehr, seit er von dem Treffen mit Stein in Prag erfahren hatte. Die Informationen an den preußischen Gesandten in Wien waren dürftig, Dienstanweisungen aller Art spärlich. Hardenberg benutzte bei wichtigen Missionen eigene, ihm ergebene und untertänige Mittelsmänner, ohne es für erforderlich zu halten, den offiziellen Vertreter Preußens am Wiener Hof zu informieren. Wenn nicht Gentz gewesen wäre, Humboldt hätte manchmal wie ein dummer Junge dagestanden.
„Zweihundert?“, fragte er also.
„Hatte ich nicht dreihundert gesagt? Na, du bekommst es zurück. Scharnhorst ist unterwegs zum Zaren, um gegen Frankreich zu verhandeln. In Hardenbergs Auftrag, der seinerseits mit den Franzosen schachert gegen die Russen. Quittung ist doch wohl nicht nötig?“
Humboldt gab ihm das Geld. „Li muss es nicht unbedingt wissen“, sagte er. Gentz nahm das Geld, als ob er Humboldt einen Gefallen erwiese, sagte: „Hab ich je geschwätzt vor deiner Frau?“ Und dann, scheinbar beiläufig: „Metternich will dich sprechen. Aber er ersucht dich, in der Öffentlichkeit auf Distanz zu achten. Als Freund Steins könntest du ihn bei Napoleon kompromittieren. Ich werde dir bald Nachricht zukommen lassen, wo ihr euch - sagen wir: auf neutralem Boden - treffen könnt. Es wird dir gefallen. Ich arrangiere das. Aber lass dich nicht auf ein Spiel ein. Metternich beherrscht die Karten perfekter als die Potentaten.“ Lachte, ging davon und pfiff eine Melodie, die sie, Humboldt erinnerte sich, das erste Mal in einem Pariser Bordell gehört hatten.
„Frecher Hund!“, sagte er leise, aber es klang anerkennend. Er verspürte keine Lust, nach dem Besuch Gentz’ in der Kanzlei zu bleiben. Die Büroluft war ihm drückend, die Dokumente schienen ihn anzugrinsen mit ihrer unverschämten Belanglosigkeit. Es war ein unerquickliches Amt, Gesandter Preußens in Wien zu sein. Er sehnte sich nach Rom. Er sehnte sich nach Königsberg in die Arme Johanna Motherbys. Sie hatte seine Briefe nicht beantwortet. Das beunruhigte ihn. Seine Leidenschaft für die Frau des schottischen Arztes war heftiger, als er es sich einzugestehen wagte. Die Entfernung vergrößerte die Sehnsucht nach ihren Zärtlichkeiten nur. Und es war die Wärme ihres Hauses auch, die gleichsam römische Atmosphäre, die ihm fehlte, so sehr seine Frau Karoline, die um seine Liaison wusste, alles tat, um ihn den Verlust vergessen zu lassen.
Gentz hatte ihm die Laune verdorben. Er war gern Staatsmann, aber ungern auf verlorenem Posten. Der König hätte einen fähigen Außenminister an ihm gehabt. Aber was war das für ein König?
Vielleicht gelang es Karoline, seine gedrückte Stimmung wieder aufzuheitern, oder den Kindern. In der Wohnung hatte er auch einige Abgüsse klassischer Skulpturen, Mitbringsel aus Rom. Und vor allem waren dort seine Bücher, die Reiseaufzeichnungen des Bruders, der noch unbeantwortete Brief Goethes. Und wollte nicht der Sohn Körners aus Dresden kommen dieser Tage mit dem Aufsatz über Schiller? Fort, fort aus dem düsteren Amt.