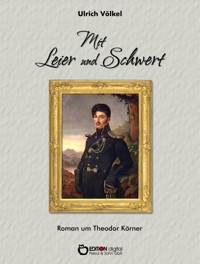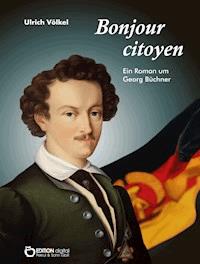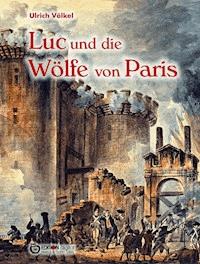7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Mann hat seine Erfahrungen gemacht, jetzt misst er sein Verhalten an der Wirklichkeit. Erfolg oder Versagen werden zum Gradmesser eigener Bewährung. Aus der kritischen Erinnerung an Vergangenes formt sich die Erkenntnis für künftige Lebensart, für menschliche Haltung. Bei einer Provokation auf hoher See kommt der junge Matrose Bernd Sorowski ums Leben. Sein Kommandant, Kapitänleutnant Gollmann, fährt nach Plauen, um der Mutter die Nachricht vom Tod ihres Sohnes zu überbringen. Die Frage: Ich habe Bernd Sorowski gekannt, doch wer ist er wirklich gewesen, und wie war mein Verhältnis zu ihm? - zwingt Gollmann immer von neuem, darüber nachzudenken, was es heißt, Offizier einer sozialistischen Armee zu sein. Er gewinnt tiefe innere Einsichten in die Notwendigkeit, sich an jedem Tag und zu jeder Stunde so zu verhalten, dass Matrosen und Soldaten unbegrenztes Vertrauen in ihren Kommandeur und dessen Fähigkeit setzen können, jederzeit richtige Entscheidungen zu treffen. Das Nachdenken über Bernd Sorowski, aufgelöst in erlebnisreiche Szenen, führt Gollmann schließlich auch zu einer Überprüfung seiner Beziehungen zu anderen Offizieren, zu seinem Schulfreund, dem Arzt Dr. Blankschön, und zu seiner Frau Ellinor, Schauspielerin am Rostocker Theater. - Ulrich Völkel zeichnet ein Bild der ständigen, vorwärtsschreitenden Entwicklung eines Menschen, für den Stillstand bereits Rückschritt bedeutet. Eingebettet in Vorgänge der sechziger Jahre aus dem Leben der Volksmarine, vermittelt er in dem erstmals 1975 erschienenen Buch Erkenntnisse, die weit über diesen Bereich hinausgehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 270
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Impressum
Ulrich Völkel
Das Schiff läuft wieder aus
ISBN 978-3-95655-532-9 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien erstmals 1975 im Militärverlag der Deutschen Demokratischen Republik.
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2015 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
1. Kapitel
Die Stadt liegt weit zurück. Die Erinnerung wird bleiben. Noch überstürzen sich die Bilder. Wesentliches hat das Unwichtige noch nicht vergessen gemacht. Erfahrenes aber und Durchdachtes durchdringen sich bereits, um ein festes Gewebe zu schaffen, das einmal das wirkliche Bild sein wird: die Erinnerung an Vergangenes als Erkenntnis für künftiges Verhalten, für Haltung.
Der Mensch wird nicht mit einem Mal erwachsen. Er verwächst immer tiefer mit dem Leben. Das geschieht für ihn unmerklich als ein steter Prozess. Andere beobachten es deutlicher, Freunde vielleicht. Und die sagen, wenn sie uns wiedertreffen nach längerer Zeit: „Du hast dich verändert. Du bist anders geworden. Irgendwie - erwachsener.“
Aber es gibt auch Ereignisse, Vorgänge, die prägen sich gleich fest ein, dass man sie als das Besondere begreift, und schlagartig, wie durch einen grellen Blitz, beleuchten sie eine bis dahin im Dunkeln verborgene Landschaft von Wissen und Gefühlen. Sie machen Leidenschaften lebendig, deren man sich vorher nicht fähig glaubte. So geschieht es dann, dass gründlicher hasst, wer bis dahin nur verachtet hat, und eine tiefe Liebe wird, was eben nur Zuneigung war.
Jochen Gollmann hat Zeit. Sie wird nicht ausreichen, um mit dem Erlebten fertig zu werden. Aber er braucht diese Stunden, um zur Besinnung zu kommen, um sich zu besinnen auf alles, was er weiß und was war.
Es regnet. Gleichmäßig huschen die Wischer über die Scheiben. Er verfolgt ihre Bewegung mit den Augen und bemerkt erst jetzt, dass sein Kopf den beständigen Rhythmus leicht mitschwingt. Gleichmäßig auch summt die Maschine des Wartburgs. Ruhe. Beruhigend wirken der Regen, die Wischer, der Motor.
Er drückt die Zigarette aus, halb geraucht. Sie schmeckt nicht. Die Anstrengung der letzten Tage macht sich bemerkbar. Er legt den Kopf zurück. „Wecken Sie mich bitte in einer halben Stunde, Genosse Ammer!“
Der Obermatrose nickt. „War hart, was, Genosse Kapitänleutnant?“
„Ja“, sagt Gollmann, „es war hart.“
Aber der Schlaf kommt nicht. Er versucht zu zählen. Bei zweihundert geraten ihm die Ziffern durcheinander, weil seine Gedanken wieder bei den Ereignissen angekommen sind, die ihn nicht loslassen. Er zählt nur noch mechanisch weiter und vergisst auch das bald.
Welche Größe in diesem Eugen Schnitt! Äußerlich der Typ eines Parteiarbeiters. Korrekt, etwas behäbig schon, aber sich bewusst gerade haltend, ein abgespanntes Gesicht, doch kein gelangweiltes Zuhören, leise Stimme, zuvorkommend höflich, nicht gerade kalt, aber auch nicht übermäßig herzlich. Er hat viel zu tun. Er ist neu in dem Betrieb, und manch Alteingesessener betrachtet ihn mit spöttischem Lächeln. Das ist auch einer von denen, die alles umkrempeln wollen, wenn sie neu sind. Aber ist es ihnen gelungen, wehe dem, der den nunmehr eingeschlagenen Pfad verlässt! Da sind sie hart. Da haben sie ihre Prinzipien wie andere Leute die Leukämie: unheilbar.
Eugen Schnitt ist anders. Er stellt infrage, was sich als Gegebenheit manifestieren will. Erprobte Wege sucht er nach glatten Stellen ab; denn er weiß, wo unsere Straßen am sichersten scheinen, geschehen oft unerwartet Unfälle. Man war sich zu sicher.
Und dieser umsichtige Mann, Parteisekretär eines großen Betriebes, korrekt, etwas unnahbar scheinend, eben noch interessierte Freundlichkeit - „Na, was führt denn die Volksmarine in unsere Berge?“ -, er lächelt, er denkt: Mit allem kommen sie zu mir, und jeden schicken sie zu mir - dieser Mann, der sich so gerade hält, fällt plötzlich hinter dem gewaltigen Schreibtisch, wie durch ein schweres Beben erschüttert, zusammen. Jochen Gollmann wusste nicht, dass Eugen Schnitt der Vater ist. Er wusste so viele Dinge nicht.
Man schrieb das Jahr 1969. Bernd Sorowski war an einem kühlen Märztag als neuer Rudergänger an Bord gekommen. Und da Kapitänleutnant Gollmann wusste, dass er aus Plauen stammte wie er, wollte er sich in der dienstfreien Zeit mit ihm über die gemeinsame Heimatstadt unterhalten. Aber das gelang nicht. Sorowski hatte etwas an sich, eine gewisse Laxheit im Ton, die ihm missfiel. Sie erinnerte ihn an Blankschöns lässiges Auftreten. Dennoch, das spürte er bald, waren die beiden ganz verschieden.
Warum verschloss er sich vor mir, überlegt Gollmann. Übertrug ich meine Abwehr gegen Blankschön auf Sorowski? Holte ich eine Auseinandersetzung nach, zu der mir vor zehn Jahren die Überlegenheit gefehlt hat?
Der Kommandant eines Schiffes muss seine Besatzung genau kennen, damit er weiß, auf wen er sich in komplizierten Situationen verlassen kann. Und es kommt auf jeden an. Zwischen ihm und diesem Genossen Sorowski gab es Spannungen seit dem ersten Tag. Hatte er etwas falsch gemacht, oder war der Junge mit falschen Erwartungen an Bord gekommen? Ein Plauener. Mit einem Jungen aus der Heimat musste man doch auskommen! Warum verschloss er sich gerade vor seinem Kommandanten? Gollmann hatte beobachtet, wie Sorowski des Öfteren mit dem Obersteuermann, Maat Tamper, zusammensaß.
Ihn fragte er: „Sie kennen Sorowski ein bisschen genauer. Was ist los mit ihm?“
„Er hat ein Problem, Genosse Kapitänleutnant. Er kommt damit noch nicht zurande. Es ist wegen zu Hause, wissen Sie“, antwortete der Maat.
Gollmann nickte. Doch es befriedigte ihn nicht, und er beschloss, den Matrosen selber zu fragen. Ungewissheit machte ihn nervös. Er musste Klarheit haben. Er bestellte ihn in seine Kammer.
„Genosse Sorowski, was ist mit Ihnen los?“
Der Matrose blickte auf, gar nicht erstaunt. Die Frage überraschte ihn nicht. Er sagte: „Ich mache meinen Dienst. Da kann mir keiner etwas.“ Er stellte das fest. Er setzte eine Mauer. Also: Was willst du?
„Ich will nichts von Ihnen“, sagte der Kommandant, schon wieder ungeduldig fordernd. Er spürte es selbst, das war nicht die rechte Art, an den Jungen heranzukommen. Deshalb sagte er möglichst kameradschaftlich: „Du hast Sorgen zu Hause. - Kann ich dir helfen?“
Bernd Sorowskis Gesicht verfinsterte sich. Woher weiß er das? Hat Tamper gequatscht? Und er machte sich steif. „Das ist meine Sache. An Bord hat das nichts zu tun.“ Ich mache es falsch. Ich mache es ausgerechnet dort am verkehrtesten, dachte Gollmann, wo ich mehr Gefühl haben müsste als Verstand. Das ist ein Fall für Ellinor. Er erinnerte sich mit einem leisen Lächeln an seine Frau. Aber Sorowski schien es zu missdeuten, und Gollmann sagte schnell: „Ich musste eben an meine Frau denken, Genosse Sorowski. Sie wirft mir manchmal vor, dass ich bei der Beurteilung anderer Menschen zu sehr von dem ausgehe, was ich in ihnen sehen will. Alles kleine Gollmänner, sagt sie.“
Nun musste Bernd lachen. „Sie haben eine kluge Frau, Genosse Kapitänleutnant.“
„Ich habe ein Foto von ihr.“ Gollmann gab ein bisschen an vor diesem Jungen. Er nahm aus der Brieftasche ein postkartengroßes Bild heraus, das die Königin von England darstellte aus einer Theateraufführung. Er trug dieses Bild ständig bei sich, zeigte es aber selten, weil ihm immer etwas unwohl dabei war: Sozialistischer Offizier schleppt Königinnenbilder mit sich herum. Der Stempel des Theaterfotografen war zwar deutlich zu sehen auf der Rückseite, aber wer beachtet das noch, wenn er so etwas angesichts der Vorderseite gedacht hat? Manch einer glaubt eben von anderen, dass sie denken wie er.
Bernd Sorowski betrachtete das Bild aufmerksam. Er wollte Zeit gewinnen, um sich darüber klar zu werden, warum sein Kommandant ihm dieses Bild zeigte. Das passte nämlich ganz und gar nicht zu dem sonst so verschlossenen Mann. Er reichte es mit der Frage zurück: „Sie ist Schauspielerin?“
„Ja“, sagte Gollmann nicht ohne Stolz. „In Rostock bei Curt Carl Vogler.“
Von dem hatte Bernd schon gehört. Das sollte ein Experte sein unter den Theaterleuten. Ein bisschen extravagant, aber er konnte was. Auch so ein Vorurteil: Wer anders ist als andere, ist schon extravagant. - Warum will der Alte mit mir reden?
„Wissen Sie, ich komme selten ins Theater. In der Rolle habe ich sie nie gesehen. Aber das hat sie auch in Wirklichkeit ein bisschen an sich, diese königliche Hoheit. Na ja, ist kein Begriff aus unserer Welt. Aber meine Frau ist so und dennoch ganz heute. Schwierig, was?“
„Eine Frau muss ja nicht unbedingt Zigarren rauchen, um von heute zu sein“, sagte Bernd Sorowski.
Gollmann lachte. „Das hat sie auch schon gemacht! Gott sei Dank nur zu Hause. Was würden die Leute sonst denken, nicht?“
Spießer, wollte Bernd sagen, aber er unterdrückte es noch rechtzeitig, weil er überlegte, ob er es besonders lustig gefunden hätte, mit einer Zigarren rauchenden Frau im Lokal zu sitzen. „Hat eben jeder seine Probleme“, sagte er.
„Hm“, stimmte ihm Jochen Gollmann zu. „Aber immer kann man sie nicht allein lösen.“ Damit spielte er wieder auf seine Frage an, doch diesmal nahm es Bernd seinem Kommandanten nicht übel. Zwei Männer redeten über das Leben: Wie geht es dir, wie geht es mir? „Wissen Sie, dass Sie Ähnlichkeit haben mit meinem Vater?“
Jochen Gollmann blickte erstaunt auf. „Ich kenne ihn nicht, leider“, sagte er bedauernd.
„Ich eben auch nicht. Das ist mein Problem.“
Wonach ihn jetzt fragen? Am besten nach gar nichts, warten, ihn kommen lassen. Wenn er reden will, gut, wenn er noch nicht so weit ist, ihm Zeit lassen. Vielen Dank, Ellinor. Jochen Gollmann atmete erleichtert auf. Hatte er den Punkt gefunden, von dem aus er diesen Jungen begreifen konnte und ihm helfen? Vielleicht ist es das beste, wenn man ihn überhaupt noch nicht reden lässt, sondern erst den Ansatzpunkt von Vertrautsein zu einer etwas gefestigteren Plattform macht. Deshalb fragte er: „Wie sieht es eigentlich zu Hause aus? Ich war lange nicht in Plauen.“
Bernd lehnte sich in seinem Stuhl zurück. Ja, wie sieht es aus zu Hause? Meint er die Stadt? Er sah das Werk vor sich, wo er am letzten Tag seines Urlaubs gewesen war, er trank Wein mit der Mutter und fuhr nach Leningrad mit Margot. Der Film lief in umgekehrter Reihenfolge stumm und schnell ab. Vielleicht geschah das zur selben Zeit, als die Klingelanlage aufschrillte.
Alarm!
Das Schiff dröhnte.
Alle Mann auf Gefechtsstation!
„Beeil dich!“
Bernd verließ schnell die Kammer, das Schott schlug hart zurück. Gollmann hastete den Niedergang hoch.
Trotz des dichten Nebels erkannte er das andere Schiff. Sorowski rannte die Steuerbordseite entlang, warf den Fender aus. Ein scharfer Ruck. Sie wurden nach vorn gerissen.
„Sorowski!“
Bremsen quietschen. „Idiot!“, ruft Ammer, dann rollt der Wagen langsam aus. Ein großer LKW, Hamburger Kennzeichen, dröhnt an ihnen vorbei.
„Was ist los?“, fragt Gollmann wie jemand, der plötzlich aus dem Schlaf gerissen wird.
„Er hätte mir fast die Backbordseite aufgerissen!“
Der Offizier muss lächeln. Ammer betrachtet seinen Wagen als Schiff. „Na, wenn man schon nicht auf einen Dampfer kommt und diese Uniform trägt“, sagt er.
„Rauchen wir eine.“ Gollmann bietet dem Fahrer von seinen Zigaretten an. Der Wagen steht.
„Rauchen wir eine“, antwortet Ammer. „Kann nicht schaden auf den Schreck.“
Sie sitzen ruhig im Auto. Der Regen hat nachgelassen. „Ich glaube, das wird man nicht so schnell los. Das verfolgt einen bis in die Träume“, sagt Ammer.
„Was?“, fragt Gollmann.
„Sie haben ,Sorowski‘ gerufen, als ich auf die Bremse trat.“
Er war also doch eingeschlafen. „Gibt es hier in der Nähe Kaffee?“
Ammer nickt. „Halbe Stunde von hier ist eine Raststätte. Wollen wir?“
„Einverstanden!“, sagt Gollmann. „Aber rauchen Sie ruhig erst zu Ende.“
So sitzen sie eine Weile, jeder mit seinen Gedanken beschäftigt. Dann fragt Ammer: „Wie war er eigentlich?“ Jochen Gollmann überlegt, denn bisher haben sie davon nicht miteinander gesprochen. Was sagt man? Wie könnte man in wenigen Worten erzählen, was er heute über Bernd Sorowski weiß. „Er war“, sagt er, „er war ein guter Genosse.“
„,Das sagt man hinterher meistens“, entgegnet Ammer. Gollmann blickt ihn an. Er will ihn zurechtweisen. Was soll dieser Ton? Früher, vor wenigen Tagen, als er alles noch nicht wusste, hätte er sich die Antwort verbeten. Jetzt sieht er nur schnell hoch und sagt dann leise: „Wissen Sie, Genosse Ammer, hinterher weiß man auch mehr.“ Es ist eine nichtssagende Antwort, aber der Matrose versteht ihn.
„Kann sein, hinterher ist man immer schlauer. Aber in solch einem Fall ist das schlimm. Für Sie, meine ich.“ Er startet. Sie fahren wieder.
Dieser Obermatrose verblüfft den Offizier mit seiner Direktheit. Er redet, was er denkt. Und er denkt unkompliziert. Er kommt auf das Einfachste zuerst: die Wahrheit. „Was sind Sie eigentlich von Beruf?“
„Kfz.-Schlosser. In ’ner ziemlich großen Bude. Berlin. Vater ist auch dort. Mutter macht sauber, Parkettkosmetikerin.“ Er lacht. „Klasse Frau, sage ich Ihnen!“
„Haben Sie Abitur?“, fragt Gollmann.
„Nee. Muss ich das? Hat doch heutzutage jeder. Vielleicht kommt das noch bei mir. Masern kriegte ich auch später. Wird ja ’ne Menge qualifiziert bei uns. - Warum?“ Er dreht den Kopf kaum zur Seite.
„Nur so“, sagt Gollmann. Es ist nicht die Wahrheit. „Sie fragen ziemlich genau“, gibt er zu.
„Das lernt man bei uns. Da wird kein Schmus gemacht in der Bude. Sollen Sie mal erleben, Brigadeversammlung. Wer da um eine Sache herumredet, den haben sie schnell auf dem Kieker. Der sieht bald steinalt aus.“
Ja, er hat recht, hinterher redet man meistens so. Hinterher ist man immer schlauer. Wenn dies alles nicht geschehen wäre, wie hätte er dann auf die Frage nach Bernd Sorowski geantwortet? Hätte er gesagt wie eben jetzt: Er war ein guter Genosse. Nein, nicht. Vielleicht als Abschluss, nach einer Reihe Einschränkungen, die die Schlussbemerkung infrage stellen: Im Großen und Ganzen würde ich sagen, er ist ein recht guter Genosse. Drumherum reden, Schmus machen, wie Ammer sagt. Sein bisschen Wissen über einen Menschen hinter allgemeinen Wendungen verbergen, damit es nach etwas aussieht. Und nicht klar sagen wie jetzt, danach: Er war ein guter Genosse!
Es kann uns nichts Schlimmeres passieren, als in Phrasen über einen Menschen reden, einen Genossen an unserer Seite. Ausgesuchte Worte, vorgegebene Begriffe: positive Einstellung zu Partei und Regierung, befriedigende Dienstausführung, gutes Verhalten im sozialistischen Kollektiv, Interesse an Kultur und Sport, gesellschaftlich tätig. So allgemein könnte man über viele urteilen. Auch über Blankschön.
Gollmann erinnert sich seines einstigen Schulfreundes. Eckehard Blankschön hatte einmal einen Aufsatz geschrieben, der war mit Zitaten gespickt. Alle erfunden. Und Blecher hatte gewagt, die Echtheit anzuzweifeln.
„Herr Blecher, es verwundert mich, dass Ihnen dieses bekannte Zitat des Ersten Sekretärs des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands nicht geläufig ist.“
„Blechmax“ hatte nervös an seiner Brille gerückt. „Ja, ja, natürlich. Es war mir nur eben nicht parat. Selbstverständlich, Eckehard. Ich erinnere mich wieder.“
Sie alle kannten diesen aalglatten Blankschön. Er hätte es fertiggebracht, alle möglichen Parteidokumente durchzustöbern, bis er auf ein sinngemäßes Zitat gestoßen wäre.
Sie hatten damals gefeixt. Es war niederträchtig gewesen von ihnen, mitzumachen. Aber Blankschön beherrschte die Klasse.
In der Stunde nach Blecher hatten sie Russisch bei Albert Putz. Er sah nicht auf, als er in die Klasse trat. Er setzte sich hinter den Tisch. Dann blickte er sie an, schweigend, mit zusammengekniffenem Mund, blass vor Ärger. Jeden einzelnen blickte er an. Gleich würde es einen Krach geben, wie er ihn lange nicht gemacht hatte. Keiner wusste, was vorgefallen sein sollte. In die angespannte Ruhe dröhnte seine Stimme: „Dass ihr euch nicht schämt, Leute. Ihr habt es doch alle gewusst. Und ihr macht das mit. Einer wie der andere macht das mit.“ Seine Stimme wurde schärfer, aber kaum lauter. „Ihr wisst genau, dass Blecher ein guter Fachlehrer ist. Aber zu anständig für manchen. Blankschön!“
Eckehard Blankschön stand auf, betont nachlässig. Er fühlte sich sehr überlegen.
„Sie sind ein Strolch!“
Die Klasse hielt den Atem an. So etwas war hier noch nie gesagt worden. Und schon gar nicht zu Blankschön, der seinem alten Herrn nur ein Wort zu stecken brauchte, und Direktor Lischer lief vor Eifer über. „Blankschön, Sie sind ein Strolch!“
„Würden Sie bitte, Herr Putz, Ihre Beschuldigung wiederholen und begründen, hier vor meiner Klasse, in deren Gegenwart Sie mich eben beleidigten?“ Es lag wieder dieses impertinente Grinsen auf seinen Lippen: Dir werd ich’s zeigen!
„Ich wusste nicht, dass das Ihre Klasse ist. Man hat mir gesagt, ich wäre hier der Klassenleiter. Aber wie mir scheint, ist das überhaupt Ihre schwache Stelle, Blankschön: die Klassenfrage.“
Das musste einen Mann wie Albert Putz zutiefst kränken. Da lacht einer über uns. Einer, der noch gar nichts ist und kein Verdienst hat und den mancher nur erträgt, weil er der Sohn des bekannten Professors ist. „Glauben Sie nicht, Blankschön, dass ich Ihnen in den Arsch krieche, um ins Herz Ihres ehrenwerten Herrn Vaters zu gelangen. Leisten Sie erst einmal etwas, ehe Sie es sich leisten können, mit uns zu lachen über unsere Schwächen. Verwechseln Sie sich nicht mit Ihrem Vater!“
Blankschön hatte seinem alten Herrn nichts gesagt. Er ging zu Blecher und bat, den Aufsatz noch einmal schreiben zu dürfen. Gollmann war geneigt zu glauben, es sei bloße Berechnung gewesen. Aber das war ungerecht. Wenn Eckehard Blankschön immer so behandelt worden wäre und von allen wie von Albert Putz, er hätte schon damals anders werden können. Mag sein, dass er dies, wenigstens vorübergehend, begriff.
Blankschön war Gollmann immer ein Stück voraus. Was ihn Anstrengung kostete und Ehrgeiz, schaffte jener wie nebenbei. Griechisch zum Beispiel. Er hätte nie in eine altphilologische Klasse gehen sollen, aber damals wollte er noch Mutter zuliebe Medizin studieren. Griechisch ist eine schöne Sprache, klangvoll, musikalisch. Doch während er sich die Vokabeln einpauken musste, die verwirrende Grammatik und die vielen Unregelmäßigkeiten, klangen aus seinem Mund Homers Strophen wie Knüppelverse neben Blankschöns flüssigen Hexametern.
Ihm half nicht das Wissen, dass Blankschöns Vater der bekannte Professor war, dessen Sohn in einer musischen Welt aufwuchs, und er, Sohn einer Trümmerfrau, in Ruinen gespielt hatte, während jener durch den Garten der Villa jagen konnte als Chingachgook. Sein Zorn war Hass und Liebe zugleich. Er beneidete Blankschön um dessen Sicherheit und hasste ihn seiner aufdringlichen Selbstverständlichkeit wegen.
Freilich, das liegt Jahre zurück, viele Jahre. Und die nach ihnen gekommen sind, wie Bernd Sorowski zum Beispiel, die verstehen sie in manchem nicht mehr. Es ist eine andere Generation, die nach dem Krieg Geborenen. Eine freiere, deswegen nicht unbeschwertere, aber eine, die an solcher Vergangenheit, wie sie Bewusstsein ihrer Jugend war, nicht mehr zu tragen hat. Im Krieg geboren, im Nachkrieg zur Schule gekommen, denken gelernt in den Jahren des schweren Anfangs, mit all seinen Irrtümern beladen und Wirrnissen, aber reich geworden durch den Beginn einer neuen Welt, das hat sie geformt, das sind ihre Erfahrungen.
Bloße Erfahrung aber ist noch kein Wissen. Doch die Summe vieler Erfahrungen kann die Qualität einer Erkenntnis ausmachen. Und insofern, scheint es Gollmann, haben wir die Gewohnheit angenommen, uns auf der Basis solchen Wissens weiterzuentwickeln. Gewohnheit, das wäre dann, in diesem Wissen wohnen, zu Hause sein hier in unserem Land.
Das ist Sophismus, hätte Blankschön nachsichtig lächelnd gesagt. Und wie hätte Bernd Sorowski geantwortet?
Gollmann verfällt wieder in den alten Fehler. Er hat ein starres Bild von Blankschön gehabt, das mit dem Zitaten-Aufsatz. Und er benutzt dieses Bild, das nicht mehr in sein Schema passt, wider besseres Wissen immer noch. Er ist auch jetzt, nach diesem Zusammentreffen mit dem ehemaligen Schulfreund, nicht völlig sicher, wes Geistes Kind Dr. Blankschön wirklich ist. Da ist noch zu viel Fremdheit zwischen ihnen und manche Geschichte. Der Aufsatz, ja, diese Erinnerung wieder. Aber vor allem jenes Zerwürfnis wegen Ellinor. Für ihn hat sich Blankschön kaum weiterentwickelt. Falsch, Genosse, er hat dir eine Lektion erteilt, auf die du vorbereitet gewesen wärst, wenn du auf deine Frau gehört hättest.
Jochen Gollmann versucht, auch dieses Erlebnis einzuordnen. Und da er den unbedingten Willen hat, ehrlich zu sein gegen sich, drängt er den Gedanken an jenen Aufsatz zurück, denn nicht das war der Grund, weshalb sie sich getrennt hatten. Der Grund hieß Ellinor.
Sie hatten das Abitur in der Tasche. Ein Sommer lag vor ihm, sein großer Sommer mit Ellinor. Das wusste er noch nicht. Im September begann das Studium; Blankschön stud. med., Jochen Gollmann zur Armee, Offiziersschule Stralsund. Sie schlenderten die Bahnhofstraße hoch ohne besonderes Ziel. Was gibt’s denn im Kino? Keine Ahnung! Na, könn’n ja mal sehen. Er weiß nicht mehr, was es gab. Von diesem Sommer weiß er nur eins: Ellinor.
Das Mädchen saß in der Milchbar. Sie hatten noch Zeit bis zum Film.
„Genehmigen wir uns einen!“, sagte Blankschön.
„Genehmigen wir uns einen.“
Ellinor saß in der Nähe des Fensters. Blankschön schnalzte mit der Zunge, machte einen Kratzfuß vor ihr, sie lachte und wies auf die freien Plätze. Blankschön gab Jochen Geld. „Hol mal drei Kognak!“ Jochen hätte ihn umbringen können - und holte den Kognak.
Ellinor ging in die 11. Klasse. Ihre Eltern, Schauspieler beide, waren letztes Jahr an das Plauener Theater gekommen, und Ellinor fiel den Jungen sofort auf. Sie bewegte sich mit der freundlichen Gelassenheit einer großen Dame. Wenn sie über den Schulhof ging, starrten sie ihr nach wie einer überirdischen Erscheinung. Ihr langes dunkles Haar hatte sie zu einem Knoten gebunden. Mit ihren strahlenden Augen blickte sie die Jungs an, und um ihren Mund war immer ein leichter Spott. Sie wusste um ihre Wirkung auf die unfertigen Männer. Das amüsierte sie wohl. Die Lehrer sahen sie gern. Nur die Lehrerinnen mochten sie nicht. Vom ersten Tag an liebte Gollmann Ellinor. Es war eine unglückliche Liebe; denn er bildete sich nichts ein. Über so einen wie mich wird sie nicht einmal nachdenken. Blankschön machte ihr den Hof.
Bei Mädchen hatte Jochen Gollmann wenig Erfolg. Spielerei lag ihm nicht. Aus Furcht, sie mit den dummen Gedanken zu langweilen, die aufrechtes Gefühl ihm eingaben, redete er allen möglichen Unsinn daher, ungereimtes Zeug, oder tat gelehrsam. Die Mädchen wollten aber nicht belehrt werden, sondern geküsst.
Er war ein ziemlicher Trottel, und Blankschön zog ihn häufig damit auf. Wenn der von Mädchen redete, von den Weibern, wie sie in die Knie sanken, wenn er sie zu fassen kriegte, wenn er mit seinen Erfolgen prahlte wie ein gelangweilter Lebemann, fehlte es Gollmann immer an Kraft, ihm seine Verlogenheit und Verlorenheit vorzuhalten, weil er in seinen geheimsten Träumen hoffte, dass ein Mädchen auch einmal in seinen Armen vor Glück weinen möchte.
Bei Ellinor war das alles anders. Wenn sie mit ihm gegangen wäre, hätte er nicht von Sternbildern, Raumfahrt und Politik geredet. Er hatte ihr zärtliche Namen gegeben in Gedanken, er hatte sie geküsst, hatte ihre Brüste berührt und die Wärme ihres glatthäutigen Körpers gespürt, noch ehe ihr Sommer kam. Er liebte sie.
Wie ein Traumwandler war er an ihren Tisch gekommen, hatte das Gesicht zu einem schiefen Grinsen verzogen über Blankschöns Kratzfuß und war, erbittert über seine eigene Ungeschicklichkeit, gegangen, um die drei Kognak zu holen von Blankschöns Geld. Als er sie brachte, saßen die beiden und plauderten längst wie Vertraute.
„Seid ihr froh, was, dass ihr euer Abi geschafft habt? Wie ist es denn ausgefallen?“
„Je nun“, sagte Blankschön gelangweilt, „sie werden nicht umhin können, mir die Lessingmedaille anzuheften.“
„Und du?“, fragte Ellinor. Es war das erste Mal, dass sie Jochen direkt ansprach.
Das Blut stieg ihm ins Gesicht. „Gut“, sagte er mit kratziger Stimme. „Sehr gut, Mutter hat sich gefreut.“
„Er ist nämlich ein folgsames Kind“, stichelte Blankschön.
Da sagte Ellinor: „Das ist schön. Ich freu mich für dich, Jochen.“
Das war sein erster Sieg über Blankschön. Er machte ihn unendlich glücklich, weil er so unerwartet kam und weil es Ellinor war, die das sagte.
Blankschön biss die Zähne aufeinander, seine Augen bekamen ein kaltes Licht. Er hatte die Ohrfeige gespürt. „Auf dem Mist krankhaften Ehrgeizes wachsen oft die buntesten Blumen“, sagte er gehässig. Zu unterliegen hatte er nicht gelernt.
„Wenn du nicht Blankschön hießest, hätte man den Namen für dich erfinden müssen. Du bist ein gut aussehender Affe.“ In Ellinors Stimme schwang der gelassene Hohn einer Königin, wie sie sie später auf der Bühne spielen sollte. Und mit unverhohlener Herzlichkeit sagte sie: „Komm, Jochen, wir wollten doch ins Kino gehen. Die Karten habe ich schon geholt.“
Der Kognak blieb stehen, Blankschön blieb sitzen. Ellinors Freundin war nicht gekommen, deshalb die zweite Kinokarte. Blankschön hatte ihm diese Niederlage lange nicht verziehen.
Obwohl Jochen Gollmann bereits vor zehn Jahren sein Abitur gemacht hat, besucht er in jedem Urlaub Albert Putz. Sie mochten sich eigentlich vom ersten Tage an. Er kann heute noch nicht genau sagen, woran das lag. Sie mochten sich eben.
Jochen Gollmann unterschied sich da ziemlich von seinen Klassenkameraden. Die nannten ihn den albernen Putz, wenn er unerbittlich gegen die Missachtung der russischen Sprache wetterte. „Scharkow! Sagen Sie Bordeaux oder Bordoh? Wir Deutschen müssen Bordoh sagen wie die Franzosen, möglichst noch französischer; und aus dem wohlklingenden russischen Charkoff machen wir ein verächtliches Scharkow.“ Oder sie nannten ihn den putzigen Albert, wenn er am Montagmorgen zur ersten Stunde in die Klasse kam, mit gewohnter Perfektion seine Tasche auf den Lehrertisch schmiss, sich auf seinen Stuhl klemmte und sagte: „Mensch, hab’ ich wieder schwere Wolken um die Antenne!“
Vielleicht war er wirklich kein guter Lehrer. Oder so: Er war kein Lehrer, wie richtige Lehrer sein müssen. Aber Jochen Gollmann mochte ihn.
Albert Putz war nicht mehr stellvertretender Schuldirektor, und Herr Lischer, der ihn gern behalten hätte, auch als Schild gegen etwaige Verdächtigungen, war abgelöst worden. Es gab allerdings für die Entscheidung des Schulrats zwei völlig verschiedene Gründe. Lischer war ein Dogmatiker. Seine stramme Vergangenheit hatte er mit strammer Haltung verdecken wollen. Und er war bitter enttäuscht, als ihm das auf die Dauer nicht gelang. - Albert Putz aber war kein richtiger Lehrer, wie der Schulrat meinte, dass ein Lehrer sein müsse. Vielleicht hatte er recht. Aber Jochen Gollmann mochte ihn. Sie waren inzwischen Freunde geworden.
Er klingelte. Putz öffnete die Tür. „Mensch, Jochen! Hast du Sonderurlaub bekommen, um mir altem Pauker zu gratulieren? Los, komm ’rein, ich habe einen herrlichen Wodka!“
Er war ausgezeichnet worden mit einem hohen Orden. Es stand in der Zeitung, die auf dem Schreibtisch lag, mit Bild. Wahrscheinlich hatte er es den ganzen Tag betrachtet voll ehrlicher Freude. „Meine Fresse in der Zeitung! Dabei tut man nur, was man kann. Nee, wen die auch alles dekorieren.“
An solch einem Tag konnte Jochen Gollmann ihm nicht mit seiner Frage kommen. Er gratulierte herzlich. „Albert, wenn einer diesen Orden verdient hat, dann du.“
„Ja“, sagte Putz ohne Eitelkeit, „ich hab’s verdient. Na sdorowje!“ Und sie tranken von dem guten Wodka.
Er musste Putz von sich erzählen. Doch es gelang ihm nicht, unbefangen zu erscheinen - Putz hörte ihm eine Weile zu, dann sagte er: „Was ist los mit dir? Warum kommst du wirklich?“
Es hatte keinen Sinn, um die Sache herumzureden. Jochen Gollmann fragte: „Kannst du dich noch an Bernd Sorowski erinnern?“
„Klar. Abitur achtundsechzig. Feiner Bengel.“
„Er ist tot.“
„Was?“ Albert Putz fuhr auf. „Wie kann er denn tot sein?“ Gollmann erzählte, was geschehen war. Albert Putz hörte zu, ohne ihn zu unterbrechen. Als Jochen geendet hatte, schwieg er. Dann sagte er: „Ich glaube, an deiner Stelle hätte ich diesen gottverfluchten NATO-Hai auf Grund geschickt mit allen Rohren, die mein Schiff besitzt.“
Jochen nickte. Trotzdem hätte Putz nicht anders gehandelt als er. Aber er verstand ihn, wie er die Verzweiflung seines Ari-Gasten begriffen hatte, der tatsächlich zum Geschütz gerannt war und beinahe geschossen hätte.
„Die Raststätte, Genosse Kapitänleutnant“, sagt Ammer. Er steuert den Wagen auf den Parkplatz. Auch der Hamburger von vorhin ist hier. Der Fahrer steigt soeben aus und geht auf das Lokal zu. Sie schließen die Türen ab, um ihren Kaffee zu trinken.
„Was essen würde ich auch ganz gern“, sagt Ammer. „Die hatten noch nichts Vernünftiges in der Kombüse.“ Um diese Zeit ist nicht viel los in der Raststätte. Die meisten Stühle sind leer, und an den anderen sitzen nur wenige Gäste. Sie nehmen in einer Ecke Platz, von der aus der Raum gut zu übersehen ist. Am Nebentisch sitzt der Hamburger. Ammer will etwas sagen wegen des verrückten Überholens, aber Gollmann hält ihn zurück.
Singend geht der Kellner durch den Raum, nimmt die Bestellungen auf, macht irgendwelche Witze dabei, serviert.
Der Kellner erzählt eine Menge fröhlicher Sachen. Ein Mädchen lacht. Es ist ein heiteres Glucksen. Gollmann sieht zu ihr hinüber. Sie blickt zu ihm. Hat sie mit den Augen gezwinkert?
Der Kellner erzählt: „In einer Woche ist Urlaub. Haha, Rentner musst du sein. Warum? In einer Woche geht’s nach Hamburg!“ Er singt etwas von der Reeperbahn nachts um halb eins.
Der Fahrer am Nebentisch verzehrt ungerührt sein Frühstück.
„Und wissen Sie, was ich in Hamburg mache? Nee, nicht, was Sie denken! Ich werd’ mir doch nischt wegholen auf der Reeperbahn. Ich mein’, keinen Herzinfarkt bei den Mädchen. Dafür ist man eben Rentner. Das ist was für die Jungen!“ Und er blickt auffällig zu dem Hamburger. „Ja, früher. Ich meine, es wäre natürlich ein schöner Tod, so was. Nee, ich geh’ zu einem Juwelier und lass’ mir Gold zeigen, pures Gold, Goldbarren! Kaufen kann ich natürlich nischt! Bin ich Onassis? Aber ansehen, Goldbarren ansehen! Das versuchen Sie mal in der HO!“
Da sitzt so ein fischiges Frauenzimmer mit einem unangenehmen Alten drei Tische weiter. Er könnte ihr Vater sein. Aber man sieht ja, was mit den beiden los ist. Als der Kellner von dem schönen Tod gesprochen hat, hat sie gegrinst. Das mit den Goldbarren erheitert auch ihn. Gegen diese findet Gollmann den spleenigen Kellner direkt sympathisch. Sie gaffen zu ihm herüber, tuscheln, dann lacht sie schrill und läuft puterrot an im Gesicht vor feistem Gaudi.
Gollmann blickt zu dem Mädchen, deren fröhliches Lachen ihm vorhin aufgefallen ist. Sie schaut ihn an und macht eine Bewegung zu den beiden, die wohl heißen soll: Was erwartest du von denen?
Der Kellner ist jetzt am Nebentisch. Er redet und tiriliert seine ganze alberne Begeisterung auf den Fahrer nieder und steigert sich in seinem Loblied auf die freie Stadt.
„Scheiß Hamburg!“, sagt der Fahrer, zahlt genau und geht schweren Schrittes aus dem Raum. Seine Pause ist um. Zeit ist Geld.
Der Kellner guckt ihm verdutzt nach. Ammer verzeiht dem Kumpel das rücksichtslose Fahren. Die zwei Unangenehmen sind empört. Wie kann einer sein eigenes Nest beschmutzen? Und tun es selber täglich. Das Mädchen aber lacht sein fröhliches Glucksen.
Ammer bestellt ein umfangreiches Frühstück, der Offizier einen Kaffee. Der Kellner notiert. Er ist ziemlich still geworden, weil ihm der Hamburger die Schau gestohlen hat.
Da sieht Jochen Gollmann, wie das junge Mädchen ihren Kaffee nimmt und die Reisetasche. Sie kommt genau auf seinen Platz zu. „Darf ich?“, fragt sie, und die Tasse steht schon auf dem Tisch. Ehe Gollmann „bitte“ sagen kann, sitzt sie bereits.
„Da drüben ist schlechte Luft“, sagt sie laut.
Plötzlich ist ihm, als habe er unter einem Druck gestanden, wie Kopfschmerzen vielleicht, die mit einem Mal verflogen sind. Dieses Mädchen hat sich als Verbündete erwiesen.
„Ich muss nach Rostock. Und Sie?“
„Wir müssen auch nach Rostock“, sagt er. „Wann fahren Sie denn?“
„Das kommt darauf an“, sagt sie.
„Worauf?“, fragt er und hat noch nichts begriffen.
„Das kommt darauf an, ob Sie mich mitnehmen oder ein anderer.“
Ammer grinst.
„Das geht leider nicht“, sagt Gollmann steif. Der Druck ist wieder da. „Es ist kein Privatwagen. Wir sind dienstlich unterwegs.“
„Dienst ist Dienst“, sagt sie, „und Schnaps ist Schnaps.“ Es ist ungerecht von ihm, dass er sie jetzt anfährt, aber mit einem Mal ist alles wieder gegenwärtig, was vergessen schien, wegen ihres fröhlichen Lachens. „Was glauben Sie denn, wie mir nach unpassenden Witzen zumute ist? Ich lechze geradezu danach!“
Sie erschrickt. Ammer blickt ihn abschätzend an. Was bildet der sich ein, denkt Gollmann. Er weiß genauso gut wie ich, dass es nicht erlaubt ist, Zivilpersonen im Dienstfahrzeug mitzunehmen. Gollmann sieht aber auch die Enttäuschung auf dem Gesicht des Mädchens. Sie versucht, sich mit einer List zu retten.
„Dann fahre ich eben mit denen mit!“, sagt sie und zeigt auf die Unangenehmen. „Wahrscheinlich setzt er sie bei nächster Gelegenheit ab, um mit mir allein zu sein. Und dabei wäre es Ihre Pflicht, mich zu beschützen.“
„Wieso?“, fragt Gollmann.
„Ich heiße Irene“, antwortet sie. „Und Irene heißt: der Frieden.“ Dann lächelt sie vorsichtig, weil sie noch nicht weiß, ob sie Erfolg haben wird. „Nehmen Sie mich mit, bitte. Ein Stück nur, ja?“
Sie gefällt ihm. Es ist jetzt nicht das angenehme Lachen, sondern ihre Stimme. Doch es geht nicht.
Mit Ammer hat sich Irene schon irgendwie geeinigt, denn er meint: „Ein Stück kann man’s ja versuchen, Genosse Kapitänleutnant. Sie muss bloß auf Tauchstation gehen, wenn Gefahr droht. Ich denk mir, Rostock ist ein Ende weg von hier. Und wenn sie wirklich sonst mit denen fahren müsste, das kann man ihr rechtens nicht antun.“ Er deutet mit dem Kopf auf die Unangenehmen.
„Ich werde Ihnen auch eine Menge lustiger Geschichten erzählen, damit Ihnen die Fahrt nicht zu lang wird und Sie Ihren Dienstauftrag vergessen können“, sagt sie.
Gollmann erschrickt. Wenn sie nun wirklich die ganze Zeit bis Rostock ihre unbekümmerten Geschichten plappert, damit er seinen Dienstauftrag vergessen soll?
Er sieht plötzlich Inge Sorowski vor sich. „Ihr Sohn ist tot, Frau Sorowski. In Ausübung seines Dienstes wurde er das Opfer einer heimtückischen Provokation.“
Die Frau hatte kein Wort gesagt, die ganze Zeit nicht. Sie schwieg, als man sie nach Hause brachte. Ihre Augen brannten vor Trockenheit. Eugen Schnitt, der alle Farbe verloren hatte aus dem Gesicht, stützte sie und hätte der Stütze selber bedurft.
Sie brachten sie in die Wohnung. Inge Sorowski setzte sich an den Tisch. Sie nahm ein Bild von dem kleinen Schrank. Matrose Bernd Sorowski lacht. Sie stellte es vor sich hin und fragte leise: „Warum ist er denn tot?“
Das vergisst man nicht, Irene. Und je lustiger deine Geschichten sind, die du uns erzählen willst, desto heftiger würde ich an die Frau denken müssen, die Mutter von Bernd Sorowski.
Ammer hat sein umfangreiches Frühstück verzehrt. Der Kaffee ist getrunken. Jochen Gollmann winkt dem Kellner. Kleinlaut kommt er eilfertig an ihren Tisch. „Ich möchte zahlen.“
„Zusammen?“
„Ja“, sagt er, „alles zusammen.“
Irene legt ihre Hand auf seinen Arm. „Bitte, ich möchte meinen Kaffee selbst bezahlen.“
„Ach was!“, entgegnet er. „Ich hab’ Sie eingeladen. Die Spesen reichen für Ihren Kaffee mit.“ Das ist ein dummer Satz, für den er sich schämt. Und er ist froh, dass sie darauf besteht, selbst zu bezahlen.
Ammer lächelt sauer. Ellinor würde sagen: ein maliziöses Lächeln. Er hat ihm das mit den Spesen übel genommen. Vielleicht denkt er jetzt: Der ist schneller zu trösten, als er vorgibt.
„Es tut mir leid“, erklärt Jochen Gollmann, „aber wir können Sie wirklich nicht mitnehmen, Irene. Es ist auch nicht nur, weil es dafür klare Befehle gibt. Warum fahren Sie nicht mit dem Zug?“
Bei dem ist also nichts zu machen. Schade, hätte so fein gepasst. „Mit dem Auto ist es lustiger.“ Sie setzt hinzu: „Und billiger.“
Ammer hätte sie zu gern mitgenommen, das sieht man ihm an. Aber er scheint die Entscheidung des Offiziers begriffen zu haben. Es ist nicht nur der Befehl.
Sie fahren wieder. Und auch jetzt wird kaum gesprochen. In Gollmanns Erinnerung drängen sich die Bilder der vergangenen Tage, die er sieht und noch nicht zu einem Ganzen fügen kann. Ihm ist, als ob er durch eine Gardine blickt.Was er wahrnimmt, sind nur Schatten. Doch er will wissen, was wirklich ist in dem Zimmer. Er muss die Zusammenhänge begreifen. Die Gardine hängt hinter den Scheiben, hinter der gläsernen Wand seiner Erfahrungen. Alles geschieht lautlos. Er hört nichts. Er muss das Fenster aufstoßen.