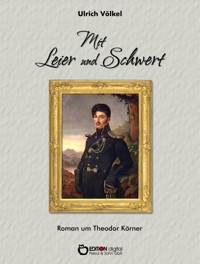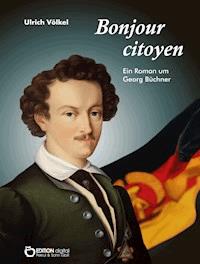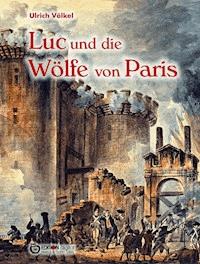
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
„Aux armes!“ Zu den Waffen! hallt es durch Paris. Der König hat den Finanzminister Necker entlassen, von dem die Franzosen geglaubt hatten, er werde mit der Verschwendungssucht des Hofes und der Misswirtschaft im Lande fertig. Von Luc erfahren die Pariser, wo das Pulver für ihre Gewehre zu holen ist. „Auf zur Bastille!“ Am 14. Juli 1789 wird dieses Symbol der verhassten Despotie gestürmt. Die Große Französische Revolution hat begonnen. INHALT: Der Bäcker in der Rue St. Antoine Vierzehn Sous Ein Mord In der Falle Wo ist Luc? Die Wölfe Luc lernt stehlen Die Bestien von Bercy Margarete Palais Royal Sonntag, 12. Juli 1789 Das erste Gefecht Gaston und der Advokat Luc kehrt zurück Vor dem Sturm Robert Das Wiedersehen Sturm auf die Bastille Der Trommler der Revolution Der Verräter Der Angriff Das Ende des Vicomte Das Ende des Verräters Zum Schluss
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 176
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Impressum
Ulrich Völkel
Luc und die Wölfe von Paris
Erzählung
ISBN 978-3-95655-536-7 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien erstmals 1989 in Der Kinderbuchverlag Berlin.
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2015 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
Der Bäcker in der Rue St. Antoine
Luc war ein Bursche von vierzehn Jahren. Er lebte in Paris. Seinem Vater gehörte die Bäckerei in der Rue St. Antoine, unweit der drohend aufragenden Bastille, der gefürchteten Festung inmitten der Stadt. Lucs Mutter lebte nicht mehr. Sie war kurz nach seiner Geburt verstorben. Den Haushalt versorgte Margarete, eine Deutsche. Sie half auch in der Backstube, und sie stand hinterm Ladentisch. Obwohl sie schon mehrere Jahre in Frankreich lebte, hatte sie noch immer Mühe, einen französischen Satz fehlerfrei zu sprechen. Aber sie war fleißig und demütig, das wusste der Bäcker zu schätzen. Und sie war gut zu Luc; zu gut, wenn man seinen Vater fragte, der ein harter Mann war.
Luc war größer als die meisten Jungs seines Alters, aber blass und spitznäsig, weshalb er von den anderen gehänselt wurde. Sie nannten ihn Baguette, weil er aussah wie ein von seinem Vater gebackenes, dünnes, superlanges Weißbrot.
Aber Luc bekam diesen Spottnamen selten zu hören, denn er brachte die meiste Zeit in der Backstube zu. Sein strenger Vater war der Meinung, Luc könnte nicht früh genug das Bäckerhandwerk erlernen. Immer wieder sagte er: „Mir hat Arbeit auch nicht geschadet. Hätte mich mein Vater nicht rechtzeitig daran gewöhnt, wäre ich so ein armer Schlucker geblieben, wie es die sind, für die sich unsereiner die halbe Nacht um die Ohren schlagen muss.“ Und er sagte das mit solchem Nachdruck, als sei die Armut der Lohnarbeiter in Paris die Folge ihrer Faulheit.
Luc, der nie etwas anderes zu hören bekam von seinem Vater als solche Reden, glaubte ihm schon aus Angst; denn so arm sein, wie es die meisten Menschen in seinem Viertel waren, wollte er wahrhaftig nicht. Und er glaubte seinem Vater auch deshalb, weil er sich das Elend ringsum nicht anders hätte erklären können.
Was wusste ein Junge wie Luc im Paris des Jahres 1789 von der Verschwendungssucht des Königshauses, den unseligen Kriegen und der landesweiten Misswirtschaft, den wirklichen Ursachen des wuchernden Elends? Nichts konnte er wissen. Die Welt war so, wie sie war. Und sie war, wie sie Gott eingerichtet hatte. Das sagte der Pfarrer. Das sagte der Vater. Margarete hütete sich, etwas anderes zu erzählen, falls sie überhaupt eine Erklärung gewusst hätte. Und Gaston, der einstige Geselle, war nicht mehr da.
Wenn der Vater frühmorgens aufstand, hatte Margarete in der Backstube bereits Feuer gemacht, einen Gerstenkaffee aufgebrüht und den Laden ausgefegt. Früher hatte Luc geglaubt, die Erwachsenen schliefen nie; denn wenn er sich abends hinlegte, waren sie noch wach, um den Teig anzusetzen, und wenn er frühmorgens die Augen aufschlug, arbeiteten sie bereits seit drei Uhr in der Backstube oder im Laden.
Von seinem zwölften Lebensjahr an lernte Luc diesen Rhythmus aus eigener Erfahrung kennen, denn sein Geburtstagsgeschenk hatte darin bestanden, dass er von nun an mit seinem Vater aufstehen musste, um in der Backstube zu arbeiten wie ein Erwachsener.
An jenem denkwürdigen zwölften Geburtstag hatte der Bäcker seinen Gehilfen Gaston entlassen. Einen überflüssigen Esser könne er sich nicht leisten, hatte er gesagt. Luc wäre jetzt alt genug, meinte er, selbst sein Brot zu verdienen.
Der Junge hatte keine Vorstellung, wie arm oder reich sein Vater tatsächlich war. Er wusste nur, der träumte davon, eines Tages einen großen Laden in einem vornehmen Viertel zu besitzen, auf der linken Seite der Seine, wo die vermögenden Bürger von Paris lebten.
Des Vaters Traum war Lucs Hoffnung geworden. Erfüllte der sich, könnten sie gewiss Gaston wieder einstellen, und er, Luc, müsste nicht mehr mitten in der Nacht von seinem Strohsack aufstehen. Ganz tief in seinen geheimsten Wünschen hatte sich sogar die Vorstellung bei ihm eingenistet, dass er, wenn der Vater erst einmal reich wäre, auch wieder eine Mutter hätte, so eine wie seine verstorbene, von der er nicht einmal wusste, wie sie ausgesehen hatte. Er war aber ganz sicher, dass sie sehr schön gewesen sein müsste. Und zärtlich.
„Schlaf nicht ein!“, rief der Vater durch die Backstube. Er war gerade dabei, Mehl abzuwiegen.
Luc knetete den Brotteig. Das war eine schwere Arbeit, bei der er gehörig ins Schwitzen kam. Während ihm das Wasser am Körper herunterlief, musste er an Gaston denken, der am Tag zuvor in der Backstube gewesen war. Allerdings kam der einstige Gehilfe nur, wenn er sicher sein konnte, dass der Meister nicht im Hause war. Dann gab ihm Margarete etwas zu essen, und sie brühte ihm einen Gerstenkaffee auf. Der Bäcker durfte davon nichts wissen. Luc, der Gaston wie einen großen Bruder liebte, verriet ihn nicht, und erst recht nicht Margarete, deren Augen auf besondere Weise leuchteten, wenn Gaston zu ihr kam. Er hatte keine neue Anstellung gefunden. Er schlug sich mit Gelegenheitsarbeit in den Markthallen durch, dem Bauch von Paris, wie sie genannt wurden.
„Vater?“, fragte Luc.
„Was gibt es?“
Luc zögerte einen Moment, weil ihm plötzlich einfiel, die Frage könnte verraten, mit wem er darüber schon einmal gesprochen hatte, nämlich mit Gaston. Aber schließlich traute er sich doch. „Was ist eigentlich der dritte Stand?“
Der Bäcker blickte ebenso überrascht wie unwillig zu seinem Sohn hinüber, doch statt zu antworten, fragte er misstrauisch: „Woher hast du das, Bursche?“
„Ich weiß nicht genau“, wich Luc aus. „Die Leute reden davon. Ich glaube, ich habe es gehört, als ich gestern das Brot in den Laden hoch brachte. Es soll eine Flugschrift geben, ist gesagt worden, da stünde es.“
Tatsächlich kursierte seit Tagen eine solche Flugschrift, verfasst von einem gewissen Siéyès, die in Paris viel gelesen wurde und sehr viel Aufsehen erregt hatte. „Was ist der dritte Stand?“, lautete die Überschrift. Und darunter stand: „Alles. Was ist er bis jetzt gewesen? Nichts. Was verlangt er? Etwas zu werden.“
Der Bäcker hatte das Flugblatt gelesen und weggeworfen. Ihm missfiel, dass sein Sohn überhaupt danach fragte. „Knete den Teig“, fuhr er Luc an, „dann weißt du, was dein Stand ist!“
Gaston hatte gesagt, der dritte Stand seien alle Bürger Frankreichs, und die zählten an die fünfundzwanzig Millionen. Unter dieser Zahl konnte sich Luc nichts vorstellen. Gaston hatte ihm erklärt, der dritte Stand wäre der überwiegende Teil aller Franzosen. „Wir sind alles. Wir waren nichts. Wir verlangen etwas zu werden!“, hatte Gaston mit entschiedener Stimme den Text des Flugblattes wiederholt. Margarete hatte nur gelächelt und ihm Gerstenkaffee nachgeschenkt.
Der Bäcker prüfte mit einem Holzstäbchen, wie weit das Brot im Ofen war. Die Frage seines Sohnes hatte er schon wieder vergessen. Er nickte zufrieden, als kein Teig mehr am Holzstab haftete, und öffnete die Klappe mit einem schweren Gewicht, das an der Seite herabhing. Die Backhitze und der Duft frischen Brotes erfüllten den Raum. Mit einem flachen langen Holzschieber holte der Bäcker immer zehn Brote auf einmal heraus. Das musste schnell gehen.
Luc stand bereit und sortierte das heiße Brot in die Regale. Er musste Handschuhe dabei tragen, weil er sich sonst die Finger verbrannt hätte.
Als sie mit der Arbeit fertig waren, lief ihnen der Schweiß in Bächen am Körper herab. Der Vater nickte zufrieden. „Marguerite!“, rief er die Magd. Er sprach ihren Namen grundsätzlich französisch aus.
Im etwas höher gelegenen Verkaufsraum wurde eine Klappe geöffnet, durch die Margaretes Kopf zu sehen war. „Patron?“
„Das Brot kostet ab heute vierzehn Sous! Schreibe das auf die Tafel. Vierzehn Sous, verstanden?“
„Oui, Monsieur, quatorze sous“, sagte Margarete und schloss die Luke wieder. In einer halben Stunde musste sie den Laden öffnen.
Luc hatte seinen Vater nur erstaunt angesehen, als der den neuen Brotpreis bekannt gab, aber er hatte nichts dazu gesagt. Vierzehn Sous für einen Laib Brot, das war für die meisten Pariser fast unerschwinglich.
„Was glotzt du mich an?“, knurrte der Vater. „Mache ich die Mehlpreise? Oder willst du morgen einer von denen da draußen sein, he?“ Wütend warf er einen Teigbatzen auf den Tisch und bearbeitete ihn mit den Fäusten, als sei der für die galoppierende Teuerung verantwortlich.
Vierzehn Sous
Vor dem Laden standen bereits mehr als dreißig Frauen an. Sie waren früh gekommen, denn man wusste nie, wie weit das Brot reichen würde. Sie vertrieben sich die Zeit mit Erzählen und redeten, wie ihnen der Schnabel gewachsen war. Und die Pariserinnen waren bekannt dafür, dass sie kein Blatt vor den Mund nahmen. Eines ihrer Lieblingsthemen war die Königin. Nicht etwa, weil sie die besonders mochten. Sie hassten sie und sahen in ihr, der Fremden, die Wurzel allen Übels. Ludwig XVI. hatte sich eine Österreicherin zur Frau genommen. Marie-Antoinette aus dem Hause Habsburg.
Der König war einfältig und träge. Das verziehen sie ihm. Aber die Königin war boshaft und verschwenderisch. Sie spinne ihre Fäden und webe ihre Netze, in denen sich nicht nur der arme Ludwig verfangen habe, behaupteten die Frauen.
Die Königin, ging die Rede, halte einen Liebhaber aus, den Schweden Axel de Ferse. Die Pariserinnen tuschelten, wenn sie sich die neuesten Ausschweifungen und Eskapaden der Österreicherin ausmalten, als wären sie dabei gewesen.
Eine junge Frau zeigte auf die Buchstaben MACL, die über der Haustür der Bäckerei standen. „Wisst ihr, was das zu bedeuten hat?“, fragte sie keck.
Nun konnten zwar die meisten Frauen wie viele aus den armen Schichten des Volkes nicht lesen, aber was diese Abkürzung bedeutete, wussten sie: Maison assurée contre l’incendie, das Haus ist feuerversichert. Aber der herausfordernde Ton der jungen Frau ließ eine andere Deutung vermuten.
„Na, was schon?“, wurde sie von mehreren der umstehenden Frauen gefragt.
„Marie Antoinette cocufie Louis!“ Marie-Antoinette setzt Ludwig Hörner auf.
Der Witz war gut. Die Frauen lachten lauthals. Sie konnten sicher sein, dass ihnen in Paris kaum etwas geschehen würde, wenn sie derart spotteten. Paris gehörte den Parisern. Der König wohnte außerhalb der Stadt in einem protzigen Palast. Sollte er glücklich werden in seinem Versailles.
Doch plötzlich herrschte atemlose Stille. Margarete hatte die Preistafel aus dem Fenster entfernt. Das konnte nichts Gutes bedeuten. Niemand unter den Wartenden glaubte, das Brot sei über Nacht billiger geworden. Dreizehn einhalb Sous hatte es gestern gekostet. Das war schon für jene Frauen, deren Männer eine feste Arbeit hatten, kaum noch zu bezahlen. Um wie viel härter musste es die Arbeitslosen treffen.
Die Frauen warteten. Ihre eben noch fröhlichen Gesichter hatten sich sorgenvoll verfinstert. Eine, es war Colette, die den Witz auf die Königin erzählt hatte, sagte: „Wenn das Brot auch nur einen halben Sou teurer wird, schlage ich dem Bäcker das Fenster ein!“ Sie sprach nur aus, was die anderen dachten.
Margarete stellte das Schild wieder in die Auslage zurück. Nur ihr Arm war zu sehen. Schämte sie sich für die Geldgier ihres Patrons, oder fürchtete sie den Zorn der Frauen vor dem Laden, denen sie bald gegenüberstehen würde?
Zunächst geschah gar nichts. Die Preiserhöhung um einen halben Sou hatte den Frauen den Atem verschlagen. Colette starrte auf die Tafel, ohne eines Wortes fähig zu sein. Die am weitesten hinten standen, wurden zuerst unruhig, denn sie konnten nicht sehen, was das Brot ab heute kosten sollte, und sie wollten es nicht glauben, als sie den neuen Preis erfuhren. Eine rief sogar: „Damit macht man keine Witze, ihr da vorn!“
Colette stand an elfter Stelle. Sie hatte die vor ihr wartenden Frauen immer wieder gezählt, aus Sorge, es könne sich jemand unbemerkt dazwischenmogeln. Jetzt war sie es selbst, die die anderen beiseiteschob, bis sie sich direkt vor dem Schild befand. Es gab keinen Zweifel, das Brot war wieder einmal teurer geworden. Da drehte sie sich zu den Frauen um. Colette war nicht besonders groß, aber sie reckte sich und streckte beide Arme mit geballten Fäusten nach oben. Dann rief sie mit einer Stimme, als müsse sie ganz Paris wecken: „Vierzehn Sous! Das Brot kostet ab heute vierzehn Sous! Wer soll das noch bezahlen?“
„Schlagen wir ihm die Tür ein!“, rief eine Frau, die so weit hinten stand, dass das Brot wahrscheinlich gar nicht bis zu ihr gereicht hätte, und die allein deswegen schon in gereizter Stimmung war.
„Macht euch nicht unglücklich, Frauen!“, rief eine andere zur Vernunft. Sie war mit einem Möbeltischler verheiratet, das waren die besten Verdiener im ganzen Viertel. Vierzehn Sous bedeuteten auch für sie sehr viel Geld, aber sie konnte es noch aufbringen.
„Unglücklich?“, höhnte Colette zurück. „Als ob wir noch unglücklicher werden könnten!“
Der Laden blieb geschlossen. Margarete hatte den Lärm gehört und traute sich nicht, den Riegel zurückzustoßen. Doch dieses Zögern trug nicht zur Beruhigung der erregten Gemüter bei. Die Frauen hatten schließlich noch mehr zu tun, als nur nach dem überteuerten Brot anzustehen.
Die ersten trommelten mit ihren mageren Fäusten gegen die Tür der Bäckerei. Die Unruhe unter den Wartenden nahm zu. Das rief weitere Leute auf den Plan. Fenster in den Häusern der Rue Saint Antoine wurden geöffnet. Haustüren gingen auf, und Neugierige traten heraus.
Bald hatten sich vor der Bäckerei an die hundert Leute versammelt. Manche von ihnen wussten gar nicht, worum es eigentlich ging. Einige hatte einfach der Lärm angelockt, weil sie immer zur Stelle sein mussten, wenn ein Auflauf entstand. Und es gab auch welche, die waren herbeigeeilt, um die ohnehin gereizte Stimmung des Volkes anzuheizen und auszunutzen, denn sie meinten, die Pariser sollten sich endlich handfest wehren gegen die grassierende Not.
Am Ende ging es gar nicht mehr um den neuen Brotpreis. Das war nur der Anlass, die ohnehin schwelende Empörung zu heller Glut zu entfachen. Schließlich reimte jemand den Spruch: „Gebt uns Brot! Schlagt den Hunger tot!“
Die Masse geriet in Bewegung. Die hinten Stehenden drängten mit Macht nach vorn, sodass die ersten gegen die Tür gedrückt wurden. Diese wiederum trommelten und schlugen gegen die Ladentür nicht nur, um den Bäcker herauszurufen. Sie hatten auch Furcht, von der Menge erdrückt zu werden. Es gab nur den einen Ausweg: vorwärts.
Margarete hatte die immer lauter werdenden Rufe, die zunehmende Empörung, den aufzüngelnden Hass mit wachsender Angst verfolgt. Sie hätte in die Backstube laufen und den Patron rufen müssen. Aber es war, als sei sie hinter der Ladentür festgewachsen. Sie konnte sich nicht von der Stelle rühren.
Da flog der erste Stein. Als das Glas splitterte, schrie Margarete auf, obwohl sie nicht verletzt worden war. Diesen Angstschrei und das Klirren davor hatte der Bäcker gehört. Er sprang die wenigen Stufen zum Laden hinauf, riss die Tür auf und begriff das Ausmaß der Gefahr wie ein Soldat im Gefecht. Er achtete nicht auf das Jammern Margaretes, die er ohnehin nicht verstand, weil sie in ihrer Angst jedes französische Wort vergessen hatte. Er stieß sie zur Seite, schlug den Riegel mit einem kräftigen Schlag zurück, riss die Ladentür auf und stand der tobenden Menge gegenüber.
Lucs Vater war sehr stark. Die Gefahr verlieh ihm zusätzliche Kräfte. Er wusste, dass alles, wofür er gelebt und geschuftet hatte, umsonst gewesen war, wenn er dieses Ungeheuer nicht bändigte.
Für den Bäcker stand sehr viel auf dem Spiel, eigentlich sein ganzes Leben. Er hatte hart arbeiten müssen, nichts war ihm geschenkt worden. Im Augenblick der Gefahr sah er sich Teig kneten, Wasser schleppen, Holz spalten, Brot austragen, den Laden scheuern, Säcke ausbürsten - er sah sich als Kind bei dem strengen Meister, der ihn schlug für den geringsten Fehler. Damals war der Gedanke geboren worden, dass er reich werden wollte, sehr reich.
Für dieses Ziel hatte er gearbeitet, hatte er geschuftet und weder sich noch andere geschont. Wenn er zu einem halben Sou gekommen war, glaubte er sich seinem Ziel bereits einen ganzen Schritt näher. Er wollte viel Geld besitzen, um sich alles leisten zu können, die feinsten Anzüge, die besten Speisen, die ausgesuchtesten Weine. Er wollte der Besitzer der größten Bäckerei von Paris werden. Und er wusste, dass er in einem, höchstens in zwei Jahren aus der schäbigen Rue Saint Antoine ausziehen und in ein gutes Viertel wechseln konnte, denn die erforderlichen Louisdors hatte er fast zusammen. Er würde sein Ziel erreichen - wenn er jetzt Sieger blieb, wenn er jetzt nicht von der Menge niedergestoßen und sein Laden geplündert würde. Er wusste, dass es seiner ganzen Kraft bedurfte.
Der Bäcker stemmte Arme und Beine in die Türfüllung. Er wehrte sich mit dem Mut der Verzweiflung. Die Adern traten ihm auf Stirn und Hals wie Stricke hervor, die Muskeln wurden eisenhart. Und da schrie er: „Geht zum Müller, Leute! Der macht die Mehlpreise! Ich bin keinen Sou besser dran als ihr!“
Es schien, als hörte man auf ihn. Der Druck ließ etwas nach. Er erkannte jetzt die ersten Gesichter in der Menge. „He, Colette!“, rief er, und es gelang ihm sogar ein schiefes Lächeln. „Wie oft hast du bei Marguerite anschreiben lassen? Ist das vielleicht deine Art, die Gefälligkeit zurückzuzahlen?“
Colette schlug die Augen nieder. Es stimmte. Margarete hatte ihr auch schon Brot gegeben, wenn sie keinen einzigen Sou mehr in der Tasche hatte.
„Und du, Masson, habe ich dir nicht zur letzten Kindstaufe eine ganze Tüte Mehl zum halben Preis abgelassen?“
Frau Masson schluckte. „Ja, das hast du, Bäcker. Und ich bin dir auch heute noch dankbar dafür.“
Er suchte in den hinteren Reihen nach bekannten Gesichtern. Da entdeckte er zu seiner Überraschung Gaston, den ehemaligen Gesellen. Was suchte der hier vor seinem Laden? „He, Gaston, willst du deinem einstigen Lehrherrn und Wohltäter den Schädel einschlagen, weil er zu arm war, dich weiter zu beschäftigen? Sage den Frauen, was ein Sack Mehl inzwischen kostet und ein Stapel Brennholz dazu! Sage ihnen, wie hoch der Pachtzins ist, den ich an Gott weiß wen alles zahlen muss, um diese Bäckerei überhaupt betreiben zu können. Du weißt es, Gaston, sag’s ihnen!“
Gaston war es unangenehm, von seinem einstigen Patron erkannt und vor allen Leuten zum Zeugen angerufen zu werden. Natürlich wusste er, dass der Bäcker aufschlug, was der Müller über den gestrigen Mehlpreis hinaus verlangte. Und der Müller forderte, um dem Getreidehändler geben zu können. Der Getreidehändler wiederum ...
Es war eine lange Kette, bis man an den Schuldigen kam. Wahr blieb aber auch, dass Bäcker, Müller, Getreidehändler und wer sonst noch trotz allem ihren Schnitt bei der Teuerung machten. Bezahlen musste der letzte in der langen Kette. Bezahlen musste, wie immer, das Volk.
Gaston wusste nicht, wie er sich verhalten sollte. Wenn die Frauen jetzt den Bäckerladen stürmten, vergrößerten sie am Ende nur das eigene Elend, denn der nächste Bäcker würde mit Sicherheit fünfzehn Sous für den Laib Brot verlangen. Andererseits war ihm klar, dass sein ehemaliger Patron log, wenn er sich selbst einen armen Schlucker nannte. Gaston hatte durch Zufall von einem Geschäft erfahren, dass mit Brotbacken nichts zu tun hatte und entschieden mehr einbrachte als die Schufterei vor dem heißen Ofen. Vor allem aber zögerte Gaston, weil Margarete und Luc in dem Laden waren, denn er konnte sich vorstellen, wozu die aufgebrachte Menge fähig war.
Vielleicht wäre die ganze Sache glimpflich abgelaufen. Vielleicht hätte sich die erregte Menge wieder zerstreut. Und vielleicht wären die Frauen mit dem teureren Brot nach Hause gegangen, um ihren hungrigen Kindern zur dünnen Zwiebelsuppe etwas geben zu können, was ihre knurrenden Mägen wenigstens beruhigte, ohne den Hunger ganz zu stillen. Vielleicht wären die, denen es um mehr ging als nur um den Brotpreis, wieder abgezogen, wenn nicht der Vicomte erschienen wäre, einer von den übelsten adligen Schmarotzern, die in Paris herumstreunten, immer lauernd, immer gierig, zu jeder Schandtat fähig und zu allen Verbrechen bereit.
Ein Mord
Der Vicomte hatte den Lärm bereits gehört, bevor er den Auflauf in der Rue Saint Antoine sehen konnte. Zunächst hatte ihn die erregte Versammlung vorsichtig gemacht. Schließlich war er ein Adliger, und Leute seines Standes waren nicht beliebt im Faubourg Saint Antoine, wie das Arbeiterviertel hieß. Er war sogar drauf und dran gewesen, den unruhigen Ort schleunigst zu verlassen, um später wiederzukommen. So eilig hatte er es nicht, den Bäcker aufzusuchen. Dennoch blieb er aus Neugier in gehörigem Abstand stehen und beobachtete mit zunehmender Genugtuung die Entwicklung. Das wäre so übel nicht, dachte er schadenfroh, wenn sie dem Wucherer den Laden plünderten und verwüsteten, denn wegen eines Brotes war der Vicomte nicht in die Rue Saint Antoine gekommen.
Nur wenige wussten wie Gaston von den heimlichen Geschäften des Bäckers. Lucs Vater verlieh Geld an Leute, die durch Spielen, Trinken und ausschweifendes Leben in Zahlungsschwierigkeiten geraten waren. Der Vicomte gehörte zu seinen Stammkunden. Dessen Schuldkonto belief sich inzwischen auf zwanzig Louisdors, die monatlichen Zinsen noch nicht einmal mitgerechnet.
Der Vicomte gab seine abwartende Haltung auf, als er begriff, dass die Menge erregt genug war, um dem Bäcker ans Leder zu gehen. Eigentlich war seine Zinszahlung fällig, aber der noble Herr hatte den Abend zuvor beim Spielen verloren und den Rest seines Geldes mit zweifelhaften Gestalten durchgebracht. Statt dem Bäcker etwas zu geben, war er gekommen, um einen weiteren Kredit aufzunehmen. Da hörte er, wie einer - es war Gaston - die Menge beschwichtigen wollte, indem er nicht den Bäcker als die eigentliche Wurzel des Übels bezeichnete, sondern den König, die Königin und das gesamte Regime anklagte. Den Vicomte scherte nicht, dass der Mann recht hatte. Ihn störte der Rufer, weil er seinen heimlichen Hoffnungen auf einen handfesten Krawall entgegenwirkte.
Der Vicomte war ein böser Charakter. Er nahm das Geld, das er in die Spielhöllen und übel beleumdete Kaschemmen schleppte, von wem immer er es bekommen konnte. Seine Verachtung dem dritten Stand gegenüber hinderte ihn nicht, bei mehreren Bürgerlichen zugleich zu borgen. Er lieh vom Bäcker, was er dem Metzger zurückzahlen musste, oder nahm beim Goldschmied Kredit auf, um den Schneider zu beschwichtigen. Es kümmerte ihn auch herzlich wenig, dass die Schulden immer höher wuchsen, als er sie abzutragen in der Lage war. Schulden sind keine Hasen, erklärte der feine Herr protzend, sie laufen nicht davon. Und fremdes Geld gibt sich leichter aus als eigenes.
Der Vicomte verfügte noch über eine andere Geldquelle, die zwar nicht so reichlich floss, wie er es brauchte, aber den Vorzug hatte, dass er die erhaltenen Louisdors nicht zurückzahlen musste. Diese Geldstücke kamen aus der Schatulle des Herzogs Philippe von Oranien, eines Vetters des Königs. Freilich, der hatte seinen Reichtum auch nicht durch ehrliche Arbeit verdient, aber danach fragten die wenigsten. Philippe von Oranien, der sich gern Philippe Egalité, Philippe der Gleiche nennen ließ, stand in dem Ruf, ein erklärter Gegner des Königs zu sein, ein erbitterter Feind der Königin zudem. Und also war er, sagten viele, ein ausgemachter Freund des Volkes.
Seine Gegnerschaft zu Louis XVI. hatte einen ganz einfachen Grund: Er selbst wollte König von Frankreich werden, und die viel zitierte Liebe zum Volk hatte keine andere Ursache als die Gewissheit, aus eigener Kraft nicht an dieses Ziel gelangen zu können.