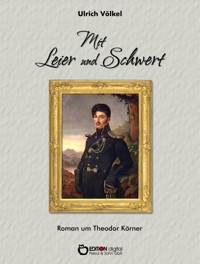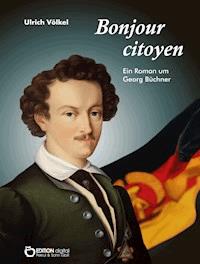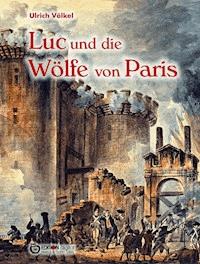4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Regionalia Verlag | Kraterleuchten
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Redewendungen und Sprichwörter
- Sprache: Deutsch
Ist wirklich alles in Butter oder liegt der Hund in der Pfanne begraben? Schweben Liebende wirklich auf Wolke sieben und kann man ihnen das Wasser reichen in dieser Höhe? Geht jemand fechten, wenn er über die Wupper will? Wird der Pfingstochse von einem Pleitegeier begleitet? Man weiß es nicht, glaubt aber, es zu wissen, was solche Redewendungen bedeuten. Man kann sich irren und ist überrascht, wenn man etwas tiefer gräbt. Der Schriftsteller Ulrich Völkel ist ein neugieriger Mensch. Er hat sich auf die Suche gemacht, um den Ursprung gängiger Redewendungen, ihre Entwicklung und heutige Bedeutung herauszufinden. Das Ergebnis darf man sich hinter die Ohren schreiben, wenn es nicht doch ein Schuss in den Ofen ist und man Bauklötze staunen kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 152
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Eine Gardinenpredigt für das Arschgesicht
Deutsche Redewendungen einst und heute
Ulrich Völkel
Impressum
Ulrich Völkel
Eine Gardinenpredigt für das Arschgesicht
Deutsche Redewendungen einst und heute
1. Auflage 2024
Regionalia Verlag,
ein Imprint der Kraterleuchten GmbH,
Gartenstraße 3, 54550 Daun
Alle Rechte vorbehalten
Korrektorat: Tim Becker
Gestaltung, Satz: Kerstin Fiebig
Umschlag: Kerstin Fiebig
ISBN Print 978-3-95540-411-6
ISBN E-Book 978-3-95540-427-7
www.regionalia-verlag.de
Inhalt
Vorwort
Abdecker und Schinderhannes
Adamsapfel
Ahoi
Aprilscherze
Arsch auf Grundeis
Arschkarte zeigen
Bahnhof verstehen
Über den Löffel balbieren
Bärendienst erweisen
Bauklötze(r) staunen
Bezirzen
Binsenwahrheit
Blumen
Böhmische Dörfer
Bombenwetter
Brett vor dem Kopf
Daumen drücken
Dreck am Stecken
Elfenbeinturm
Etepetete
Ewig und drei Tage
Gardinenpredigt
Mein lieber Herr Gesangsverein
Geschäft machen
Ins Gras beißen
Hammelsprung
Henkersmahlzeit
Hinz und Kunz
Holla, die Waldfee
Auf Holz klopfen
Am Hungertuch nagen
Kaiserschnitt
Unter aller Kanone
Mit Kind und Kegel
Kohldampf schieben
Einen Korb bekommen
Kurve kratzen
Laus über die Leber
Leseratte
Maulaffen feilhalten
Nagelprobe
Aus dem Nähkästchen plaudern
Persilschein
Pleitegeier
Rabeneltern
Am Riemen reißen
Schema F
Auf den Schlips treten
Schmiere stehen
Schuss in den Ofen
Bis die Schwarte kracht
Standpauke halten
Stein im Brett
Auf den Strich gehen
Treppenwitz
Trick 17
Einen Vogel haben
Vögeln
Wolke sieben
Zapfenstreich
Vorwort
Angeln im Wörtersee
Oft werden die Begriffe Sprichwort und Redewendung fälschlicherweise synonym gebraucht. Der Unterschied liegt in der Flexibilität ihrer Verwendung: Ein Sprichwort ist nicht flexibel und lässt sich als Spruch nur in einer bestimmten Reihenfolge als feststehender Satz verwenden. Eine Redewendung hingegen kann auch lediglich eine Phrase oder ein bestimmter Begriff sein, der sich flexibel in die verschiedensten Sätze einbauen lässt. Sowohl Sprichwörter als auch Redewendungen gehören zu unserem Kulturgut und werden oft und gerne verwendet.
Ich bin kein Wissenschaftler und ich möchte mit diesem Buch auch nicht den Eindruck erwecken, einer zu sein. Was nicht heißt, dass ich nicht gründlich genug recherchiert habe. Meine Intention war herauszufinden, wie Redewendungen, die wir im täglichen Sprachgebrauch benutzen, entstanden sind und wie vielfältig die Quellen sein können, aus denen sich die Flüsse speisen, die dann im großen Wörtersee einmünden. Ich bin ein Geschichtenerzähler und ich habe meinen Spaß beim Suchen gehabt, was, hoffe ich jedenfalls, auch für andere amüsant oder von Interesse sein könnte. Meine Enkelkinder lachen schon, wenn ich sie frage, ob sie wüssten, was … Und sie sagen dann: Opa weiß mal wieder was. Na, besser, als wenn sie sagen würden, der alte Mann hat doch keine Ahnung.
Tante Paula, meine freundliche Nachbarin aus Z., war eine neugierige Frau. Sie hatte auch keine Scheu, selbst intimste Fragen zu stellen. Um das als Anteilnahme zu kaschieren, erklärte sie: »Ich bin nicht neugierig. Ich will’s nur wissen.«
Ich bin auch neugierig. Und wissen will ich es sowieso. Sprache ist ein lebendiges Wesen. Man benutzt sie, um sich einander verständlich zu machen. Dabei kommt es nicht nur darauf an, wie man es sagt (der Ton macht die Musik), sondern natürlich auch, was man sagt. Und manchmal sagt man etwas, ohne eigentlich zu wissen, woher das Wort kommt, das man verwendet, was es vielleicht ursprünglich bedeutet und wie es sich im Laufe der Jahre und Jahrhunderte verändert hat. Zum Beispiel Treppenwitz. Oder Kaiserschnitt. Und wieso verrichtet man ein Geschäft, wenn man auf die Toilette geht?
Ich will wissen, wenn ich ein Wort oder eine Wendung gebrauche, warum man das so sagt und ob das vielleicht einmal eine ganz andere Bedeutung hatte. Dann schlage ich nach im Herkunftswörterbuch des Dudens oder im Grimmschen Wörterbuch und gelegentlich google ich auch (was aber immer mit Vorsicht zu gebrauchen ist). Herr Google irrt sich manchmal. Außerdem bildet Googlen nicht, man bildet es sich nur ein, weil man es ohne eigenen Aufwand zur Kenntnis nimmt und weiß, wenn man es vergisst, kann man es wieder nachschlagen. »Was du ererbt von deinen Vätern, erwirb es, um es zu besitzen«, der kluge Goethe.
Wissen ist Macht, wusste schon der englische Philosoph Francis Bacon. Spötter parodierten: Nichts wissen macht auch nichts. Wenn man in einer Runde mit Wissen brillieren kann, also zum Beispiel in Sachen Kaiserschnitt, gilt man vielleicht als Klugscheißer, aber die Genugtuung, etwas zu wissen, was die anderen nicht wussten, ist auch etwas Schönes. Stimmt’s, Tante Paula?
Dieses Buch ist eine unvollständige Sammlung von Wörtern und Begriffen, die mir im Laufe der Jahre begegnet sind und die mich zum Nachdenken brachten. Wer einen Begriff nicht aufgeführt findet, der ihm aufgefallen ist, sollte selbst auf die Suche gehen, damit er gewitzt erscheinen kann. Kein Witz.
Manchmal sitze ich am Ufer des Wörtersees und werfe meine Angel nach dem richtigen Wort aus. Manchmal beißt das richtige an. Manchmal hat sich der Haken nur im Kraut verfangen. Und manchmal ist ein Wort am Haken, das ich nicht kenne. Ich nehme es jedenfalls erst einmal mit, um zu Hause nachzuschlagen. Beim nächsten Tag am Wörtersee weiß ich dann Bescheid. Petri Heil und Petri Dank! (Petri Dank sagt man allerdings wie Weidmanns Dank nur bei erfolgreichem Fang und geglückter Jagd.)
Ulrich Völkel
Adamsapfel
Laut Bibel hat Eva Adam verführt, einen Apfel vom Baum der Erkenntnis zu kosten, was strikt gegen Gottes Gebot verstieß und womit das ganze Elend, die Erbsünde, begann. Weil sich Adam weigerte, so die Legende, die Frucht zu essen, half Eva ein wenig nach und steckte ihm einfach ein Stück in den Mund. Der deutlich tast- und sichtbar hervorragende Abschnitt des männlichen Schildknorpels (Kehlkopf) wird als Adamsapfel bezeichnet mit der Erklärung, dass Adam das Stück der verbotenen Frucht im Hals stecken geblieben ist. »…,weil dem Adam der kröbs oder griebs des von Eva dargereichten apfels in der kehle stecken geblieben sein soll«, erklärt das Grimmsche Wörterbuch.
Die Legende selbst steht so nicht in der Bibel, ist aber in zahlreichen christlichen Erzählungen seit dem Mittelalter nachweisbar. In der Genesis (3.6) ist nur von einer Frucht die Rede. Für die Juden war es eine Feige, für die orthodoxen Christen eine Orange und im Islam ist die Rede von einem Glas Wein. Wenn überhaupt, könnte es sich um einen Granatapfel gehandelt haben.
In der Medizin wird die Bezeichnung Pomum Adami vom 16. bis ins 19. Jahrhundert gebraucht. Seit 1895 (Basler humananatomische Nomenklatur) gilt Prominentia laryngea.
Die Bezeichnung Adamsapfel ist bereits für das 15. Jahrhundert belegt. Im 14. Jahrhundert sagte man noch Granatapfel, was dem ursprünglichen Text nähersteht. Der Apfel kommt aus Zentralasien und wurde erst von den Römern nach Europa gebracht. In den alten arabischen Medizinschriften heißt der Schildknorpel Granatapfel. Das Bild vom Apfel ist eine falsche Übersetzung der »Vulgata«. Dort steht arbor mali, das ist der Baum des Bösen. Stattdessen heißt es arbor malli, das ist der Apfelbaum.
In den »Volksmärchen aus Pommern und Rügen« von Ulrich Jahn wird die biblische Geschichte vom Sündenfall so erzählt: Eva hatte, vom Teufel verführt, einen Apfel vom Baum der Erkenntnis gepflückt und davon gegessen, obwohl das ausdrücklich verboten war.
»Da fiel es ihr schwer auf die Seele, dass sie sich versündigt habe, und damit sie nicht allein verstoßen würde, rief sie ihren Mann herbei und bat ihn, auch von den Früchten zu kosten. Adam wurde jedoch sehr zornig und verwies der Eva den Ungehorsam gegen des Herrgotts Gebot. Das bekümmerte sie nur umso mehr, und weil sie durchaus nicht alleine aus dem Paradiese vertrieben werden wollte, nahm sie einen Apfel von dem Baume der Erkenntnis und steckte ihn ihrem Manne mit Gewalt in den Mund, dass er ihn herabschlucken musste. Aber auf halbem Wege blieb er stecken. Und noch heute tragen darum alle Menschenkinder den Adamsapfel an der Gurgel und werden ihn tragen, solange es Menschen auf Erden gibt.«
Bemerkenswert in diesem Zusammenhang, dass mit Menschen eigentlich nur die männliche Gattung verstanden wird. Frauen haben keinen Adamsapfel.
Unter den zahlreichen schmackhaften Äpfeln gibt es übrigens auch einen Adamsapfel als Winterapfel. »Die Früchte sind groß und rundlich, die Schale karminrot gefärbt. Das weißgelbe Fruchtfleisch ist sehr saftig und schmeckt angenehm süßweinig und leicht gewürzt«, lautet die Beschreibung der Lieferanten.
Ahoi
Der Seemannsgruß Ahoi wird überraschenderweise auch in Tschechien und der Slowakei benutzt. Dazu fällt mir Ingeborg Bachmanns Gedicht »Böhmen am Meer« ein oder Franz Fühmanns gleichlautende Erzählung. Bereits in Shakespeares Komödie »Ein Wintermärchen« lesen wir von »Bohemia. Adesert country near the sea« als einem Sehnsuchtsort.
Auf See ruft man sich von Schiff zu Schiff Ahoi als Grußwort zu. Es ist vermutlich entstanden aus den Silben a und hoy, wobei a als Anruf vorangestellt wurde. »Hoy!« Oder »hoyhoy!« forderte man in England das Vieh auf, sich vorwärtszubewegen. Der schottische Dichter William Falconer schrieb 1769: »Wenn der Kapitän den Leuten im Mastkorb etwas befehlen will, ruft er: Mastkorb, hurra! Worauf sie antworten: Hallo!« Auch in späteren englischen Fachwörterbüchern wird Ahoy nicht angeführt.
1827 hatte James Ferimore Cooper seinen Roman »The Red Rover« veröffentlicht, im folgenden Jahr erschien »Der rothe Freibeuter« in Frankfurt am Main. Der Übersetzer Karl Meurer nahm es nicht ganz genau. Aus dem Befehl »All hands to mischief, ahoy« wurde »Alle zu Hauf!« Aus »Possen, ahoy!« und »Good humour, ahoy!« wurde »Bei den Possen gehalten, ahoi!«
Friedrich Knickerbocker, der 1831 die zweite Übersetzung vorlegte, überging oder umschrieb ahoy auch falsch mit »Holüber!«. Erst 1842 erhielt »Der Lotse« durch eine weitere Übersetzung von Eduard Mauch eine Vereinheitlichung, allerdings mit vier Mal ahoy und einem Mal ahoi.
Ahoj ist inzwischen ein häufig zu hörendendes Wort in Tschechien und der Slowakei. Es wird als Gruß- oder Abschiedsformel gebraucht.
Ob tiefschürfende sprachwissenschaftliche Untersuchungen immer ein überzeugendes Ergebnis bringen, sei dahingestellt. Vielleicht ist das Wort ahoi einfach als Interjektion entstanden, ein An- und Ausruf, den man möglichst weit hören sollte, wie es der Sprachforscher Gustav Goedel meint. Wie das Ahoj nach Tschechien und in die Slowakei kam, wird unterschiedlich beurteilt oder vermutet. Es könnte sein, dass tschechische Matrosen den Gruß aus Hamburg mitgebracht haben.
Etwas gewagter klingt die Erklärung, dass die Mädchen aus den Hafenbars an Moldau und Oberelbe ihre Freier zum Abschied warnten und ihnen nachriefen:
»A hoj! Kdo nehojil, tomu upad« (Und holla! Wer ihn nicht geheilt hat, dem ist er abgefallen!).
Die Verbreitung des Grußes geht wahrscheinlich auf die zwanziger Jahre des letzten Jahrhunderts zurück, als das Kanufahren unter tschechischen und slowakischen Jugendlichen und Studenten populär wurde, vermutet Dietmar Bartz in seiner Abhandlung »Wie das Ahoj nach Böhmen kam«, und die Kanuten auf den südmährischen und südböhmischen Flüssen unterwegs waren. Damals bildete sich eine Wandervogelbewegung. Die jungen Leute kochten an Lagerfeuern und übernachteten in Indianerzelten. Manche nannten sich trempi (Tramps). »A-hoooooj!« war ihre identitätsstiftende Anrede. In Tschechien und der Slowakei ist Ahoj so verbreitet wie in Deutschland das Hallo.
Als die deutschen Truppen in Böhmen und Mähren einfielen und das Land besetzten, wurde ahoj als Akronym (aus den Anfangsbuchstaben mehrerer Wörter gebildetes Kurzwort) benutzt: »Adolfa Hitlera oběsíme jistě!« (Klar, wir hängen Adolf Hitler!). Seit dem Kirchenkampf (1950) sagte man: »A jhriešnych ochraňuje Ježiš.« (Jesus schützt auch die Sündigen).
Aprilscherze
Es ist ein seit Alters geübter Brauch, jemanden in den April zu schicken, was so viel bedeutet wie ihn auf harmlose Weise zu veralbern. Was hat das mit dem ersten Tag des Frühlingsmonats zu tun?
Der Brauch ist seit dem 17. Jahrhundert in Deutschland, aber auch in den Nachbarländern Frankreich, den Niederlanden und England bekannt. Man schickt den Lehrling nach Mückenfett oder bittet den Freund um Hahneneier. Ein angefeuchtetes Haar auf der Fensterscheibe täuscht gesprungenes Glas vor. Der Kuchen sei verbrannt und die Schwiegermutter habe ihren Besuch angekündigt. Eben so etwas.
Goethe dichtete:
Willst du den März nicht ganz verlieren, So lass nicht in April dich führen.
Den ersten April musst überstehn, Dann kann dir manches Gute geschehn.
Auch der Volksmund reimte sich einiges auf den 1. April zusammen:
»Am ersten April schickt man die Narren, wohin man will.«
Am Niederrhein heißt es:
»Aprilgeck, steck de Nos in den Kaffeedreck.«
Der Brauch, jemanden in den April zu schicken, wird 1618 erstmals in Baiern (damals noch nicht mit y geschrieben) erwähnt. Vermutlich handelt es sich dabei um eine Adaption des englische Wortes Aprilfoot (auch All-fools-day). Über die Gründe, den 1. April als Datum solcher Späße zu benutzen, wird mehr spekuliert als wirklich bewiesen. Es kann sein, dass mit der Verlegung des Neujahrstages vom 1. April auf den 1. Januar durch den französischen König Charles IX. im Jahre 1564 die für den Jahresbeginn üblichen Geschenke wegfielen und nur noch Scherzgaben überreicht wurden als Erinnerung an den ehemaligen Feiertag.
Der in den April Geschickte wurde verspottet mit dem Ruf: »Poisson d’Avril« (= Aprilfisch). »Wir wollen und ordnen an, dass in allen Akten, Verzeichnissen, Dokumenten, Verträgen, Anordnungen, Edikten sowohl in offener als auch in gesandter Form und in allen privaten Schriftstücken das Jahr von nun an am ersten Tag des Monats Januar beginnt beziehungsweise gezählt wird«, heißt es im Edikt von Roussillon, Artikel 39.
Dem »Opfer« des Aprilscherzes wurde heimlich ein Fische angehängt, vermutlich eine Anspielung darauf, dass in der Fastenzeit bis Ostern kein Fleisch gegessen werden durfte. Später wurde der Fisch aus Pappe oder Papier gebastelt.
Zu Lebzeiten von Charles IX. war ein poisson d’avril noch ein Dienstbote, der einen Liebesbrief seines Herrn überbrachte.
Unter den zahlreichen Deutungsversuchen findet sich der Hinweis auf den Augsburger Reichstag von 1530, auf dem das Münzwesen neu geregelt werden sollte. Weil es dazu nicht kam, wurde der 1. April für viele Spekulanten, die auf diesen Münztag gesetzt hatten, ein Reinfall und sie verloren viel Geld.
Eine andere Erklärung verweist auf den 1. April 1572. An diesem Tag verlor Herzog Alba die Schlacht um Brielle. Worauf die siegreichen Wassergeusen dem verhassten Spanier »eine Nase drehten«, nachzulesen in den Annalen: »Op 1 april verloor Alva zijn bril« (am 1. April verlor Alba seine Brille).
In den April geschickt hat der Hofstaat von Heinrich IV. den König mit der angeblichen Einladung eines hübschen Mädchens zu einem tête-à-tête. Als der lüsterne Herr an dem angegebenen Ort ankam, wurde er von seinen Höflingen und seiner Frau schadenfroh lachend empfangen.
Nach biblischer Vorstellung war der 1. April der Geburts- und Sterbetag von Judas Iskariot. An diesem Tag sei auch der von Gott verstoßene Luzifer in die Hölle eingezogen. Ein Unglückstag, an dem man »höllisch« aufpassen muss.
Der April ist für sein unbeständiges Wetter bekannt. Wer in den April geschickt wird, muss mit allerlei Ungemach rechnen. In Italien gilt der März als wechselhaft. Dort sagt man marzo pazzo (verrückter März). Im Engadin wird der 1. März in Erinnerung an den römischen Jahresbeginn im Monat März (zu Ehren des Kriegsgottes Mars) begangen.
Das »Große Handbuch des Aberglaubens«, herausgegeben von Ulrike Müller-Kaspar, bringt den 1. April in Verbindung mit der Quirinalia, dem Fest zu Ehren des Gottes Quirinus, der die Gestalt von Romulus annahm, einem der beiden Gründer Roms.