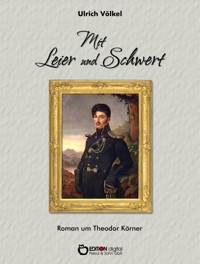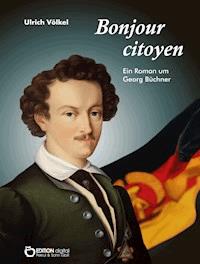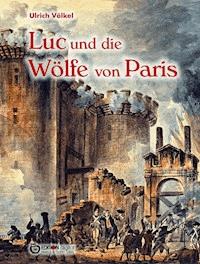7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
„Der obere Teil der Küchentür war verglast, kleine Felder mit getönten, auf einer Seite geriffelten Scheiben, durch Holzstege voneinander getrennt. Mit dem linken Ellbogen schlug Wilhelm Juppe eines der Glasfenster heraus, griff durch das Loch und drehte den von innen steckenden Schlüssel herum. Dann öffnete er die Küchentür. Frau Bauer lag vor dem Herd, aus dem hörbar das Gas ausströmte. Huppe lief zum hinteren Teil der Küche, riss die beiden schmalen Flügel auf und atmete heftig die frische Luft ein…” Ulrich Völkel schrieb Gegenwartsbücher und historische Romane, er ist vielen Lesern kein Unbekannter mehr. Nun versucht er sich, dem Bei8spiel anderer Autoren folgend, auch auf dem Gebiet der Kriminalliteratur. Dem „Vierten Schlüssel“ merkt man die Erfahrung des Verfassers, auch ein bisschen seine Routine im Umgang mit dem geschriebenen Wort an. Da ist gleich von der ersten Seite Spannung, die Personen sind Menschen von Fleisch und Blut, und ihre Handlungen und Motive erscheinen logisch und verständlich. Und noch etwas bringt Völkel in den Kriminalroman ein: Er erzählt zwei scheinbar unabhängige Fälle, die sich auf eigenartige Weise berühren. Eine bisher kaum gekannte Konstruktion mit zweifellos neuartigen Spannungselementen, die selbst den geübten Krimileser nicht ohne Überraschung aus der Lektüre entlassen. Das Buch erschien erstmals 1988 beim Militärverlag der Deutschen Demokratischen Republik.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 312
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Impressum
Ulrich Völkel
Der vierte Schlüssel
Kriminalroman
ISBN 978-3-86394-775-0 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien 1988 beim Militärverlag der Deutschen Demokratischen Republik.
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2012 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Alte Dorfstraße 2 b 19065 Godern Tel.: 03860-505 788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
1. Kapitel
Achim Bauer verließ am Montag früh Punkt sechs Uhr zehn seine Wohnung. Sechs Uhr zwanzig kam der Linienbus, mit dem er bis zur Endstation fuhr wie alle Tage, wenn er zur Arbeit musste. Er war stellvertretender Abteilungsleiter im Konstruktionsbüro des Wohnungsbaukombinats. Trotz seiner sitzenden Tätigkeit hatte er eine aufrechte, betont sportliche Haltung, die aber mehr das Ergebnis von Eitelkeit war als von regelmäßigem Training in einer Turnhalle. Achim Bauer achtete auch sonst auf ein gepflegtes Äußeres. Für Kleidung gab er viel Geld aus. Er benutzte teures Rasierwasser, ging immer mit Schlips und Kragen. In Jeans und T-Shirt hätte er sich unwohl gefühlt. Bei wichtigen Verhandlungen war er nicht nur erfolgreich, weil er über sehr viel Sachverstand verfügte, er wirkte auch besonders seriös, das schlug zu Buche.
Nachdem er die Wohnungstür zweimal abgeschlossen hatte, vergewisserte er sich durch einen Druck auf die Klinke, ob die Tür auch wirklich zu war, eine überflüssige Geste, Gewohnheit. Er war eben in allen Dingen gründlich, manchmal sogar auf eine penible Art.
Er hatte gerade den Fuß auf die erste Treppenstufe gesetzt, als die Tür der Nachbarwohnung geöffnet wurde und Frau Graff scheinbar zufällig heraustrat. Er schmunzelte. Er hatte sie im Verdacht, stundenlang hinter der Tür zu stehen und zu warten, bis sich draußen jemand bewegte, mit dem sie ein Gespräch anfangen konnte. Sie war eine alte Frau und viel allein. Aber wenn sie einen zu fassen bekam, dann, so sagte Achim Bauer, hielt sie ihn fest und kam vom Hundertsten ins Tausendste. Gelegentlich machte sie Besorgungen für seine Frau, die krank war. Das hätte er sonst erledigen müssen. Seine Freundlichkeit ihr gegenüber hatte also weniger mit einer umgänglichen Art zu tun, er war im Gegenteil mitunter von verletzender Einsilbigkeit. Er tat nur freundlich aus praktischen Erwägungen heraus.
"Guten Morgen, Frau Graff", grüßte er und ging weiter die Treppe hinab.
"Guten Morgen, Herr Bauer, schließen Sie man gar nicht erst ab. Ich wollte gerade bei Ihrer Frau klingeln. Sie hat mir gestern gesagt, dass es ihr nicht besonders geht. Das Wetter, wissen Sie? Ich hab's auch so auf dem Herzen. Da will ich gleich fragen, was ich für sie besorgen kann."
Nun blieb er doch stehen. "Ist nicht nötig, Frau Graff. Lassen Sie sie schlafen. Ich erledige das heute auf dem Heimweg. Sie hat die ganze Nacht kein Auge zugemacht." Er sagte es in einem Ton, als handelte es sich um eine dienstliche Anweisung.
Frau Graff überhörte es geflissentlich. "Ach ja, wenn man es mit dem Herzen hat. Ich kenne das von Paul. So jung und schon so krank." Und gleich wollte sie von ihren Gebrechen anfangen, die sie plagten, aber Achim Bauer schien es wie immer eilig zu haben. Er blickte auf seine Armbanduhr. "Mein Bus! Also nicht klingeln. Sie meldet sich schon, wenn sie etwas braucht."
Das missfiel ihr. Sie hätte gern mit der Nachbarin ein Schwätzchen gemacht. Wen hatte sie sonst schon, mit dem sie reden konnte? Paul war tot, jetzt das dritte Jahr. Und der Glasermeister Juppe, der Werkstatt und Wohnung in der unteren Etage des zweistöckigen Reihenhauses hatte, das ihm gehörte, war ein alter Muffel. Geizig war er auch, obwohl er eigentlich Geld wie Heu hatte. Bei dem musste sie auf Heller und Pfennig abrechnen, wenn sie von ihren Besorgungen zurückkam. Der gab nie mehr als ein paar Groschen Trinkgeld. Frau Bauer war eine feine Person. Und großzügig war sie außerdem.
Ohne sich weiter um die alte Frau zu kümmern, ging Achim Bauer die Treppe hinab. Frau Graff stand noch unschlüssig, ob sie nicht doch klingeln sollte, wenn er aus dem Haus war, unterließ es aber, weil sie sich vor dem unwilligen Blick fürchtete, den sie gar nicht hätte sehen können. Also schlurfte sie zu ihrer Wohnungstür zurück. Ich warte halt noch ein bisschen, sagte sie sich. Ich geh eben erst einmal zu Juppe.
Die Haustür schlug zu. Achim Bauer zog den Hut tiefer in die Stirn, weil ein feiner Nieselregen fiel. November, der unangenehmste Monat des Jahres.
Er überquerte die Straße an der Ampel, ging am Springbrunnen vorbei, der erst wieder zum 1. Mai des kommenden Jahres angestellt würde. Die Bushaltestelle befand sich direkt vor der Post am Marktplatz. Die meisten Wartenden standen jeden Morgen hier, dennoch taten sie fremd miteinander. Jeder schien nur mit sich und den eigenen Problemen beschäftigt zu sein.
Achim Bauer war mit seinen Gedanken bereits am Schreibtisch. Nicht bloß das Wetter war unfreundlich, ihn erwartete auch eine Besprechung mit seiner Chefin, der er sich fachlich überlegen glaubte. Aber mit Gisela Werner zu streiten fiel ihm jedes Mal schwer.
Der Bus kam, und die Wartenden stiegen ein. Als er die Kreuzung überquerte, blickte Achim Bauer zu dem kleinen Haus hinüber, in dem er wohnte. Das Licht brannte im Zimmer zur Straße. Habe ich es nicht ausgemacht, fragte er sich verunsichert. Und als ob das von Bedeutung wäre, ging er in Gedanken alle seine Handlungen noch einmal durch. Er erinnerte sich nicht, die Lampe angemacht oder ausgeschaltet zu haben. Und im Grunde war es auch ohne Bedeutung, wenn es Frau Graff nicht sehen konnte. Die brachte es fertig und klingelte. Nun ja, dachte er, dann kann ich es auch nicht ändern.
Der Bus fuhr exakt die im Fahrplan angegebene Zeit, siebzehn Minuten bis zum Bahnhof. Achim Bauer kontrollierte das jeden Tag auf seiner Uhr, als wäre er beauftragt, mögliche Unregelmäßigkeiten festzustellen. Zufrieden stieg er aus, weil es heute wieder gestimmt hatte. Er überquerte die Straße vorschriftsmäßig im rechten Winkel. Bis zum Büro des Wohnungsbaukombinats waren es etwa dreihundert Meter. Er zählte die Schritte. Er zählte gern. Um diese Jahreszeit sah man fast keinen Radfahrer mehr, aber sobald die Tage wieder länger wurden, etwa von Mitte März an, machte er sich einen Spaß daraus, unterwegs die Fahrräder zu zählen, wobei er so etwas wie eine Spielregel entwickelt hatte, was zu registrieren war und was nicht. Nämlich nur bewegte Fahrräder, nicht etwa die abgestellten. Dabei hatte er bestimmte Mittelwerte herausgefunden. März, April etwa zehn, im Sommer zwanzig bis fünfundzwanzig. Es war ein Tick, das wusste er, über den er sich selber amüsierte. Aber er nahm ihn dennoch ernst.
Am Bürohaus angekommen, stieg er schwungvoll die acht Stufen der Treppe vor dem Eingang hinauf. Man hätte glauben können, er nähme immer zwei auf einmal, so federte er durch. Aber das wäre ihm denn doch zu jungenhaft erschienen, es hätte vielleicht noch zu seinem sportlichen Aussehen gepasst, aber nicht zu seinem korrekten Anzug.
Dem Pförtner nickte er kurz zu. Zwar stand ein Schild mit Großbuchstaben über dem Glasfenster - AUSWEISE UNAUFGEFORDERT VORZEIGEN! -, doch das ignorierte er seit Jahren. Er gehörte gewissermaßen zum Inventar des Hauses, gleich nach dem Studium hatte er hier angefangen und war nun schon das zehnte Jahr beim Kombinat. Die Ausweiskontrolle hielt er für lächerlich. Waren sie vielleicht ein militärisches Objekt? Wer unrechtmäßig ins Haus kommen wollte, hätte mühelos andere Wege gefunden.
Der Pförtner kannte ihn und nickte zurück. Achim Bauer kam genau zehn Minuten vor dem offiziellen Arbeitsbeginn, wenn sein Bus nicht Verspätung hatte. Er betrat das Gebäude ohne Hast, aber in Eile. Manche der Zuspätkommenden sprangen die Treppe hinauf, als könnten sie die Uhr überholen und doch noch rechtzeitig im Zimmer erscheinen, wenn ihre bezahlte Arbeitszeit begann. Da saß Achim Bauer bereits an seinem Schreibtisch, hatte die Unterlagen und Schreibgeräte bereitgelegt, den Kalender zurecht gesteckt. Punkt sieben Uhr begann er zu arbeiten. Man konnte nicht sagen, dass er ein Pünktlichkeitsfanatiker war. Solche Art Genauigkeit hatte für ihn einen gewissen sportlichen Reiz, aber er wirkte dabei so akkurat, dass es andere als eine Herausforderung empfanden. Insgeheim genoss er es, denn er spürte, wie er die Kollegen in Verlegenheit brachte, wenn er demonstrativ auf die Uhr blickte und so tat, als geschehe es beiläufig. Beliebt war er nicht in der Abteilung, das machte er auch durch Sachverstand nicht wett. Es war ihm allerdings gleichgültig. Sein Ehrgeiz hatte einen anderen Grund: Er wollte Chef werden.
Vor einem Jahr sah es fast so aus, als ob er sein Ziel erreicht hätte. Da entschied der Generaldirektor, überraschend für alle, anders. Er setzte Gisela Werner als Abteilungsleiterin ein. Zweifellos war diese Entscheidung gut überlegt. Die selbstbewusste, fachlich versierte junge Frau, Mitte Dreißig, Leitungserfahrung aus früheren Funktionen, verfügte auch aus kaderpolitischen Gründen über die bessere Ausgangsposition. Man hatte nur nicht mit ihr gerechnet. Und obwohl es einiges Erstaunen bei Achim Bauers Kollegen gab, dass nicht er mit dieser Aufgabe betraut worden war, war doch auch Schadenfreude mit im Spiel. Und Aufatmen. Achim Bauer als Abteilungsleiter wäre kein angenehmer Chef gewesen.
Wer jedoch gedacht hatte, er würde Protest einlegen, weil er so sichtbar übergangen worden war, irrte sich. Bauer blieb der eifrige, untadelige Stellvertreter, der er schon drei Jahre lang war. Er spielte weder die graue Eminenz noch den mit seinen Erfahrungen hinter dem Berg haltenden zweiten Mann. Er unterstützte die Abteilungsleiterin nach Kräften und für alle sichtbar. Nur wenn er mit ihr allein war, ließ er sie merken, wer der Bessere von beiden war. Aber auch das tat er so geschickt, dass ihm daraus von Gisela Werner kein Vorwurf gemacht werden konnte. Dabei beobachtete er sich selber aus ironischer Distanz, wusste um seinen Ehrgeiz ebenso wie um seine Cleverness, betrieb auch dieses Spiel mit sportlichem Einsatz - und wartete. Es hätte nichts eingebracht, frontal gegen die Entscheidung des Generaldirektors anzugehen. Viel gescheiter war es doch, abwarten zu können und unentbehrlich zu werden. Möglicherweise wurde einmal die Position eines Sektorenleiters vakant oder gar eines Direktors. Achim Bauer hätte sich auf die perfekteste Weise dafür empfohlen. Wer ehrgeizig ist, muss warten können. Hastige, überstürzte Entscheidungen und Handlungen waren grundsätzlich nicht sein Stil. Was er tat, war bis ins Detail überlegt. Wer ihm einen Fehler nachweisen wollte, musste sehr früh aufstehen. Es hätte sogar Mühe gemacht zu belegen, dass er ein Karrierist war, so offensichtlich das auch den Anschein hatte.
Achim Bauer blickte auf seine Uhr: drei Minuten vor acht. Er hätte also noch zwei Minuten Zeit gehabt, um zu Gisela Werner zu gehen, deren Zimmer sich neben dem kleinen Sekretariat befand, linke Tür, während seines rechts abging. Termin war acht Uhr. Er nahm seine Unterlagen auf, überblickte noch einmal den Schreibtisch, ob nichts liegen geblieben war, rückte die Bleistifte wie Soldaten zurecht und ging aus dem Zimmer.
Die Sekretärin saß an der Maschine. Da sie nach ihm gekommen war, grüßte er knapp und fragte sie, ob Kollegin Werner in ihrem Zimmer sei. Die Antwort wartete er gar nicht erst ab. Er hatte bereits die Klinke der gepolsterten Tür in der Hand, als die Sekretärin bejahte, und betrat den Raum, in dem die Abteilungsleiterin saß.
Gisela Werner machte sich gerade Notizen in ihrem Kalender. Sie blickte auf und lächelte ihm zu. "Guten Morgen, Achim."
Er trat zu ihr, beugte sich schnell hinab und küsste ihre Wange. "Guten Morgen, mein Schatz." Dann blickte er auf ihren Terrainkalender. "Alles voll. Und wo ist Platz für mich?" Er spielte den Schmollenden.
"Achim!", wies sie ihn zurecht. "Du weißt, ich mag das nicht im Büro. Braucht bloß mal jemand hereinzukommen. Also lass das bitte in Zukunft." Unmutsfalten auf der Stirn zeigten an, dass sie wirklich verärgert war. "Kommen wir zur Sache. Du bist der Meinung, dass die von mir vorgeschlagene Materialeinsparung auf Kosten der statischen Festigkeit geht. Ist das so?"
Er ging ohne sichtbaren Übergang, als hätten sie bereits geraume Zeit miteinander gesprochen, auf ihren sachlichen Ton ein. Seine Verärgerung ließ er sich nicht anmerken, denn das hätte keinen Eindruck auf sie gemacht. Dafür kannte er sie inzwischen zu gut. Gisela Werner war zwei Personen in einer: leidenschaftliche Geliebte im Bett und unnahbar strenge Chefin im Büro. Es war eine seltsame Art von Verhältnis, das sie miteinander verband.
Begonnen hatte alles, als sie ihre erste gemeinsame Dienstreise unternahmen. Hätte ihm jemand am Morgen gesagt, wie der Abend enden würde, wäre ihm das absurd vorgekommen. Zwar spielten sie sich die Bälle während der Verhandlung wie ein lang aufeinander eingestimmtes Paar zu, verstanden sich fast wortlos, wann der eine, wann der andere reden musste, aber eigentlich funktionierten sie wie ein perfekt konstruierter Computer. Dass es zwischen ihnen irgendwelche anderen als dienstliche Beziehungen geben könnte, schien gänzlich ausgeschlossen zu sein. Noch während des gemeinsamen Essens am Abend mit den Vertretern des Partnerbetriebes herrschte ein durchaus sachlicher Ton.
Gisela Werner war eine schöne Frau, gut gewachsen, die Bluse wohlgefüllt, schlanke Taille, runde Hüften, straffes Gesäß und lange Beine mit schmalen Fesseln. Ihr Gesicht, oval, von weich fallenden, kurz geschnittenen kastanienbraunen Haaren umrahmt, fiel besonders durch sinnliche volle Lippen und tiefdunkle Augen auf. Die Nase war schmal mit einem leichten Sattel. Vielleicht war ihm das alles nie bewusst geworden, weil er, wenn er in ihr schon die Frau sah, so eben doch eine, die ihm bei der Entscheidung, wer Leiter der Abteilung werden sollte, vorgezogen worden war, die erfolgreichere Konkurrentin also. Außerdem hatte er nie Verhältnisse mit gleichaltrigen Frauen gehabt. Er brauchte stets das Gefühl, der Überlegene zu sein. Selbstbewusste, aus eigenem Antrieb handelnde Frauen akzeptierte er höchstens im beruflichen Bereich. So waren alle seine Liebschaften gewesen, so war auch seine Ehe.
Als sie nach dem Abendessen im Lift in ihre Hoteletage fuhren, sagte sie: "Ich dusche mich und ziehe etwas anderes an, dann gehe ich in die Bar. Kommst du mit." Sie fragte nicht, sie sagte es.
Sie war mit ihm in die Bar gegangen, weil sie mit ihm schlafen wollte; in einer fremden Stadt, weit weg von allen Bekannten. Sie wollte mit ihm schlafen, weil sie Lust auf einen Mann hatte, und es sollte nicht irgendwer sein, das hatte sie nicht nötig.
Achim Bauer brauchte seine Zeit, um das Verhältnis mit Gisela Werner als das zu verstehen, was sie darunter verstand. Sie hatte sich allen Schmus wie Ichliebedich oder Ichkannohnedichnichtleben von Anfang an verbeten. Davon hatte sie ein für allemal die Nase voll. Als er sagte, dass er sich scheiden lassen würde, wenn sie ihn heiratete, erklärte sie ihm unumwunden, dass das für sie nicht in Frage käme. Sie wollte ihn fürs Bett haben, nicht fürs Leben.
Ein solches Verhältnis war ihm neu. Gisela Werner war nicht die erste, mit der er Vera, seine Frau, betrog. Aber immer war er es gewesen, der die Spielregeln bestimmte. Und er zog sich zurück, wenn sich die Ungleichung einer Gleichung zu nähern schien. Mit Gisela Werner war das von vornherein anders. Sie war auch noch als seine Geliebte seine Chefin. Das kränkte ihn. Das reizte ihn und forderte ihn heraus.
Er hielt es für Liebe, was ihn an ihr fesselte, dabei war es im Grunde nur verletzte Eitelkeit. Er wollte das Verhältnis umkehren und versuchte es so lange mit allen möglichen Tricks, bis er nicht mehr wusste, dass es sich um Tricks handelte. Er war zerknirscht, wenn sie ihn abfahren ließ. Er empfand Sehnsucht, wenn sie ihn auf Distanz hielt. Zwischendurch redete er sich ein, sie sei nur so unnahbar, um ihn ganz unter ihren Willen zu zwingen. Aber da irrte er sich. Weil er von ihr dachte, wie er von allen Frauen dachte, war er unfähig, sie zu begreifen und damit vielleicht ihre Liebe zu gewinnen. Er unterlag dem Trugschluss vieler Männer, die die Eitelkeit, geliebt zu werden, mit selber lieben verwechseln. Gisela Werner war zu gescheit, um das nicht zu erkennen, also verhielt sie sich danach.
Was er auch tat und sagte, sie ließ sich nichts vormachen. Genau auf diese Art Mann war sie schon einmal hereingefallen. Vielleicht war das sogar der Grund, warum sie sich ihn, nun mit wachem Verstand, ausgesucht hatte. Er sah ihrem Exgatten sogar ein bisschen ähnlich. Wenn sie mit ihm schlief, hatte sie mitunter die Vorstellung, sie schlafe mit ihrem geschiedenen Mann. Das erregte sie auf besondere Weise. Und das warnte sie immer wieder. Darum brauchte sie Zeit zwischen ihren Liebesnächten. Sie wusste, wenn sie sich Achim Bauer auslieferte, war sie geliefert wie schon einmal.
Gisela Werner hatte gelernt, hatte lernen müssen, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Sie war nicht besonders glücklich über diesen Zustand, aber unglücklich war sie acht Ehejahre lang gewesen.
"Möchtest du einen Kaffee?" Es war mehr eine Floskel als eine Frage. Sie spürte seine Unruhe, kannte den Grund und wollte ihn versöhnlich stimmen. Manchmal tat er ihr sogar leid. Sie tranken zwei-, dreimal in der Woche ihren Kaffee gemeinsam, wenn sie die anfallenden Aufgaben durchgingen. Solche Vertrautheit hatte es vor jener Dienstreise nicht gegeben. Sie dachten beide nicht daran, dass irgendwem dergleichen auffallen könnte, aber Gisela Werners Sekretärin machte sich ihre Gedanken. Feine Chefin, dachte sie, schließlich ist er verheiratet. Sie konnte ihn nicht leiden.
Während sie Kaffee tranken, entnahm er seiner Brieftasche dreihundert Mark und gab Gisela Werner das Geld. "Zahlst du es bitte ein?"
Sie nahm die Scheine. Sie hätte sie von Anfang an nicht nehmen dürfen. Jetzt war es zu spät. Sie wäre sich selber albern vorgekommen, wenn sie es nicht mehr getan hätte. "Damit sind es genau siebentausend", sagte sie, als lobte sie ein sparsames Kind. "Was willst du eigentlich mit dem Geld anfangen?"
"Na, was schon? Dich bestechen!" Er lachte schiefgesichtig. Hätte er den Willen gehabt, wirklich ehrlich zu sein, hätte er zugeben müssen, dass sein heimliches Sparen ohne Veras Wissen im Grunde genommen darauf hinauslief.
Er hatte Gisela gesagt, dass er sich scheiden lassen wollte. Aber mit nichts als dem Hemd auf dem Hintern, das er gerade trug, aus der Ehe gehen, wie es die meisten Männer machten, nur um fortzukommen, das sollte ihm nicht passieren. Er war sich im Klaren darüber, dass seine Frau einer Scheidung nicht einfach zustimmen würde, und meinte, dass sie, entspräche das Gericht nach langem Hin und Her doch seinem Antrag, um jedes Stück kämpfen würde, nur um sich an ihm zu rächen.
Gisela Werner hatte damals - gewiss in einem schwachen Moment, aber das ließ sich nicht mehr rückgängig machen - ein Sparbuch für ihn angelegt, auf das sie monatlich einzahlte, was er von seinem Gehalt beiseite legen konnte oder durch Nebenarbeit verdiente. Mitunter mussten technische Zeichnungen angefertigt werden, für die während der täglichen Arbeit die Zeit fehlte und die zwar nicht übermäßig, doch immerhin anständig honoriert wurden. Jedenfalls hatte er auf diese Weise in ziemlich kurzer Zeit eine ansehnliche Summe zusammenbekommen, von der seine Frau nichts wusste.
Das Geld war als Startkapital gedacht. Und insgeheim hoffte Achim Bauer, er könnte Gisela Werner irgendwann mit einer fünfstelligen Summe imponieren. Er ahnte nicht, dass sie, wenn sie die Beträge einzahlte, ein Gefühl hatte, als sei es unrechtmäßig erworbenes Geld. Sie nahm die dreihundert Mark und steckte sie schnell weg.
"Vergleichen wir die Termine", sagte sie. Er meinte, es gehe ihr darum, in Gegenwart der Sekretärin, die das Kaffeegeschirr abräumte, bei der Arbeit gesehen zu werden. Das war auch so, aber vor allem wollte sie die von ihr selbst bestimmte Distanz nicht verlieren, weder durch Nähe noch durch zu großen Abstand. Der Grat, auf dem sie wandelte, war sehr schmal und verlangte viel Selbstbeherrschung. In einsamen Stunden nannte sie sich nicht selten eine überspannte Person, die meinte, da sie einmal Pech mit einem Mann gehabt hatte, prädestiniert für Unfälle solcher Art zu sein, und darüber vergaß, dass ihre missglückte Ehe zu einem nicht unerheblichen Teil auch eigenes Versagen war. Vielleicht liebte er sie wirklich. Vielleicht brauchte nicht nur er sie, sondern sie auch einen Mann wie ihn? Aber Schwächeanfälle dieser Art, wie sie sie im Nachhinein nannte, gingen schnell vorbei. Trotzdem, so beherrscht, wie sie immer tat, war sie in Wirklichkeit gar nicht. Kann man von Notwehr sprechen, wenn es eine innere Not ist, gegen die man sich zur Wehr setzt?
Mit der Arbeit gewann sie ihre Sicherheit zurück. Sie verglichen Termine, Erfüllungsstände und statistische Werte. Ihr schien allerdings, dass Achim Bauer nicht so konzentriert bei der Sache war wie sonst. Sie wollte schon fragen, was mit ihm los sei, unterließ es aber, weil sie zu wissen glaubte, was ihn beschäftigte. Das schlechte Gewissen meldete sich. Behandelte sie ihn mitunter nicht zu distanziert, so als wäre nie etwas zwischen ihnen gewesen? Tat sie ihm vielleicht doch unrecht? Aber sie hielt sich an die Tatsache, dass er verheiratet war. Und wenn er sich, wie er wiederholt gesagt hatte, von seiner Frau trennen würde, was geschah dann? "Ist was, Achim?"
Er blickte erstaunt auf, weniger wegen der Frage, sondern wegen des unerwartet warmen Tones. Er schluckte und schüttelte verneinend den Kopf. "Wie kommst du darauf? Nein", sagte er. "War das alles?"
"Für heute, ja." Die Art, wie er antwortete, irritierte sie. Er hatte sich gut unter Kontrolle wie meistens. Aber irgendetwas schien ihn zu beunruhigen.
Gisela Werner blieb grübelnd sitzen, nachdem er den Raum verlassen hatte. Vielleicht ist das wirklich nur Emanzengespinne, sagte sie sich. Ich bin einfach das gebrannte Kind. Kein Mensch ist wie der andere und Achim nicht mein Verflossener. Was tue ich, wenn er sich tatsächlich scheiden lässt? Sie fand keine Antwort. Es störte sie allerdings, dass er seine Entscheidungen zu sehr an die ihren band. Statt klare Verhältnisse zu schaffen, ehe er ein neues einging. Aber bin ich besser, fragte sie sich. Er wäre nicht auf den Gedanken gekommen, mit mir in die Bar zu gehen. Das vernünftigste würde sein, einen klaren Schlussstrich zu ziehen. Es wäre auch das ehrlichste. Aber erst einmal können! So genau vermochte sie denn doch nicht zu trennen zwischen Bett und Büro. Blöde Hormone, dachte sie. Geht es ihm ähnlich?
Achim Bauer hatte das Zimmer der Abteilungsleiterin verlassen und die Tür zu seinem bereits geöffnet, als er plötzlich stehen blieb und zur Sekretärin sagte, sie möge ihm doch bitte mal ein Amt geben, er wolle seine Frau anrufen, es gehe ihr nicht gut.
Die Sekretärin sah ihn erstaunt an. Das hätte er auch von seinem Zimmer aus tun können. Der spielt den besorgten Gatten und kommt gerade von seiner... Sie dachte das Wort nicht einmal. Schlechtes Gewissen oder schlechtes Theater? Dass seine Ehe nicht besonders gut ging, wussten schließlich alle Mitarbeiter in der Abteilung. Sie gab ihm das Amt. "Ich lege es auf Ihr Zimmer, Kollege Bauer."
Kurz danach kam er wieder an die Tür und sagte: "Ich brauche in einer Stunde noch einmal ein Amt. Sie meldet sich nicht. Schläft wohl noch."
2. Kapitel
Wenn es sich einrichten ließ, machte Leutnant Niemz um zwölf Uhr Mittagspause. Es ließ sich selten einrichten, denn für einen Mitarbeiter der MUK - die Abkürzung klang besser als das ganze Wort: Morduntersuchungskommission - waren pünktliche Pausen Mangelware. Aber gelang es ihm dennoch einmal, rief er kurz vor zwölf seine Frau an. Auch sie war Mitarbeiterin der Kriminalpolizei, allerdings als gelernter Finanzkaufmann in einer Abteilung, die sich mit Straftaten gegen die Volkswirtschaft beschäftigte.
Manchmal klappte es wirklich, dass sie beide Zeit hatten und gemeinsam Mittag essen konnten. Handelte es sich dabei jedoch um einen Montag, gingen sie nicht in die Kantine, sondern einkaufen oder Schaufenster ansehen. Montags gab es in der Betriebsküche entweder etwas, das man nur gutwillig Makkaroni nennen konnte, oder Eintopf, der auch so aussah. An diesem Tag hatten Dietrich und Esther Niemz pünktlich Mittagspause. Es war ein Montag.
Er holte seine Frau ab. Sie trugen sich beim Diensthabenden aus. Als sie draußen auf der Straße waren, hakte sich Esther bei ihrem Mann ein. Und weil gerade jemand vorbeikam, der sah, wie sie das Tor passierten, hinter dem sich auch die Zellen für die Untersuchungshäftlinge befanden, und sie neugierig musterte, sagte Esther betont: "Also, was ist, hast du nun die Kaninchen geklaut oder nicht?"
Dietrich Niemz, auf das Spiel eingehend, antwortete herausfordernd: "Was geht dich das an? Frage ich, wozu du 'ne rote Handtasche brauchst?" Und als sich der Passant empört abwandte, kicherten beide wie Kinder über einen ungeheuren Spaß. Dietrich Niemz allerdings nicht ganz so ausgelassen wie seine Frau, der man den Schalk auch sonst ansah.
"Was kaufen wir heute?", fragte er Esther, denn sie gingen nie ziellos in die Stadt. Aber es war mehr Spiel als wirkliche Absicht, denn meistens handelte es sich um Möbel, die sie sich ansahen. Sie besaßen noch keine eigene Wohnung. Möbel kaufen — das bedeutete eigentlich Möbel ansehen, die sie vorerst gar nicht aufstellen konnten - gab ihnen ein bisschen die Illusion, bald ein eigenes Zuhause zu haben. Noch bewohnten sie ein Zimmer bei Esthers Eltern.
"Schlafzimmer!", erwiderte sie schnell. "Mir ist gerade so." Und dabei drückte sie seinen Oberarm gegen ihre linke Brust.
"Ist es dafür nicht etwas zu hell?", gab er zu bedenken. "Was sollen die Leute sagen?"
"Nur aussuchen, nicht ausprobieren", erklärte sie und wiederholte den Druck. Sie waren gerade ein halbes Jahr verheiratet und so verliebt ineinander, wie man es sein muss.
Möbel kaufen war also nicht ernst gemeint, jedenfalls nicht in dem Sinne, Möbel wirklich kaufen zu wollen. Denn eine eigene Wohnung, das war ihnen gesagt worden, darauf müssten sie schon noch ein wenig warten. Sie hatten ja noch nicht einmal ein Kind, um auf die Dringlichkeitsliste gesetzt zu werden, die eigentlich Dringlicherkeitsliste hätten heißen müssen. Also, Schlafzimmer stand heute auf dem Programm.
Auf dem Weg in die Stadt kamen sie am Kleinen Markt vorbei. Sie kauften jeder eine Bratwurst und aßen sie vor den großen Fenstern des Möbelhauses. Das Problem mit den Betten bestand unter anderem auch darin, dass Dietrich Niemz mehr als Gardemaß besaß, einssechsundachtzig, und dass alle Betten nicht länger als einsneunzig waren. Herzliche Grüße vom Orthopäden. Sie schliefen auf einer breiten Couch, auch nicht mehr das neueste Modell.
"Französische Betten sind ohnehin schöner", erklärte Esther.
Er schüttelte missbilligend den Kopf und schnalzte scheinbar pikiert mit der Zunge. "Welche Abgründe entdecke ich in dir, Weib!" Dann gingen sie in den Laden.
In sieben Kojen abgeteilt, waren die zum Verkauf freien oder zur Bestellung möglichen Schlafzimmer aufgebaut. Mal Birke, mal Eiche, mal Palisander - Furnier natürlich immer. Eins mit blauem Jeansstoff bezogen, eins in grellem Grün gestrichen, eins ganz in Weiß. Und eines war phantastisch schön, genau das, was sie suchten, allerdings mit einem kleinen Schild versehen: "Verkauft". Und bestellen, erklärte ihnen die Verkäuferin, könne man es ohnehin nicht, das Modell sei eigentlich für den Export bestimmt.
"Und ausprobieren?", fragte Esther mit einem Unterton, der kurz vor einer Herausforderung lag.
Die Verkäuferin musterte sie abschätzend. Kunden gibt es! "Was glauben Sie, weshalb wir die Kojen mit einer Schnur abgetrennt haben? Die Leute würden sonst alles begrapschen."
Das ging Esther gegen den Strich. "Vielleicht", sagte sie, "machen das die Kunden, weil sie wissen wollen, was sie für ihr teures Geld kaufen sollen!"
Dietrich Niemz wurde unruhig. Schließlich, wenn jemand wüsste, wer sie waren, könnte er Esthers Bemerkung missdeuten, und er versuchte, sie durch eine vorsichtige Berührung der Schulter weiterzuführen. Aber da hatte sich Esther bereits steif gemacht. "Wie sind die Matratzen?," fragte sie herausfordernd.
"Meine Dame", erklärte die Verkäuferin so betont höflich, dass man ihren Widerwillen heraushörte, "das Modell ist bereits verkauft, und es ist nur einmal vorhanden. Warum wollen Sie dann wissen, wie die Matratzen sind? Wählen Sie sich doch eins unserer anderen Schlafzimmer aus."
"Wenn das Ihr einziges Schlafzimmer dieser Art ist und ohnehin bereits verkauft, warum stellen Sie es dann überhaupt aus? Um den Kunden vorzuführen, was sie nicht bekommen können?"
"Esther!", bat Dietrich Niemz leise, dem das ganze nun doch entschieden zu weit ging.
Sie schien ihn nicht zu hören. Und die Verkäuferin wandte sich mit der Bemerkung ab, dass die Kundin sich ja beim Verkaufsstellenleiter beschweren könne, sie sei für die Einrichtung der Kojen nicht zuständig, und außerdem wollten noch andere Leute bedient werden.
Auf Esthers Stirn hatte sich eine drohende Falte gebildet. Ihr Mann wusste, dass es im Augenblick wenig Sinn haben würde, seiner Frau zu erklären, wie unpassend die Szene war, die sie der Verkäuferin gemacht hatte, zumal er ihr im Grunde genommen recht geben musste. Natürlich war es ärgerlich für die Kundschaft, ein Modell zu betrachten, das nicht zu kaufen war, obwohl es qualitätsmäßig von den Einrichtungen in den anderen Kojen sichtbar abstach. Aber der Verkäuferin konnte man daraus keinen Vorwurf machen. Er schluckte also den Kommentar hinunter und verließ mit Esther das Möbelhaus.
Auf der Straße entwölkte sich allmählich ihr Gesicht. Lange konnte sie ohnehin nicht zornig sein. "War wohl nichts, was?", fragte sie etwas kleinlaut.
Er neigte sich zu ihr und küsste ihr Haar. "Das nächste Mal kaufen wir Kochtöpfe. Die darfst du alle begrapschen, einverstanden?"
"Oder Babysachen."
"Oder Babysachen." Er lachte. Und plötzlich blieb er stehen. "He, wie kommst du auf Babysachen?"
Sie sah ihn an. Leichte Röte huschte über ihr Gesicht. "Wenn du mich besser verhört hättest, Genosse Leutnant, wüsstest du es schon längst."
Er war sonst wirklich nicht begriffsstutzig, aber diesmal brauchte er seine Zeit. Außerdem konnte ihn Esther mit dem unschuldigsten Gesicht necken. "Ein rechtzeitiges Geständnis wirkt sich positiv auf die Zumessung des Strafmaßes aus, Bürgerin." Aber dann begriff er, dass es kein Scherz war. "Esther", sagte er ganz dünn, fast ängstlich, "Esther, stimmt das?"
Sie hielt seinem Blick stand. Sie sah, wie ihm die Augen feucht wurden. Und da war ihr gleichgültig, dass sie mitten in der Fußgängerzone standen, von unzähligen Passanten umströmt. Sie sagte nur: "Wir bekommen ein Kind, Dietrich", denn jedes weitere Wort wäre ohnehin an seiner Brust erstickt. Er nahm seine fast einen Kopf kleinere Frau in die Arme und presste sie an sich und hätte jubeln können, wenn er sich dabei nicht komisch vorgekommen wäre.
Sie mussten sich beeilen, um in die Dienststelle zurückzukommen, denn die Mittagspause war gleich vorbei. Ihre aufgeregte Freude versteckten sie hinter scheinbar ruppigen Bemerkungen. "Ob auch alles dran ist an ihm?", überlegte Dietrich Niemz und sah seine Frau zweifelnd an.
"Pfuschst du neuerdings?", hielt sie lachend dagegen. "Ein Glück, dass wir zum Nachbessern noch etwas Zeit haben."
Der Diensthabende sah sie aufs Tor zukommen. Es war ein älterer Genosse, und er schmunzelte. Er mochte glückliche Menschen. Viele waren es nicht, die seine Pforte passierten. Die meisten Leute, wenn sie nicht gerade selbst Mitarbeiter der VP waren, hatten ihre Sorgen oder ein schlechtes Gewissen. Da fielen zwei wie Esther und Dietrich Niemz schon auf, denn selbst wer hier arbeitete, sah selten die Sonnenseite des Lebens.
"Genosse Leutnant", sagte er, als sie das Tor erreicht hatten, "es ist schon nach Ihnen gefragt worden, Sie sollen sich gleich bei Hauptmann Beer melden. Er hat bereits zweimal bei mir anrufen lassen,"
Dietrich Niemz bedankte sich für die Mitteilung. Und zu Esther sagte er: "Kann sein, dass ich heute später nach Hause komme. Ich weiß noch nicht, was anliegt."
"Du willst dich nur um die Nacharbeit drücken", antwortete sie. "Hoffentlich wird unser Kind ein Ladendieb."
Er sah sie fragend an, weil er nicht wusste, was sie damit sagen wollte.
"Dann hätten wir endlich mal einen gemeinsamen Fall und einen gemeinsamen Feierabend!"
Sie verabschiedeten sich mit einem schnellen Kuss. Vor dem Zimmer von Hauptmann Beer traf Niemz einen Genossen seiner Abteilung. "Was ist los?", fragte er.
"Kellerstraße sieben, erste Etage links, Tod durch Gas. Eine Vera Bauer."
3. Kapitel
Frau Graff war kurz nach elf Uhr vom Einkaufen zurückgekommen. Sie ging zuerst in die Werkstatt des Glasermeisters Juppe, der ihr an diesem Morgen ungewöhnlich viele Besorgungen aufgetragen hatte. Er musste überhaupt einen guten Tag haben, denn er blubberte nicht vor sich hin, wie er das sonst gewöhnlich tat.
Sie packte das Netz aus. Fisch für die Katze, ein Weißbrot, obwohl montags weit und breit kein Bäcker geöffnet hatte. Sie war bis ins Zentrum zur Kaufhalle gegangen. Dann hatte sie das Transistorradio von der Dienstleistung abgeholt, das nun wieder den ganzen Tag quäken würde, wenn Wilhelm Juppe in der Werkstatt war. Und schließlich hatte er sie noch nach einer Zeitschrift geschickt, "Guter Rat", dafür hatte sie fast die Kioske der halben Stadt abklappern müssen. Ein Glück, dass sie mit ihren dreiundsechzig Jahren noch gut zu Fuß war.
Sie rechnete Juppe vor, was sie von den fünfzig Mark ausgegeben hatte: sechsundvierzig Mark und siebenunddreißig Pfennige.
Der Glasermeister schob das Kleingeld zurück. "Ist für Sie, Graffen."
Sie blickte ihn verdutzt an. "Ist heute Weihnachten?"
Er bereute bereits, ihr soviel Trinkgeld gegeben zu haben. "Das ist für die ganze Woche!", knurrte er. "Wo haben Sie denn die Zeitung her?" Er fragte, als hätte er nicht erwartet, dass sie den "Guten Rat" überhaupt bekommen würde.
"Ich kenn da eine."
Er winkte ab. "Wo kennen Sie mal nicht eine, Graffen? Werden die ganze Zeit geschnattert haben. Waren fast drei Stunden unterwegs."
Danke war ein Wort, das Glasermeister Juppe nicht zu kennen schien. Sie ärgerte sich jedes Mal, dass sie immer wieder Besorgungen für ihn machte. Nun ja, wenn mal etwas kaputt war in ihrer Wohnung, reparierte er es, seit Paul tot war, wenn sie ihn auch wochenlang bitten musste. Dabei war es sein Haus, und er hätte eigentlich ein Interesse daran haben müssen, dass alles in Ordnung war. Bei Bauers, da steckte er alle naslang den Kopf durch die Tür. War ja auch der Herr Ingenieur. Juppe hielt es eben mit besseren Herrschaften. Sie war nur eine alte Frau.
Frau Graff verließ die Werkstatt. Im Hausflur sog sie prüfend die Luft ein. "Wonach riecht 'n das, Herr Juppe? Haben Sie irgendwo Gas an oder so was?"
"Nee!", rief der Glaser aus der Werkstatt. "Ich hab 'n Furz gelassen. Gucken Sie lieber in Ihrer Küche nach, ob bei Ihnen noch alles dicht ist. Sie brennen mir mit Ihrer Schusseligkeit sowieso eines Tages die Bude ab." Mit dem rechten Fuß schlug er die Tür zu, dass die Scheiben schepperten.
"Der Schuster hat die schlechtesten Schuhe, und beim Glaser klirren die Fenster", brummelte Frau Graff vor sich hin und stieg die Treppe zu ihrer Wohnung hoch. Dabei musste sie sich am Geländer festhalten. Laufen konnte sie gut, aber das Treppensteigen machte ihr Schwierigkeiten. Der Gasgeruch nahm zu. Da beeilte sie sich, die letzten Stufen zu nehmen. Hastig schloss sie ihre Wohnungstür auf und ging in die Küche. Hatte sie vielleicht den Gashahn nicht richtig zugedreht? Nein, von da kam der Geruch nicht. Sie stellte das Netz mit den restlichen Einkäufen auf den kleinen Tisch unterm Küchenfenster. Viel war es nicht, was sie für sich alleine brauchte. Dann hängte sie ihren Mantel auf. Der Gasgeruch war im Flur stärker. Er musste von draußen kommen.
"Vielleicht bei Bauers", sagte sie. Frau Graff hatte sich angewöhnt, mit sich selbst zu reden. Das gab ihr das Gefühl, mit jemand sprechen zu können, der hierher gehörte und doch nicht mehr da war. "Ich geh mal klingeln, Paul." Als ob er noch am Tisch säße und seinen grässlichen Stumpen zum Küchenfenster hin ausrauchte.
Sie schlurfte über den Flur. Draußen roch es widerlich nach Gas. Es konnte nur von Bauers kommen. Sie klingelte. Nichts zu hören. Sie wollte ein zweites Mal auf den Knopf drücken, erinnerte sich aber noch rechtzeitig, dass man bei Gasgeruch nichts Elektrisches anmachen sollte, und erschrak nachträglich. Sie klopfte und rief: "Frau Bauer!" Und als niemand antwortete, wiederholte sie lauter: "Frau Bauer, sind Sie da?" Dann trommelte sie mit ihren kleinen, mageren Fäusten aufgeregt gegen die Tür. Niemand antwortete.
"Is 'n los da oben?", dröhnte Juppes Stimme herauf. "Wollt ihr mir das Haus kaputtschlagen?"
"Mann, Juppe", rief Frau Graff fast atemlos, "kommen Sie bloß hoch, hier riecht's wie in der Gasanstalt!"
Da war er mit wenigen Sätzen, immer zwei Stufen auf einmal nehmend, was man ihm bei seiner Leibesfülle gar nicht zugetraut hätte, in der oberen Etage. Er fasste an die Klinke. "Abgeschlossen."
Frau Graff nickte. "Und klingeln darf man auch nicht, sonst fliegt uns das ganze Haus um die Ohren."
"Bin ich doof?", fragte er. "Zur Seite!" Und als sie Platz gemacht hatte, nahm er einen kurzen Anlauf und rammte sein ganzes Gewicht von fast zwei Zentnern gegen die Tür zu Bauers Wohnung. Krachend flog sie auf. Juppe wäre fast hingeschlagen. Er fasste nach der Klinke der Küchentür. "Verdammt, auch abgeschlossen." Er bückte sich und schaute durchs Schlüsselloch. "Der Schlüssel steckt von innen. Kommen Sie mal her und überzeugen Sie sich selbst. Hinterher heißt es noch, ich hätte die ganze Wohnung demoliert."
Obwohl Frau Graff fast übel wurde von dem Gasgeruch, folgte sie seiner Aufforderung und guckte durch das Schlüsselloch. "Stimmt", sagte sie, "von innen abgeschlossen." Jetzt erst begriff sie, was geschehen sein musste, aber noch war sie zu keiner Reaktion fähig.
Der obere Teil der Küchentür war verglast, kleine Felder mit getönten, auf einer Seite geriffelten Scheiben, durch Holzstege voneinander getrennt. Mit dem linken Ellenbogen schlug Wilhelm Juppe eines dieser Glasfelder heraus, griff durch das Loch und drehte den von innen steckenden Schlüssel herum.
Dann öffnete er die Küchentür. Frau Bauer lag vor dem Herd, aus dem hörbar das Gas ausströmte. Juppe lief zum Fenster im hinteren Teil der Küche, riss die beiden schmalen Flügel auf und atmete heftig die frische Luft ein.
Frau Graff stand an der Tür, die Hände vors Gesicht geschlagen, und murmelte ein Ogottogott, als könnte das die junge Frau wieder auferstehen lassen.
Juppe drehte den Haupthahn der Gasleitung zu. Dann fasste er die Liegende von hinten um den Oberkörper und rief der alten Frau zu, sie solle nicht herumstehen, sondern zupacken. "An den Beinen!", fuhr er sie an, als sie noch immer unschlüssig dastand. Gemeinsam trugen sie Vera Bauer aus der Küche in die Wohnung von Frau Graff hinüber. Sie legten sie auf das Sofa. Wilhelm Juppe fasste nach dem Puls, er hob das rechte Augenlid der Frau hoch und horchte auf die Herzschläge, als ob er etwas davon verstünde. Dann sah er Frau Graff an und schüttelte traurig den Kopf. "Sie ist offenbar tot"
"Ogottogottogott", wiederholte sie ihren Seufzer von vorhin. "Die arme Frau. Das hat sie nur seinetwegen gemacht. Ich hab gewusst, dass das nicht gut ausgehen kann. Ich hab's gewusst, Herr Juppe."
"Was reden Sie da? Was konnte nicht gut ausgehen?", frage er.
"Sagen Sie bloß, das haben Sie nicht gewusst. Dieser Kerl, der Bauer, der hat doch längst eine andere. Das sind die Schlimmsten, die immer so vornehm tun. Die arme Frau, krank war sie auch."
"Was reden Sie bloß wieder zusammen?", fuhr Juppe sie an. "Ich geh mal telefonieren. Decken Sie ihr was über und bleiben Sie hier." Er verließ die Wohnung und polterte die Treppe hinunter. Zuerst verständigte er die Polizei. Sie fragten ihn, ob er schon einen Arzt angerufen habe. Er verneinte. Sie brauche keinen mehr. Der Mann am anderen Ende der Leitung sagte, dass ein Arzt entscheiden müsse, ob die Frau tot sei, und kein Laie. Das Wort empfand Juppe als Beleidigung. "Rufen Sie doch selbst an!" Und er dachte, dass er der Polizei nicht mehr helfen würde, als unbedingt nötig.
Die Schnelle Medizinische Hilfe kam, als der Glasermeister wieder in der Graffschen Wohnung war. Der Arzt hielt sich nicht lange mit der Untersuchung auf. "Sie lebt noch, schnell!" Mit nervendem Sirenengeheul wurde Vera Bauer in die Klinik gebracht. Herr Juppe war ganz blass geworden, als man sie an ihm vorbeigetragen hatte. Frau Graff bemerkte es und dachte, er ist doch nicht so hart verpackt wie er immer tut.
Noch auf dem Weg in die Klinik starb Vera Bauer.
4. Kapitel
Leutnant Niemz fuhr den Lada. Hauptmann Beer saß neben ihm. "Sie werden die Untersuchung leiten, Genosse Niemz", sagte er. "Ich komme nur mit, weil ich ohnehin in diese Richtung muss. Dabei kann ich mir gleich alles ansehen, falls Sie später Fragen haben sollten."
Na klar, dachte Dietrich Niemz. Frau, die sich in der Küche einschließt und den Gashahn aufdreht, ein äußerst komplizierter Fall, man muss auch den jüngeren Genossen gelegentlich Verantwortung übertragen. Er nickte nicht unbedingt begeistert.
"Die Genossen von der Spurensicherung sind bereits unterwegs. Sie warten sicherlich schon auf uns. Wo waren Sie eigentlich?", fragte Beer.
"Ich habe mich ausgetragen, Genosse Hauptmann", antwortete Niemz, der die Frage missverstanden hatte. Beer wollte bloß über irgendetwas reden, um dem jüngeren Genossen den Einstieg in den Fall leichter zu machen. Würde er ihn jetzt mit gut gemeinten Hinweisen befrachten, ging er vielleicht von vornherein mit der verkrampften Haltung an die Arbeit, um Himmels willen keinen Fehler zu machen.
"Das war kein Vorwurf, nur Neugier", erklärte der Hauptmann.
Dietrich Niemz dachte an den Mittag mit Esther. Er lächelte. "Wir waren einkaufen, meine Frau und ich." Und dann — er hätte es doch nicht für sich behalten können, dafür war die Freude viel zu groß - sagte er stolz: "Wir bekommen nämlich ein Kind, Genosse Hauptmann!"
"Wir beide?" Beer lachte. "Glückwunsch, Genosse Niemz! Da werde ich wohl der Wohnungskommission einen Wink geben müssen."
Niemz sah seinen Vorgesetzten dankbar an. "Wäre nicht verkehrt, Genosse Hauptmann", sagte er. Dann lenkte er den Wagen in die schmale Straße mit dem Kopfsteinpflaster, bremste und hielt an. "Kellerstraße sieben, Glaserei Juppe, Genosse Hauptmann." Der Wagen der Kriminaltechniker stand bereits da, die Genossen warteten auf den Untersuchungsführer.