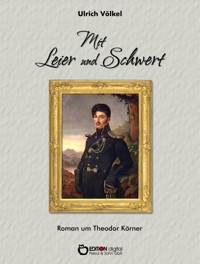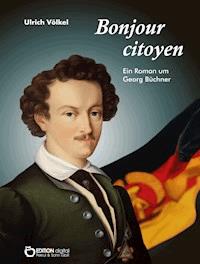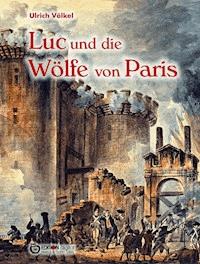7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wussten Sie schon, dass ein Admiral kommt, wenn Sie auf drei Fingern pfeifen? Ehrlich gesagt, es klappt auch nicht immer - meistens muss man zweimal pfeifen. Aber der Matrose Sauernig schafft es auf Anhieb. Dabei möchte er gar nicht so einen sauertöpfischen Namen haben und viel lieber die Reporterin Fröhlich heiraten, denn nach dem neuen Familiengesetz ... Doch erst einmal fällt er ins Wasser, und das ausgerechnet in Gegenwart des Admirals. Aber sonst ist dies ein heiterer Roman. Er handelt von einem Bürgermeister, der während der Predigt „Bravo!“ ruft, und Cäcilie Feldmann will mit ihrem Lottogewinn eine neue Straße bauen. Ihr Sohn ist Maat bei der Volksmarine, die Antiquitätenfirma Musch & Meier kauft alte Hutschachteln, und auch sonst passiert allerhand ... INHALT: Die Stunden der Sonntage Auf der Brücke mit Marie Sommergeräusche Der Admiral Freunde LESEPROBE: Da kam wirklich einer auf dem Motorrad angeknattert, kam genau auf die Brücke zu, bremste plötzlich scharf und sagte: „Nanu, Werner, was machst du denn hier?“ „Tag, Onkel Erich!“, sagte Werner erfreut. „Ich dachte schon, ich krieg’ keinen mehr zu sehen von uns. Wir haben Übung, weißt du? Ich bin hierher geschickt worden auf Vorposten. Unser Chef ist in Ordnung, der lässt mich Heimatluft schnuppern.“ „Das ist Taktik“, sagte Nig. „Damit er besser verteidigt. Tag, Onkel Erich.“ Erich Bruswater lachte. „Dein Putzer?“ „Das ist Nig, irgendwie mein Kumpel.“ Und zu Nig sagte Werner: „Erich Bruswater, unser Vorsitzender. Ich hab’ dir erzählt von ihm.“ „Ja, er hat die schöne Tochter. Weiß Bescheid. Sieht ganz sympathisch aus. Könnte einer von meiner Verwandtschaft sein.“ Erich blickte Werner an. Er suchte etwas im Gesicht des Jungen und fand Verlegenheit. Wegen Marie, dachte er. „Das mit dem Vorsitzenden stimmt nicht mehr seit einer Woche. Ich bin auf der letzten Versammlung abgelöst worden. Jetzt regiert meine Frau wieder. Ist schon ein Kummer. Um den Doktorhut komme ich wohl nicht herum.“ Das war auch ein Kummer, tatsächlich. Davon musste Werner dem Nig gelegentlich erzählen, die Geschichte von Erich Bruswater und seiner Frau Mimi, die er Onkel und Tante nannte, obwohl sie es gar nicht waren. Er hätte viel lieber Vater und Mutter zu ihnen gesagt. Aber das war wiederum eine Geschichte, und die konnte man dem Nig nicht erzählen. Der hatte einmal, als Werner anfing von Marie zu reden, gesagt: „So umständlich, wie du dich anstellst in Sachen Mädchen, da muss ich dich mal auf einen Kursus schicken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 219
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Impressum
Ulrich Völkel
Auf der Brücke mit Marie
Fünf Geschichten anstelle eines Romans
ISBN 978-3-95655-510-7 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien erstmals 1973 im Militärverlag der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin.
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2015 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
Die Stunden der Sonntage
Sie waren neunzehnhundertfünfundvierzig aus Stettin geflohen; einer Stadt, die schon lange Szczecin heißt. Mutter zog den Tafelwagen, auf dem die geringen Habseligkeiten verstaut lagen, und obenauf saß der Junge. Großvater schob. Manchmal den Wagen, manchmal mit Zigaretten. Beides war früher nie seines Standes gewesen, Herr Rittmeister a. D.; denn sie flohen vor den „menschenfressenden Russen“, den „Frauen vergewaltigenden Bolschewiken“. Flohen aus ihrer Stadt heim ins Reich. Sie gehörten zu denen, die das Orakel falsch gedeutet hatten, wonach sie ein großes Land zerstören würden, wenn sie seine Grenzen überschritten. Sie waren nicht darauf gekommen, zur rechten Zeit, dass es ihr eigenes Land sein könnte. Der Herr Rittmeister kam nicht darauf, nicht sein Sohn, der Oberleutnant, und dessen nunmehrige Witwe Cäcilie Feldmann auch nicht. Zusätzlich einige Millionen, die jetzt alle durch das Land Deutschland flohen (oder was noch davon da war) und viel Elend sahen.
Dennoch wurde Werners fünfter Geburtstag gefeiert, und sie lebten in Saus und Braus. Da war nämlich unterwegs ein Proviantamt gestürmt worden. Frau Oberleutnant entwickelte bei der Gelegenheit sehr praktische Fähigkeiten. Sie schmiss, was sie entbehren konnte, vom Wagen und lud statt dessen Käserollen auf, groß wie ein Karrenrad, und Würste und Zucker und Mehl. Viel war es trotzdem nicht, was sie mitschleppen konnten. So wurde wieder einmal sichtbar, wie gut dran ist, wer reich ist und gesund. Denn die vermögenden Bauern der Umgegend kamen mit großen Leiterwagen vorgefahren und luden auf zu Zentnern, was sie bald gegen Bettwäsche, gegen Gold und Schmuck der hungrigen Städter eintauschen konnten nach dem Wechselkurs der Zeiten: ein Goldring - ein Sack Kartoffeln.
Das war ein Leben! Werner erinnerte sich noch lange an diese wunderbaren Wochen. Man fuhr durch das große Land, saß auf dem Tafelwagen zwischen Wurst und Fliegerschokolade, die Vögel tirilierten den Frühling zusammen, und nur noch selten brach ihr Lied ab, weil sich ein schnelles Stück Eisen verirrt hatte, das eigentlich einen Menschen treffen sollte.
Warum bloß jammerten die Erwachsenen? Großvater wurde sogar zärtlich in seinem Kummer. Er sah Werner an und sprach: „Du wirst uns rächen, mein Junge. Du wirst ein deutscher Soldat werden, wie dein Vater und dein Großvater es waren. Deutschland setzt alle Hoffnung in deinesgleichen.“
Werner setzte zunächst alle Hoffnung auf seinen Geburtstag.
Gefeiert wurde mit Opas vaterländischer Ansprache. Mutter hatte ein Stück richtige Seife organisiert. Das fand Werner weniger lustig, weil man sich damit waschen musste. Den wahren Wert entdeckte er erst, als er feststellte, womit sich andere wuschen. Fingernagelgroß vertauschte er das Geschenk fürs Seifenblasen gegen Würfelzucker, Knöpfe, Taschenmesser und Zigarettenbilder. Es waren herrliche Zeiten angebrochen. In Stettin hatte man längst nicht so gut Geburtstag feiern können.
Im Proviantamt hatten sie auch ein paar kleine Tafeln Wachs mitgehen lassen, das nahm Mutter zum Braten. Einen Kochtopf besaßen sie und eine Pfanne. Großvater baute aus Feldsteinen einen Ofen. Und wenn sie sich irgendwo Kartoffeln erbettelt oder erschoben hatten, machte Mutter Pommes frites. Sie briet die Kartoffeln in Wachs. Das schmeckte ekelhaft, und Werner konnte nicht einsehen, warum es auf dieser wunderbaren Reise kein richtiges Essen gab wie zu Hause.
Nun war der Junge also fünf Jahre alt geworden. Die Mutter nahm eine leere Leuchtpatrone, befestigte einen Wollfaden an einem Knopf, versenkte ihn in der Hülse und goss flüssiges Wachs hinein. Wenn es erkaltet war, zog sie eine Kerze heraus, fünf insgesamt. Das war sein schönstes Geschenk; denn als die langsam herunterbrannten, begriff der Junge, dass man damit keine Pommes frites mehr machen konnte.
Der Spaß an der Reise ließ jedoch bald nach; denn sie wurde immer länger und hatte noch kein Ziel gefunden. Überall, wohin sie kamen, fanden sie vor, was sie verlassen hatten: Unglück, Hunger, Ruinen und die Angst vor dem Krieg. Nein, die große Reise machte keinen Spaß mehr. Die Mutter hatte auch die Kraft verloren, hübsche Märchen zu erfinden, Lieder zu singen oder freundlich mit dem Jungen zu reden. Eines Tages sagte sie: „Es ist aus.“
Das war an einer hölzernen Brücke, die über einen Fluss führte hin zu dem Dorf Ambach. Der Rittmeister verstand nicht. „Was ist aus?“, wollte er wissen. „Die anderen ziehen weiter. Wir gehen mit.“
„Wohin?“, fragte die Mutter.
„Als ob es darauf ankommt!“, sagte der Großvater ärgerlich. „Die anderen ziehen weiter, also marschieren auch wir.“
„So. Marschieren“, sagte die Mutter. „Marschieren.“ Und dann sagte Frau Oberleutnant verwitwet zum Herrn Rittmeister a. D.: „Du kannst mich mal!“ Das war so ungeheuer neu in der Familie, dass der Großvater betroffen schwieg.
Der Treck zog nächsten Morgen weiter. Den kümmerte es nicht, dass welche liegen blieben. Er kannte das längst und hatte kein Interesse an den Abgefallenen. Nicht einmal einen Strich machte er auf seiner Liste oder schrieb: Drei Mann Verlust an der Brücke nach Ambach. Auch der Treck war am Ende, weil kein Ende abzusehen war.
Als sie den Tag gesessen hatten, ohne zu reden, ohne etwas zu essen, sagte der Rittmeister - nein, der Großvater sagte müde: „Was soll nun werden, Cäcilie?“ Er war ein alter Mann geworden unversehens.
Am Abend kam ein Mädchen mit einem Krug Milch. Sie hieß Marie, war fünf Jahre alt und hatte das Häuflein seit dem Morgen beobachtet. Die Milch sollte sie den Katzen bringen, hatte der Vater gesagt. Gierig trank sie der Junge. Das Mädchen sagte: „Ich weiß, wo ihr wohnen könnt. Ich hab’ ein feines Versteck. Dort stört euch niemand. Komm!“
Da gingen sie eben mit. Wenn jemand ein richtiges Ziel hatte damals, gingen die Leute einfach mit.
Marie führte die Flüchtlinge zur Feldscheune, schob zwei Bretter auseinander und zeigte ihnen das Versteck im Stroh. Platz war genug, trocken und geschützt. Hier konnte man endlich ausruhen. Und Marie beschaffte an den nächsten Tagen was zu essen. Sie lehrte die Hühner, ihre Eier in neue Nester zu legen, entzog den Katzen die Milch und stahl Wurst und Brot aus der Speisekammer. Wenn der Bauer aus dem Haus war, half ihr Werner dabei.
Es wurde ein aufregendes Leben. Sie unternahmen beide kleine Ausflüge und hatten eine Stelle an der Pinne gefunden, wo sie herrlich spielen konnten. Marie war prima, nicht so ein zimperliches Gör wie die Mädchen zu Hause in seiner Straße. Sie konnte sogar Mäuse anfassen und Spinnen, wusste auch, wie man mit einem Strohhalm die Milch unterm Rahm hervorzaubert. Werner lernte eine Menge wichtiger Sachen fürs Leben.
Aber der Großvater verfiel in dieser Enge, als ob er in den wenigen Tagen an Altwerden nachholen müsste, was er bisher versäumt hatte. Die Mutter sah sich das gerade eine Woche an. „Wir müssen hier wieder fort“, sagte sie. Das verstand Werner nicht. Es ging ihnen doch gut? Er redete mit seinem Freund darüber, mit Marie. Die wusste noch keinen Rat, aber sie wollte helfen.
Am nächsten Morgen trat der Bauer Erich Bruswater in die Scheune und rief: „He, ihr da in der Höhle, kommt mal ’raus!“ Seine Tochter Marie stand in sicherer Entfernung. Sie bebte vor Angst.
Da krochen sie hervor und starrten auf Erich Bruswater. Der sah sich die kläglichen Gestalten an. Es waren eine Frau, aschfahl im Gesicht, ein alter Mann, sehr alt. Und der Junge. Der kam als letzter hervor. Gerade als der Bauer losdonnern wollte: ,Ihr Gesindel, ihr verfluchtiges! Schert euch davon, oder soll ich mir die Pest ins Haus holen?', ebenda ging Werner auf ihn zu, gab ihm die Hand und sagte: „Tag, Onkel. Wir sind schon lange hier. Marie hat mir viel erzählt von dir. Sie ist mein Freund. Und das sind wir.“
Erich Bruswater guckte sich verdutzt den Knirps an. Die Mutter konnte nicht schreien vor Schreck. Nach Jahren wurde ihr erst klar, dass ihnen der Junge das Leben gerettet hatte, das menschliche Leben. Denn das auf der Landstraße konnte man bestenfalls ein Dasein nennen.
Marie flüsterte ganz leise: „Papsi.“ Der Vater konnte es eigentlich gar nicht hören.
„Mitkommen!“, sagte der Bauer, und seine Stimme klang nun weniger streng. Sie folgten ihm. Er sah sich nicht um. Sie gingen aufs Dorf zu und dann auf den Hof. Sie wussten nicht, was werden sollte. Die Front rückte immer näher.
Der Bauer trat ins Haus. Die Bäuerin stand da und wischte sich die Hände ab an der Schürze. Aber die waren längst trocken.
Erich Bruswater stieg die Treppe hoch, seine Gefangenen folgten ihm. Mit dem Fuß stieß er die Tür auf zur Gerümpelkammer. „Aufräumen!“, befahl er. Und sie gehorchten.
So begann ihr Leben nach dem Krieg. In einer Wohnung, einer richtigen Wohnung, die im Winter warm sein würde; denn darunter lag der Kuhstall. Man hörte das dumpfe Rumoren der Tiere. Marie kam am Abend und brachte eine dampfende Schüssel Suppe, dazu Brot. Werner sagte: „Wir könnten heiraten.“ Und galt seither als ihr Bräutigam.
Die Jahre vergingen. Schwere Jahre, die aber in der Erinnerung leicht wurden für Werner. Nicht das Bittere blieb nach, sondern das Fröhliche. Für Werner war das Erinnern an die Nachkriegszeit nicht verbunden mit Hunger, Armut oder Verzweiflung. Irgendwie war da immer Marie.
Also, sie begannen zu leben. Der Frau fiel die Arbeit als Magd schwer, doch sie schuftete, ohne aufzusehen. Der Großvater saß meistens hinter dem Haus und starrte vor sich hin. Der Bauer war gut zu ihnen und auch die Bäuerin. Die Kinder begannen mit anderen Dingen zu spielen als mit leeren Granathülsen.
Der Krieg war aus. Der Führer tot. „Krepiert!“, sagte der Bauer verächtlich wie von einem räudigen Köter. Und dann kamen die Sieger ins Dorf.
Sie schlugen ihr Lager bei der Feldscheune auf, und mancher im Dorf zitterte, wenn abends ihre Musik herüberklang.
Eines Tages kam der Junge nicht nach Hause. Die Mutter machte sich Sorgen seinetwegen. Und als jemand sagte, er habe Werner zur Feldscheune gehen sehen, lief sie zu Walter Macks. Er besaß einen bissigen Hund und eine scharfe Axt.
„Walter“, sagte sie, „nimm den Hund und die Axt, wir müssen zu den Russen.“
Walter Macks schwieg.
„Wenn du dich nicht traust, ich geh’ allein. Gib mir den Hund mit. Eh sie mir den Jungen auffressen!“
Da kam er mit. Er hatte den Hund losgemacht, und sie trug die Axt. Das Dorf hielt den Atem an. Der Posten legte die MPi zurecht. „Stoi!“ Aber die Mutter verlangte den Herrn Offizier zu sprechen.
In einem Kreis lachender Soldaten saß Werner und lachte mit. Er lernte Russisch und konnte schon „dawai!“ sagen und „durak“ und „Frietz“. Die Frau trat in den Kreis, griff sich den Jungen mit der linken Hand, schwang die Axt in der rechten und schrie: „Jetzt ist Frieden!“
Sie starrten die Mutter an und begriffen nicht. Aber sie machten auch nicht Platz.
Walter Macks erzählte die Sache später so: „Dem Hund warfen sie ein Stück Fleisch vor. Und mich schleppten sie vor einen Stapel Holz. ,Rabota!‘, sagten sie. Und ich arbeitete. Die Frau steckten sie in die Küche, und auch zu ihr sagten sie: ,Rabota!‘ Da haben wir halt unsere Rabotationskosten erstattet und ihnen eine Mahlzeit gekocht. Und selber mitgegessen. Dabei muss Cäcilie ihre Angst vor den Soldaten hinuntergeschluckt haben. Ich kann es mir nicht anders erklären. Der Kommandeur hat Wodka gereicht und immer gesagt: ,Du Bauer, ich Bauer. Na sdorowje!‘ Wir tranken aus einer Flasche.“
Als sie zurückkamen ins Dorf, wurden sie angesehen wie Verbrecher; denn die Russen hatten sie nicht verschleppt nach Sibirien, sondern bewirtet. Die Gerüchte waren noch stärker als die Wahrheit.
Am nächsten Morgen wurde Walter Macks in ein Kriegsgefangenenlager gebracht. Die wenigsten erinnerten sich daran, dass man ihn noch drei Monate vor Kriegsende zum Volkssturm eingezogen hatte. Nein, das fiel ihnen jetzt nicht ein und auch nicht die ungeklärte Sache mit seinem Bruder, und dass er in der Nazipartei gewesen war und oft beim Ortsbauernführer gesessen hatte. - Die Leute im Dorf sagten: Weil er mit dem Beil das Gör geholt hat von der da, aus dem Treck, deshalb.
Der Mutter kam die Furcht noch einmal hoch. Würde sie auch geholt werden? Doch die schwere Arbeit als Magd ließ ihr wenig Zeit zum Grübeln, und die Sorge um ihre kleine Familie war größer als die Angst um sich selber. Der Großvater gefiel ihr gar nicht mehr. Der saß den ganzen Tag stumpf herum und blickte sie aus leeren Augen an, vor denen sie unsicher wurde.
Sie wohnten noch über dem Kuhstall, aber der Bauer hatte ihnen eine zweite Kammer gegeben, auch so etwas wie eine Küche. Werner nutzte jede freie Stunde, um mit Marie unterwegs zu sein.
Eines Tages stand der Großvater entschlossen auf von seinem Stuhl. „Ich mach’ das nicht mehr mit. Ich will arbeiten. Draußen. Als Feldhüter.“ Er ging zu dem neuen Bürgermeister und saß seither in einem ausrangierten Eisenbahnwagen, bewachte die Flur und schrieb an seinen Memoiren „Der Krieg ist nicht der Vater aller Dinge“.
Der Bauer rief die Magd in die Stube und sagte: „Es hat keinen Zweck mit dir, Cäcilie. Du taugst nicht für die Arbeit als Magd.“
Sie erschrak.
„Du machst dich kaputt“, sagte die Bäuerin.
Aber Cäcilie Feldmann, diese blasse, magere Frau, wollte sich nicht das Stück Brot wegnehmen lassen. Sie hatte sich festgekrallt an das bisschen Hoffnung, hier in diesem Dorf noch einmal von vorn beginnen zu können.
„Ich geh’ nicht vom Hof. Ich übernehm’ noch die Schweine. Aber ich geh’ nicht vom Hof!“, sagte sie störrisch.
Die Bäuerin schüttelte den Kopf. „Ihr sollt hier wohnen bleiben, das ist es nicht. Ich kann’s einfach nicht mehr mit ansehen, wie du dich abquälst. Erich sagt das auch. Also geh zum Bürgermeister, ja? Wir haben mit ihm geredet. Er weiß etwas für dich.“
Was blieb ihr da anderes übrig? Sie ging am nächsten Morgen zu ihm hin. Aber sie fürchtete sich vor ihm.
Der Bürgermeister war ein kleiner Mann. Die Krankheit fraß jeden Tag einen Zentimeter von ihm. Er spuckte Blut und hatte ständig Not mit dem Atmen. Wenn er in Wut geriet, und das geschah oft in diesem Großbauerndorf, sprach er spanisch. Das Spanisch der Interbrigaden.
Er hatte Buchenwald als „Spanier“ überstanden. Die Nazis hielten den Pepe für blöd und machten ihre Witze mit ihm. Er spielte ihnen den Narren und war ein wichtiger Mann in der illegalen Lagerleitung gewesen.
„Kannst du Schreibmaschine, Genossin?“, fragte er.
„Ein bisschen“, sagte die Frau leise.
„Hast du das Kommunistische Manifest gelesen?“
„Nein.“
Er schlug mit der Faust auf den Tisch: „Máquina de escribir! Auch Schreibmaschine schreiben ist eine Klassenfrage, verstehst du? Der Mensch ist kein Automat. Er denkt. Wie willst du einen kommunistischen Brief verfassen, camarada, ohne das Manifest gelesen zu haben? Wärst eine schlechte Sekretärin. Hier, lies!“
Er holte aus dem Schrank ein arg zerlesenes Büchlein hervor, legte es auf ihren Platz und sagte: „Was hast du gelernt? Du hast gelernt: Schreibmaschine schreiben ist eine Klassenfrage. Todas las energias para la instauranción el socialismo!“
Das ist ein merkwürdiger Mensch, dachte die Frau. Und was meint er mit Klassenfrage? Der Junge ist gerade in die erste Klasse gekommen. In welche gehöre ich?
Der Bürgermeister kümmerte sich nicht weiter um seine Sekretärin. Sie begann in dem Buch zu lesen. Und liest noch heute darin.
Dieser Bürgermeister war eine neue Erde für sie. Von ihm ging eine starke Kraft aus, die sie zum Nachdenken zwang. Er war schwer krank. Ein Wunder, dass er überhaupt noch lebte. Aber er schonte sich nicht. In seiner Arbeitsweise lag kaum System, weil er keine Zeit fand, den Schreibkram zu erledigen. Notgedrungen übernahm sie das und fand sich schon nach kurzer Zeit zurecht. Ihm war das völlig klar; denn sie hatte ja das Buch von ihm.
Er lief auf die Höfe, um mit den Bauern zu reden, damit sie ihr Soll pünktlich ablieferten. Die Einsichtigen nannte er herzlich „Camarada“. Die Widerspenstigen schrie er an: „Fascisto!“ Eine klare Einteilung.
Sonntags ging er in den Gottesdienst, und am Anfang geschah es nicht selten, dass er am liebsten aufgesprungen wäre und Zwischenfragen gestellt hätte wie in einer Diskussion.
Sagte der Pfarrer: „Die Knechte, so unter dem Joch sind, sollen ihre Herren aller Ehren werthalten“, musste der Bürgermeister sich zusammennehmen, um nicht sofort eine flammende Rede über die Expropriation der Expropriateure zu halten mit spanischen Vokabeln.
Sagte der Pfarrer jedoch: „Bessert euer Leben und Wesen, so will ich bei euch wohnen an diesem Ort“, rief der Bürgermeister leise: „Bravo!“, und klatschte in die Hände.
Als aber der Bürgermeister einmal auf einer Versammlung redete und sprach: „Die Partei legt uns eine Last auf, aber sie hilft uns auch“, da lächelte der Pfarrer und meinte: „Psalm achtundsechzig, Vers zwanzig.“ Doch er verriet ihn nicht.
Manchmal ließ sich der Pfarrer auf eine Diskussion ein nach dem Gottesdienst. Da blieben die Leute und stritten heftig mit, und der Bürgermeister ging schnell zu praktischen Fragen über. Religion sei Opium für das Volk, und auch die Schnapsbrennerei wäre verboten.
„Der Klügere gibt nach“, sagte der Pfarrer endlich. Er sprach fortan den Text seiner Predigten mit dem Bürgermeister ab, und Cäcilie brauchte an den Sonntagvormittagen nicht mehr mit in die Kirche. Sie hatte endlich wieder Zeit für sich und den Jungen, der ihr zu verwildern schien.
Cäcilie Feldmann brauchte lange, eh sie den Bürgermeister wirklich begriff. Und sie verstand ihn auf ihre Art, indem sie sich durch das Gewirr seiner Reden mithilfe des zerlesenen Buches fand wie am Faden der Ariadne. Sie konnte auch nicht lachen wie die anderen, wenn er in einer Frauenversammlung davon sprach, wie die Leitung dieser Organisation besser zu machen sei: „Es geht bei euch, senoras, vor allem darum, die unteren Organe zu entwickeln!“ Sie verspottete ihn nicht, wenn er die Fremdwörter handhabte wie ein Grobschmied die Pinzette. Sie suchte nach der Kraft, die diesen schwer kranken Menschen aufrecht hielt.
Als Walter Macks zurückkam aus der usbekischen Wüste, war sie schon das zweite Jahr Sekretärin. Und der Bürgermeister sagte: „Der kommt mir nicht ins Dorf, der fascisto!“
„Der ist kein Faschist gewesen“, sagte die Frau. „Der doch nicht.“
„Dann muss ich einer gewesen sein, wenn der keiner war!“, brauste der Bürgermeister auf und fügte erklärend hinzu, weil er sah, wie sie erschrak: „Camarada, wusstest du, dass die Nazis seinen Bruder erschlagen haben achtunddreißig und der Walter wurde ein Jahr darauf ihr Büttel in Ambach? Wusstest du das nicht?“
Nein, von dem Bruder hatte sie nichts gewusst. Aber sie glaubte auch nicht, dass Walter ein Faschist gewesen war.
„Fascisto bleibt fascisto! Der kommt mir nicht ins Dorf“, sagte der Bürgermeister.
„Wohin soll er?“, fragte die Frau.
„Seine Sache!“
„Und wenn er nach Holstein geht? Wo wir nicht sind, ist der Feind. Das hab’ ich gelernt bei dir.“
Der Bürgermeister sah seine Sekretärin aus kleinen Augen lange an. Er atmete schwer. Jetzt brüllt er los, dachte sie. Jetzt brüllt er los, und ich werde kein Wort verstehen. Sie hielt seinem Blick stand und sagte nur noch: „Der Mensch ist gut.“
Er begriff, dass er einen Fehler gemacht hätte ohne die Frau. Langsam ging er auf sie zu. Er umarmte sie. „Ich danke dir, Genossin. Ich danke dir. Und da habe ich geglaubt, ich bin allein in diesem Dorf.“ Dann ging er schnell aus dem Zimmer.
Aus solchen Stunden, dachte die Frau, werden die Sonntage gemacht.
Bürgermeisterin wurde sie auf besondere Art. In einer Versammlung sprach der Bürgermeister zu den Bauern des Dorfes Ambach. Das war im Jahre neunundvierzig, zur Gründung der Deutschen Demokratischen Republik.
Der Bürgermeister redete und geriet in Eifer. Es rutschten ihm vor Freude spanische Vokabeln zwischen die deutschen Sätze, worüber die Leute lachten. Er aber meinte, sie lachten über den neuen Staat. Das erhitzte ihn.
Walter Macks leitete die Versammlung. Er hatte Mühe, die Bauern wenigstens so weit ruhig zu halten, dass sie nicht auseinanderliefen. Als der Bürgermeister aber ausrief: „Es lebe Wilhelmo Piecko!“, brach ein ungeheures Gejohle aus; denn Piko hieß der Bulle vom Schmied.
Das Gesicht des Bürgermeisters verzerrte sich. Krampfhaft hielt er sich am Rednerpult fest. Noch einmal nahm er all seine unvorstellbare Kraft zusammen und flüsterte leise: „Cäcilie übernimmt das Amt. Walter soll endlich reden!“
Sie trugen ihn nach Hause. Als er im Bett lag, sah er alle an, die um ihn standen. „Die neue Erde“, sagte er zufrieden. „La tierra nueva.“ So starb er.
Am nächsten Morgen kam Walter zur neuen Bürgermeisterin. Sie war ganz mechanisch ins Büro gegangen, saß nun da wie vergessen und wartete, dass einer camarada zu ihr sagte.
„Was soll werden?“, fragte sie..
„Hackfruchternte“, sagte Walter wie selbstverständlich. „Da gibt es eine Menge zu tun für dich, Bürgermeisterin.“
„Ich mach’ das nicht!“, sagte sie störrisch. „Ich kann das gar nicht.“
Walter schüttelte fast fröhlich den Kopf. „Nein, Cäcilie, du kannst das nicht. Wir alle können das noch nicht. Wir haben eine verflixt wichtige Sache angefangen, die keiner vor uns gemacht hat bisher hierzulande.“
Cäcilie sträubte sich. Und als nichts mehr half gegen die Gescheitheit dieses Mannes, griff sie ihn an. „Was hat er gemeint, wovon du endlich reden sollst? Was wissen wir denn nicht von dir?“
„Richtig“, sagte Walter, „damit fangen wir an. Was wissen wir voneinander und was nicht?“ Er lehnte sich zurück in seinem Sessel und begann zu erzählen. „Das ist eine lange Geschichte. Ich war in der Hitlerpartei, bin in die usbekische Wüste geschickt worden, hab’ viel gelernt, bin zurückgekommen und wieder Bauer geworden. Das genügt für den Anfang.“
„Das genügt nicht!“ Was war es, das auch diesem Manne solche Sicherheit gab? Eine Sicherheit, die sich bei Walter als Spaß zeigte selbst in ernsten Situationen. Heitere Überlegenheit, die auf besserem Wissen beruhte. Was wusste er besser? Sie hätte gar nicht genau sagen können, warum sie das so unbedingt erfahren wollte.
Eine Neugier auf diese Dinge war in ihr gewachsen die Jahre in Ambach. Deshalb reichte ihr auch die kurze Biografie des Mannes nicht aus. „Als Bürgermeisterin muss ich mehr wissen.“
Walter lächelte. Sie macht es also! Sie macht es und stellt genau die richtigen Fragen: Wer sind die Menschen, mit denen ich lebe?
Achtunddreißig hatten sie Walters jüngeren Bruder geholt. „Ich hab’ immer gesagt: Das geht krumm aus mit dir, Politiker. Hab’ immer gesagt: Politicker, weil ich nichts im Sinn hatte mit seiner Sache. Ein Bauer soll sich um seinen Hof kümmern, sonst nichts. Politik verdirbt den Charakter. War ein Pfundskerl, unser Kleiner, das kannst du schon glauben. Als sie ihn erschlagen hatten, wusste ich, dass er im Recht war. Es kommt mich heut noch sauer an, dass ich erst diesen Beweis brauchte. Da hab’ ich mir gesagt: Du wirst sie ausrotten, allesamt, wie Unkraut. Allein schaffst du es nicht, das war mir klar. Ich ging zu seinen Genossen.“
Er hatte keinen mehr angetroffen. Sie waren verhaftet worden oder konnten sich noch rechtzeitig verbergen. Mit anderen bekam er keinen Kontakt. Also begann er, allein zu kämpfen.
„Ich ging in die Nazipartei. Ich sang ihre Lieder. Was ich verhindern konnte im Dorf, das verhinderte ich. Es war zu wenig, verdammt! Einmal hatte ich durch Zufall erfahren, dass sie den Admiral jagten. Er ist ein Kieler Matrose gewesen. Ich kannte ihn noch durch meinen Bruder, nicht den Namen, nur das Gesicht und dass sie ihn Admiral nannten. Und ich wusste, wo er an dem Tag war. Seine Gruppe ist durchgekommen. Ihn hat es erwischt, glaube ich. Jedenfalls habe ich ihn nie wieder gesehen.“
Die Frau zweifelte nicht. Der Mann sprach die Wahrheit. „Aber warum, ich meine, du hättest doch alles sagen können nach dem Krieg. Stattdessen gehst du in die Wüste!“
„Wer hätte meine Geschichte geglaubt, Cäcilie? Es waren so viele, die plötzlich Widerstandskämpfer gewesen sein wollten. Ich habe die ganzen Jahre allein arbeiten müssen. Der Admiral wäre der einzige gewesen, der für mich hätte gutsagen können.“
Und sie begriff ihn. Was ekelten sie jene Leute, denen man aus dem Gesicht lesen konnte, wie sie um ihr bisschen gutes Gewissen logen. Walter sagte: Ich hab’ die Gefangenschaft mitgemacht, ich habe dort besser denken gelernt. Jetzt will ich hier handeln. - Auch in ihm lebte die große Hoffnung. „La tierra nueva“, sagte sie leise.
„Cäcilie, ich weiß nicht, ob du mich begreifen wirst. Wir müssen den großen scheuen Fisch zum Reden bringen, verstehst du? Das Ungeahnte, was in den Menschen ist. Sie wissen es zum großen Teil nicht, dass sie es haben. Sie werden es bestreiten zumeist. Pathos, davon haben wir genug gehabt. Falsches freilich, aber wer kann das schon heute unterscheiden?“
„Ich verstehe dich schon“, sagte sie langsam, als dächte sie jedes Wort zum ersten Mal.
Wie zwei Verschwörer saßen sie da. „Machen wir uns an die Arbeit. Wir wissen, dass es ihn gibt, den großen scheuen Fisch. Jetzt müssen wir Menschen suchen, die sich neugierig machen lassen auf ihn.“
Sie dachte an jenes Buch, das ihr der Bürgermeister am Anfang gegeben hatte. Und sie dachte an die Rede des Präsidenten, die der Spanier mit einem selbst gebastelten Lautsprecher hatte durchs Dorf dröhnen lassen.
„Wenn wir ihn fangen wollen, müssen wir mitten unter den Fischern sein und das Ungewöhnliche tun, als ob es Alltägliches wäre. Wir müssen ihn zum Reden zwingen, Cäcilie. Und die Menschen werden ihm antworten, vorsichtig erst. Diese Sprache muss gelernt werden wie das Gehen nach einer schweren Krankheit. Aber sie ist gut erlernbar und hat den richtigen Klang für unsere Ohren. Den Spaß machen wir uns, was, Cäcilie?“
Irgendwann muss ich das schon einmal gedacht haben: Aus solchen Stunden werden die Sonntage gemacht.
Das Telefon schrillte. Jemand verlangte den Bürgermeister. Und die Frau sagte: „Am Apparat.“
Der Spanier war auf seine Art ein guter Lehrer gewesen. Freilich, wer ihn begreifen wollte, musste mit seinen Hoffnungen verwandt sein. Der musste träumen können wie er und verfluchen, was er verfluchte. Der musste den Wunsch haben, sein Leben gut zu machen in einer Weise, wie es auch seinesgleichen gut tat.
Der Weg, den die Witwe eines Oberleutnants der Hitlerarmee gemacht hatte vor Jahren über den Fluss in dieses Dorf, war ein Weg gewesen, den sie seither auf vielerlei Art immer wieder gegangen ist.
Sie nahm ihre Arbeit ernst und nutzte jede Stunde, um für dieses Leben besser gerüstet zu sein. Doch wegen des Jungen machte sie sich manchmal Vorhaltungen, sie vernachlässige ihn. Ein Glück, dass der so gut aufgehoben war bei Bruswaters. Er sagte noch wie am ersten Tag Onkel und Tante zu ihnen. Und mit Marie war er jede freie Minute zusammen. Sie galten als unzertrennlich im Dorf, und mancher redete in der alten Weise, sie wären einander versprochen.
Noch waren sie Kinder. Noch bedeutete es nur Spiel, wenn sie sich eine Laubhöhle bauten. Aber immerhin, so klein blieben sie nicht ständig.
Ich müsste einmal mit Werner reden, dachte die Mutter. Aber wann? Die Tage waren voll Arbeit, die Abende mit Sitzungen ausgebucht, die Nächte gehörten dem Fernstudium. Und wie? Was man seinem halbwüchsigen Bengel erzählen muss, wenn er zwölfjährig mit einer Zwölfjährigen Höhlen baut, darüber wurde sie in keiner Dienstbesprechung belehrt.
Sie redete mit den Bruswaters. Erich wippte nachdenklich mit dem Kopf. Die Bürgermeisterin mochte so unrecht nicht haben. Was trieben die beiden eigentlich in ihrer Laubhöhle? „Raucht ihr oder so was?“
„Wir erzählen uns Geschichten“, antwortete Marie. „Schöne Geschichten.“ Dabei sah sie ihn an, als ob sie nicht wüsste, warum die Erwachsenen so ernste Gesichter machten.
„Was für welche?“, wollte der Vater wissen.
„Na, eben schöne.“
Die Mutter wollte ihre Tochter ermahnen, dass man seinem Vater anders antworten sollte, aber Erich brummelte etwas wie: „Solange sie bloß welche erzählen und keine machen, geht’s ja.“ Damit war für ihn das Thema erledigt. Schließlich sollte die Mutter ihres Amtes walten und mit der Tochter reden.
Sie hatten sich wirklich schöne Geschichten erzählt. Aber etwas wurde anders nach diesen misstrauischen Fragen. Die Erfahrungen der Erwachsenen waren in ihre Kinderwelt eingedrungen und von nun an in ihre Köpfe gesetzt, ihnen noch nicht bewusst, aber sie spürten es beim Spiel. Redensarten, die sie, ohne ihre Bedeutung zu kennen, nachgeahmt hatten, bekamen einen anderen Klang. Ruppigkeit wurde Zärtlichkeit.
Sie spielten Mann und Frau. Werner kam von der Arbeit. Er hatte zentnerschwere Kartoffelsäcke geschleppt. Noch bedeuteten ihnen Kastanien Kartoffeln für die Städter. Marie holte ihr Schulbrot aus der Tasche. Jeden Abend küsste er sie auf den Mund. Onkel Bruswater tat das ebenso mit der Tante. Und plötzlich küsste Marie zurück. Werner erschrak so, dass er fast gefallen wäre. Er hielt sich an Marie fest.